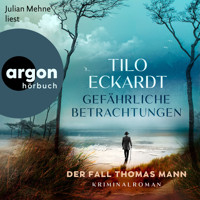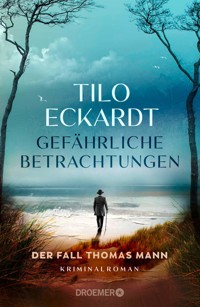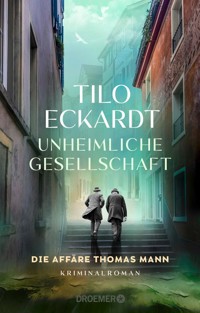
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thomas-Mann-Romane
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt voller Flüchtlinge und Spitzel. Wer ist Freund, wer ist Feind? Mann & Müller auf der Spur eines Schattenmannes Im historischen Kriminalroman um das ungewöhnlichste Ermittlerteam ever heften sich der Schriftsteller Thomas Mann und sein junger litauischer Übersetzer, genannt Müller, an die Fersen eines mysteriösen und gefährlichen Mannes. Der ebenso elegante wie raffinierte Roman über Freundschaft und die Kraft der Literatur lässt die Grenzen zwischen historischer Wirklichkeit und dichterischer Fiktion gekonnt verschwimmen. Oktober 1933. Thomas Mann sucht mit seiner Familie Zuflucht in Zürich, weil er in seiner Heimat Repressalien oder gar eine Verhaftung fürchten muss. Doch auch in der Schweiz ist die Lage alles andere als sicher. Der Dichter wird von Ängsten geplagt, die sich noch steigern, als die forsche Autofahrerin Katia Mann vor ihrem Haus in Küsnacht einen Mann anfährt, der anschließend spurlos verschwindet. Dem eilig herbeigerufenen Getreuen Žydrūnas Miuleris alias Müller gelingt es nicht, die Identität des Unfallbeteiligten festzustellen. Dieser scheint auf rätselhafte Weise sein Äußeres zu verändern und den Spieß umzudrehen: Mit einem Mal fühlen sich Mann & Müller beschattet. Als Gerüchte laut werden, dass die Gestapo nicht davor zurückschreckt, Regimegegner bis in die neutrale Schweiz zu verfolgen, überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst versucht jemand Ludwik, Müllers vierbeinigen Gefährten, zu ermorden, dann entgeht er selbst nur knapp einem Anschlag. Doch war er das eigentliche Ziel? In einer Stadt voller Spitzel sind Mann & Müller auf Katia Manns zweifelhafte Fahrkünste und die Pünktlichkeit der Schweizer Bahn angewiesen, um einen Fall zu lösen, der – wie ihnen klar wird – einst im fernen Nida seinen Anfang nahm. Ein spannendes und höchst unterhaltsames literarisches Denkmal für den großen Thomas Mann. Tilo Eckardts historischer Krimi »Unheimliche Gesellschaft« lässt uns einen der größten deutschen Schriftsteller in neuem Licht entdecken. Der 2. Fall für Mann & Müller beruht auf wahren Begebenheiten um einen deutschen Spion in Litauen. Das erste Mal gemeinsame Sache machten der Dichter und sein Übersetzer in »Gefährliche Betrachtungen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tilo Eckardt
Unheimliche Gesellschaft
Die Affäre Thomas MannKriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Oktober 1933: Nach einem letzten hellen Sommer in seinem geliebten Nida fälltDunkelheit über Deutschland, und Thomas Mann sucht mit seiner Familie Zuflucht in Zürich, weil er in seiner Heimat Repressalien oder gar eine Verhaftung fürchten muss. Doch auch in der Schweiz ist die Lage alles andere als sicher. Der Dichter wird von Ängsten geplagt, die sich noch steigern, als die forsche Autofahrerin Katia Mann vor ihrem Haus in Küsnacht einen Mann anfährt, der anschließend spurlos verschwindet. Dem eilig herbeigerufenen Getreuen Žydrūnas Miuleris alias Müller gelingt es nicht, die Identität des Unfallbeteiligten festzustellen. Dieser scheint auf rätselhafte Weise sein Äußeres zu verändern und den Spieß umzudrehen: Mit einem Mal fühlen sich Mann & Müller beschattet.
Als Gerüchte laut werden, dass die Gestapo nicht davor zurückschreckt, Regimegegner bis in die neutrale Schweiz zu verfolgen, überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst versucht jemand Ludwik, Müllers vierbeinigen Gefährten, zu ermorden, dann entgeht er selbst nur knapp einem Anschlag. Doch war er das eigentliche Ziel? In einer Stadt voller Spitzel sind Mann & Müller auf Katia Manns zweifelhafte Fahrkünste und die Pünktlichkeit der Schweizer Bahn angewiesen, um einen Fall zu lösen, der – wie ihnen klar wird – einst im fernen Nida seinen Anfang nahm.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Epilog
Anmerkungen des Autors
Quellenverzeichnis und Literaturhinweis
Danksagung
Für die drei Schweizer Mädchen am Brunnen
»Warum sind wir so kalt? / Warum – das tut doch weh!
Warum? Wir werden bald / Wie lauter Eis und Schnee!
Beteiligt euch, – es geht um eure Erde / Und ihr allein, ihr habt die ganze Macht.
Seht zu, daß es ein wenig wärmer werde / In unserer schlimmen, kalten Winternacht.«
Erika Mann, Die Pfeffermühle, 1. Januar 1933
»So glaubst du auch jetzt, die Morgenluft einziehend,
an deine Freiheit und Tugend, während du wissen solltest
und im Grunde auch weißt, dass die Welt ihre Netze bereit hält,
dich darein zu verstricken.«
Thomas Mann, Herr und Hund
Prolog
Verletzlichkeit
Der Dichter spießte mit spitzem Zeigefinger einen Artikel in der Zeitung auf, die offen in seinem Schoß lag, und sagte übergangslos, so als würden wir ein eben erst unterbrochenes Gespräch weiterführen: »Hier! Haben Sie das gelesen, Müller? Dieser Hitler lässt nun alle Masken fallen und fordert die uneingeschränkte Macht im Staat.« Dabei fiel Asche von der Zigarette in seinem Mundwinkel auf die Zeitung.
Katia Mann saß im Korbstuhl neben ihrem Mann und las in einem Buch. Ich war gerade erst auf dem Schwiegermutterberg angekommen und stand am Rande der Veranda, doch sie bot mir keinen Platz an. Stattdessen schob sie sich die Sonnenbrille auf den ergrauenden Scheitel, drehte sich zu ihrem Mann um und sagte: »Tommy, wollt ihr hier draußen arbeiten oder im Haus?«
»Wir gehen ins Haus.«
Ludwik trabte zu Katia Mann, blieb neben ihrem Stuhl stehen und ließ sich von ihr den Nacken kraulen.
»Er kann bei mir bleiben, dann seid ihr ungestört.« Sie hob den Blick. »Sind Sie im Gesicht etwas voller geworden, oder macht das der neue Schnurrbart?« Sie war eben eine eher unverblümte Persönlichkeit. Ich mochte sie, obwohl ich mir nie sicher sein konnte, dass die Sympathie auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Die Kinder sind an diesem herrlichen Tag sicher am Strand.«
»Nur an Tagen, an denen es gute Wellen gibt. Für das Spielen im Sand halten sie sich schon für zu alt. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wo sie sich herumtreiben. Vielleicht haben sie sich ein Ruderboot genommen und sind aufs Haff hinaus? Vielleicht jagen sie gerade einen Elch?«
Zu alt?, fragte ich mich und dachte daran, wie Elisabeth und Michael, von ihren Eltern Medi und Bibi genannt, zwei Jahre zuvor noch mit Begeisterung Cowboy und Indianer gespielt hatten. Zwei Jahre mögen nicht viel sein im Leben, wenn man jedoch jung ist, liegen zwischen dem elften und dreizehnten Lebensjahr ganze Welten.
»Diese fuchtelnde Schreckgestalt genießt es, das Zünglein an der Waage zu sein. Erklärt Reichskanzler Papen doch rundheraus, dass sein nationalsozialistischer Terrortrupp sich an keiner Regierung beteiligt, in der nicht er Kanzler ist und einhundert Prozent freie Hand in seinen Entscheidungen hat. Hitler erpresst offen den Staat und gibt sich nicht die geringste Mühe, diese Tatsache zu verschleiern. Und das nur eine Woche, nachdem die infame Verschwörung seiner SA-Büttel zu einem Anschlag auf das Gewerkschaftshaus in Königsberg aufgeflogen ist.«
Auch ich las Zeitung, wann immer ich eine in die Finger bekommen konnte, so zuletzt am Morgen in meiner Pension beim Frühstück, als mir das Glück beschieden war, eine verwaiste Ausgabe der Vossischen auf einer Sitzbank zu finden. »Die Welt ist in einem erschreckenden Zustand. Bedenken Sie auch den Bombenanschlag in Frankreich, den Putschversuch in Spanien und die Unruhen hier im Memelland: Pulverfässer allüberall.«
»Sie sagen es, Müller.« Der Dichter schlug die Zeitung energisch zu. »Sie sind also mit der Novellenübersetzung fertig?«
Tatsächlich hatte mir das mühsame Verdienen des Lebensunterhaltes mit kleineren Übersetzungen von Zeitungsartikeln und Manualen von Radioapparaten kaum Zeit gelassen, am Tod in Venedig zu arbeiten. Erst kurz vor meiner Abreise hatte ich eine Fassung fertiggestellt, an die ich während ruhiger Tage auf der Kurischen Nehrung letzte Hand anlegen wollte. Denn weiter hatte ich sonst keine Pflichten, außer der, mit Dalia, meiner Angebeteten, am abendlichen Haffufer spazieren zu gehen.
»So gut wie, Herr Mann. Nun bleibt noch die Feinarbeit, und dafür benötige ich Ihre Hilfe.«
»Meine Hilfe beim Übersetzen? Ich wüsste nicht, was ich beizutragen hätte?«
»Ich befürchte, sein Litauisch hat sich durch die Sommeraufenthalte nicht wesentlich verbessert«, sagte Katia Mann lakonisch, ohne den Blick von ihrem Buch zu heben.
Ich lachte auf, doch im Grunde war es mir peinlich, zugeben zu müssen, dass ich mit einer Liste von Fragen angetreten war, für deren Beantwortung ich den Dichter benötigte, um die Arbeit endlich zu einem befriedigenden Abschluss bringen zu können.
Thomas Mann erhob sich, öffnete die Terrassentür und bat mich in das Wohnzimmer. Licht fiel von zwei Seiten durch die bodentiefen Fenster. Der Raum hatte sich im Laufe des Vormittages aufgeheizt und war schlecht gelüftet. Der Dichter ließ sich am runden Tisch vor dem Kamin nieder und forderte mich auf, Platz zu nehmen.
»Wird das viel Zeit in Anspruch nehmen?«, fragte Thomas Mann mit seiner typischen Miene äußerster Skepsis. Sie hätte mir eine Warnung sein sollen. Zwar war mir bewusst, dass der Dichter es ganz und gar nicht schätzte, wenn man seinen geheiligten Tagesplan durcheinanderbrachte und er dadurch das Pensum, das er sich vorgenommen hatte, nicht bewältigte. Doch ich hielt mein Anliegen für wichtig genug, um es trotzdem selbstbewusst vorzutragen.
»Ich denke nicht«, sagte ich und schlug wider besseres Wissen meine Kladde auf. »Ich habe hier eine Liste mit Begriffen vorbereitet, deren Bedeutung zu klären mir nicht eindeutig möglich war. Und da Sie selbst am besten wissen, was Sie sagen wollen, sollte die Klärung nicht allzu viel Zeit beanspruchen.«
»Hört, hört«, sagte er, machte große Augen und senkte das Kinn. »Sie trauen mir also durchaus zu, dass ich weiß, was ich sagen will? Gleichwohl unterstellen Sie mir – wie haben Sie es gerade ausgedrückt – Uneindeutigkeit in der Wortwahl?«
»Oh, aber Sie verstehen mich miss. Nicht Ihre Sprache ist unpräzise oder schwammig, mein Auffassungsvermögen ist es.«
Das Mädchen trat an den Tisch und fragte den Dichter nach seinen Wünschen. Nachdem sie wieder gegangen war, räusperte er sich. »Nun, gut. Was steht als Erstes auf Ihrer Liste?«
»Beginnen wir mit der als ›Halbdame‹ bezeichneten Gouvernante im dritten Kapitel. Ich konnte den Begriff in keinem Wörterbuch finden und gehe deshalb davon aus, dass Sie ihn neu geschöpft haben.«
»Mögen Sie die Halbdame nicht?«
»Doch, doch, ich mag sie sehr. Doch um die korrekte litauische Entsprechung zu finden, muss ich eben auch verstehen, was genau mit ihr gemeint ist.«
»Was gibt es da zu verstehen?«
»Vordergründig scheint die Halbdame auf ein zwei- oder gar zwischengeschlechtliches Wesen hinzudeuten, halb Dame, halb Frau, also auch halb Mann, ein bedauernswertes Geschöpf, zerrissen zwischen Lüsternheit und Vernunft.«
»Ich glaube, Sie sind der Erste, der im Tod von Venedig einen Hermaphroditen entdeckt hat.«
»Nun, ich meine das natürlich als Metapher in der Weise, dass die Halbdame für menschliche Schönheit in Transzendenz stehen könnte, nach Form und Ausdruck suchend, sich quasi spiegelnd und also eine Entsprechung findend in dem Begriff der ›Vormännlichkeit‹, die Aschenbach mit dem schönen Knaben Tadzio assoziiert …« Ich blickte ihm ins Gesicht, woraufhin ich meine Rede unterbrach und mit einem nachgeschobenen »Wenn Sie wissen, was ich meine?« lauwarm abrundete.
Er wusste es nicht. Das konnte ich der Art entnehmen, wie er mit einem Stirnrunzeln den Aschenbecher heranzog, noch einen Zug tat und dann den Zigarettenrest mit zusammengekniffenen Augen energisch ausdrückte. Er lächelte spöttisch. »Ich will nicht hoffen, dass Ihre gesamte Liste aus Fragen dieser Art besteht.«
Du lieber Himmel, dachte ich bei mir, das kommt davon, wenn man sich einem genialen Mann gegenüber besonders gescheit geben will. »Es ist ein eher anspruchsvolleres Beispiel«, versuchte ich zu beschwichtigen. »Die meisten Fragen betreffen einfache Begriffsklärungen.«
Der Dichter nickte. »Nun, die Gouvernante benimmt sich einfach nicht sonderlich damenhaft.« In seiner Stimme klang eine kontrollierte Ungeduld mit, so als fühlte er sich genötigt, einem Kind zu erklären, warum es sinnvoller ist, erst die Hose anzuziehen und dann die Schuhe.
Es waren Momente wie diese, in denen mich Thomas Mann geflissentlich auf den mir zustehenden Platz verwies. Vielleicht überrascht es Sie zu hören, dass mich seine ruppige Abfertigung nicht besonders hart traf. Ich glaubte den Dichter schon recht gut zu kennen. Man durfte, ja, man sollte ihn loben, aber man durfte ihm nicht zu nahekommen. Darin war er ein Autor wie jeder andere überall und zu jeder Zeit. Unterschätze niemals die Verletzlichkeit von Schriftstellern, schon gar nicht als Übersetzer. Und wage nicht, dich als solcher zum Kritiker aufzuschwingen. Offensichtlich hatte ich mir in seinen Augen mit meinem Interpretationsversuch eindeutig zu viel herausgenommen. Doch was blieb mir anderes übrig? Als Übersetzer ist man notgedrungen auch Deuter. Das Werk des Dichters war voller Wortschöpfungen, deren Sinn sich mir nicht immer erschloss. Bei meiner Arbeit am Tod in Venedig regte sich in mir hin und wieder der Verdacht, dass Thomas Mann, dieser überaus präzise Autor, neue Worte durchaus nicht immer aus reiner Lust am Fabulieren erfand, sondern gelegentlich aus erstaunlicher Schlamperei oder gar Unkenntnis. Was sollte die in keinem Wörterbuch zu findende »Laßheit« anderes sein als die gewöhnliche »Lässlichkeit«, derer sich sein Held Aschenbach im Angesicht seiner Schwäche zeiht? Das würde ich doch wohl noch fragen dürfen.
»Die Halbdame ist nicht damenhaft?«
»Sie haben es erfasst, Müller. Es fehlt ihr gewissermaßen an damenhafter Eleganz, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Das erklärt es natürlich.«
»Es verhunzt einem die Freude an der Lektüre, wenn man sich an den Details aufhängt«, sagte Thomas Mann. »Auf die großen Ideen kommt es an, nicht auf Wortklauberei. Nehmen Sie nur meinen Joseph: Nicht um die Legendenfigur selbst geht es, sondern um die Vereinigung von Mythus und Vernunft.«
»Ich befürchte, Übersetzen ist Wortklauberei.«
Woraufhin er mich zunächst eine kleine Weile recht mitleidig ansah und mir dann aber doch bereitwillig in der nächsten Stunde bei der Begriffsklärung unter die Arme griff, den »Ziegenbart aus dem Schiffsinnern« genauso geduldig erläuterte wie den »weltgültigen Abendanzug« und die »quinkelierende Geige«.
Die Explosion war nicht zu hören. Doch für die besonders Feinfühligen war sie zu spüren. Die Nehrung hielt für einen Augenblick den Atem an. Der Wind verebbte, die Blätter der Bäume hörten auf zu rascheln, selbst die Vögel schwiegen für einen Wimpernschlag, bevor der dezente Chor der Inselgeräusche wieder einsetzte. Ich hob den Kopf, weil ich eine Bewegung bei Ludwik wahrnahm. Durch das Fenster konnte ich sehen, dass er von seinem Platz auf der Veranda neben Katia Mann aufgestanden war und in Vorstehhaltung in Richtung Westen starrte. So verharrte er einige Sekunden, drehte sich dann zu mir um und sah mich mit einem Blick an, als wollte er sagen: »Warum sitzt du dort noch herum? Wir müssen los!«
Der Dichter ließ eine Seite meines Übersetzungsmanuskripts sinken. Ich blickte durch die Scheibe der Veranda auf Katia Mann, die ihren Roman auf den Tisch gelegt hatte und neben Ludwik in die Knie gegangen war. Ich hörte sie fragen: »Was hast du gesehen? Was ist denn da?«
Dann begann der Teekessel in der Küche zu pfeifen, wir hörten das Mädchen hantieren, und sie kam mit dem Tee herein. Der Dichter und ich wandten uns wieder der Arbeit und Katia Mann ihrem Buch zu. Ludwik hingegen schien sich nicht zu beruhigen, kam herein, blieb kurz neben mir sitzen, lief wieder hinaus, starrte lange in den Wald, nur um den Vorgang zu wiederholen.
Es vergingen vielleicht zehn Minuten, bis das Bimmeln der Motorspritze zu hören und an Arbeit nicht mehr zu denken war.
Ludwik und ich rannten der Motorspritze hinterher. Sie nahm die Schneise durch den Wald, an deren Ende die Pension lag, aber ich konnte, ich wollte mir nicht vorstellen, dass sie betroffen sein könnte. Doch wir hörten das Fauchen des Feuers, lange bevor wir es sehen konnten. Und es gab kein anderes Haus an diesem Teil des Ostseestrandes. Neben dem verkohlten Gerippe eines Fahrrades musste ich anhalten und nach Luft ringen. Es war das Miele, Frau Bryls ganzer Stolz. Welche enorme Kraft konnte es dermaßen zerstört und bis an den Waldrand geschleudert haben?
Als wir die Villa Bernstein erreichten, stand der Nordflügel des Hauses bis unter das Dach in Flammen. An der Stelle, wo zuvor der Schuppen gewesen war, rauchte nur noch ein Häufchen Trümmer. Die Feuerwehrmänner hatten die Spritze gegen den Wind zwischen Düne und Haus positioniert und ihre Schläuche ausgerichtet. Ich zählte fünf Wasserfontänen, die von den Flammen aufgesogen wurden wie Limonade von einem gierigen, wütenden Kind. Badegäste kamen verwirrt und halb bekleidet vom Strand, unbeaufsichtigte Halbwüchsige, deren Neugierde weit größer war als ihr Sinn für die Gefahr, wagten sich so nahe an die Brandstelle, bis die Hitze sie zurückprallen ließ. Freiwillige Wasserträger liefen unaufhörlich zwischen Meer und Pension hin und her und warfen den Inhalt von Töpfen, Eimern und Hüten wirkungslos in das tosende Inferno. Die Südseite des Gebäudes schien äußerlich noch weitestgehend intakt zu sein, obwohl schon erste Rauchschwaden aus den Öffnungen quollen. Hier hatten sich die Bewohner der Pension versammelt, ein paar Männer wagten sich ins Haus und reichten Stühle, Bilder und Bücher durch Türen und Fenster zu Helfern hinaus. Aus einem der Fenster im ersten Stock flogen im hohen Bogen Wäsche- und Kleidungsstücke, das war Frau Bryl, das Gesicht rot und nass von der Hitze und von Tränen oder Löschwasser. Sie lehnte sich so weit aus dem Fenster, dass ich schon glaubte, sie würde herausfallen, und schrie den Menschen zu: »Die Betten! Rettet die Betten!« Und gleich darauf: »Wo ist Ludwik? Hat jemand meinen Hund gesehen?«
Ich wollte Ludwik zurückhalten, doch er riss sich los, rannte bellend um das brennende Haus herum, wollte hinein zu seinem Frauchen, wich zurück, suchte einen anderen Zugang, den es nicht gab, und in seiner rauen Stimme lagen all die Verwirrung und Angst und Hilflosigkeit, die jeder, der in dieser Stunde Zeuge der Katastrophe wurde, empfunden haben musste.
Bald schon musste Frau Bryl von mehreren Männern gezwungen werden, ihr Haus zu verlassen. Die scharfen Wasserfontänen zielten zwischenzeitlich auf das Dach, doch sie vermochten nichts mehr auszurichten. Reglos und mit zusammengepressten Lippen sah Frau Bryl dabei zu, wie der erste Dachbalken fiel und die Decke zu den Zimmern darunter durchschlug, dass die Funken stoben. Sie wandte sich ab und lief in den angrenzenden Wald.
Immer mehr Menschen versammelten sich am Katastrophenort, fast schien es, als wäre ganz Nidden auf den Beinen. In sicherer Entfernung standen betroffen der Dichter und seine Frau. Ich spürte nicht, wie die Zeit verging, aber irgendwann ergriff jemand meine Hand und drückte sie. Dalia schaute mich traurig an. »Die arme Frau Bryl. Es fühlt sich an wie das Ende.«
Ernst Mollenhauer räumte für einige der obdachlos gewordenen Pensionsgäste die Künstlerateliers seines Gasthauses. Andere wurden von Fischern des Dorfes aufgenommen oder kamen im Schulhaus unter. Der Pfarrer der Gemeinde veranstaltete umgehend eine Kleidersammlung. Alle im Ort halfen nach Kräften. Die untröstliche Frau Bryl fand mitfühlende Aufnahme bei der Familie Pinkis in Purwin. Und was mich betraf? Alle meine Habseligkeiten waren verbrannt. Mir blieben nur die Kleider, die ich trug – und das Manuskript meiner Übersetzung des Tod in Venedig, das im Sommerhaus seines Autors lag. Thomas Mann und seine Frau luden mich ein, vorübergehend bei ihnen zu wohnen, was ich am Ende ausschlug. Zum einen wollte ich dem Dichter nicht zur Last fallen, zum anderen bot mir das Hotel Nordische Linnäa ein kleines Zimmer zu dem sehr günstigen Preis von drei Mark pro Nacht. Was ich hingegen sehr gern von Frau Mann annahm, waren eine Garnitur Wäsche sowie ein Hemd, beides aus dem Fundus des Dichters. Angesichts der Umstände, unter denen ich in den Besitz dieser Dinge kam, hielt ich mich mit dem Ausdruck von Freude damals sehr zurück. Doch das ist lange her, und heute schäme ich mich nicht, zuzugeben, dass meine Brust unter dem feinen Leinen, das einst den Nobelpreisträger kleidete, über viele Jahre stolzgeschwellt war. Es war ein sehr gutes Hemd, und ich trug es, bis es durch Abnutzung so dünn geworden war, dass man hindurchsehen konnte.
Kapitel eins
Ermutigung
Ich träume noch manchmal von der Kurischen Nehrung. Dann stehe ich auf der Großen Düne und schaue auf Nidden hinab. Ich spüre die Sonne im Rücken, und mein Schatten ist ein körperloser Mann auf Stelzen, der sich auf den makellosen Sand wirft. Wenn ich mich bewege, bewegt sich der Stelzenmann über den gerippten Untergrund und sieht aus, als würde er zittern. Am Fuße der Düne beginnt der Wald, und ich muss mich nur ein kleines Stück vorbeugen, um die weiße Gestalt zu sehen, die sich gemessenen Schrittes mit auf dem Rücken verschränkten Händen zwischen den sich im Wind hin und her wiegenden Bäumen bewegt. Thomas Mann trägt seinen Sommeranzug mit Tennisschuhen, steckt sich eine Zigarette an, raucht sie in einem Zug und wirft sie in den Wald, der sofort in Flammen aufgeht. Er ist nicht allein. Im gebührenden Abstand folgen ihm seine Niddener Zeitgenossen: Ich erkenne Ernst Mollenhauer, der alle paar Meter in die Knie geht und sorgsam die weggeworfenen Stummel des Dichters einsammelt. Da ist Max Pechstein, die Pfeife im Mund, er malt mit einem Pinsel Striche in die Luft. Frau Bryl jongliert mit dampfenden Zeppelinen und ruft dabei: »Levez-vous!« Hinterdrein schwebt Paul Isenfels in wallenden Gewändern und photographiert die vor ihm Gehenden mit einem winzigen Apparat. Ich lächle und winke, und der Dichter dreht sich zu mir um und zieht besorgt die linke Augenbraue hoch und höher, er droht dabei mit dem Zeigefinger, und dann bewegt sich der Boden unter mir, und eine Hand streckt sich aus dem Sand und tastet nach meinem Schatten, der zurückbleibt, während ich die Flucht ergreife. In Varianten des Traumes stehe ich in der Brandung der Ostsee, Blätter von Papier wehen in einer Windhose um mich herum, die Hand taucht aus dem Wasser auf, und der Dichter applaudiert sitzend in seinem Strandkorb. In besonders amüsanten Nächten reite ich auch mit Thomas Mann auf einem Elch durch den Nehrungswald.
Ich begehe nicht den Fehler, diesen Träumen eine Bedeutung zuzumessen. Sie sind nicht mehr als eine wilde Mischung von Erinnerungen, die mein Kopf, der auch im Wachzustand zunehmend Schwierigkeiten hat, die Dinge in eine Ordnung zu bringen, mir bröckchenweise hinwirft. Eine Mischung aus Bildern und Gefühlen, selten bedrohlich, oft unterhaltsam. Ich weiß, wem die Hand gehört, die nach meinem Schatten greift. Das Wissen um und die Erinnerung an eine ungesühnte Schuld waren es, die mich veranlassten, die Geschichte meines ersten Sommers mit Thomas Mann aufzuschreiben. Ich hatte sie teils als Geständnis, teils als Selbstvergewisserung zu Papier gebracht, ohne eine rechte Vorstellung davon, was nach Abschluss der Arbeit damit geschehen würde und wen sie interessieren könnte. Ich halte mich nicht für einen Menschen mit schriftstellerischem Talent. Ich bin nur ein Übersetzer und habe mir nie eingebildet, genügend Einbildungskraft für das Erfinden von Geschichten zu besitzen. Die Wahrheit aufzuschreiben, erfordert hingegen keinerlei schöpferische Kraft. Trotzdem war ich nach Abschluss der Arbeit erschöpft von der selbst auferlegten Pflicht, mir Wort für Wort die Schuldbrocken von der Seele zu schreiben, die seit Jahrzehnten auf mir lasteten. Darauf wollte ich es eigentlich beruhen lassen.
Doch der Dichter und meine Erlebnisse mit ihm beschäftigen mich weiterhin. Nichts nimmt Menschen meines Alters so sehr in Beschlag wie die Erinnerung. Wir haben viel Zeit dafür. Wer will also einem Mann von einhundertundzwei Lebensjahren vorwerfen, dass er in der Vergangenheit lebt? In einer Vergangenheit, die wie die eines jeden Menschen einmalig und unwiederbringlich ist, in meinem Fall aber zudem aufgrund der Beteiligten von erhöhtem Interesse für die Allgemeinheit? Tatsächlich beschleicht mich inzwischen gelegentlich ein unangenehm weihevolles Gefühl der Bestimmung. Es erstaunt mich selbst, denn hohles Pathos ist mir bei anderen Menschen ausgesprochen zuwider. Nein, es ging mir mit meinen Memoiren nie darum, meine eigene Rolle zu überhöhen. Doch es ist nun einmal die bescheidene Wahrheit, dass ich Seit an Seit gefahrvolle Situationen mit dem berühmten Dichter Thomas Mann durchgestanden habe, von denen keiner der Abertausenden Gelehrten und Studenten, die sich seit Jahrzehnten mit Leben und Werk des großen Mannes beschäftigen, zu berichten weiß. Deshalb hatte er mich einst am Ostseestrand als seine »glücklichste menschliche Akquise« bezeichnet. Und deshalb begann ich nach Abschluss des ersten Bandes mit dem Prolog für einen weiteren Band mit Erinnerungen, bevor mich die Kraft und die Lust verließen. Das Problem bestand vor allen Dingen darin, dass ich für das Schreiben an dem Computer, den mein Urenkel Jonas mir eingerichtet hatte, meinen Sessel verlassen und auf einem unbequemen Stuhl am Tisch sitzen musste. Schon nach kurzer Zeit verspürte ich ein Zwicken am Steiß, auf das ein Mann meines Alters gern verzichtet, wenn es sich vermeiden lässt. Also ließ ich meine Erinnerungen im Kopf und verfiel in meinen angestammten Tagesrhythmus.
Die Hälfte des Tages verbringe ich in meinem Sessel, die andere Hälfte in meinem Bett. Es handelt sich um einen sehr gemütlichen Sessel und um ein sehr bequemes Bett. Zwischen beiden liegen drei Meter. Von meinem Sessel aus ist alles, was ich von der Welt durch das Fenster sehe, die Spitze des Fernsehturms von Vilnius. Zwischen ihr und mir liegen ungefähr tausend Meter. Näher will ich die heutige Welt gar nicht an mich herankommen lassen. Nicht, weil ich Angst vor ihr hätte, sondern weil sie mich nicht mehr sonderlich interessiert. So wenig, wie diese Welt sich für mich interessiert. Nun, der Welt bin ich tatsächlich herzlich egal, aber bei einem winzigen und zugleich ungemein wichtigen Teil dieser Welt hatte ich Neugierde geweckt.
»Ist das alles?«
Mit dieser Frage müsste dieses Buch eigentlich beginnen.
Ich saß aufs Angenehmste ermattet in meinem Sessel und hielt die Augen geschlossen, denn ich hatte vor Kurzem erst gegessen, und in meinem Alter ist es nicht mehr möglich, zu verdauen und gleichzeitig irgendetwas anderes zu tun, zum Beispiel, eine sinnvolle Konversation mit Jonas zu führen. Was allerdings bis dato unter allen Umständen schwierig gewesen wäre, weil mein Urenkel Reden überhaupt für ziemlich überflüssig hält, weshalb wir bei seinen mehr oder weniger regelmäßigen Besuchen meist Schach spielen, denn dabei gibt es nicht viel zu sagen.
Nach der Partie, die ich wie immer verloren hatte, war die nette Nachbarin von Wohnung 36B vorbeigekommen und hatte mir mein Mittagessen gebracht. Ihren Namen hatte ich wieder vergessen, aber erstaunlicherweise erinnerte ich mich jetzt auf Anhieb daran, was ich gegessen hatte. Es war eine Suppe gewesen mit gelben Bohnen und Kartoffeln und Hähnchenfleisch, und sie hatte so gut geschmeckt, dass ich zwei Portionen gelöffelt hatte. Jetzt fiel mir erstaunlicherweise auch der Name meiner Nachbarin wieder ein, er lautete Girdauskienė, die Suppe hatte also tatsächlich ungeahnte Geisteskräfte in mir geweckt. Wie lange war das Mittagessen her? Wie lange döste ich schon im Sessel vor mich hin? Und warum war Jonas immer noch da, obgleich er, wie man so sagt, stets so viele Hummeln im Hintern hatte, dass er es kaum erwarten konnte, wieder zu gehen, kaum war er durch die Tür getreten? Gleichwie, wenn der Junge Hunger hatte, sollte er sich etwas von der Suppe nehmen, also sagte ich, noch immer, ohne die Augen zu öffnen: »Nein, der Rest ist im Kühlschrank.«
»Du bewahrst Teile des Manuskripts im Kühlschrank auf?«
Ich hob die Lider und fand mich einem erstaunlichen Bild gegenüber: Mein zweiundzwanzigjähriger Urenkel Jonas nicht etwa mit einem seiner flachen Geräte zum Wischen und Klicken hantierend, sondern mit einem Stapel Papier in beiden Händen, die Ellbogen auf den Wohnzimmertisch gestützt.
»Was ist das?«
»Was das ist? Das ist die Geschichte von dir und diesem Schriftsteller, die du selbst aufgeschrieben hast.«
Ich wusste natürlich, was er meinte. Es war mir nur kurz entfallen.
»Du hast sie gelesen?«
»Schon«, sagte er und wirkte auf mich beinahe so, als müsste er sich für das Eingeständnis, etwas gelesen zu haben, das nicht mit sogenannten Smileys angereichert war, geradezu schämen. Ich hatte meinen Urenkel noch nie mit einem Buch in der Hand gesehen. Las er überhaupt? Andererseits: Was wusste ich schon darüber, was und wie man in diesem Jahrtausend las. Der Ignoranz der Jugend, die man ihr in allen Zeiten nachsagt, steht stets auch die unzweifelhafte Arroganz des Alters gegenüber.
»Also die ganze Geschichte mit der verschwundenen Rede so quer, und dann noch das neue Kapitel mit dem Feuer.«
Jonas, so wurde mir in diesem Augenblick klar, war mein Erstleser. Er war also überhaupt der erste lebende Mensch auf Erden, der einen Teil meiner Abenteuer mit dem Dichter kannte. Der vage Plan, das fertige Manuskript in eine Schublade zu legen, sodass jemand es nach meinem hoffentlich baldigen Tod finden würde, um es zu lesen und dann – falls derjenige es für wert erachtete – möglicherweise zu veröffentlichen, war gescheitert. Und während ich mich sonst unter allen Umständen dagegen verwehrt hätte, dass jemand in meinem Privatleben herumschnüffelte, war mir mit einem Mal geradezu feierlich zumute. So musste es sich anfühlen, wenn man etwas an die jüngere Generation weitergab.
»Hat es dir gefallen?«
»Schon. Ich wusste gar nicht, dass du so berühmte Leute kennengelernt hast. Dieser Thomas Mann war ja ein ziemlich eingebildeter Typ, aber anscheinend so berühmt wie die Frau, die Harry Potter geschrieben hat.«
Ich nahm an, dass er von einem aktuellen Buch sprach, das mir nichts sagte. »Vielleicht noch berühmter, wenn du den Namen der Autorin von diesem Potter nicht einmal kennst.«
Jonas verzog den Mund. »J. K. Rowling. Ich habe ihn nicht genannt, weil du ihn sowieso sofort wieder vergisst.«
»Frechling.«
»Du hast meine Frage nicht beantwortet.«
»Welche Frage?«
»Ob das alles ist? Oder ob die Geschichte noch weitergeht?«
»Glaubst du denn, dass sie noch weitergeht?«
»Ich finde, dass du viele Andeutungen machst. Soll ich dir einen Tee kochen?«
»Ja.«
Er stand auf und verschwand in der Küche, in der sich zwei Menschen nicht aufhalten konnten, ohne einander auf den Füßen zu stehen. Sie bestand aus einer Anrichte, zwei immer kalten Kochplatten und einem hässlichen Mikrowellenherd, der zu summen begann, als Jonas das Wasser darin heiß machte. »Eigentlich schade, dass ich meine Urgroßmutter nie kennengelernt habe!«, rief er.
»Man sollte seine Urgroßeltern gar nicht kennen.«
»Was meinst du?« Er kehrte mit einer Tasse zurück, aus der das blassgelbe Fähnchen eines Teebeutels hing.
»Wenn es mit rechten Dingen zugeht, werden Menschen nicht so alt, dass das möglich wäre. Jedenfalls nicht Litauer. Ihre Traurigkeit ist schuld daran. Ich bin die Ausnahme. Anscheinend trinke ich zu viel Tee und zu wenig Alkohol.«
Doch tatsächlich hatte Jonas mir einen weiteren Grund geliefert, die Geschichte von Mann & Müller fortzusetzen. Denn alle Geschichten haben für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedeutung. Und während Kenner von Thomas Mann und solche, die sich dafür halten, in dem, was nun folgen wird, einzelne leuchtende Mosaiksteinchen zur Vervollständigung einer Autorenbiographie entdecken mögen, öffnet sich für andere ein Fensterchen zur eigenen Geschichte und Herkunft. So wie für meinen Urenkel Jonas.
»Noch einmal wochenlang auf einem unbequemen Stuhl vor einem Bildschirm am Schreibtisch sitzen? Dazu habe ich keine Lust.« Und keine Kraft, wie ich insgeheim für mich hinzufügte. »Daraus wird nichts werden. Man soll sich außerdem nicht so wichtig nehmen.«
Aber Jonas – der liebe, gute Junge – ließ nicht locker. »Du könntest sie aufnehmen.«
»Wen soll ich aufnehmen?«
»Nicht jemanden, sondern etwas. So ein Computer ist nicht nur eine digitale Schreibmaschine, sondern auch ein digitales Tonbandgerät. Du drückst ein rotes Knöpfchen und redest einfach drauflos, das kostet keine Mühe.«
»Du schlägst vor, dass ich laut mit mir selbst spreche? Wenn ich jetzt noch nicht ganz verrückt bin, werde ich es danach sein.«
Das brachte ihn zum Lachen. »Oder so: Du könntest schön gemütlich in deinem Sessel sitzen bleiben und mir die Geschichte diktieren.«
»Ha! Ich denke vielleicht langsam, aber ich kann schnell sprechen. Und du glaubst, du könntest alles mitschreiben? Ja, sollte man denn heutzutage in der Schule tatsächlich noch das Zehn-Finger-System lehren?«
Er lächelte mich milde an: »Bočelis, ich könnte auf meinem Smartphone mitschreiben und wäre schneller als irgendwer mit dem Zehn-Finger-System auf einem Computer.«
»Bočelis«, also Großväterchen, hatte er mich zuletzt als Kind zu Weihnachten genannt. Er versuchte es wirklich mit allen Tricks. Ich ließ mich im Sessel zurücksinken, schloss die Augen und dachte nach. Jonas hatte recht mit seinem Verdacht. Da war noch mehr. Und wenn ich schon in der Vergangenheit lebte, warum sie nicht teilen mit jemandem, der sich – jedenfalls für den Moment – dafür interessierte. Die Laune konnte schon morgen vorbei sein, aber ich hatte nichts zu verlieren. Ich lebte schon lange nicht mehr nach dem Motto carpe diem, nutze den Tag. Meine Devise lautete seit einiger Zeit eher: somnum per diem, verschlafe den Tag.
»Du müsstest jeden Tag kommen«, sagte ich. »Wer weiß, wie lange ich noch in der Lage bin, mich an Einzelheiten zu erinnern. Oder an dich.«
»Du neigst zu Übertreibungen.«
»Ich neige zum Sterben.«
»Noch lange nicht.«
»Soll das eine Drohung sein?«
»Du bist ein Miesepeter.«
»Und du ein frecher Jungfuchs.«
Er sah mich erwartungsvoll und herausfordernd an.
»Jeden Tag«, wiederholte ich meine Bedingung. »Bis ich die ganze Geschichte erzählt habe.«
Das schien ihn ins Grübeln zu bringen, was ich nur zu gut verstand. Ich will den jungen Menschen sehen, der nichts Besseres zu tun hat, als sich von den Altvorderen Geschichten vom Krieg erzählen zu lassen.
»Die Uni macht gerade sowieso Pause.«
Ich nickte. »Du müsstest es genauso aufschreiben, wie ich es dir erzähle. Wie bei einem Diktat in der Schule. Wort für Wort.«
»Na ja, vielleicht könnte ich hin und wieder etwas ändern. Nicht inhaltlich natürlich. Aber du hast oft eine ziemlich umständliche Art zu sprechen.«
»Ich spreche so, wie ich spreche.«
»Echt jetzt«, sagte er seufzend, »Wort für Wort?«
Ich lächelte in mich hinein. »Willst du die Geschichte hören, oder nicht?«
»Ja.«
»Was gibt es dann noch zu überlegen?«
»Okay.«
Ich öffnete die Augen. »Gib mir den Stein, der da auf dem Regal liegt.«
Die Aufforderung verwirrte Jonas. »Welchen Stein? Wo?«
»Hinter dir.«
»Den hier?«
»Gib ihn mir.«
»Wozu brauchst du ihn?«
»Als Gedächtnisstütze.«
Er rieb mit dem Daumen über den rot-grün marmorierten Stein. »Wozu brauchst du eine Stütze? Was ist mit dem photographischen Gedächtnis, von dem du im ersten Buch erzählst?«
Ich hielt ihm die offene Handfläche als Aufforderung entgegen. »Hoffentlich schreibst du aufmerksamer, als du liest. Dem photographischen Gedächtnis verdanke ich Bilder aus der Vergangenheit. Doch erst Gefühle geben diesen Bildern Sinn.«
Er legte ihn mir endlich in die ausgestreckte Hand und war nun mit einem Mal Feuer und Flamme. »Verstehe … also sind in dem Stein sozusagen Gefühle eingeschlossen? Meine Freundin redet immer über die Kraft der Steine.« Er hatte einen Klappcomputer aus seinem Rucksack genommen und sich auf den Schoß gelegt.
Wahrscheinlich habe ich die Augen verdreht. »Überspannter modischer Humbug. Nichts ist in einem Stein eingeschlossen. Ein Stein ist ein Stein. Aber dieser hier ist ein hübscher Stein. Und damit er hübsch bleibt und nicht stumpf wird, muss ich ihn jeden Tag zwischen den Fingern reiben.«
»Du willst mir doch nicht weismachen, dass er nichts bedeutet. Das ist der Stein, den du in der ersten Geschichte erwähnst, oder? Der, den du an dem Tag am Strand der Kurischen Nehrung aufgehoben hast, als du dort zum ersten Mal Thomas Mann begegnet bist.«
Er hatte recht. »Du hast ja doch aufmerksam gelesen. Ja, das ist der Stein von damals. Eigentlich ein Wunder, dass ich ihn noch habe. Oft habe ich monatelang nicht an ihn gedacht, geradezu vergessen, dass es ihn gibt, und dann ganz plötzlich ertaste ich ihn in einer Hosen- oder Jackentasche und weiß nicht mehr, wie er dort hingekommen ist. Warum schreibst du das nicht?«
»Ich wusste nicht, dass das schon zur Geschichte gehört.«
»Ab jetzt gehört alles zur Geschichte. Der Stein begleitet mich also schon sehr lange, auch damals in Zürich im Oktober 1933, als ich entführt wurde.«
Jonas sah überrascht auf. »Du bist entführt worden?«
»Ja. Dazu kommen wir später. Aber ich kann das Diktat nicht jedes Mal unterbrechen, wenn etwas passiert, das dich überrascht. So werden wir nie fertig.«
Und so kam es, dass ich diese weitere biographische Erzählung ernsthaft in Angriff nahm. Es reichte mir die Ermutigung eines einzigen Menschen. Eines besonderen Menschen, wie ich heute sagen muss. Denn aus einem größtenteils desinteressierten Urenkel, der von seinen ebenso desinteressierten Eltern zweimal im Monat dazu verdonnert worden war, seinen schlecht gelaunten Urgroßvater zu besuchen, um eine Runde Schach mit ihm zu spielen und ihm bei Computerproblemen zu helfen, sollte in den Wochen des Diktats endgültig ein Freund und Vertrauter werden. Wie so vieles in meinem Leben verdanke ich auch diese, wahrscheinlich letzte »glückliche menschliche Akquise« in meinem Leben dem Dichter.
Und damit können Sie sich, so Sie sich dazu bemüßigt fühlen, ein weiteres meiner Abenteuer mit Thomas Mann zu Gemüte führen. Um es zu verstehen, müssen Sie nicht en détail wissen, wie ich den Dichter im Sommer 1930 am Strand von Nidden kennenlernte oder wie genau ich ihn durch meine Ungeschicklichkeit zunächst in größte Kalamitäten stürzte, es mir aber mit Tatkraft und viel Glück auch wieder gelang, ihn daraus zu befreien. Wobei die Kenntnis der damaligen Ereignisse Ihnen zumindest mein kompliziertes Verhältnis zu dem Dichter verständlicher machen würde. Die Kurische Nehrung verband ihn und mich, und in unseren Gesprächen kamen wir immer wieder auf sie zurück.
Damals in Zürich begegnete ich einem anderen Thomas Mann. Einem Thomas Mann, der einerseits das Unglück für Deutschland so klar hatte kommen sehen wie wenige seiner Zeitgenossen. Der aber andererseits ganz unvorbereitet darauf gewesen war, seine Heimat verloren zu haben, eine Heimat, zu der er sich zugleich stärker denn je hingezogen fühlte. Wie in Nidden thronte er in seinem Schweizer Refugium über dem Wasser – aus dem Schwiegermutterberg war die Schiedhalde und aus der Lagune der Zürichsee geworden, doch diesmal schöpfte er keine Kraft aus der Schönheit seiner Umgebung, weil alles Neue ihn an jedem Morgen nur umso quälender an den Verlust des Alten gemahnte. Der neuen Sprache, den neuen Gepflogenheiten, Bekanntschaften und Orten begegnete er mit Misstrauen, doch das tiefste Misstrauen hegte er gegen sich selbst, seinen Körper und seinen Verstand, der sich mit dem Verlust der Freiheit nicht abzufinden vermochte. Das Leben im Exil, das physische Außensein, war ihm dem Wesen nach nichts weniger als ein unerträglich unnatürlicher Zustand. Er spürte, dass mit seiner Person zugleich der Humanismus, für den er stand, diese höhere deutsche Idee für das Bessere und Anständige und Wahre, verbannt worden war. Etwas, das er niemals widerspruchslos hinnehmen würde.
Ich schrieb dieses nächste Kapitel meiner Erlebnisse mit Thomas Mann mit und für Jonas und fühlte mich beflügelt von dem Gedanken.
Und wenngleich ich nichts mutwillig ausschmücken werde, nur um meinem einen jungen Leser zu gefallen, so wird dieses Buch anders als das erste weniger dem Drang nach innerer Läuterung geschuldet sein als vielmehr dem Wunsch, mit unseren Erlebnissen zu unterhalten. Selbstverständlich unter strikter Wahrung der historischen Wahrheit und ohne Beschönigung der furchterregenden Details. Und wenn ich Ihnen an dieser Stelle schon verrate, dass die Geschichte gut ausgeht, nehme ich nichts vorweg. Sie können schließlich in jedem guten Lexikon nachlesen, dass Thomas Mann erst zweiundzwanzig Jahre später gestorben ist. Nach der Lektüre allerdings mag Ihnen das nicht mehr so selbstverständlich erscheinen.
Mit fast einhundertundzwei Jahren sind zwar die Synapsen in meinem Kopf so wie alle anderen körperlichen Funktionen träge geworden, aber ich bin gottlob noch nicht dement. Meine besondere Gabe, die Jonas weiter oben erwähnte, ermöglicht es mir in besonderen Momenten, alles, was sich in meinem Sichtfeld befindet, bis in die kleinste Einzelheit zu memorieren. Der Volksmund nennt diese Gabe »photographisches Gedächtnis«. Ich selbst habe stets versucht, möglichst wenig Aufhebens darum zu machen. Im Erwachsenenleben lernte ich, diese Momente selbst zu bestimmen, meine Gabe also bewusst anzuwenden. Dann ziehe ich mir etwas über den Kopf, das ich meine unsichtbare Gedankendecke nenne. Es wird still in meinem Kopf, und ich sehe nichts als dieses Bild vor mir, einen Raum, ein Dokument oder ein Panorama. Es dauert nur einen Augenblick und bleibt für immer. Und weil das so ist, muss ich vorsichtig sein. Es ist ja nicht so, als würden wir Menschen nicht schon generell genug geistigen Unrat mit uns herumschleppen, den wir uns nicht ausgesucht haben. Zeit meines Lebens habe ich von Ahnungslosen für diese Begabung große Bewunderung erfahren. Sie stellen sich vor, wie ich Quizsendungen im Fernsehen gewinnen und der Polizei bei der Überführung von Serienmördern helfen könnte. Aber Sie würden staunen, wie selten man im Leben Gelegenheit hat, vor Fremden mit dem auswendigen Referieren von Thomas-Mann-Texten Eindruck zu schinden. Nun, die Wahrheit ist, dass dieses photographische Gedächtnis im Leben oft mehr Belastung als Hilfe war. Denn es ist nach meiner Erfahrung wahr, dass die Zeit alle Verletzungen heilt, außer die tödlichen. Dies kann sie aber nur, wenn die Erinnerung an schlimme Dinge eine Chance hat zu verblassen.
Mir ist auch daran gelegen, endlich den bescheidenen Platz in Anspruch zu nehmen, den ich in Thomas Manns Leben eingenommen habe und den kein Gelehrter der Literaturgeschichte jemals zu würdigen wusste. Aus guten Gründen, die in dem Manuskript hoffentlich nachvollziehbar erläutert werden. Der Dichter und ich waren jedenfalls im Sommer 1930 stillschweigend darin übereingekommen, dass das tödliche Geheimnis, das uns verband, Grund genug war, über unsere Verbindung für alle Zeiten den Schleier des Schweigens auszubreiten. An dieser Stelle nur so viel dazu: Jemand war gewaltsam zu Tode gekommen. Ich will nicht unbedingt behaupten, dass dieser Jemand es verdient hatte zu sterben, doch zumindest hatte er sich selbst in die Gefahr begeben, in der er umkam. Dass Thomas Mann Zeuge geworden war, durfte die Welt nie erfahren. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass er im Oktober 1933 unfreiwillig und unter den abenteuerlichsten Umständen für wenige lebensbedrohliche Minuten aus dem Schweizer Exil nach Deutschland zurückgekehrt war.
Kapitel zwei
Baldmöglichste Anreise
In den mehr als fünfzig Jahren, die ich ihn überlebte, habe ich alles von und über Thomas Mann gelesen, was ich in die Finger bekam. Zunächst auf Deutsch, dann in litauischer und russischer Übersetzung und nach dem Ende der Besatzungszeit selbst seine erhaltenen Tagebücher. Insgeheim hoffte ich auf eine Erwähnung, auf den geringsten Hinweis meiner Existenz, doch der Dichter hat sich eisern an unsere Vereinbarung gehalten. Ich bin und bleibe ein Phantom der Vergangenheit, das in diesen Zeilen nur kurz aufscheint, um dann für alle Ewigkeit wieder zu verschwinden. Längst habe ich mich damit abgefunden, nicht wie Paul Ehrenberg oder Kurt Martens als Empfänger herzerwärmender Briefe für jeden sichtbar in einer Reihe mit den wenigen Freunden zu stehen, die Thomas Mann in seinem Leben hatte.
Und doch gibt es zwei an mich gerichtete Schriftstücke von Thomas Mann, die ich in der Folge zitieren werde. Die Originale sind verschollen, die buchstabengetreuen Kopien sind in meinem Kopf. Das erste ist ein Telegramm, das mich am Freitag, den 29. September 1933, erreichte.
Ludwik und ich teilten uns damals ein winziges Zimmer in einem Mietshaus am Steindammer Wall nahe der Königsberger Sternwarte. Es lag nur ein Stockwerk unterhalb des Zimmers, in dem Dalia und ihre getigerte Katze wohnten. Die Nachbarschaft war kein Zufall. Hund und Katze hielten wir getrennt, was nicht weiter schwierig war, denn Ludwik hatte trotz seiner Größe offenbar Angst vor der Katze, die ihn umgekehrt seine Nichtswürdigkeit auf eine Art spüren ließ, wie nur Katzen sie kultivieren können. Dalia und ich hingegen ließen uns nicht trennen. Wir waren uns seit den turbulenten Sommerwochen in Nidden im Jahre 1930 besonders zugetan, verbrachten immer mehr Zeit miteinander, hielten uns bei den Händen, wenn wir gemeinsam die Straßen entlanggingen, fühlten uns wie ein Paar und versprachen uns schließlich im Frühling 1933 einander, was nur deshalb nicht als offizielle Verlobung zu gelten hatte, weil unsere Eltern nichts von unserem Glück wussten und ich kein Geld für einen Ring hatte. Trotz des Versprechens, das wir uns gegeben hatten, teilten wir Tisch und Bett nur heimlich miteinander. Über Monate nach dem Einzug in das Mietshaus am Steindammer Wall hatte ich mich nächtens über die dunkle, knarrende Treppe zu Dalias Zimmer geschlichen, was zugleich Gefühle der Erregung und der Erniedrigung in mir auslöste. Am Tag hingegen gaben wir uns bei Begegnungen im Haus den Anschein größtmöglichen Desinteresses.
Sie mögen das komisch finden, aber solche Versteckspiele wurden erwachsenen Menschen damals tatsächlich abverlangt.
Natürlich konnte das nicht ewig gut gehen, und wir flogen in einer besonders kalten Winternacht auf, als das Eis Dalias Fenster zerspringen ließ, was die Vermieterin in Alarmbereitschaft versetzte, woraufhin sie energisch an ihre Tür zu hämmern begann. Der Schrank war nicht groß genug, um mich darin zu verstecken, so waren wir gezwungen, ein vollumfängliches Geständnis abzulegen. Ich sah uns schon unter einer Brücke erfrieren, doch Dalia beherrschte bereits damals die Kunst, in heiklen Situationen Argumente in überzeugendster Art und Weise ruhig und vernünftig vorzutragen. Und wie sich herausstellte, hatten wir der Vermieterin unrecht getan. Sie war durchaus nicht bigott und fühlte sich auf romantische Weise an ihre Jugendjahre erinnert. Wir versicherten ihr, dass auf unsere Verlobung eine Vermählung folgen und wir bis dahin den Anstand wahren würden, und wiesen zudem nur halb scherzhaft darauf hin, dass die Überlebenschancen in einer Winternacht mit geborstenem Fenster deutlich größer waren, wenn man sich gegenseitig wärmte. Danach achteten wir immer noch darauf, möglichst nicht gehört zu werden, aber das Leben wurde doch entspannter.
Tagsüber zogen Herr und Hund von Café zu Café, in jedem nur so lange verweilend, wie ich glaubhaft vorgeben konnte, dass noch ein Rest Kaffee in meiner Tasse war. Dies durchaus nicht zu meinem reinen Vergnügen oder mit der Pose des Bohemiens, sondern mit kleineren Übersetzungen beschäftigt. Ich arbeitete vor allem für Zeitungen und schrieb Manuale für Hersteller von Radioapparaten, elektrischen Plätteisen und Staubsaugern. Meine fertiggestellte Übersetzung des Tod in Venedig – bis auf die Kleider, die ich am Leibe trug, das Einzige, was im Sommer zuvor in Nidden nicht einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen war – bewahrte ich immer noch in der Schublade auf. Verschiedentlich war ich damit bei litauischen Häusern vorstellig geworden, hatte aber noch niemanden überzeugen können, die Novelle auch zu verlegen. In welchem Zusammenhang das erwähnte Feuer mit dem merkwürdigen Fall steht, den Mann & Müller im Oktober 1933 in Zürich zu lösen hatten, davon wird noch die Rede sein.
Da dieses besagte Telegramm einer gewissen Dramatik nicht entbehrt, will ich es hier zitieren. Mit ihm begann das Zürcher Abenteuer. Zunächst ganz harmlos, um dann allerdings Wendungen zu nehmen, die Leib und Leben gleich mehrerer beteiligter Personen gefährdeten. Es las sich wie folgt:
Gruesse Sie herzlich aus Zuerich. Beunruhigendes ist geschehen, ersuche Sie daher dringend um baldmöglichste Anreise – Thomas Mann, Hotel St. Peter
In den Stunden bis zum Abend wartete ich voller Ungeduld mit dieser Neuigkeit in meiner Tasche darauf, dass Dalia aus der Universität zurückkehren würde. Als ich ihre Schritte im Flur vernahm, riss ich die Tür auf, zog sie zu mir ins Zimmer und hielt ihr das Telegramm hin.
Nachdem sie es noch im Mantel gelesen hatte, sagte ich in gespielter Empörung: »Er macht sich nicht einmal die Mühe, einen Grund für die Dringlichkeit zu nennen.« Sicherlich wollte ich ihr gegenüber so den Eindruck vermeiden, als könnte der Dichter einfach nach mir pfeifen wie nach seinem Hund.
»Und ich finde, diese Tatsache solltest du als Zeichen des Vertrauens werten«, sagte Dalia. »Abgesehen davon wird man in einem Telegramm in der Regel nicht ausschweifend.«
»Du bist also der Meinung, ich sollte alles stehen und liegen lassen und zu ihm in die Schweiz fahren?« Eine Seite in mir hoffte, dass sie mich nicht gehen lassen würde, zumal ich selbst nicht eine Minute mehr als absolut notwendig von Dalia getrennt sein wollte. Eine andere, ebenso starke, hoffte auf ihre Billigung der abenteuerlichen Reise.
»Ich gebe nur die Umstände zu bedenken«, sagte sie. »Er und seine Familie mussten die Heimat verlassen, und es ist zweifelhaft, ob sie jemals zurückkehren können. Spazierengehen mit ihm am Lagunenufer in Nidden, das war einmal, Žydrūnėlis. Also wenn dir an einem Wiedersehen mit ihm gelegen ist, dann ist seine Stunde der Not vielleicht zugleich für dich die Gunst der Stunde.«
Dalia hatte natürlich recht. Schließlich war im Januar desselben Jahres genau das eingetreten, wovor der Dichter schon fast drei Jahren zuvor ebenso eindringlich wie vergeblich gewarnt hatte: Die Barbarei hatte triumphiert. Adolf Hitler war zum Reichskanzler ernannt worden, und seine als brave Beamte verkleideten Schergen hatten stante pede damit begonnen, eine Demokratie in einen Unterdrückerstaat zu verwandeln. Eine wirksame Methode zur Erreichung dieses Ziels war es, unverzüglich diejenigen mundtot zu machen oder gleich umzubringen, die sich besonders hörbar für die Demokratie verwendeten. Prompt wurde ein – selbstverständlich streng geordnetes – Verfahren in Gang gesetzt, um den Schriftsteller Thomas Mann in Schutzhaft zu nehmen, sobald er deutschen Boden betreten würde. Schutzhaft. Was für ein höchst merkwürdiger Begriff! Wer oder was will sich vor wem oder was schützen? Das Regime womöglich sich selbst vor dem Dichter? So groß die flüchtige Genugtuung über diesen Gedanken sein mag, so groß ist die Verzweiflung bei dem, der unter dieser Bedrohung lebt. Thomas Mann und seine Frau hatten sich auf Vortragsreise im Ausland befunden, als sich im frisch geschmierten Getriebe des Terrors ein Rädchen nach dem andern in Bewegung setzte und ineinandergriff. Und so kam es, dass das Exil des Thomas Mann ganz ohne sein Zutun begann. Alle Welt geht davon aus, dass der Dichter erst nach dem Krieg wieder deutschen Boden betreten hätte. Und technisch gesehen stimmt das sogar. Doch wie knapp er in einem unbedachten Moment tatsächlich der Verhaftung entging, weiß bis dato nur eine Handvoll Menschen. Und nach Lektüre auch Sie.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass ich, als dieses Gespräch mit Dalia stattfand, schon seit Monaten nichts von Thomas Mann gehört hatte, und mich hatte zunehmend eine gewisse Unruhe beschlichen, ein geradezu atemberaubendes Unwohlsein, so als hätte ich mich zu lange in einem schlecht gelüfteten und düsteren Raum aufgehalten.
»Aber ich kann unmöglich sagen, wie lange die Reise dauern würde.«
Ich spüre noch Dalias sanfte Hand an meiner Wange. Niemand kannte meine Vorgeschichte mit dem Dichter so gut wie sie, zumal sie selbst darin eine wichtige Rolle gespielt hatte. »Du stehst Thomas Mann bei und nimmst Ludwik mit. Ich werde hier auf dich warten, ganz gleich, wie lange es dauert. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpassen wirst.«