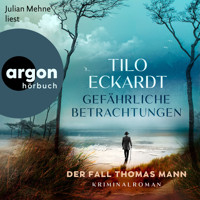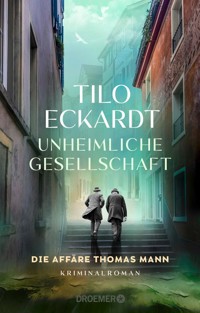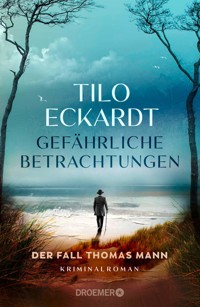
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Thomas-Mann-Romane
- Sprache: Deutsch
Zum Jubiläumsjahr des großen Autors und Literatur-Nobelpreisträgers: Ein historischer Kriminalroman, der Thomas Mann auf noch nie gelesene Weise lebendig werden lässt. Der Dichter hatte sich vom Strandkorb erhoben und die Jagdszenen beobachtet. Als ich im bescheidenen Triumph die Arme mit den aufgefangenen, zerknitterten Blättern hob, schlug er sich auf die Oberschenkel und klatschte dann in die Hände. "Ganz vortrefflich!", rief er, und mir ging das Herz auf. Eine schillernde Hommage an Thomas Mann und eine spannende Erzählung über Mut, Freundschaft und die Kraft der Literatur, die Welt zu verändern. Ein Roman, der die Grenzen zwischen historischer Wahrheit und dichterischer Erfindung kunstvoll und spielerisch verschwimmen lässt. Nidden im Sommer 1930, ostpreußisches Fischerdorf und Künstlerkolonie auf der Kurischen Nehrung, einem archaischen Landstrich zwischen wilder Ostsee und stiller Lagune. An dieser weißen Küste "so schön geschwungen, dass man glauben könnte, in Nordafrika zu sein", landet im Juli 1930 Thomas Mann mit Familie, um das neue Sommerhaus zu beziehen. Daheim in Deutschland droht nach der Auflösung des Reichstags das Ende der Weimarer Republik, und der tief beunruhigte Dichter arbeitet im Bademantel im Schatten seines Strandkorbes heimlich an einer großen Rede, mit der er das deutsche Volk vor dem erstarkenden Nationalsozialismus warnen will. Da kreuzen sich unter außergewöhnlichen Umständen die Wege des weltberühmten Dichters und des jungen litauischen Übersetzers Žydrūnas Miuleris, den Mann hartnäckig und eingedeutscht Müller nennt. Und es ist dieser Müller der den Dichter in größte Schwierigkeiten bringt, als er das Manuskript der brisanten Rede verliert. Die Suche danach scheint weitere rätselhafte Ereignisse in Gang zu bringen. Thomas Mann fühlt sich verfolgt und beobachtet und ein Mitglied seines Hausstandes verschwindet spurlos. Der Dichter und sein Übersetzer sehen sich einem ebenso seltsamen wie aufregenden Fall gegenüber. Zwischen Wanderdünen und Wald, umgeben von exzentrischen Künstlern, stoischen Fischern und neugierigen Kurgästen müssen Mann und Müller alles daransetzen, die Abschriften wiederzuerlangen, bevor sie in die falschen Hände geraten. Mit diesem historischen Kriminalroman um das nicht ganz freiwillige Ermittler-Duo Mann und Müller setzt Tilo Eckardt einem der größten Erzähler des 20. Jahrhunderts ein ganz besonderes literarisches Denkmal. Die beginnende Zeit des Nationalsozialismus wird ebenso lebendig wie der bis heute gefeierte und geliebte Schriftsteller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tilo Eckardt
Gefährliche Betrachtungen
Der Fall Thomas MannKriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nidden im Sommer 1930. In dem idyllischen ostpreußischen Fischerdorf kreuzen sich die Wege des weltberühmten Schriftstellers Thomas Mann und des jungen Übersetzers Žydrūnas Miuleris, genannt Müller, unter außergewöhnlichen Umständen. Nach der Auflösung des Reichstags droht das Ende der Weimarer Republik, und der tief beunruhigte Dichter arbeitet in der Sommerfrische heimlich an einer politischen Rede, mit der er das deutsche Volk vor dem erstarkenden Nationalsozialismus warnen will. Doch dann verschwinden brisante Abschriften des Redemanuskripts, und Thomas Mann entdeckt Spuren eines Einbruchs in sein Arbeitszimmer. Zwischen wilder Ostsee und stiller Lagune, umgeben von exzentrischen Künstlern, knorrigen Fischern und Sommergästen, müssen Mann und Müller alles daransetzen, die Abschriften wiederzuerlangen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
August 1930
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
August 1989
EPILOG
Anmerkungen des Autors
Quellen- und Literaturverzeichnis
Dank
Tau – Für dich
Es ist schwer, es zugleich der Wahrheit und den Leuten recht zu machen.
Thomas Mann
Well, we could lose about a page and a half, I suppose, from that sequence in the summerhouse, but the rest is totally essential.
Bernard Black, Elephants and Hens
August 1930
KAPITEL EINS
Wind
Was … Was ist los?«
Die Gestalt ragte vor mir auf, verschattete das Fenster, und die Kette mit dunkel glänzenden Perlen, die sie um ihren hochgeschlossenen Kragen trug, klimperte leise vor meinem Gesicht. Mir schlug das Herz bis zum Hals, denn für Menschen wie mich, die sich mit dem Einschlafen schwertun, fremde dunkle Räume fürchten und ihre intensivsten Träume im Morgengrauen haben, war es die schlimmste Art, geweckt zu werden. Meine Pensionswirtin tat es jeden Morgen.
»Levez-vous et brillez! Erhebe dich und scheine!«
»Wie spät ist es?«
»Halb sieben. Sie wollen ihn doch nicht wieder verpassen, Herr Miuleris!«
Frau Bryl hatte vom ersten Moment unserer Begegnung an einen Narren an mir gefressen. Wenn ich bei Menschen, die mich noch nicht kennen, einen guten Eindruck machen will, neige ich dazu, zu viel zu reden. Nur deshalb hatte ich ihr direkt nach meiner Ankunft nach dem dritten Glas Starka auf einem niedrigen Hocker in ihrer Küche kauernd von meiner Mission erzählt, noch bevor ich einen ersten Blick in mein Zimmer geworfen hatte. Und Frau Bryl erklärte sich umgehend zur Komplizin. Die Kutsche mit der Familie Mann sei schließlich bei deren triumphalem Einzug in Nidden ganz nah an ihr vorbeigefahren. Sie sei sich sogar sicher, die kleine Elisabeth, wenngleich verständlicherweise eingeschüchtert ob des Menschenauflaufs, habe ihr zugelächelt. So sei das eben mit ihr, sie falle den Menschen ins Auge und sei beliebt, besonders bei Kindern und Hunden, die ein Gespür dafür hätten, wem sie vertrauen können. Dabei sei sie doch eine ganz gewöhnliche Frau. Und dann stellte sie mich auch gleich ihrem Hund Ludwik vor, einem riesenhaften Owtscharka mit dem dichten weißen Fell einer Ziege, der aus dem Flur getrottet kam, vor mir stehen blieb und mich auf Augenhöhe musterte, sodass ich nicht wusste, ob ich den Blick erwidern oder lieber wegschauen sollte. Frau Bryl war sensibel genug, mein Unbehagen zu spüren, und so zog sie ihn mit sanfter Kraft von mir weg und sagte, es sei wichtig für Ludwik, alle ihre Gäste zu kennen und von Fremden unterscheiden zu können. Er sei Wachhund und »der einzige Mann im Haus«. Wie ich noch herausfinden sollte, ging diese Bewachung durch Ludwik gelegentlich so weit, dass er vor meiner Zimmertür lag und nur den Kopf hob, wenn ich rücksichtsvoll über ihn stieg.
»Also: Raus aus den Federn! Der Jäger muss mit seiner Beute aufstehen.«
»Ich möchte Thomas Mann übersetzen, nicht erlegen«, sagte ich, und das brachte sie zum Lachen.
Seit meiner Ankunft in Nidden zwei Tage zuvor versuchte ich, Kontakt zu dem berühmten Dichter aufzunehmen. Bislang hatten diese Versuche so ausgesehen, dass ich von meiner Pension nahe dem Strand eine knappe halbe Stunde durch den Nehrungswald zu seinem Sommerhaus auf einer Düne über der Lagune wanderte und in Sichtweite auf dem Weg zwischen Bäumen und Sträuchern darauf wartete, dass er aus der Tür trat. Dann wollte ich die Gelegenheit nutzen, ihn auf mich aufmerksam zu machen. Ich war mir sicher, er würde mich wiedererkennen und mir mit einem Zeichen erlauben, ihn anzusprechen. Unsere zweite Begegnung wollte ich so ungezwungen und natürlich aussehen lassen, wie es nur möglich war. Keinesfalls durfte ich mich dem großen Mann aufdrängen oder ihm gegenüber verzweifelt erscheinen. Und doch war ich es. Begierig und machtlos wie ein ausgehungerter Löwe, der einen Elefanten umschleicht. Nein, ich war kein Löwe, ich war eine Hyäne. Geduckt und unansehnlich, während er groß und majestätisch war.
»Kas tai – kas – tai …« Mit diesen Worten hatte ich mich im Jahr zuvor Thomas Mann in Königsberg vorgestellt. Nach dessen Lesung stand ich brav in der Schlange derjenigen, die sich seinen Namen in ihre Ausgabe schreiben lassen wollten. Diese vier Worte waren meine Bewerbungsrede. Man mag es mir nicht als Eitelkeit auslegen, wenn ich sage, dass ich über diese vier Worte zwei lange Nächte lang gebrütet hatte. Sie mussten stimmen. Sie mussten – wenn es nach mir ging – für die Ewigkeit sein. Ich übertreibe nicht. Denn es handelt sich um die ersten Worte eines weltberühmten Buches. Eines Buches, das das Leben seines Autors verändert hatte.
Sie glauben mir vielleicht nicht, weil Sie sich für belesen halten und diese Worte trotzdem noch nie gehört haben. Das liegt daran, dass es sich streng genommen nicht um die Worte des Autors handelt, sondern um meine. Es ist Litauisch.
Ich bin der Übersetzer.
Und es sind genau diese Worte – »Was ist das. – Was – ist das …«–, die der berühmte Mann ein gutes Jahr nach der Begegnung in Königsberg, für seine Verhältnisse überreizt durch Portwein und zutiefst erschrocken, selbst ausrufen sollte, als er die Leiche erblickte. Das heißt, streng genommen waren es nur die Beine der Leiche, die aus dem Fenster ragten. Ich sehe das groteske Bild genau vor mir. In dieser windigen Nacht im August 1930 hinter dem Hotel Königin Louise in Nidden auf der Kurischen Nehrung lud ich zu meiner ewigen Schande die Schuld an dem Tod eines Menschen auf mich. Um ihn zu verteidigen. Und mit ihm die Freiheit und die Liebe und die Literatur.
Das glaubte ich damals. Heute weiß ich, dass ich einfach nur die Hosen gestrichen voll hatte.
Für die wahre Geschichte, die ich hier erzählen will, gibt es keine Zeugen mehr. Alle beteiligten Personen sind schon vor langer Zeit gestorben, und auch ich werde hoffentlich nicht mehr ewig unter den Lebenden sein. Obwohl ich – seit ich das einhundertste Lebensjahr überschritten habe und mir gnädigerweise nicht mehr wehtut als jeden Morgen sämtliche Knochen – dem Leben gegenüber immer öfter eine Gelassenheit verspüre, die sich beinahe wie Unsterblichkeit anfühlt. Den Original-Redenentwurf, um den es hier gehen wird, hat meines Wissens kein Mensch je gesehen. Und das von mir angefertigte Faksimile hat der Dichter vernichtet. Für die Behauptungen, die ich in diesem Buch aufstelle, gibt es nicht die geringsten Beweise. In keinem Archiv existiert eine Photographie, die mich zusammen mit Thomas Mann auf der Kurischen Nehrung oder in Zürich oder in Princeton zeigt. Die Tagebücher, die er in dem Sommer schrieb, in dem das hier Geschilderte sich abspielte, hat er selbst viele Jahre später verbrannt.
Sie müssen meinen Worten also nicht vertrauen. Herrje, ich traue meinen Worten selbst oft genug nicht. Das ist eine Berufskrankheit. Vertrauen kann ich hingegen meinem untrüglichen Langzeitgedächtnis und den vergilbten Bildern in meinem Kopf.
In den Tagen, da ich dies aufschreibe, vermag ich mich am Abend kaum noch zu entsinnen, was meine freundliche Nachbarin aus Apartment 36B mir zu Mittag gekocht hat. Aber dieser Augenblick meiner ersten Begegnung mit dem großen Dichter ist mir so frisch in Erinnerung, als wäre er gestern geschehen. So wie alle Ereignisse, von denen ich hier erzählen möchte.
Er saß in seinem grauen Zweireiher mit weißem Einstecktuch kerzengerade an einem schlichten Holztisch, den ihm der Veranstalter der Lesung in Königsberg hingestellt hatte. Die Alva-Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken, den Osmia-Füllfederhalter in der rechten Hand. »Kas tai – kas – tai …« Ich muss gegrinst haben wie ein schlechter Zirkusartist, dem gerade die erste saubere Pirouette seines Lebens gelungen war. Und er bedachte mich mit diesem Blick, den ich damals schon von Bildern in der Zeitung kannte: von oben herab, obwohl er saß und ich, der Bittsteller, stand. Die Braue über seinem linken Auge um ein paar Grad nach oben gezogen, arrogant und neugierig zugleich. Hätte der Dichter in diesem peinlichen Moment so etwas Erwartbares gesagt wie »Sind Sie noch bei Trost?«, hätte ich mein Vorhaben an Ort und Stelle begraben können. Doch stattdessen presste er die Lippen gerade so fest zusammen, dass man es für ein Lächeln hätte halten können, und sagte: »Kein Grund, sich zu kasteien, junger Mann. Doch mich interessiert, was Sie da für eine Sprache sprechen.«
Frau Bryl stand nur einen Schritt von meinem Bett entfernt, näher, als es der Anstand gebot. Der Saum ihrer weißen Schürze über dem schwarzen Kleid berührte die Decke. Selbst wenn ich mich hätte erheben wollen, wäre zwischen Bettkante und ihr dafür kein Platz gewesen. Seit meiner Ankunft charmierte sie und kommandierte mich zugleich herum, als wäre ich nicht nur ihr zahlender Gast, sondern zudem ihr Mündel. Sie wollte mir gefallen und genoss die Grenzüberschreitungen, was mir schon deshalb hochnotpeinlich war, weil sie vermutlich gut dreißig Jahre älter war als ich. In der besagten ersten Nacht hatte mich der ungewohnte, stark gewürzte Kornwodka umgetrieben. Da ich eine Aversion gegen Bettpfannen habe, suchte ich nachts mehrfach das Toilettenhäuschen auf. Zum Schlafen trug ich gewohnheitsgemäß nur eine weiße Leinenunterhose und hatte keinen Morgenmantel eingepackt. So tastete ich unter dem Sternenhimmel mit den nackten Füßen über das scharfkantige, feuchte Gras auf der Suche nach dem Abort hinter dem Haus. Dabei hatte ich eine Bewegung an den Vorhängen ihres Kammerfensters wahrgenommen und keinen Zweifel daran gehegt, dass Frau Bryl mich im Mondlicht beobachtete.
»Ich bin wach, danke. Und jetzt würde ich gerne aufstehen und mich ankleiden.«
»Excusez-moi«, rief Frau Bryl mit dem schmerzlichen Ausdruck missverstandener Selbstlosigkeit.
Sie behauptete mir gegenüber, eigentlich Bryl-Orekhowsky zu heißen und von einer wohlhabenden polnischen Adelsfamilie abzustammen. Ihr Mann, Offizier und ebenfalls von Stand, wäre aus dem Großen Krieg nicht heimgekommen, was sie als Wink des Schicksals empfunden habe, ihrem alten Leben voller Luxus ganz den Rücken zuzuwenden. Die Villa Bernstein in Nidden habe sie deshalb günstig erwerben können, weil das Haus einsam und allein auf der »falschen« Seite der Nehrung stand, nämlich auf der Ostseeseite gleich hinter den Schutzdünen. Für die allermeisten von weit her angereisten Kurgäste war das deutlich zu weitab vom »Schuss« und von den Dingen, die zu einer gelungenen Sommerfrische gehörten wie Restaurants, Bootsrundfahrten und malerisches Dorfleben. Wer hingegen, so wie ich, bereit war, auf solche Annehmlichkeiten in der Nähe zu verzichten, wurde mit günstigen Zimmerpreisen belohnt. Und den Kochkünsten und Geschichten von Frau Bryl. Je mehr Starka sie getrunken hatte, desto größer wurde der Familienschatz, den sie bei Nacht und Nebel aus Krakau gerettet und an einem geheimen Ort auf der Nehrung versteckt hatte, desto wohlklingender wurden die Namen derer, die im Hause ihrer Kindheit angeblich ein und aus gegangen waren, und desto polyglotter wurde die Erziehung, die sie genossen, und vielfältiger die Sprachen, die sie unter dem strengen Blick von Hauslehrern hatte erlernen müssen. Neben dem Französischen, Russischen und Litauischen selbstverständlich auch das Deutsche, das sie mit ihren Gästen zwar nötigenfalls spreche, es ansonsten jedoch nicht sonderlich schätze, schließlich hätten die Deutschen ihren Mann auf dem Gewissen. Tatsächlich hörte ich sie beim Kochen oder Backen eine Art von geheimnisvoll unverständlichem Deutsch sprechen, das hauptsächlich aus Wortbrocken mit bilabialen Affrikaten wie »Eintopf«, »Gugelhupf« und »Auflaupf« – so klang es tatsächlich aus ihrem Mund – bestand, was oft sehr komisch wirkte. Sie hatte eine beachtliche Bibliothek in einem Salon, den sie nur ihren bevorzugten Gästen vorführte und zur Nutzung überließ. Nicht ohne die Ermahnung, entnommene Bücher, jedes einzelne unersetzlich, wieder genau an der Stelle im Regal einzusortieren, wo sie nach dem Alphabet hingehörten. Sie sagte, sie hasse »confusion« in ihrer »Schatzkammer des Wissens«, und es mache sie verrückt, wenn sie ein bestimmtes Buch darin suche, und es sei nicht zu finden. Lesen sah ich sie allerdings nie. Bei den Büchern handelte es sich in erster Linie um polnische Ausgaben, aber es gab auch eine ansehnliche Zahl von Klassikern in französischer und russischer Sprache, ein paar wenige Werke nur auf Litauisch und unter letzteren selbstverständlich keine von Thomas Mann. Er war noch nicht ins Litauische übersetzt. Dies zu ändern war meine Mission. Und dafür brauchte ich den Segen des Autors.
Seufzend blieb sie in der Tür stehen. »Wenn Sie nicht trödeln, sind die Varškėčiai noch warm.«
Diese litauischen Quarkbällchen waren nur ein Grund, warum ich blieb und auch im Folgejahr wieder kam. Trotz des Schreckens, den Frau Bryl mir jeden Morgen bereitete, habe ich mich in der Villa Bernstein immer wohlgefühlt. Ich mochte dieses große, honiggelb gestrichene Haus mit der Vorlaube über dem Eingang, deren Stützen spielerisch zu Kolonnaden geformt waren. Und dann kam das Jahr, in dem ich mit den anderen Gästen nächtens vor den rauchenden Ruinen der Pension stand, und anschließend wurde im Dorf geflüstert und geraunt über Geisterkutschen, Sandhexen, Spione und einen verschwundenen Schatz. Aber dies ist eine andere Geschichte, auf die es sich für Sie zu warten lohnt. Ich werde sie gerne später erzählen, sollte es mir noch vergönnt sein.
Auch an diesem Tag blieb mein ungeschickter Annährungsversuch an den Dichter fruchtlos, und ich kehrte missmutig in die Pension zurück, wo mich Frau Bryl in dieser Stimmung am frühen Nachmittag in der Bibliothek sitzen sah. Sie stellte eine Tasse Tee vor mir ab, stemmte die Hände in die Hüften und sagte: »Wieder kein Glück bei Herrn Mann? Sie scheinen jemand zu sein, der die Flinte sehr schnell ins Korn wirft.«
»Davon kann keine Rede sein. Aber ich will den Mann ja nicht belästigen, indem ich mich den ganzen Tag vor seinem Haus herumtreibe.«
Frau Bryl, die den Ehrgeiz hatte, über alle Vorgänge im Dorf informiert zu sein, wusste zu berichten, dass Thomas Mann nur selten auswärts aß, nicht in den Dorfladen zum Einkaufen ging und bis auf Spaziergänge keine Ausflüge unternahm. Allerdings ging er gern ans Meer.
»Und vom Briefträger weiß ich, dass der Herr Nobelpreisträger sich extra einen Strandkorb hat liefern lassen, den niemand außer ihm benutzen darf. Er soll nicht weit von hier stehen. Warum gehen Sie heute Nachmittag nicht einmal am Strand entlang, vielleicht haben Sie dort mehr Glück.«
Ich folgte ihrem Vorschlag und lief kurz darauf am Strand in Richtung Südwesten. Der feine Sand der Nehrung sammelte sich in meinen Schuhen und Hosenaufschlägen, und der Wind zerrte an meinem Jackett. Der stetige Südwestwind verleiht der Brandung des Baltischen Meeres an dieser Stelle eine Großartigkeit, die an die Nordsee erinnert. Ich selbst bin aus Respekt vor dieser Brandung nie weiter als bis zu den Waden ins Wasser gegangen. Es ist mir außerdem viel zu kalt. Kinder rannten am Saum des Meeres vor den Wellenzungen davon. Bänke bunter Steine sammelten sich an der Wasserkante, und wenn die Wellen ans Ufer leckten, klang es, als würde ein Sack Murmeln ausgeschüttet. Ich blieb stehen, klopfte mir die Hose ab und krempelte die Aufschläge hoch. Einen der Myriaden bunten Steine – einen rot-grün marmorierten, ich weiß das deshalb so genau, weil der Stein neben dem Computer liegt, den mein Urenkel mir eingerichtet hat und auf dem ich dies schreibe – hob ich auf und ließ ihn in der linken Hand kreisen, um meine Nerven zu beruhigen. Würde ich hier und heute dem großen Dichter begegnen?
Vor mir machte ich einen einzelnen dunklen Punkt im strahlenden Weiß des sonnenbeschienenen Strandes aus. Als ich näher kam, wurde die Form des Strandkorbes erkennbar. Und aus dem Strandkorb staken Beine mit weißen Schuhen an ihrem Ende. Deren Besitzer wechselte das übergeschlagene Bein, ein Fuß wippte gleichmäßig, der andere suchte Stand im Sand. Der Strandkorb gehörte dem Mann, den meine Wirtin zuvor so forsch als »Beute« bezeichnet hatte.
Ich änderte meine Richtung und hielt mich an den Brandungssaum, um einen besseren Blick auf den Strandkorb zu bekommen. Der Dichter saß vornübergebeugt und schrieb etwas auf den Knien. Zwei blonde Jungen in Badekleidung liefen zu ihm, umkreisten den Strandkorb, kickten Sand und sprangen herum, um herauszufinden, ob dieser komische Mann mit Kapitänsmütze als Anregung für ihren nie ermüdenden Spieltrieb dienen konnte. Ich weiß noch, wie ich mich schämte beim Anblick der spielerischen Unbekümmertheit, mit der sich diese Kinder dem großen Mann näherten und um seine Aufmerksamkeit buhlten, während ich, ein gestandener Mann mit ernsthaften Absichten, sich schüchtern am Rande seines Dunstkreises herumdrückte.
Und dann hatten das Schicksal und der Wind ein Einsehen mit mir. Als der Dichter sich der frechen Aufführung der beiden Jungen zuwandte und dabei die Hand von den Blättern auf seinem Knie hob, lösten sich einige davon und wurden von einer Böe davongetragen. Die Kinder reagierten sofort auf das neue Spiel und rannten los, um sie einzufangen. Die Blätter tanzten durch die Luft, verteilten sich, legten sich für einen Moment sanft auf bunte Kiesel, nur um wieder hochgehoben und wild die Richtungen wechselnd weitergetragen zu werden. Ein Knabe von etwa fünf Jahren konnte die Richtung fast so schnell ändern wie das Blatt, das er jagte, und er kam ihm schon sehr nahe, aber ich war schneller. Und glücklicher. Denn es wurde mir geradewegs durch die Hosenbeine geweht. Der Junge musste vor mir bremsen, grub die Füße in den Sand und schaute mich, den Spielverderber, mit so viel Enttäuschung und Überraschung an, dass ich kurz überlegte, ihm das Blatt zu überlassen, besann mich jedoch eines Besseren. Diesen Windstoß des Schicksals würde ich nicht ungenutzt lassen. Ich machte kehrt, rannte dem Blatt Haken schlagend nach – auch ich war gut in Form –, holte es glücklich nach kurzer Strecke ein und warf mich darauf, sprang auf und erhaschte ein weiteres. Das dritte Blatt wollte rechts an mir vorbei, doch mit einem großen Ausfallschritt trat ich darauf und machte auch dieses dingfest. Der Knabe stand noch eine Sekunde, dann schien er das Spiel vergessen zu haben, drehte sich um und rannte zu den anderen Kindern ans Wasser. Ich klopfte mir den Sand von den Hosenbeinen und warf Thomas Mann dabei einen verstohlenen Blick zu.
Der Dichter hatte sich vom Strandkorb erhoben und die Jagdszenen beobachtet. Als ich im bescheidenen Triumph die Arme mit den aufgefangenen, zerknitterten Blättern hob, schlug er sich auf die Oberschenkel und klatschte dann in die Hände.
»Ganz vortrefflich!«, rief er, und mir ging das Herz auf.
Nicht nur würde sich die Vorstellung meinerseits nun von selbst ergeben, ich hatte meinem Helden einen Dienst erwiesen, geistesgegenwärtig und selbstlos. Doch so dankbar ich über die Gelegenheit war, so neugierig war ich auch darauf, was ich da für einen Fang gemacht hatte. Also blieb ich kurz stehen, legte mir die Blätter auf den Oberschenkel und gab vor, sie ein wenig glätten zu wollen.
In meinem Kopf wurde es so still wie in einem Filmtheater, wenn das Licht ausgeht, und meine Gedanken verdichteten sich wie eine Decke, unter der ich mich zurückzog, sodass das Rauschen der Brandung, das Schreien der Möwen und die Rufe der Kinder nicht mehr zu hören waren. Drei Sekunden. Mehr brauchte ich nicht, um mir alles zu merken. Denn es waren ja nur drei Blätter.
Seit meinem ersten Tag an der Volksschule wusste ich von der Existenz dieser Gedankendecke, unter die ich schlüpfen konnte, erkannte ich die besondere Begabung, die mir zu eigen war. Lange hatte ich keinen Namen dafür, ich verstand nur, dass ich mich mit großer Klarheit und in kleinsten Details an Dinge erinnern konnte. Selbst dann, wenn ich nur einen kurzen Blick darauf geworfen hatte. Von der Tafel schrieb ich bloß dann ab, wenn es von mir verlangt wurde. Dabei musste ich lediglich für einen Augenblick den Kopf heben, um mir alles, was darauf stand, zu merken. Nicht nur, was dort stand, sondern auch, an welcher Stelle, in welcher Schrift, auf welcher Linie – bis hin zu Unregelmäßigkeiten des Striches, wenn die Kreide beim Schwung eines G oder eines J unter dem Druck der Lehrerhand abgebrochen war. Diese Fähigkeit, die ich meistenteils bewusst anwenden, die sich aber in Momenten besonderer Erregung auch verselbstständigen konnte, verunsicherte mich zunächst. Zudem merkte ich schnell, dass mir meine Begabung nicht dabei half, Dinge zu verstehen. Mathematische Tafelbilder blieben für mich unverständlich. Aber das war nicht wichtig, denn ich brauchte sie im Leben nie. In der Literatur hingegen brillierte ich. Die Aufnahmefähigkeit meines Gehirns schien unbegrenzt. Jedes Buch, das ich las, kannte ich nach der Lektüre auswendig. Und wie oft war es in meinem Leben auf Reisen nützlich, nur einen schnellen Blick auf den Stadtplan werfen zu müssen, um mich an einem fremden Ort mühelos zurechtzufinden, obwohl ich einen furchtbar schlechten Orientierungssinn habe.
Leider ist für diese Art visueller Gedächtnisleistung, wie mir mein Arzt vor einigen Wochen mitteilte, ein gesunder Glukosestoffwechsel im Hirn genauso Voraussetzung wie für das Kurzzeitgedächtnis generell. Er sagte noch viele andere Dinge und gab mir ein Diagnoseblatt. Als ich einen Blick darauf warf, die Stimme des Arztes trotzdem noch hörte genauso wie das Summen der Neonlampen über mir, ich also die Gedankendecke nicht mehr über mich ziehen konnte, da wusste ich, dass mich die Gabe verlassen hatte. Und ich war erleichtert. Die Erinnerung an die wichtigste Zeit meines Lebens hat mich hingegen auch im einhundertundersten Jahr nicht im Stich gelassen. Das müssen Sie mir einfach glauben. Ein Trost in meiner gegenwärtig ereignislosen Existenz.
Ich ging dem Dichter also unsicher entgegen, weiche Knie auf weichem Sand. Einmal war ich ihm schon begegnet, wie bereits gesagt, allerdings hatte er damals gesessen. Nun da er vor mir stand, bemerkte ich, wie groß er eigentlich war. Thomas Mann überragte mich um einen halben Kopf, wirkte aber noch riesiger wegen seiner kerzengeraden Haltung, wohingegen ich den Kopf zwischen die Schultern zog. Er hob die linke Augenbraue und senkte gleichzeitig das Kinn, so als wäre ihm jetzt gerade etwas eingefallen. Seine Nase hatte die Prominenz eines Schattenwerfers an einer Sonnenuhr, die auf vier Uhr stand. Wie sehr ich mir in jenem Moment wünschte, dass er mich erkennen würde.
Und da sagte er es auch schon: »Sind wir uns nicht schon einmal begegnet?« Mit diesen Worten streckte er die Hand nach den Blättern aus, faltete sie zusammen und schob sie in die tiefe rechte Tasche seines Bademantels. Ich blickte ihm in die listigen Augen, während er ein flaches, silbernes Zigarettenetui aus der anderen Tasche des Bademantels hervorholte. Er klappte es auf, entnahm ihm eine Zigarette, klopfte den Tabak auf dem Deckel fest, steckte sie sich in den Mundwinkel und wollte sie mit einem silbernen Feuerzeug entzünden, was Ostseeböen verhinderten. Mir fiel auf, wie lang und dünn seine Finger waren. Ich nahm ihm das Feuerzeug ab, sodass er das Gesicht mit beiden Händen abschirmen konnte, während ich ihm Feuer gab. »Danke«, sagte er, ließ das Dupont wieder in die Seitentasche gleiten, blies den Rauch des ersten Zuges aus und blickte aufs Meer. »Meine Frau zeiht mich oft der Nachlässigkeit im Umgang mit Papieren. Da hätte sie sich wieder entrüsten können.«
Mehr als achtzig Jahre später steht dieses Bild einem Photoabzug im Entwicklerbad gleich immer deutlicher und kontrastreicher vor meinem inneren Auge. Ich will an dieser Stelle kurz innehalten, denn ich muss Ihnen dieses Bild und diesen Mann, diesen Thomas Mann, näher beschreiben, damit Sie verstehen, warum ich jetzt nicht anders kann, als zu lächeln: Er hat sich allem Anschein nach an diesem Tag nicht rasiert, denn die Wangen sind voller ungleichmäßiger Stoppeln, und der Schnurrbart wächst ihm über die Oberlippe. Die kurzen Haare sind ungekämmt und zerzaust, als wären sie im Meer nass und anschließend achtlos trocken gerubbelt worden. Vielleicht war er tatsächlich baden, denn er trägt einen blau-grau karierten Frotteebademantel, der selbst dem großen Mann viel zu groß ist. Der Mantel steht offen, der Gürtel hängt nur noch in einer Schlaufe und schleift über den Boden, und unter dem Mantel erkennen wir einen schwarzen Badeanzug, einen Einteiler mit weißen Nähten. Die Beine sind nackt bis auf ein Paar himmelblaue Strümpfe mit Strumpfhaltern. Die Füße stecken in strahlend weißen Tennisschuhen, die so leicht und schlank und geschmeidig aussehen, als wären sie aus feinstem Antilopenleder gefertigt. Die Augen hinter der Nickelbrille sind freundlich, aber ich blicke nur auf die Zigarette in seinem Mundwinkel, die wippt und von der Asche bröckelt, wenn er spricht.
Heute kommt es mir so vor, als wäre ich damals einer der wenigen Menschen gewesen, Männer oder Frauen, der nicht rauchte. Alle rauchten. Die Damen mit Spitze und die Herren mit gelblichen Fingerspitzen. Aber es gab noch kein Image des Rauchens. Noch niemand hatte Humphrey Bogart auf der Leinwand gesehen, und alle anderen großen Ikonen des Rauchens, von Marlene Dietrich bis zu Steve McQueen, sollten erst noch folgen. Heute raucht kaum noch jemand, aber jeder, der bei Trost ist, würde sofort wieder zu einer Zigarette greifen, wenn ihm Lauren Bacall mit einem Streichholz Feuer gäbe. Und auch ich hätte mir an Ort und Stelle diese Unsitte zu eigen gemacht, wenn mir der große Dichter eine Zigarette angeboten hätte. Ich wollte nicht nur seinen Roman übersetzen. Ich wollte sein wie er. Mein Urenkel Jonas würde sagen: Thomas Mann war verdammt cool.
Bis auf die Strumpfhalter.
»Dass Sie sich an mich erinnern, ehrt mich, Herr Mann.«
Der Dichter konnte sich jedes Gesicht merken, aber keinerlei Namen, wie ich noch herausfinden sollte.
»Darf ich mich Ihnen noch einmal in aller Form vorstellen? Žydrūnas Miuleris aus Kaunas, Student und Übersetzer aus dem Litauischen. Ich hatte seinerzeit in Königsberg den Wunsch an Sie herangetragen, Sie übersetzen zu dürfen … also zunächst nur die Buddenbrooks, um genau zu sein.«
»Richtig, richtig. Jetzt, wo Sie es sagen. Mule heißen Sie?« Die Augenbraue ging wieder hoch. Aus seinem Munde klang mein Name wie ein amerikanisches Maultier.
»Miuleris. Das ist im Grunde die litauische Version von Müller.«
Thomas Mann nickte, zog an seiner Alva und warf sie dann in den Sand. »Sehen Sie … Müller, darin liegt für mich die Schwierigkeit. Würden Sie ins Englische übertragen, könnte ich mir selbst ein Bild von Ihrer Arbeit machen, weil ich der Sprache mächtig bin. Würden Sie ins Schwedische übersetzen oder ins Italienische, so hätte mein Verleger sicher einen Gewährsmann im jeweiligen Land. Doch ins Litauische?« Er entzündete eine frische Zigarette. »Eine sehr kleine Sprache, wie mir scheint. Gibt es überhaupt Verlage in Litauen?«
»O ja, Herr Mann. Nicht viele, aber kleine und feine. Sehen Sie, in so kleinen Ländern laufen die Dinge etwas anders als in den von Ihnen genannten mit einer großen literarischen Tradition. Es ist nicht unüblich, dass Übersetzer als Vermittler fungieren, sozusagen als Agenten der Literatur, und Verlegern eine fertige Arbeit anbieten. Zumal mit Ihrem Segen, Herr Mann. Wir sind eine sehr alte Kulturnation, möchte ich nicht ohne Stolz sagen, einst das größte Land in Europa. Ihre Werke würden in Litauen vielfach gelesen werden – müssen gelesen werden!«
Mit einem Male erfüllten Stimmen die Luft. Ein Grüppchen Jugendlicher kam im Laufschritt, sportlich alert und mit lebhaftem Gesang den Strand herauf. Kommandos wurden gerufen und im Chor beantwortet. Ein weiterer Ruf, dann bildeten die jungen Männer eine Formation, nur um plötzlich auszuschwärmen und mit militärischer Präzision Aufstellung für eine Art Wehrspiel zu nehmen. Der heilige Ernst in den Gesichtern, die fühlbare Mission, mit der diese jungen Menschen erfüllt waren, ließen mich erschaudern. Nur ein Jahr später sollte an den Badehosen dieser Jungen stolz das völkische Emblem prangen.
Einer im Trupp gab die Kommandos, war seiner Stimme nach der Älteste und trug sein Hemd stramm unter die glänzende Koppel geschoben. Er erblickte den Dichter vor dem Strandkorb, erteilte seiner Schar einen scharfen Befehl, sodass die sich rührten und aus der Formation fielen. Dann näherte er sich Thomas Mann und blieb als Silhouette im Gegenlicht der Nachmittagssonne stehen. Eine Schirmmütze verdeckte das Gesicht und verlieh seinem Kopf eine nahezu dreieckige Form. Ein Bein vorgestreckt, Hände in den Hüften, stellte er sich in Pose und warf mit einer merkwürdig herrischen Geste den Kopf zurück, bevor er rief: »Herr Thomas Mann, nehme ich an?«
»Derselbe.«
»Darf ich Ihnen ganz persönlich meine Bewunderung und meinen Dank ausdrücken. Ihr Werk und Wirken strahlt weit über die Heimat hinaus«, verkündete er. »Sie sind ein leuchtendes Beispiel dafür, wie hohe Kunst, Volk und Nation eine überlegene Verbindung eingehen, dank deren Deutschland aus der Schmach von Versailles gestärkt hervorgehen wird. Wahrlich: Deutschland, Deutschland über alles!«
Aus meiner Position von der Seite betrachtet meinte ich dem Dichter seinen Widerwillen gegen die pathetische Lobhudelei ansehen zu können. Wie er sich versteifte und das Kinn senkte, wie er die Hände noch tiefer in die Bademanteltaschen schob, als wollte er einen drohenden Handschlag vorauseilend verweigern wollen. Eine seiner Augenbrauen wanderte wieder die Stirn hinauf, während er über eine Erwiderung nachzudenken schien. »Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen. Jedoch fühle ich mich nicht Volk und Nation, sondern nur der Kunst und der europäischen Bildung verpflichtet.«
Der eben noch stramme Mensch reagierte, als hätte ihm ein Vogel auf den gestärkten Hemdkragen geschissen. Die Körperspannung löste sich auf in einem Moment des Konsternierens, bevor er sich in ein geübtes Ritual rettete, die Brust herausdrückte, den Kopf wieder zurückwarf und den Arm hob zum Deutschen Gruß: »Heil!« Damit wandte er sich ab und ging steif zurück zu seinen Leuten.
Ich hörte den Dichter sagen: »Jaja, du mich auch.« Er wandte sich dem Strandkorb zu. »So, und nun muss ich mich wieder an die Arbeit machen.«
»Wenn Sie mir erlauben, noch einmal auf die Übersetzung zu sprechen zu kommen«, sagte ich schnell. Und in der Angst, dass der abrupte Themenwechsel schon das Ende meiner Bemühungen bedeuten könnte, wurde ich Opfer meiner Eitelkeit, als ich hinzufügte: »Sie können mir vertrauen. Unnötig, zu erwähnen, dass ich ein großer Bewunderer Ihres Werkes bin. Ich möchte behaupten, ich kenne es beinahe auswendig.«
»Auswendig, sagen Sie? Ha! Ja, wie das denn, Herr Müller?« Er hatte den Kopf zur Seite geneigt und sah mich über die Gläser seiner Brille hinweg amüsiert an. »Sie könnten mir also beispielsweise den ersten Satz im dritten Kapitel des Tonio Kröger hier und jetzt zitieren?« Hörbar eine gutmütig spöttische Herausforderung, die ich trotzdem annahm.
Ich stellte mich aufrecht, schloss die Augen und zog für einen Moment die Gedankendecke über mich. »›Er ging den Weg, den er gehen musste, ein wenig nachlässig und ungleichmäßig, vor sich hin pfeifend, mit seitwärts geneigtem Kopfe ins Weite blickend, und wenn er irreging, so geschah es, weil es für etliche einen richtigen Weg überhaupt nicht gibt.‹«
Als ich die Augen öffnete, hatte er einen merkwürdigen Ausdruck angenommen. Der Mund stand ihm offen, und die Zigarette drohte herauszufallen. Und in seinem Blick las ich zum einen Wohlwollen, aber auch eine mitleidige Verwirrung, sodass ich schon befürchtete, er könnte mich für verrückt halten.
»Nur ein Glückstreffer«, sagte ich.
»Soso.« Thomas Mann wischte etwas Sand vom Sitzkissen des Strandkorbes, setzte sich dann wieder in den Schatten und streckte die Beine aus. »Zitieren ist eine Form der Dankbarkeit. Ich sag Ihnen was, junger Mann. Sie haben mich neugierig gemacht, und ich würde mich gern ein wenig länger mit Ihnen unterhalten. Warum begleiten Sie mich nicht auf einem Spaziergang? Sind Sie Frühaufsteher? Dann finden Sie sich morgen früh um sieben bei unserem Sommerhaus ein. Ich empfehle solides Schuhwerk.«
Ich konnte mein Glück kaum fassen. Der Wind hatte mir diese einmalige Gelegenheit direkt vor die Füße geweht, und meine schamlose Angeberei hatte ein Übriges getan. Ich würde Zeit mit dem Bewunderten verbringen können. Nur er und ich und die wilden Elche des Nehrungswaldes. Ich glaube, ich nickte nur ergeben und ging ein paar Schritte rückwärts wie am Ende einer Papstaudienz, wandte mich ab mit hochrotem Gesicht und wollte meinen Triumph genießen, als er mich noch einmal rief. »Herr Müller?«
Ich drehte mich um.
»Ich muss gestehen, dass Sie mich in Erstaunen versetzt haben.« Er hielt die geretteten Blätter hoch. »Kann ich ruhigen Gewissens davon ausgehen, dass Sie den Inhalt von dem hier nicht auch auswendig gelernt haben?«
Er sagte es mit einem Augenzwinkern, das mich vollkommen überrumpelte. »Von dem kurzen Blick darauf? Sie scherzen, Herr Mann«, sagte ich mit einem albernen Lachen. Eine Notlüge aus dem Moment heraus, die mir noch leidtun würde.
KAPITEL ZWEI
Tumult
Ich war bestens gelaunt und überlegte, zur Feier des Tages in einem Gasthaus im Ort zu Abend zu essen. Doch angesichts meiner bescheidenen finanziellen Verhältnisse und der Tatsache, dass das Abendessen im Preis des Logis bei Frau Bryl inkludiert war, konnte ich mich nicht zu dieser Extravaganz durchringen. Ich aß also stattdessen auf der Veranda der Pension mit Blick nach Westen auf einen Himmel, in dem das Blau mit sinkender Sonne kräftiger zu leuchten begann. Pünktlich um sechs hatte meine Wirtin aufgetragen. Sie hatte zur Feier der erfolgreich angebahnten Begegnung mit Thomas Mann Zeppeline zubereitet. Die mit würzigem Fleisch gefüllten Kartoffelklöße lagen wie knusprige Luftschiffe in einer kräftigen Soße aus in Butter ausgelassenem Speck mit Smetana. Für jede Litauerin und jeden Litauer müssen Cepelinai stets genauso schmecken wie in ihrer Kindheit. Als Mutter am Sonntagvormittag mit der Zubereitung beschäftigt gewesen war und alle bei Tisch nur darauf warteten, dass sie mit von der Herdhitze erröteten Wangen, die Schüssel in der Hand, aus der Küche trat. Nichts vermag so zuverlässig unsere sentimentale Seite zum Vorschein zu bringen wie der Gedanke an die Lieblingsspeise. Ich fand jedenfalls an diesem Abend, dass Frau Bryls Cepelinai dem Geschmack meiner Kindheit schon sehr nahekamen.
Meine Ausgabe der Buddenbrooks, die Kladde mit den Übersetzungsnotizen und den Montblanc aus dem Besitz meines Vaters hatte ich neben den Teller gelegt und blätterte im Buch nach der Stelle, die ich zuletzt geprüft hatte. Selbstverständlich hatte ich nicht vor, zu essen und wie nebenbei an der anspruchsvollen Übersetzung zu arbeiten. Dies war eine Vorarbeit, eine mir im höchsten Maße angenehme spielerische Annäherung an die Stolpersteine eines Textes, die ich mir zur Angewohnheit gemacht hatte. Ich las, blieb an Worten hängen, für die ich Entsprechungen suchte, spielte damit herum, fand und untersuchte Varianten, sagte mir die Worte laut vor und schrieb mir dasjenige, das mir am besten gefiel, mit einem Vermerk in die Kladde. Doch das Spiel machte mir nicht so viel Freude wie sonst, denn ich war durch die Ereignisse am Strand und durch die frischen Bilder in meinem Kopf abgelenkt. Die Bilder der geschriebenen Seiten, die ich für Thomas Mann gerettet hatte. Drei Blätter, bedeckt mit seiner disziplinierten Handschrift, steil, eng, mit gleichmäßig nach rechts geneigten Unterlängen und Buchstaben, die ein Muster von Häkchen bildeten. Ich konnte das Geschriebene nicht ohne Weiteres lesen, ich musste es mit Zeit und Muße entziffern.
Doch eigentlich verbot mir das der Anstand. Denn der Inhalt der Blätter war selbstredend privat. Man liest ja auch nicht anderer Leute Briefe, nur weil die Gelegenheit günstig ist. Überdies hatte ich dem großen Dichter versichert, den Inhalt nicht zu kennen.
Ich hoffe, Sie nehmen mir ab, dass ich keinesfalls glaube, Einfluss auf die Geschichte genommen zu haben. Obwohl wir alle durch unsere Handlungen und Entscheidungen, durch die schiere Tatsache unseres Daseins dem Lauf der Dinge kaum wahrnehmbare Schubser in die eine oder andere Richtung geben. Wohlgemerkt hätte nicht Thomas Manns Leben eine andere Wendung genommen, wenn ich mich damals anders entschieden und die Blätter ignoriert hätte, meines hingegen schon.
Wie kann man etwas, das man im Kopf hat, wieder wegdenken? Vielleicht, indem man es aus dem Kopf herausholt, aufschreibt, weglegt und dann vergessen kann. Ich weiß, dass ich mir den Vertrauensbruch schönrede. Und doch glaubte ich, dem Dichter womöglich sogar einen Dienst zu erweisen, hatte ich doch gerade miterlebt, wie fahrlässig er mit seinen Notizen umging, wie leicht ihm der Wind Gedanken aus der Hand reißen konnte. Ich würde also sein Archivar sein, schlug eine neue Seite in meiner Kladde auf, zog mir die Gedankendecke über den Kopf und begann, das Schriftbild sorgfältig bis ins Detail aus meinem Gedächtnis zu faksimilieren, während ich nebenbei die Zeppeline aß. Ich tat es ohne Eile und ohne inhaltliches Verständnis. Entschlüsseln würde ich das Aufgeschriebene später.
Ich hatte gerade die letzte Zeile rekonstruiert und den letzten Bissen heruntergeschluckt, als ich hinter mir eine Stimme vernahm: »Haben Sie bereits mit der Übersetzung der Buddenbrooks begonnen?«
Ich schrak dermaßen zusammen, dass meine Hand, die auf der Kladdenseite gelegen hatte, sich verkrampfte und das Papier darunter zerknitterte.
»Frau Bryl, warum müssen Sie mich immerzu erschrecken?« Wie lange hatte sie mir schon über die Schulter geschaut?
»Herr Miuleris, warum sind Sie auch so furchtbar schreckhaft?« Sie räumte den Teller ab. »Haben Ihnen die Cepelinai geschmeckt?«
»Hervorragend«, sagte ich wahrheitsgemäß.
»Erstaunlich, dass Sie sich überhaupt an Ihre Mahlzeit erinnern können, wo Sie doch die ganze Zeit die Nase nicht in den Teller, sondern in Ihre Arbeit gesteckt haben.«
»Beobachten Sie mich etwa?«
Mein Misstrauen gegenüber Frau Bryl mag Ihnen übertrieben erscheinen, aber zu diesem Zeitpunkt der Geschichte begann ich bereits damit, mir Gedanken darüber zu machen, wem ich trauen konnte und wem nicht.
»Selbstverständlich beobachte ich Sie!« Sie wirkte gekränkt. »Eine gute Wirtin hat ihre Gäste immer im Blick.«
Man musste ihr zugutehalten, dass sie ihre Sache als Pensionswirtin anständig machte. Das überraschende Hereinplatzen in Gästezimmer und die an Übergriffigkeit grenzende Neugierde standen aus ihrer Sicht nicht im Geringsten im Widerspruch zu den guten Absichten.
»Kann ich Sie zu einem Digestif überreden? Einen Williams vielleicht? Oder einen schönen Tresterbrand?«
»Da muss ich leider dankend ablehnen.« Ich nahm Füller, Buch und Kladde und erhob mich. »Ich habe beschlossen, den heutigen Tag mit einem Glas Bier bei Blode ausklingen zu lassen.«
»Ganz wie Sie wünschen. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich spätestens um elf Uhr das Haus abschließe und zu Bett gehe. Kommen Sie nicht auf die Idee, zur Unzeit an mein Schlafzimmerfenster zu klopfen.«
Zurück in meiner Kammer, sah ich mich um. Die Einrichtung bestand aus Bett, Stuhl, Tisch und Kommode mit Waschschüssel. Das kleine Fenster bot mir einen Blick auf den Wald, ein Zimmer mit Dünenblick war mir zu teuer gewesen. Ich konnte beim besten Willen keinen Ort entdecken, an dem meine Kladde vor den neugierigen Fingern und Blicken meiner Wirtin sicher gewesen wäre. Ich setzte mich an den Tisch und begann, die faksimilierten Seiten nahe der Bindung vorsichtig herauszutrennen. Dann schrieb ich – ich weiß nicht, warum, vielleicht einer antrainierten Ordnung halber – »Thomas Mann, 3.VIII.30« klein in die obere rechte Ecke jedes Blattes, faltete sie zusammen und schob sie in die Innentasche meines Jacketts.
Frohgemut machte ich mich auf den Weg zum Gasthaus Blode, denn ich hatte etwas zu feiern. Ich, Žydrūnas Miuleris, Übersetzer aus Vilnius, war eingeladen, am nächsten Tag mit dem Meister spazieren zu gehen. Eine solche Entwicklung der Dinge hätte ich mir niemals träumen lassen. Sein Interesse an mir steigerte mein Selbstwertgefühl erheblich, und ich hielt es nicht für unwahrscheinlich, dass ich den Abend mit einem Glas zu viel begehen könnte. So oder so, am Morgen zur vereinbarten Stunde wäre ich bereit, Seit an Seit mit dem Dichter durch den Wald zu wandern.
Es war noch nicht acht Uhr, und ich lief mit der tief stehenden Sonne im Rücken. Von meiner Pension auf der Meerseite der Nehrung konnte ich über anderthalb Kilometer durch den dichten Laubwald auf direktem Weg das Gasthaus Blode auf der Haffseite ansteuern. Zunächst stetig bergauf, bis ich den Dünenkamm erreicht hatte, danach bis ins Dorf sanft wieder bergab. Im Wald begegnete ich dem Ehepaar Mathies aus Stralsund, die wie ich in Frau Bryls Pension logierten. Sie grüßten freundlich und erzählten kurz und angeregt von ihrem Abendessen bei Blode. Es sei ihnen allerdings etwas zu laut geworden, als »die Herren Künstler und Schöngeister« gekommen seien – wie Herr Mathies bemerkte. Das Gasthaus Blode war Treffpunkt für Mitglieder der Künstlerkolonie von Nidden, die illustren Gäste tranken viel und neigten zum laustarken Diskutieren und Politisieren. Nun, die Mathiesens würden sich, wie sie sagten, den Abend nicht verderben lassen, denn man sei auf dem Weg zum Strand, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Frau Mathies zog ihren Gatten am Arm, und der sagte noch: »Dort am Strand sollten diese Maler den Farben der Natur nacheifern, statt am Stammtisch Reden gegen Deutschland zu schwingen.«
Als ich mich zehn Minuten später dem Gasthaus näherte, war es schon so dämmrig, dass mir das warme Licht aus den Fenstern des großzügig verglasten Gastraumes die letzten Meter des Weges wies. Durch die Scheiben konnte ich sehen, dass die meisten Tische besetzt waren.
Damals war Nidden ein verträumtes Fischerdorf mit nur ein paar Hundert Einwohnern. Es gab fünf Gasthöfe, doch keiner lag so malerisch wie das Gasthaus des Förderers der Künste Hermann Blode: nur einen Steinwurf vom Ufer entfernt mit einem weiten Blick auf das stille Wasser des Haffs. Bei Blode saßen während der Saison zu jeder Tageszeit neben Familien in der Sommerfrische und Kurgästen Künstler aus Königsberg, Dresden und Berlin, die, von der Reinheit der Natur angelockt, auf der Nehrung das »Authentische« suchten und auf ihren Paletten die unendlich scheinenden Schattierungen von Blau mischten für Kornblumen, leuchtende Himmel, dunkles Haff und die Windbretter an den Mastspitzen der Kurenkähne. Vor vielen Jahren, als ich dank der neuen Freiheit noch reisen konnte und wollte, stand ich in einem Museum in Málaga vor einem Bild, das ein »Haus auf der Kurischen Nehrung« zeigte, und da waren sie wieder, alle diese Nuancen von Blau und noch viel mehr in dem Werk, das der Künstler mit kurzen, unruhigen Pinselstrichen gemalt hatte. Und ich musste wieder einmal an diesen schicksalhaften Abend bei Blode denken.
Als ich die Tür zum Gasthaus aufstieß, wäre ich fast mit einem Mädchen zusammengestoßen, das mit einem Tablett voller Gläser vom Ausschank kam. Insgeheim hatte ich gehofft, dass ich ihr begegnen würde.
»Zydrūnėlis!«, rief Dalia erfreut aus, und ich lächelte über das ganze Gesicht, weil sie mich so zutraulich auf Litauisch »kleiner Žydrūnas« genannt hatte.
An dieser Stelle möchte ich unbedingt betonen, dass ich entgegen anderslautenden Gerüchten, die später im Dorf die Runde machen sollten, nicht ihretwegen nach Nidden gekommen war. Dalia und ich kannten uns aus dem Studium. Ich mochte sie gern, seit wir in der Bibliothek unter dem Dach der Vytautas-Magnus-Universität von Kaunas gemeinsam an einem Katheder gesessen und uns gegenseitig bei lateinischen Deklinationen geholfen hatten. Dabei wehrte sie auf humorvolle Art einen ungeschickten Versuch von mir ab, sie zu küssen. Seither war ich entschieden verliebt in sie. Dalia war hilfsbereit und ehrlich, und ich bewunderte ihren Tatendrang. Sie hatte an einer Studentenbühne geschauspielert und setzte sich als Mitglied im Jugendverband Ateitininkai für die Zukunft junger Menschen ein. Sie lachte gern und hatte Pläne, und trotzdem konnte sie gut mit dem Gedanken leben, dass alles immer anders kommen konnte.
Ich wusste, dass sie während der Saison in Nidden Geld verdiente, und ich will gern zugeben, dass mich die Aussicht auf ein Wiedersehen mit dem lebenslustigen, blonden Mädchen freudig stimmte. Dass der Dichter sein Sommerhaus ausgerechnet an Dalias Arbeitsort gebaut hatte, war eine wahrhaft glückliche Fügung. So kam zu meiner ersten Mission – den Dichter für die Übersetzung auf meine Seite zu ziehen – unverhofft noch eine zweite hinzu: Ich wollte gemeinsam mit Dalia bei Sonnenuntergang am Strand spazieren gehen.
»Warte, Dalia«, sagte ich, und sie hielt inne, obwohl sie die Tür zum Gastraum mit der Schuler schon halb aufgestoßen hatte, das runde Gesicht allerliebst gerötet von fieberhafter Betriebsamkeit, aber die hellen, blauen Augen gespannt auf mich gerichtet, während sie sich Haare aus dem Gesicht pustete.
»Nun, ich habe mich gefragt, ob du es für sehr unangebracht hieltest, wenn ich dich fragte, ob du und ich, günstigenfalls an einem deiner freien Abende und wenn das Wetter es erlaubt …«
»Zydrūnėlis, das Tablett wird mir schwer.«
»Natürlich! Wie dumm von mir, ich halte dich von der Arbeit ab.«
»Komm mit«, sagte sie.
Ich folgte Dalia durch den Gastraum nach, dessen Wände voller Gemälde hingen, auf denen Kurenkähne, Dünen und Fischerhäuser zu sehen waren. Auf der überdachten Veranda mit dem Blick über das Haff saßen in der Restwärme des Sommertages von Bier und deftigem Essen erhitzte Menschen und erfüllten die Luft mit Stimmengewirr und Zigarettenqualm. Warm strahlte das Licht von den Petroleumlampen auf den Tischen. Am Rande der Veranda blieb Dalia hüftschwingend stehen und rief die Bestellungen für die drei Herren auf, die an dem dortigen Tisch saßen. Zwei der Herren waren ins Gespräch vertieft und sahen nur kurz auf. Der dritte im Bunde, mir gegenübersitzend, wirkte etwas verloren. Umso mehr freute er sich allem Anschein nach, mich in Dalias Schlepptau zu sehen.
»Ja, da schau her, was bringst du uns denn da, Dalia?«, rief er zur Begrüßung mit einem angenehm weichen Zungenschlag, den ich spontan im süddeutschen Raum verortete.
»Bier und nette Gesellschaft«, gab Dalia zur Antwort und schenkte mir einen lächelnden Seitenblick. Als sie ein Glas vor meinem Gegenüber abstellte, legte der ihr die Hand auf den Unterarm, und sie verzog das Gesicht, konnte sich aber nicht gegen die Berührung wehren, weil sie beide Hände voll hatte. »Lassen Sie das, Herr Pfaffenkogel.«
Sein rundliches, vom Alkohol gerötetes Gesicht strahlte ungeniert. »Herrje! Gestern war ich noch der Rudi, und heute ist Berühren mit den Pfoten schon verboten? Dabei weiß unsere Dalia die schönen Künste doch zu schätzen«, rief er plump in die Runde, »auch wenn sie sich manchmal ziert.«
Dalia drehte dem Mann den Rücken zu. »Für dich habe ich auch ein Bier übrig«, sagte sie zu mir und deutete auf die beiden freien Stühle am Tisch. »Setz dich. Und am besten bringe ich gleich noch eine Runde, dann haben die Herren etwas, an dem sie sich festhalten können.«
Ich nickte zur Begrüßung freundlich in die Runde, zog mir einen Stuhl heran und setzte mich. Ich spürte die Kühle des Glases an meinen Lippen, noch bevor sie es berührten.
»Nicht doch! Wenn Sie an diesem Tisch sitzen wollen, müssen Sie sich vorstellen und mit jedem hier anstoßen.«
Das verstanden die anderen Herren als Aufforderung, nach ihren Gläsern zu greifen und mich anzusehen. Ich erwiderte die Blicke nacheinander. »Žydrūnas Miuleris ist mein Name.«
Die anderen nannten die ihren, Gläser klirrten, der erste Schluck war eine Lust.