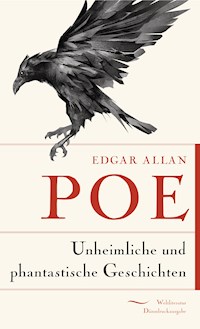
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Anaconda Weltliteratur Dünndruckausgabe
- Sprache: Deutsch
Edgar Allan Poe war der unübertroffene Meister des Unheimlichen, mit messerscharfer Feder sezierte er die Nachtseite der menschlichen Seele. Der Amerikaner schrieb Weltliteratur im wahrsten Sinn des Wortes: Seine Geschichten gingen um die ganze Welt und befruchteten zahllose Autoren und ganze literarische Genres. Poe, der nur 41 Jahre alt wurde, war in geradezu unheimlicher Weise produktiv. Auf über 1600 Seiten sind hier die wichtigsten Geschichten versammelt, in denen es schaurig und phantastisch zugeht, alle berühmten Klassiker ebenso wie wenig bekannte Wunderstücke und gehobene Schätze.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1908
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Edgar Allan Poe
Unheimlicheund phantastischeGeschichten
Aus dem Amerikanischenvon Wolf Durian, Gisela Etzel, Marie Ewers,Emmy Keller und Karl Lerbs
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 Anaconda Verlag GmbH, KölnEin Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbHAlle Rechte vorbehalten.Umschlagmotiv: flying black crow on a white background,shutterstock.com / KHIUSUmschlaggestaltung: www.katjaholst.deSatz und Layout: www.paque.de
ISBN [email protected]
Inhalt
Metzengerstein
Der Duc de l’Omelette
Eine Geschichte aus Jerusalem
Der verlorene Atem
Bon-Bon
Das Manuskript in der Flasche
Das Stelldichein
Berenice
Morella
Der Löwe
Das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfaall
König Pest
Schatten
Vier Tiere in einem
Die denkwürdigen Erlebnisse des Artur Gordon Pym
Eine Fopperei
Schweigen
Ligeia
Wie man einen Blackwood-Artikel schreibt
Ein furchtbares Erlebnis
Der Teufel im Glockenstuhl
Der Mann, der aufgerieben worden war
Der Untergang des Hauses Usher
William Wilson
Das Gespräch zwischen Eiros und Charmion
Warum der kleine Franzose die Hand in der Schlinge trägt
Das Tagebuch des Julius Rodman
Der Geschäftsmann
Der Mann der Menge
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Hinab in den Maelström
Die Insel der Fee
Das Zwiegespräch zwischen Monos und Una
Eleonora
Verwette niemals dem Teufel deinen Kopf
Drei Sonntage in einer Woche
Das ovale Porträt
Die Maske des Roten Todes
Das Geheimnis der Marie Rogêt
Wassergrube und Pendel
Das schwatzende Herz
Der Goldkäfer
Die schwarze Katze
Über den Schwindel als Wissenschaft
Die Brille
Eine Erzählung aus den Ragged Mountains
Der Lügenballon
Lebendig begraben
Eine mesmeristische Offenbarung
Die längliche Kiste
Der Engel des Sonderbaren
»Du bist der Mann«
Des wohlachtbaren Mr Thingum Bob, früheren Herausgeber der »Blechschmiede« literarischer Werdegang
Der entwendete Brief
Die 1002. Nacht der Scheherazade
Unterredung mit einer Mumie
Die Schöpferkraft der Worte
Der Teufel der Verkehrtheit
Das System des Dr. Teer und Prof. Feder
Die Tatsachen im Fall Waldemar
Die Sphinx
Das Fass Amontillado
Der Herrschaftssitz Arnheim
Mellonta Tauta
Hopp-Frosch
Von Kempelen und seine Entdeckung
Der ver-x-te Artikel
Landors Landhaus
Quellenverzeichnis
Metzengerstein
Pestis eram vivus – moriens tua mors ero.
MARTIN LUTHER
Schrecken und Verhängnis stampfen dahin durch alle Jahrhunderte. Warum also die Zeit angeben, in der sich das ereignete, was ich euch jetzt berichten will? Mag die Angabe genügen, dass es damals war, als man im Innern Ungarns fest, wenn auch nur im Geheimen, der Lehre von der Seelenwanderung anhing. Von der Lehre selbst, das heißt davon, ob sie möglich oder unmöglich sei, will ich nicht reden. Ich behaupte indes, dass unsere Ungläubigkeit zum großen Teil demselben Quell entspringt, von dem La Bruyère unser Unglück herleitet: il vient de ne pouvoir être seuls.1
Doch im Aberglauben der Ungarn gab es Dinge, die nahe an Abgeschmacktheit grenzten. Sie, die Ungarn, wichen in ihren Anschauungen weit ab von denen ihrer östlichen Vorbilder. So sagten zum Beispiel jene: »die Seele« – ich zitiere hier die Worte eines gewissenhaften und gelehrten Parisers – »ne demeure qu’une seule fois dans un corps sensible. Ainsi – un cheval, un chien, un homme même, n’est que la ressemblance illusoire de ces êtres.«
Die Familien Berlifitzing und Metzengerstein lagen seit Jahrhunderten in Zwist. Nie noch sah man zwei so erlauchte Häuser in so erbitterter und tödlicher Feindschaft. Sie mochte in den Worten einer uralten Prophezeiung begründet sein, die also lautete: Ein stolzer Name soll in Schrecken untergehen, wenn, wie der Reiter über sein Ross, die Sterblichkeit von Metzengerstein triumphieren wird über die Unsterblichkeit von Berlifitzing.
Gewiss, die Worte an sich hatten wenig oder gar keinen Sinn. Doch unbedeutendere Ursachen haben –und dies vor nicht allzu langer Zeit – geradeso schwerwiegende Folgen gehabt. Übrigens hatten die beiden benachbarten Familien lange Zeit darin gewetteifert, ihren Einfluss auf die Regierungsgeschäfte geltend zu machen. Ferner sind Nachbarn selten Freunde, und die Bewohner des Schlosses Berlifitzing konnten von ihren hohen Säulengängen bis in die Fenster der Burg Metzengerstein sehen. Und überdies hatte sich die mehr als lehnsherrliche Pracht der Metzengerstein in einer Art und Weise geäußert, dass sie den leicht erregbaren Stolz der weniger ahnenreichen und weniger begüterten Berlifitzings verletzen musste. Was Wunder also, dass jene Prophezeiung, so dumm sie auch klingen mochte, eine Feindschaft zwischen den zwei Familien zuwege brachte, die ohnedies durch erbliche Belastung zu Streit und Eifersucht veranlagt waren. Die Prophezeiung schien, wenn sie irgendetwas besagte, so jedenfalls einen endgültigen Triumph des bereits jetzt mächtigeren Hauses anzukünden und wurde darum mit umso bittererem Hass von der schwächeren und weniger einflussreichen Partei im Gedächtnis behalten.
Wilhelm Graf Berlifitzing war, obgleich von hoher Abkunft, zur Zeit dieser Erzählung ein kraftloser und kindischer Greis. Er hatte weiter nichts Bemerkenswertes an sich als eine übertriebene und hartnäckige Abneigung gegen die Familie seines Nebenbuhlers und eine so leidenschaftliche Liebe für Pferde und Jagd, dass weder seine körperliche Schwäche noch sein hohes Alter oder sein Schwachsinn ihn davon abhalten konnten, täglich an den Gefahren des Jagdvergnügens teilzunehmen.
Friedrich Baron Metzengerstein dagegen war noch nicht einmal mündig. Sein Vater, der Minister gewesen, starb in jungen Jahren. Seine Mutter, Baronin Marie, war ihm bald ins Grab gefolgt. Friedrich war damals achtzehn Jahre alt. In einer Stadt sind achtzehn Jahre keine lange Zeitspanne; in einer Wildnis aber, in der köstlichen Einsamkeit dieses alten Stammsitzes, hat jeder Pendelschwung weit tiefere Bedeutung.
Zufolge besonderer Bestimmungen des Hausgesetzes trat der Baron bei Ableben seines Vaters sogleich die Herrschaft über die ausgedehnten Besitzungen an. Selten wohl hatte ein ungarischer Edelmann solch herrliche Güter besessen. Zahllose Schlösser waren sein. Das bedeutendste an Pracht und Ausdehnung war Schloss Metzengerstein. Die Grenzlinie seines Gebietes war niemals sicher festgestellt, aber allein der große Park hatte einen Umfang von fünfzig Meilen.
Als der so jugendliche Herr, dessen Charakter allgemein bekannt war, in den unbeschränkten Besitz des riesigen Vermögens kam, war man sich über sein künftiges Auftreten so ziemlich im Klaren. Und wirklich, drei Tage lang stellten die Taten des jungen Erben selbst die des Herodes in den Schatten und übertrafen sogar bei Weitem die Erwartungen seiner begeisterten Bewunderer. Schandbare Schwelgereien, gemeine Treulosigkeit, unerhörte Scheußlichkeiten gaben seinen zitternden Vasallen bald zu verstehen, dass weder kriechende Unterwürfigkeit ihrerseits noch Gewissensbisse seinerseits jemals irgendwelche Sicherheit gewähren würden vor den erbarmungslosen Fängen dieses kleinen Caligula. In der Nacht des vierten Tages gerieten die Stallungen des Schlosses Berlifitzing in Brand, und die einmütige Ansicht der Nachbarschaft war, dass das Verbrechen der Brandstiftung auf die grauenvolle Liste der Untaten und Gräuel des Barons zu setzen sei.
Während des Aufruhrs, den dies Ereignis mit sich brachte, saß der junge Edelmann anscheinend in tiefen Gedanken in einem großen, einsamen und hochgelegenen Gemach des Stammschlosses Metzengerstein. Die kostbaren, obgleich verblassten Wandteppiche, die ringsum düster herabhingen, zeigten die schattenhaften und herrischen Gestalten von wohl tausend erlauchten Ahnen. Hier saßen hermelingeschmückte Priester und geistliche Würdenträger vertraulich neben Autokraten und Fürsten und legten gegen die Ansprüche eines weltlichen Königs ihr Veto ein oder hielten mit dem Machtspruch päpstlicher Obergewalt das rebellische Zepter des Erzfeindes in Bann. Dort tummelten die dunklen, hohen Gestalten der Ritter von Metzengerstein ihre kraftvollen Kriegsrosse auf den Leichen der besiegten Feinde und machten mit ihren entschlossenen Mienen selbst stählerne Nerven erschauern. Und hier wieder fluteten die wollüstigen und schwanengleichen Gestalten der Damen aus längst vergangenen Zeiten in irren, unwirklichen Tänzen zu den Tönen einer unwirklichen Melodie.
Während der Baron auf den anwachsenden Tumult in den Ställen der Berlifitzing lauschte oder vielleicht über irgendeine neue, noch dreistere Tat nachsann, hafteten seine Blicke unwillkürlich auf der Gestalt eines riesenhaften Pferdes von ganz seltsamer Farbe, das auf der Wandverkleidung als das Ross eines sarazenischen Vorfahren der gegnerischen Familie dargestellt war. Das Pferd selbst stand regungslos im Vordergrund des Bildes, sein gefällter Reiter aber verendete im Hintergrund unter dem Dolchstich eines Metzengerstein.
Ein teuflisches Lächeln umspielte Friedrichs Lippen, als er sich dessen bewusst wurde, welche Richtung sein Blick unbeabsichtigt genommen hatte. Er wandte die Augen nicht ab, trotzdem eine unerklärliche, erstickende Angst sich wie ein Leichentuch auf seine Sinne legte. Nur mit Mühe konnte er dies traumhafte und sonderbare Empfinden mit der Gewissheit, wach zu sein, vereinigen. Je länger er spähte, desto bannender wurde der Zauber – desto unmöglicher schien es ihm, jemals den Blick von jenem seltsamen Bild wieder abwenden zu können. Als aber der Aufruhr draußen plötzlich noch wilder tobte, richtete er mit gewaltsamer Anstrengung seine Aufmerksamkeit auf den roten Lichtschein, der aus den flammenden Ställen auf die Fenster des Gemaches fiel.
Doch einen Augenblick nur tat er das – ganz unwillkürlich schweiften seine Augen wieder zur Wand. Mit Staunen und schauderndem Entsetzen nahm er wahr, dass der Kopf des riesigen Hengstes inzwischen seine Stellung geändert hatte. Vorher waren Hals und Kopf des Tieres wie mitfühlend zu dem am Boden liegenden Herrn herabgebeugt, jetzt hatten sie sich in voller Länge gegen den Baron ausgestreckt. Die Augen, die vorher unsichtbar blieben, hatten einen eindringlichen Menschenblick und glühten in merkwürdig rotem Feuer, und die aufgewölbten Lippen des offenbar wütenden Tieres legten ekelhafte Totenzähne bloß.
Betäubt vor Schrecken wankte der junge Edelmann zur Tür. Als er sie aufwarf, strömte eine Flut roten Lichtes weit ins Zimmer und zeichnete seinen klar umgrenzten Schatten gegen den schwankenden Wandteppich. Und er schauderte, als er, der zögernd auf der Schwelle stand, bemerkte, dass dieser Schatten genau die Gestalt des erbarmungslosen und triumphierenden Mörders des Sarazenen-Berlifitzing deckte.
Um seiner selbst wieder Herr zu werden, eilte der Baron ins Freie. Am Haupttor des Schlosses traf er auf drei Stallburschen. Mit großer Mühe und Lebensgefahr versuchten sie die wilden Sprünge eines riesigen, feuerfarbenen Rosses zu bändigen.
»Wessen Pferd? Wie kommt ihr zu ihm?«, fragte der Jüngling in heiserer Angst, denn er hatte sofort bemerkt, dass der geheimnisvolle Hengst auf dem Wandteppich das vollkommene Seitenstück zu dem rasenden Tier hier war.
»Es ist Ihr Eigen, Herr«, erwiderte einer der Burschen. »Wenigstens hat sich kein anderer als Eigentümer gemeldet. Wir fingen es ein, als es dampfend und schäumend vor Wut aus den brennenden Ställen des Schlosses Berlifitzing daherfloh. Wir nahmen an, dass es zu des alten Grafen Gestüt ausländischer Rosse gehörte, und führten es als einen Durchgänger zurück. Aber die Stallknechte dort erheben keinen Anspruch auf das Pferd, und das ist doch seltsam, denn es zeigt sichtbare Spuren, dass es mit knapper Not den Flammen entronnen ist.«
»Auch trägt es deutlich die Buchstaben W. v. B. auf der Stirn eingebrannt«, ergänzte ein zweiter Bursche. »Ich dachte natürlich, es wären die Zeichen von Wilhelm von Berlifitzing – aber alle im Schloss leugnen durchaus, das Pferd zu kennen.«
»Höchst seltsam!«, sagte der junge Baron nachdenklich – und offenbar ohne selbst zu wissen, was er sagte. »Es ist, wie Ihr sagt, ein merkwürdiges, ein wundersames Tier! Allerdings auch, wie Ihr ebenfalls richtig bemerkt, von argwöhnischem und unfügsamem Wesen. – Gut also, sei es mein!«, setzte er nach einer Pause hinzu. »Ein Reiter wie Friedrich von Metzengerstein kann vielleicht selbst noch den Teufel aus dem Stall der Berlifitzing bändigen.«
»Sie sind in einem Irrtum, Herr; das Pferd stammt, wie wir wohl bereits sagten, nicht aus den Ställen des Grafen. Wäre das der Fall, so hätten wir unsere Pflicht besser gekannt, als es vor eine so hohe Persönlichkeit Ihrer Familie zu bringen.«
»Allerdings wahr«, bemerkte der Baron trocken. In diesem Augenblick kam eilig und mit roten Wangen ein junger Kammerdiener aus dem Schloss herbeigelaufen. Er berichtete dem Herrn im Flüsterton, dass in einem der oberen Zimmer – er bezeichnete es näher – ein kleines Stück Wandverkleidung plötzlich verschwand. Er erzählte allerlei Einzelheiten, aber so leise, dass die Neugier der Stallburschen nicht auf ihre Rechnung kam.
Der junge Friedrich schien während dieses Berichtes sehr erregt. Bald jedoch fand er seine Ruhe wieder, und mit einer Miene voll böser Entschlossenheit gab er den kurzen Befehl, dass das fragliche Zimmer sogleich zu verschließen und der Schlüssel ihm selbst zu übergeben sei.
»Haben Sie von dem unglückseligen Tod des alten Berlifitzing gehört?«, fragte einer der Untergebenen den Baron, als der Diener sich wieder entfernt hatte und das riesige Ross, das der Edelmann soeben in Besitz genommen, mit verdoppelter Wut die lange Allee hinunterstürmte, die das Schloss mit den Stallungen der Metzengerstein verband.
»Nein!«, wandte der Baron sich hastig an den Sprecher. »Tot, sagst du?«
»Wahrhaftig ja, Herr! Und einem Edlen Ihres Namens wird diese Nachricht, wie ich mir denke, nicht unwillkommen sein.«
Ein flüchtiges Lächeln flog über das Antlitz des andern. »Wie starb er?«
»Bei seinem eiligen Bemühen, seine Lieblingspferde zu retten, kam er selber elend in den Flammen um.«
»Wahr – haf – tig?«, sagte der Baron langsam, als übermanne ihn allmählich die Überzeugung von der Wahrheit eines aufregenden Gedankens.
»Wahrhaftig!«, beteuerte der Knecht.
»Entsetzlich!«, sagte der Jüngling ruhig und kehrte ins Schloss zurück.
Von dieser Stunde an war das Betragen des jungen Baron Friedrich von Metzengerstein ein gänzlich anderes. Wirklich, sein Benehmen täuschte alle Erwartungen und machte die Wünsche zunichte, die so manche berechnende Mutter im Stillen gehegt hatte. Mehr noch als bisher wich er in Manieren und Gewohnheiten von den Sitten der benachbarten Aristokratie ab. Er wurde nie mehr außerhalb der Grenzen seiner eigenen Besitzungen gesehen und war auf der weiten geselligen Welt ohne jeden Gefährten – es sei denn, dass das unnatürliche, wilde feuerfarbene Pferd, das er jetzt täglich ritt, irgendein geheimnisvolles Recht auf diese Bezeichnung gehabt hätte.
Die Nachbarschaft aber schickte noch immer ihre Einladungen: »Will der Baron unser Fest mit seiner Gegenwart beehren?«, »Will der Baron uns auf einer Eberjagd Gesellschaft leisten?« – »Metzengerstein jagt nicht«, »Metzengerstein kommt nicht«, waren seine lakonischen Antworten.
Solche wiederholten Beleidigungen mochte der hochmütige Adel sich nicht lange gefallen lassen. Die Einladungen wurden weniger herzlich, weniger häufig, und schließlich hörten sie ganz auf. Die Witwe des unglücklichen Grafen Berlifitzing sprach sogar die Hoffnung aus, es möge einmal dahin kommen, dass der Baron genötigt sei, zu Hause zu bleiben, wenn er nicht wünsche, zu Hause zu bleiben, da er die Gesellschaft von seinesgleichen verachte; und auszureiten, wenn er nicht wünsche, auszureiten, da er die Gesellschaft eines Pferdes vorziehe. Das war natürlich ein recht alberner Ausspruch und bewies nur, wie höchst unsinnig unsere Rede gerade dann wird, wenn wir ihr ganz besondere Bedeutung geben möchten.
Die Sanftmütigen jedoch suchten das veränderte Benehmen des jungen Edelmannes aus der so natürlichen Trauer des Sohnes um den frühen Verlust der Eltern abzuleiten; sie hatten anscheinend ganz sein ungezügeltes und ruchloses Betragen in den ersten Tagen nach jenem Verlust vergessen. Es gab noch andere, welche die Schuld dem hochmütigen Selbstbewusstsein des jungen Mannes zuschrieben. Und wieder andere, zu denen auch der Hausarzt gehörte, sprachen von krankhafter Schwermut und erblicher Belastung, während bei der Mehrzahl noch dunklere und zweideutigere Mutmaßungen in Umlauf waren.
Ja, des Barons verrückte Zuneigung zu seinem jüngst eingestellten Hengst – eine Zuneigung, die aus jedem neuen Beweis von des Tieres Wildheit und teuflischem Gebaren neue Kräfte zu schöpfen schien – wurde in den Augen aller vernünftig denkenden Leute zu einer Äußerung widerlicher Unnatur. Ob glühende Mittagszeit – ob tote Nachtstunde – ob krank oder gesund – ob Sturm oder Sonne – immer schien der junge Metzengerstein festgeschmiedet in den Sattel jenes ungeheuren Rosses, dessen unzähmbare Wildheit so gut zu seinem eigenen Wesen stimmte.
Überdies gab es Umstände, die in Verbindung mit jüngst vergangenen Ereignissen der Manie des Reiters und den Fähigkeiten des Rosses eine unheimliche und verhängnisvolle Bedeutung gaben. Man hatte die Weite eines einzigen Sprunges genau nachgemessen und gefunden, dass er die verwegensten Schätzungen gewaltig übertraf. Auch hatte der Baron keinen besonderen Namen für das Tier, während doch sonst jedes seiner Pferde seine eigene Benennung hatte. Ferner hatte man dem Hengst seinen Stall abseits von den anderen zugewiesen; und was die Pflege und Bedienung des Pferdes anlangte, so besorgte dies der Eigentümer selbst, denn kein anderer hätte es gewagt, auch nur den Stall zu betreten. Außerdem sagte man, dass keiner der drei Knechte, die das Ross nach seiner Flucht aus der Feuersbrunst von Berlifitzing mit Hilfe von Schlinge und Zaumzeug eingefangen hatten, mit Bestimmtheit versichern konnte, dass er während des gefährlichen Kampfes oder irgendwann nachher den Körper des Tieres tatsächlich unter der Hand gefühlt habe. Beweise von besonderer Klugheit bei einem edlen und rassigen Ross könnten wohl kaum eine übertriebene Aufregung hervorrufen, aber hier gab es Dinge, die sich mit Macht selbst den Ungläubigsten und Gleichgültigsten aufdrängten; und es kam vor, dass die atemlos staunende Volksmenge vor des Pferdes unheimlich bedeutungsvollem Stampfen entsetzt zurückwich, es geschah, dass der junge Metzengerstein sich erbleichend abwandte von dem scharfen, eindringlichen Blick seines verständigen, menschlichen Auges.
Unter dem Gefolge des Barons befand sich jedoch nicht einer, der daran gezweifelt hätte, dass die seltsame Zuneigung, die der junge Edelmann für sein feuriges Pferd an den Tag legte, aufrichtig und innig sei; nicht einer, außer einem missgestalten, armseligen kleinen Pagen, dessen Krüppelhaftigkeit jedem im Weg und dessen Ansichten jedem gleichgültig waren. Er hatte die Unverfrorenheit, zu behaupten (es verlohnt sich kaum, seine Meinung wiederzugeben), dass sein Herr nie ohne einen unerklärlichen, allerdings kaum wahrnehmbaren Schauder in den Sattel steige und dass bei seiner Rückkehr von dem gewohnten langen Ritt jeder Zug seines Gesichts in triumphierender Bosheit verzerrt sei.
In einer stürmischen Nacht erwachte Metzengerstein aus schwerem Schlaf, stürzte wie ein Wahnsinniger aus seinem Zimmer, bestieg in Hast sein Pferd und sprengte davon in den dunklen Forst. Man schenkte einem so gewohnten Vorkommnis weiter keine Aufmerksamkeit; bald aber wartete man voll tiefer Besorgnis auf die Rückkehr des Herrn – als nämlich nach einigen Stunden seiner Abwesenheit die mächtigen und prächtigen Mauern der Burg Metzengerstein unter der Gewalt eines wogenden, qualmenden Feuermeeres bis in ihre Grundfesten krachten und wankten.
Da die Flammen, als man sie gewahr wurde, bereits so schrecklich um sich gegriffen hatten, dass alle Versuche, einen Teil des Schlosses zu retten, fruchtlos geblieben wären, so stand die erstaunte Nachbarschaft stumm, um nicht zu sagen gefühllos dabei. Dann aber erregte etwas Neues und Schreckliches die Aufmerksamkeit der Gaffer und bewies, wie viel aufregender für eine Volksmenge der Anblick eines kämpfenden Menschen ist als die entfesselte Wut seelenloser Materie.
Die lange Allee uralter Eichen, die vom Forst zur Hauptpforte des Schlosses führte, sprengte ein Ross daher, dessen tosende Wildheit den Dämon des Unwetters noch überraste. Auf seinem Rücken trug es einen Reiter in zerfetzten Kleidern, der fraglos die Herrschaft über sein Tier verloren hatte. Die Todesangst auf seinem Antlitz und das krampfhafte Zucken des Körpers sprachen von stattgehabten unmenschlichen Kämpfen; aber kein Laut, außer einem einzigen Schrei, entfloh seinen blutigen Lippen, die in Entsetzen durch und durch gebissen waren. Ein Augenblick – und das Klappern der Hufe erklang scharf und schrill durch das Brausen der Flammen und das Heulen des Windes; ein zweiter – und mit einem einzigen Satz über Tor und Graben hinweg galoppierte der Hengst die wankende Treppe des Schlosses hinauf und verschwand mit seinem Reiter inmitten des Wirbelsturms der sausenden Flammen.
Die Wut des Sturmes legte sich sofort, und eine tote Ruhe folgte. Eine stille weiße Flamme umhüllte den Bau wie ein Leichentuch, und weit hinauf in die ruhige Luft ergoss sich ein Glanz übernatürlichen Lichtes, während eine Wolke von Rauch sich über den Trümmern aufbaute in der klar erkennbaren Gestalt eines ungeheuren – Pferdes.
1Mercier tritt in »L’an deux mille quatre cent quarante« ernstlich für die Lehre von der Seelenwanderung ein, und I. d’Israeli sagt: »Kein System ist so klar und widerstrebt so wenig dem Verstand.« Auch von Colonel Ethan Allen, dem »Sohn der Grünen Berge«, heißt es, dass er ein ernster Anhänger der Lehre von der Seelenwanderung gewesen sei.
Der Duc de l’Omelette
Und schritt mit eins in kühlere Regionen.
COWPER
Keats starb an einer Kritik. Wer war es noch, der an L’Andromaque1 starb? Niedere Seelen! – De l’Omelette starb an einem Ortolan. L’histoire en est brève. Steh mir bei, Geist des Apicius!
Ein goldener Käfig trug einen kleinen geflügelten Wanderer, ein gefesseltes, rührendes, indolentes Vögelchen, von seiner Heimat im fernen Peru nach der Chaussee d’Antin. Sechs Pairs des Kaiserreiches begleiteten den glücklichen Vogel von seiner königlichen Eigentümerin, La Bellissima, zu dem Duc de l’Omelette. An diesem Abend wollte der Duc allein speisen. In der Einsamkeit seines Arbeitszimmers lehnte er lässig auf jener Ottomane, für die er seine Loyalität geopfert hatte, indem er seinen König überbot – auf der berühmten Ottomane von Cadet.
Er gräbt sein Gesicht in die Kissen. Die Uhr schlägt. Unfähig, Ihre Gefühle zu unterdrücken, nehmen Seine Gnaden eine Olive. In diesem Augenblick öffnet sich die Tür leise zum Klang sanfter Musik, und sieh! der lieblichste Vogel steht vor dem geliebtesten der Männer! Doch eine unsägliche Furcht legt sich plötzlich auf die Züge des Duc. – »Horreur! – chien! – Baptiste! –l’oiseau! ah, bon Dieu! Cet oiseau modeste que tu as deshabillé de ses plumes, et que tu as servi sans papier!« Unnötig, mehr zu sagen: Der Duc starb an Ekel.
»Ha! Ha! Ha!«, sagten Seine Gnaden am dritten Tag nach Ihrem Ableben.
»He! He! He!«, echote der Teufel leise und richtete sich empor.
»Aber das ist doch sicherlich nicht ernst gemeint«, gab De l’Omelette zurück. »Ich habe gesündigt – c’est vrai – aber, mein Lieber, bedenke! – Du hast doch nicht wirklich die Absicht, solch – solch – wie soll ich sagen – solch barbarische Drohungen auszuführen.«
»Was nicht?«, sagte Seine Majestät. »Fix, Herr, ziehen Sie sich aus!«
»Was, ausziehen? Meiner Treu, eine niedliche Zumutung! Nein, Teuerster, ich werde mich nicht entkleiden. Wer sind Sie denn, dass ich, der Duc de l’Omelette, Prince de Foie-gras, eben mündig geworden, Autor der Mazurkiade, Mitglied der Akademie, mich auf ihren Befehl der entzückendsten Beinkleider, die jemals Bourdon verfertigte, des köstlichsten Hausgewandes, das jemals Rombert hervorzauberte, entledigen sollte, ganz zu schweigen von der Notwendigkeit, meine Haare aus den Papierwickeln nehmen, und von der Unbequemlichkeit, meine Handschuhe ausziehen zu müssen?«
»Wer ich bin? – ach so! Ich bin Beelzebub, Prinz der Unterwelt. Eben holte ich dich aus einem mit Elfenbein eingelegten Rosenholzsarg. Du warst sonderbar parfümiert und wie eine Warensendung adressiert. Belial, mein Kirchhofsverwalter, hat dich hierher geschickt. Die Beinkleider, deren du dich rühmst und die von Bourdon gemacht sein sollen, sind ein Paar vorzügliche Leinenunterhosen, und dein Morgengewand ist ein Leichentuch von nicht allzu knappen Dimensionen.«
»Herr!«, rief der Duc, »ich lasse mich nicht ungestraft beleidigen! Herr! Ich werde die erste beste Gelegenheit ergreifen, um mich für diese Kränkung meiner Ehre zu rächen! Herr! Sie werden von mir hören! Für jetzt – au revoir!«, und der Duc war im Begriff, mit einer Verbeugung den Satan zu verlassen, als er von einem diensttuenden Kammerherrn zurückgebracht wurde. Hierauf rieben sich Seine Gnaden die Augen, gähnten, zuckten die Achseln und überlegten. Als der Duc seine Haltung wieder gewonnen hatte, prüfte er seine Umgebung.
Sie war wundervoll. Sogar De l’Omelette erklärte sie für bien comme il faut. Dies lag jedoch nicht an der Länge und Breite des Raumes, sondern an der Höhe. Ah, die war ganz überwältigend! Keine Spur von Decke – nur eine dichte durcheinanderwogende Masse von feuerfarbigen Wolken. Im Gehirn Seiner Gnaden wirbelte es, wenn Sie hinaufsahen. Von oben herab hing eine Kette aus unbekanntem blutrotem Metall, deren oberes Ende sich parmi les nues verlor wie die Stadt Boston. Am unteren Ende schwang ein großes Gefäß hin und her. Der Duc erkannte es als einen Rubin; aus ihm strömte aber ein so intensives, so beständiges, so furchtbares Licht, wie nie ein solches ein Perser angebetet oder ein Geber sich vorgestellt hat, wie nie ein solches einem Muselmann im Traum erschienen ist, wenn er opiumbetäubt auf das Mohnlager taumelte, den Rücken den gefährlichen Blüten, das Antlitz der Sonne zugewendet. Der Duc murmelte eine leise Verwünschung.
Die Ecken des Raumes waren nischenartig abgerundet. In drei dieser Nischen standen Statuen von gigantischen Ausmessungen. Griechische Schönheit und ägyptische Ungeheuerlichkeit bildeten ein französisches tout ensemble. Die Statue der vierten Ecke war verschleiert; sie war nicht so riesenhaft. Aber ein schmaler Fußknöchel, ein sandalenbeschuhter Fuß waren sichtbar. De l’Omelette presste die Hand aufs Herz, schloss die Augen, schlug sie wieder auf und ertappte Seine satanische Majestät auf – Erröten.
Aber die Gemälde! – Kypris! Astarte! Astoreth! –tausende und immer dieselben! Und Raffael hatte sie gesehen! Ja, Raffael war hier gewesen; denn malte er nicht die – – –? Und gehörte er nicht infolgedessen den Verdammten an? Die Gemälde! Die Gemälde! O Wollust! O Liebe! Wer kann beim Anblick dieser verbotenen Schönheiten noch Augen haben für die zarten Entwürfe der Goldrahmen, die wie Sterne von den Mauern aus Hyazinth und Porphyr leuchten?
Aber dem Duc sinkt doch das Herz. Nicht, wie man vermuten möchte, schwindlig gemacht durch die Pracht, noch auch trunken durch den sinnverwirrenden Hauch all der unzähligen Weihrauchgefäße. Il est vrai qu’à toutes ces choses il a pensé beaucoup –mais! Der Duc de l’Omelette ist ganz von Schrecken ergriffen; denn der Durchblick durch das düstere, unverhängte, einzige Fenster zeigt ihm das Funkeln eines grässlichen Feuers!
Le pauvre Duc! Er konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass die herrlichen, lockenden, nie verklingenden Melodien, die die Halle durchströmten, die Klagen und das Geheul der Verzweifelten und Verdammten seien, aber geläutert und verändert durch die Zauberkraft der verwunschenen Fensterscheiben! Und dort! – auf der Ottomane! – wer mochte der wohl sein – der petit-maître – nein, der Göttliche, der da sitzt wie aus Marmor gemeißelt, mit bleichem Antlitz, et qui sourit si amèrement?
Mais il faut agir – das heißt, ein Franzose gibt eine Sache nie ganz verloren. Außerdem hassen Seine Gnaden Szenen. De l’Omelette ist wieder er selbst. Auf einem Tisch lagen unter anderen Waffen einige Rapiere. Der Duc wusste sie zu führen; il avait tué ses six hommes. Nun denn, il peut s’échapper. Er prüft zwei der Waffen und bietet sie mit unnachahmlicher Grazie Seiner Majestät zur Wahl. Horreur! Seine Majestät ist kein Fechter.
Mais il joue! Welches Glück! Seine Gnaden hatten immer ein glänzendes Gedächtnis. Er hat einmal im »Diable« des Abbé Gualtier geblättert und dort gefunden, »que le Diablo n’ose pas refuser un jeu d’écarté.«
Aber die Chancen – die Chancen! Wahrlich verzweifelt; aber kaum weniger verzweifelt als der Duc. Doch kennt er nicht die Schliche und Kniffe? Ist er nicht mit Pierre le Brun fertig geworden? War er nicht Mitglied des Klubs Vingt-et-un? »Si je perds«, denkt er, »je serai deux fois perdu – dann habe ich eben voilà tout! doppelt verspielt –« (Hier zucken Seine Gnaden die Achseln.) »Si je gagne, je reviendrai à mes ortolans – que les cartes soient préparées!«
Seine Gnaden waren ganz Aufmerksamkeit; Seine Majestät war lässig. Ein Zuschauer würde an Karl und Franz gedacht haben. Seine Gnaden dachten ans Spiel, Seine Majestät dachte an nichts und mischte. Der Duc hob ab.
Die Karten werden ausgeteilt. Der Trumpf wird aufgelegt – es ist – es ist – der König? Nein – es ist die Dame. Seine Majestät fluchte über deren männliche Kleidung.
De l’Omelette legte die Hand aufs Herz.
Sie spielen. Der Duc zählt. Das Spiel ist zu Ende. Seine Majestät zählt aufmerksam, lächelt und trinkt. Der Duc lässt eine Karte verschwinden.
»C’est à vous à faire«, sagt Seine Majestät und hebt ab. Seine Gnaden verbeugen sich, geben und erheben sich en présentant le Roi.
Seine Majestät sieht verdrießlich aus.
Wäre Alexander nicht Alexander gewesen, so hätte er Diogenes sein mögen; der Duc versicherte beim Abschiednehmen seinem Partner, »que s’il n’eut été De l’Omelette, il n’aurait point d’objection d’être le Diable.«
1Montfleury. Der Autor des Parnasse Réformé lässt ihn im Hades folgendermaßen sprechen: »L’homme donc qui voudrait savoir ce dont je suis mort, qu’il ne demande pas si ce fut de fièvre ou de podagre ou d’autre chose,mais qu’il entende que ce fut de l’Andromaque.«
Eine Geschichte aus Jerusalem
Intonsos rigidam in frontem descendere canos passus erat.
LUCAN, PHARSALIA, II, 375/6
… eine borstige Last - -
ÜBERSETZUNG
»Lasst uns zu den Wällen eilen«, sagte Abel-Phittim zu Bazi-Ben-Levi und Simeon dem Pharisäer, am zehnten Tag des Monats Thamuz dreitausendneunhundertundeinundvierzig, »lasst uns zu den Wällen am Tor des Benjamin in der Stadt Davids eilen, das auf das Lager der Unbeschnittenen niederblickt; denn es ist Sonnenaufgang und die letzte Stunde der vierten Wache, und die Götzendiener sollten uns, dem Versprechen des Pompejus gemäß, mit den Opferlämmern erwarten.«
Simeon, Abel-Phittim und Bazi-Ben-Levi waren die Gizbarim oder Unterempfänger der Opfergaben in der heiligen Stadt Jerusalem.
»Wahrlich, lasst uns eilen«, erwiderte der Pharisäer; »denn diese Großmut der Heiden ist ungewöhnlich, und Wankelmütigkeit ist den Vaalanbetern eigentümlich.«
»Dass sie wankelmütig und hinterlistig sind, das ist so wahr wie der Pentateuch«, sagte Bazi-Ben-Levi; »aber nur gegen das Volk des Adonai. Wann hätte es sich je gezeigt, dass die Ammoniter gegen ihre eigenen Interessen gehandelt hätten? Ich meine, es sei kein besonderes Zeichen von Großmut, uns für den Altar des Herrn Lämmer zuzugestehen, wenn sie statt dessen für den Kopf dreißig Silberschekel erhalten!«
»Du vergisst jedoch, Ben-Levi«, entgegnete Abel-Phittim, »dass der Römer Pompejus, der jetzt die Stadt des Allerhöchsten gottlos belagert, keine Gewissheit hat, ob wir nicht die derart für den Altar erworbenen Lämmer mehr zur Pflege des Leibes denn des Geistes verwenden.«
»Nun, bei den fünf Ecken meines Bartes«, rief der Pharisäer, der zu der Sekte gehörte, die man »die Werfer« nannte (jene kleine Gruppe von Heiligen, deren Art, die Füße aufs Pflaster zu werfen und daran zu zerfetzen, für die weniger eifrigen Gläubigen lange ein Stachel und ein Vorwurf war – ein Stein des Anstoßes für weniger begabte Erdenpilger), »bei den fünf Ecken des Bartes, den zu scheren mir als Priester verboten ist —, müssen wir den Tag erleben, da ein gotteslästerlicher und götzendienerischer römischer Emporkömmling uns beschuldigen soll, die heiligsten und geweihtesten Dinge fleischlichen Gelüsten zuzuführen? Müssen wir den Tag erleben, da –«
»Wozu uns um die Gründe des Philisters kümmern«, fiel Abel-Phittim ein, »denn heute ziehen wir zum ersten Mal Vorteil aus seinem Geiz oder seiner Großmut; lasst uns lieber zu den Wällen eilen, sonst könnte es an Opfergaben für den Altar fehlen, dessen Flammen die Wasser des Himmels nicht auslöschen und dessen Rauchsäulen kein Sturm zur Seite beugen kann.«
Der Stadtteil, dem unsere würdigen Gizbarim nun zueilten und der den Namen seines Erbauers, des Königs David, führte, galt als der befestigtste Bezirk Jerusalems, da er auf dem steilen und hohen Berg Zion gelegen war. Hier wurde ein breiter, tiefer und in den festen Stein gehauener Wallgraben von einer auf seinem inneren Rand errichteten sehr starken Mauer verteidigt. Diese Mauer war in regelmäßigen Zwischenräumen mit Türmen aus weißem Marmor geziert, deren niedrigster sechzig und deren höchster hundertundzwanzig Ellen hoch war. In der Nähe des Tores Benjamin aber erhob sich die Mauer keineswegs auf dem Grabenrand. Im Gegenteil, zwischen dem Boden des Grabens und dem Fundament des Walles erhob sich eine senkrechte Felswand von zweihundertundfünfzig Ellen Höhe, die einen Teil des steilen Berges Moriah bildete. Als also Simeon und seine Gefährten oben auf dem Turme Adoni-Bezek erschienen – dem höchsten aller Türme um Jerusalem und dem üblichen Ort der Verhandlungen mit dem belagernden Heer –, blickten sie auf das feindliche Lager von einer Höhe hinab, die um viele Fuß jene der Pyramide des Cheops überragte und um einige Fuß sogar den Tempel des Belus.
»Wahrlich«, seufzte der Pharisäer, als er, von Schwindel ergriffen, über den Abgrund spähte, »die Unbeschnittenen sind zahlreich wie der Sand am Meer – wie die Heuschrecken in der Wüste! Das Tal des Königs ist zum Tal Adommin geworden.«
»Und dennoch«, fügte Ben-Levi hinzu, »kannst du mir nicht einen Philister weisen – nein, von Aleph bis Tau, von den Wüsten bis zu den Zinnen nicht einen einzigen –, der auch nur im Geringsten größer wäre als der Buchstabe Jot!«
»Lasst den Korb mit den Silberschekels herunter!«, schrie hier ein römischer Soldat mit rauer, krächzender Stimme, die aus den Reichen Plutos hervorzudringen schien. »Lasst den Korb mit der verfluchten Münze herunter, bei deren Aussprache ein edler Römer sich die Zunge zerbrochen hat! Beweist ihr denn so unserm Herrn Pompejus eure Dankbarkeit, der sich herabließ, eurem götzendienerischen Anliegen zu willfahren? Der Gott Phöbus, der ein wahrer Gott ist, hat seit einer Stunde seine Fahrt begonnen – und wolltet ihr nicht bei Sonnenaufgang an den Wällen sein? Aedepol! Meint ihr, wir, die Eroberer der Welt, hätten nichts Besseres zu tun, als vor jedem Hundeloch herumzustehen und mit den Hunden der Erde zu verhandeln? Herunter mit dem Korb! sag ich –und gebt acht, dass euer lumpiges Geld von hellem Glanz und rechtem Gewicht ist!«
»El Elohim!«, rief der Pharisäer aus, als die unharmonischen Laute des Zenturios an den Felsen des Abgrunds erdröhnten und in der Richtung des Tempels verhallten. »El Elohim! Wer ist der Gott Phöbus? Wen ruft der Lästerer an? Du, Bazi-Ben-Levi, der du in den Gesetzen der Heiden belesen bist und unter denen weiltest, die sich mit Götzendienst befassen! – ist es Nergal, von dem der Götzendiener spricht? – oder Ashimah? – oder Nibhaz? – oder Tartak? – oder Adramalech? – oder Anamalech? – oder Sukot-Benit? – oder Dagon? – oder Belial? – oder Baal-Perit? – oder Baal-Peor? – oder Baal-Zebub?«
»Wahrlich, es ist keiner von diesen – doch hüte dich, das Seil zu hastig durch die Finger gleiten zu lassen; denn sollte das Flechtwerk dort an jenem Felsenvorsprung hängen bleiben, so würden die heiligen Gegenstände elendiglich herausstürzen.«
Mit Hilfe einer kunstlos gefügten Einrichtung wurde nun der schwere Korb achtsam zu der Menge hinabgelassen, und aus der schwindelnden Höhe konnte man sehen, wie die Römer sich um ihn drängten; wegen der großen Entfernung aber und eines zunehmenden Nebels konnte man keinen deutlichen Einblick in ihr Gehaben gewinnen.
Schon war eine halbe Stunde dahingegangen.
»Wir werden zu spät kommen«, seufzte der Pharisäer, als er nach Ablauf dieser Zeit in den Abgrund hinunterspähte, »wir werden zu spät kommen! Die Katholim werden uns vom Dienst ausschließen.«
»Nie mehr, nie mehr werden wir im Überfluss leben«, erwiderte Abel-Phittim, »unsre Bärte werden nicht mehr vom Weihrauch duften – unsre Lenden mit hartem Tempelleinen gegürtet sein.«
»Raca!«, fluchte Ben-Levi, »Raca! Wollen sie uns mit dem Kaufpreis durchgehen oder, heiliger Moses, prüfen sie am Ende gar die Schekels des Tabernakels auf ihr Gewicht?«
»Sie haben endlich das Zeichen gegeben«, rief der Pharisäer, »sie haben endlich das Zeichen gegeben – zieh an, Abel-Phittim! – Und du, Bazi-Ben-Levi, zieh an! – Denn wahrlich, entweder halten die Philister den Korb noch fest, oder der Herr hat ihre Herzen erweicht, ein Tier von gutem Gewicht hineinzutun!« Und die Gizbarim zogen und zogen, während ihre Last durch den stärker zunehmenden Nebel schwerfällig aufwärts schwankte.
»Bewahr uns!«, brach es nach Ablauf einer Stunde, als am Ende des Seils ein Gegenstand undeutlich sichtbar wurde, von den Lippen Ben-Levis.
»Bewahr uns! – Pfui! – Es ist ein Widder aus dem Dickicht von Engedi und so buschig wie das Tal Josaphat.«
»Es ist ein Erstling aus der Herde«, sagte Abel-Phittim, »ich erkenne es am Blöken seines Mundes und am unschuldigen Bau seiner Glieder. Seine Augen sind schöner als Edelsteine, und sein Fleisch gleicht dem Honig des Hebron.«
»Es ist ein gemästetes Kalb von den Weiden von Baschan«, sagte der Pharisäer, »die Heiden haben wundersam an uns gehandelt! Lasst uns unsre Stimmen in einem Psalm erheben! Lasst uns Dank sagen mit Schalmei und mit dem Psalter – mit Harfe und Flöte und Posaune!«
Erst als der Korb nur noch ein paar Fuß von den Gizbarim entfernt war, bot sich den Blicken mit tiefem Grunzen ein Schwein von ungewöhnlichem Umfang.
»O El Emanu!«, entrang es sich langsam dem Trio, als es seine Last fahren ließ und das befreite Borstentier kopfüber unter die Philister stürzte. »El Emanu!« – Sie verdrehten die Augen gen Himmel – »Gott steh uns bei! – Es ist das unaussprechliche Fleisch!«
Der verlorene Atem
Das schlimmste Missgeschick wird schließlich einmal dem unermüdeten Mut philosophischer Standhaftigkeit weichen müssen – gleich wie die zäheste Feste sich endlich doch der ausdauernden Belagerung eines hartnäckigen Gegners ergeben muss. Salmanassar hat, wie in der Heiligen Schrift zu lesen steht, volle drei Jahre vor Samaria gelegen, bis die Stadt endlich doch erlag. In den Schriften Diodors wird uns berichtet, dass Ninive sich volle sieben Jahre lang behauptete –bis es sich schließlich trotz allem ergeben musste. Troja fiel am Ende des zweiten Lustrums; und Asdod hat (für welche Angabe sich uns Aristäus verbürgt) seine Tore dem Psammetich erst geöffnet, als er den fünften Teil eines Jahrhunderts davorgelegen hatte.
»Elende! Zanksüchtige Megäre! Böse Sieben!«, sagte ich am Morgen nach unserer Trauung zu meiner Frau. »Hexe! Dirne! Pfuhl des Lasters! Du Mensch gewordene Bosheit und Sündhaftigkeit! Du … du …« Ich stand auf den Zehen, packte meine Frau am Hals und war bemüht, ihr noch herzlichere Bei- und Kosenamen ins Ohr zu schreien, von denen ich sicher erwarten durfte, dass sie sie von ihrer Minderwertigkeit überzeugen würden – da stockte ich plötzlich und merkte zu meinem Schrecken, dass ich meinen Atem verloren hatte.
Man gebraucht die Redewendungen »Ich bin außer Atem«, »Mir bleibt der Atem weg« usw. oft genug in der täglichen Verkehrssprache; aber es war mir bisher nie in den Sinn gekommen, dass mir etwas so Schreckliches tatsächlich zustoßen könnte. Wenn du, geschätzter Leser, über eine fruchtbare Phantasie verfügst, so versuche dir bitte auszumalen, welcher Bestürzung und Verzweiflung ich anheimfiel, als mir die furchtbare Gewissheit wurde, dass ich in der Tat meinen Atem verloren hatte.
Aber der freundliche Genius, der über mir wacht, hat mich niemals völlig verlassen. Auch in den verzwicktesten Lebenslagen kommt mir nie ein gewisser Sinn für die Schicklichkeit abhanden. »Et le chemin de passion me conduit à la philosophie véritable«, sagt Lord Eduard in der »Neuen Heloise« von sich selbst.
Es war mir zunächst unmöglich, festzustellen, inwieweit das Unheil, das mich betroffen hatte, schädlich auf meinen Organismus wirkte; unter allen Umständen jedoch wollte ich, das stand fest, die Sache vor meiner Frau verheimlichen. Es gelang mir unverzüglich, meines Zornes und meiner Erregung Herr zu werden; mit gänzlich verändertem Gesicht tätschelte ich meiner Frau die eine Wange, drückte ihr einen Kuss auf die andere, sprach kein Wort, schien ihr Erstaunen über mein so plötzlich verändertes seltsames Betragen überhaupt nicht zu bemerken – und tänzelte im Menuettschritt zum Zimmer hinaus.
Erst als ich mein eigenes Gemach erreicht hatte, wurde mir allmählich klar, in welch absonderliche Lage ich da geraten war. Ohne Atem war ich gewissermaßen tot; tot und dennoch lebendig. Als Ausnahmegeschöpf wandelte ich auf Erden: lebendig und der Fähigkeit zu atmen beraubt!
Jawohl, ich war atemlos. Mit bitterem Ernst behaupte ich, dass mir der Atem ganz und gar ausgegangen war. Und wenn’s mich den Kopf gekostet hätte –ich wäre nicht imstande gewesen, auch nur eine Flaumfeder mit dem Anhauch meines Mundes zu bewegen oder die glatte Fläche eines Spiegels zu trüben. Welch ein hartes Geschick! Und doch, als sich der erste Sturm des Schmerzes ein wenig gelegt hatte, verspürte ich ein leises Trostgefühl. Ich entdeckte nämlich, dass mir die Fähigkeit zu sprechen, die ich während des Gesprächs mit meiner Frau so gänzlich verloren hatte, doch nur teilweise abhandengekommen war. Wenn ich, so konnte ich in dieser denkwürdigen Krise feststellen, meine Stimme zu einem eigentümlich tiefen Kehlton zu dämpfen suchte, dann gelang es mir immer noch, mich verständlich zu machen. Ich bekam heraus, dass diese tiefen gedämpften Töne nichts mit dem Atmungsvorgang zu schaffen hatten, vielmehr nur auf einer krampfartigen Tätigkeit der Halsmuskeln beruhten.
Ich ließ mich in einen Stuhl fallen und versank in Grübeln über meine wunderliche Lage. Meine Gedanken waren nicht eben von tröstlicher Art. Eine Kette seltsamer und äußerst schmerzlicher Vorstellungen glitt durch meine Seele, und sogar der Gedanke an Selbstmord blitzte in meinem Hirn auf. Es ist indessen ein wesentliches Merkmal für die Verdrehtheit menschlicher Geistesverfassung, dass sie das Nächstliegende geflissentlich übersieht und sich an eine abseitige, oft recht zweifelhafte Ausflucht zu klammern pflegt. Mit stillem Neid ließ ich meine Blicke auf der getigerten Katze ruhen, die behaglich schnurrend vorm Kamin lag, und auf dem friedlich unter dem Tisch schnarchenden Hund. Die hörbar regelmäßige Tätigkeit ihrer Lungen machte mir meinen schweren Verlust doppelt schmerzlich fühlbar.
In tiefer Niedergeschlagenheit, von einem wilden Wirrwarr aus Hoffnung und Furcht gequält, hörte ich endlich meine Frau die Treppe herunterkommen und das Haus verlassen. Als ich überzeugt war, dass sie fort sei, begab ich mich mit klopfendem Herzen an die Stätte, wo sich mein Unglück ereignet hatte.
Ich verriegelte die Tür von innen und unterzog das Zimmer einer peinlich genauen Durchsuchung. Denn war es nicht am Ende möglich, dass sich der schmerzlich vermisste Gegenstand in irgendeiner dunklen Ecke, in einer Schublade oder einem Schrank wiederfand? Er konnte eine dunstförmige, vielleicht gar eine greifbare Gestalt angenommen haben. Die meisten Philosophen denken immer noch über gewisse zur Philosophie gehörige Dinge höchst unphilosophisch. William Godwin sagt indessen in seinem »Mandeville«, unsichtbare Dinge seien das einzig Wirkliche; und jedermann wird mir zugeben, dass dies ein bemerkenswerter Gesichtspunkt sei. Ich bitte den geschätzten Leser, innezuhalten und den Fall zu bedenken, ehe er mich einer lächerlichen Handlungsweise zeiht. Er erinnere sich freundlichst daran, dass Anaxagoras behauptet hat, der Schnee sei schwarz; und ich habe mich davon überzeugt, dass dies in der Tat der Fall ist.
Lange und sorgsam setzte ich meine Bemühungen fort – aber als verabscheuenswerter Lohn meines Fleißes und meiner Beharrlichkeit wurde mir lediglich der Fund eines falschen Gebisses, zweier Paare falscher Hüften und eines ganzen Bündels von Liebesbriefen zuteil, die Herr Windenough an meine Frau gerichtet hatte. Ich möchte übrigens bei der Gelegenheit hier nicht verfehlen zu bemerken, dass die Schwäche meiner Frau für Herrn Windenough mir längst kein Geheimnis mehr war, mir aber weiter kein Kopfzerbrechen machte. Die Bewunderung meiner Gattin für einen Mann, der mir in jeder Hinsicht so völlig unähnlich war, betrachtete ich als durchaus natürlich und nahm sie als notwendiges Übel hin. Ich bin (jeder, der mich kennt, kann es bezeugen) stark und kräftig gebaut, aber von ziemlich kleinem Wuchs und rechtschaffener Beleibtheit. So ist es kein Wunder, wenn die hohe schlanke Gestalt Herrn Windenoughs im Verein mit seinem sprichwörtlich gewordenen vornehmen Auftreten die Blicke meiner Frau auf sich gelenkt hat. Aber kehren wir zu meinem Bericht zurück.
Meine Bemühungen blieben, wie gesagt, ergebnislos. Einen Schrank, eine Schublade, eine Ecke nach der anderen durchforschte ich aufs Genaueste – vergebens. Einen Augenblick freilich glaubte ich mein Ziel erreicht zu haben; das war, als ich beim Kramen in einem Toilettekasten eine Flasche Grandjeans Erzengel-Öl zerbrach. Übrigens verbreitete es einen durchaus angenehmen Geruch, und ich gestatte mir aus diesem Grund, es meinen Lesern bestens zu empfehlen.
Schweren Herzens kehrte ich in mein Gemach zurück und grübelte. Wie sollte ich es anstellen, meiner Frau mein trauriges Unglück zu verhehlen, bis ich die nötigen Vorkehrungen zum Verlassen des Landes würde getroffen haben? – denn dazu war ich bereits fest entschlossen. Unter einem anderen Himmelsstrich, in einem Land, wo kein Mensch mich kannte, konnte ich immerhin mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, dass ich mein widriges Geschick würde verbergen können. Ich verhehlte mir nicht, dass dieses Geschick mehr, als es selbst die vollkommenste Mittellosigkeit vermocht hätte, dazu angetan sei, mir die Liebe meiner Mitmenschen zu entfremden, mich vielleicht gar der Verachtung der Glücklichen und Rechtschaffenen preiszugeben. Ich zauderte nicht lange. Da ich rasch lerne und ein gutes Gedächtnis habe, sagte ich die ganze Tragödie »Metamora« aus dem Gedächtnis her. Zu meinem Glück entsann ich mich, dass die Aufführung dieses Dramas oder doch die Partie des Helden den Klang der Stimme, der mir völlig abhandengekommen war, gänzlich überflüssig machte und dass der mir verbliebene tiefe Kehlton hier völlig am Platz war.
Ich übte deshalb eine Weile am Ufer eines viel besuchten Sees, mit welcher Tätigkeit ich nun freilich keineswegs die bekannte Methode des Demosthenes nachahmen wollte; vielmehr war es mir um die Ausführung eines reiflich erwogenen, selbst erdachten Plans zu tun. Als ich so nach jeder Richtung hin meine Vorkehrungen getroffen hatte, beschloss ich, meiner Frau den Glauben beizubringen, dass mich eine plötzliche Leidenschaft für das Theater ergriffen habe. Dies gelang mir außerordentlich gut: Auf jede Frage oder Anrede antwortete ich mit irgendeinem Zitat aus der erwähnten Tragödie, und alsbald bemerkte ich mit größter Befriedigung, dass diese Zitate fast bei jeder Gelegenheit anwendbar waren. Bei solchen Anlässen fröhnte ich dann ausgiebig dem Ehrgeiz, es einem der beliebtesten Schauspieler gleichzutun: Ich rollte die Augen, fletschte die Zähne, stieß mit den Knien, scharrte mit den Füßen – kurz, ich ließ nichts von all den Gesten und Kunststückchen aus, mit denen volkstümliche Darsteller zu wirken pflegen. Man nahm (das sei zugegeben) allgemein an, ich wäre verrückt geworden, und sprach davon, mich ins Irrenhaus zu bringen und in die Zwangsjacke zu stecken; aber dass ich meinen Atem verloren hätte, auf diese Vermutung, geschätzter Leser, kam niemand.
Als endlich alle meine Angelegenheiten geordnet waren, belegte ich eines Morgens in aller Frühe einen Platz in der nach … fahrenden Postkutsche; meinen Bekannten hatte ich erzählt, eine dringende geschäftliche Angelegenheit von größter Wichtigkeit erfordere meine persönliche Anwesenheit in … Der Wagen saß gerappelt voll; da es indessen noch sehr früh war, konnte ich in dem ungewissen Dämmerlicht die Gesichter meiner Reisegefährten nicht erkennen. Widerspruchslos ließ ich mich zwischen zwei Herren von riesenhaftem Leibesumfang unterbringen, indessen ein dritter, womöglich noch größerer und dickerer Fahrgast sich, sobald die Pferde angezogen hatten, mit der Bitte um freundliche Entschuldigung über mich warf und alsbald fest einschlief. Meine in schüchternen Kehltönen vorgebrachten Einwendungen ertranken rettungslos in dem starken regelmäßigen Schnarchen meines Peinigers; so laut war es, dass es das Brüllen des Ochsen von Phalaris übertönt haben würde. Glücklicherweise schloss der untätige Zustand meiner Atmungsorgane eine Erstickungsgefahr aus. Als es jedoch allmählich ganz hell geworden war und wir die Vorstädte von W… erreicht hatten, erhob sich mein Quälgeist von mir, schob seinen Hemdkragen zurecht und dankte auf recht verbindliche Art für meine Höflichkeit. Ich aber blieb bewegungslos, kein Glied vermochte ich zu bewegen, mein Kopf hing schlaff auf der Seite. Da schöpfte der dicke Herr einen jähen Argwohn. Er machte sofort die anderen Fahrgäste munter und eröffnete ihnen kurz und bündig, er habe sich davon überzeugt, dass anstelle eines lebendigen und für seine Handlungen verantwortlichen Menschen eine Leiche unter die Reisenden eingeschmuggelt worden sei. Um die Wahrheit dieser seiner Behauptung zu erhärten, versetzte er mir einen heftigen Schlag auf das rechte Auge. Hierauf hielten alle anderen Fahrgäste es für ihre Pflicht, mich ihrerseits an den Ohren zu ziehen. Ein junger praktischer Arzt, der sich zufällig unter den Mitreisenden befand, hielt mir einen Taschenspiegel vor den Mund, und da sich das Glas nicht trübte, meine Atemlosigkeit somit erwiesen war, stellte sich der Doktor auf den Boden der Anschauung des dicken Herrn. Darauf fasste die ganze Gesellschaft den Beschluss, so etwas könne sie sich nicht gefallen lassen und die Leiche sei mit tunlichster Beschleunigung zu entfernen.
Wir hatten gerade das Wirtshaus »Zur Krähe« erreicht, als man mich ergriff und ohne Weiteres aus dem Wagen warf. Ich geriet dabei unter ein hinteres Wagenrad, das mir über beide Arme ging; doch geschah mir weiter kein erheblicher Schaden dabei. Ich muss übrigens dem Kutscher hier geben, was des Kutschers ist, und erwähnen, dass er es nicht verabsäumte, meinen Koffer hinter mir dreinzuwerfen. Dieser Koffer landete leider auf meinem Kopf und brachte meiner Schädeldecke eine ungewöhnliche, höchst bemerkenswerte Verletzung bei.
Der Krähenwirt, ein sehr gastfreundlicher Mann, nahm sich meiner an; und da er in meinem Koffer hinlängliche Dinge vorfand, die eine reichliche Entschädigung für die etwa zu erwartende geringe Mühe gewährleisteten, schickte er sogleich zu einem ihm bekannten Arzt und vertraute mich der Obhut dieses Herrn an. Dabei verabsäumte er auch nicht, gleichzeitig eine Rechnung über zehn Dollar einzureichen.
Der Arzt brachte mich in sein Operationszimmer und begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Nachdem er mir die Ohren abgeschnitten hatte, konnte er bereits Lebenszeichen feststellen. Er klingelte und schickte zu einem in der Nähe wohnenden, als Wissenschaftler bestens bewährten Apotheker, um gemeinsam mit ihm weitere Versuche anzustellen. Für den Fall, dass seine Vermutung, die mich noch zu den Lebenden zählte, sich als richtig erweisen sollte, machte er als umsichtiger Mann einen Eingriff in meinen Magen und entfernte einen Teil der Eingeweide daraus, um sie einer gesonderten Untersuchung zu unterziehen.
Der Apotheker vertrat jedoch die Ansicht, dass ich tatsächlich tot sei. Ich war bestrebt, ihn von dieser Meinung abzubringen, indem ich mich zu bewegen versuchte; wirklich gelang es mir mit großer Anstrengung, einige krampfhafte Bewegungen auszuführen. Die operativen Eingriffe des Arztes hatten mir das Bewusstsein wiedergegeben und mich einigermaßen wieder in den Besitz meiner Kräfte gebracht. Der Apotheker indessen (wirklich ein hochgelehrter Mann!) schrieb meine krampfhaften Zuckungen der Wirkung einer neuen galvanischen Batterie zu, die er in Anwendung gebracht und mit der er bereits mehrere höchst bemerkenswerte Versuche ausgeführt hatte – Versuche, die sogleich mein brennendes Interesse erweckten. Ich war tief enttäuscht und betrübt, dass ich trotz verzweifeltster Anstrengungen nicht einmal den Mund zu öffnen, geschweige denn zu reden vermochte, dass vielmehr meine Sprache mir vollkommen den Dienst verweigerte. So blieb es mir versagt, die geistvollen, wenn auch phantastischen Theorien des Apothekers zu widerlegen, die mich unter anderen Umständen lebhaft gefesselt haben würden.
Da die beiden Herren keine Einigung erzielen konnten, beschlossen sie, mich für weitere Untersuchungen aufzusparen und mich einstweilen in einem Dachkämmerchen unterzubringen. Die gutmütige Doktorsfrau brachte Unterhosen und Strümpfe für mich herbei; und nachdem man mich also notdürftig bekleidet hatte, fesselte der Arzt selbst meine Hände und band mir ein Tuch um die Kinnladen. Dann schloss er die Tür meines Dachkämmerchens von außen zu und begab sich eilends an sein Mittagsessen. Ich hingegen lag einsam und verlassen da und hatte Muße genug, über mein beklagenswertes Los nachzudenken.
Bald jedoch verspürte ich zu meinem größten Entzücken das Empfinden, dass ich doch wieder einige Töne würde von mir geben können, wenn die Behinderung meiner Kinnladen durch das Tuch fortfiele. Das war nun ein großer Trost für mich; und ich sprach (innerlich) einige Stellen aus einem schönen Abendgebet, das von der Allgegenwart Gottes handelt und das vor dem Einschlafen zu beten ich nie versäume – als plötzlich durch ein Loch in der Wand zwei Katzen hereinkamen, sich mit einem einzigen Satz auf mich stürzten und mein Gesicht auf die schaudererregendste Weise zerkratzten und zerbissen.
Aber wie der Verlust seiner Ohren einst Cyrus den Weg zum Thron ebnete und wie Zopyrus dem durch Abschneiden verursachten Verlust seiner Nase den Besitz Babylons verdankte, so schlug auch mir der Verlust einiger Unzen Bluts aus meinem Antlitz zum Heil aus. Voll Schreck, Schmerz und Wut zerriss ich mit gewaltiger Kraft die um meine Hände geschlungenen Fesseln und warf das um meine Kinnladen gewundene Tuch von mir. Ich sprang auf und musterte, durchs Zimmer stampfend, die garstigen Tiere, die mich so kriegerisch angegriffen hatten, mit verächtlichen Blicken. Dann aber riss ich die Fensterriegel auf und stürzte mich voll Mut in die Tiefe hinab.
Nun fügte es der Zufall, dass der berüchtigte Straßenräuber W., mit dem ich eine fatale Ähnlichkeit hatte, zu dieser Zeit aus dem Stadtgefängnis in einen der Vororte geschafft wurde, wo das Schafott seiner wartete. Da er schon seit Langem schwer krank und bereits sehr schwach war, hatte man ihm die Vergünstigung gewährt, dass er ohne Handschellen und in den gewöhnlichen Sträflingskleidern zum Richtplatz geführt wurde. Er lag lang ausgestreckt auf dem Henkerkarren und fuhr zufällig gerade in dem Augenblick an dem Haus des Arztes vorbei, als ich mich aus dem Dachfenster stürzte. Sein Gefolge bestand lediglich aus zwei Rekruten des sechsten Infanterie-Regiments. Die beiden Rekruten waren betrunken; der Kutscher war eingeschlafen.
Ein weiterer fataler Zufall wollte es, dass ich geradewegs auf diesen Karren fiel. W. nun, ein durchs Ohr gebrannter Schuft, machte sich die Gelegenheit zunutze, um unbemerkt hinter mir aus dem Karren zu schlüpfen und mit äußerster Beschleunigung in einer nahen Allee zu verschwinden. Die Rekruten waren zwar durch den Krach munter geworden, doch blieb ihnen der Sinn des Ereignisses dunkel. Da ich indessen wie das leibhaftige Ebenbild des entwischten Schurken aussah und nun meinerseits lang ausgestreckt auf dem Karren lag, glaubten sie ihren Delinquenten im Begriff, einen Fluchtversuch zu unternehmen, und wählten zur Austreibung dieses Gelüstes das Mittel, mit dem dicken Ende ihrer Musketen auf mich einzuschlagen. Wir erreichten bald den Bestimmungsort. Natürlich aber konnte ich mich nicht verteidigen. Mein unabänderliches Schicksal bestimmte: Du wirst gehängt! Halb mit bitteren Gefühlen, halb mit Gleichmut ergab ich mich in mein hartes Los. Da ich nur wenig von den Eigenschaften eines Zynikers besitze, fühlte ich mich hilflos wie ein Hund. Der Henker legte die Schlinge um meinen Hals. Das Fallbrett fiel.
Die Gefühle zu schildern, die mich erfüllten, als ich am Galgen hing – ich versage es mir; obgleich ich weiß Gott ein Wörtchen darüber reden könnte – und obgleich über dieses Thema bisher nur wenig geschrieben wurde. Um über so etwas schreiben zu können, muss man sich unbedingt vorher hängen lassen. Jeder Schriftsteller sollte nur das schildern, was er durch eigene Erfahrung kennengelernt hat. Dies war auch die Meinung Marc Antons, als er seine berühmte Abhandlung über die beste Methode, betrunken zu werden, schrieb. Ich beschränke mich auf die Erwähnung der Tatsache, dass ich nicht starb. Scheinbar freilich war ich tot; da ich indessen schon vor der Exekution keinen Atem mehr gehabt hatte, konnte ich ihn auch nicht verlieren. Außer einer Beule am Kopf, die ich der Behandlung durch meine militärische Begleitmannschaft verdankte, verursachte mir der juristische Gewaltakt, das darf ich wohl sagen, wenig Unbequemlichkeit. Und der heftige Ruck an meinem Hals, als das Fallbrett fiel, erwies sich beinahe als ausgleichendes Gegengewicht zu der Misshandlung, die mir der dicke Herr in der Postkutsche hatte zuteilwerden lassen.
Aus wohlerwogenen Gründen tat ich indessen mein Bestes, um die Zuschauer auf ihre Kosten kommen zu lassen. Meine Zuckungen sind, so sagt man allgemein, so außergewöhnlich sehenswert gewesen, dass sie schwer zu überbieten sein dürften. Die anwesende Volksmenge war entzückt und klatschte Beifall. Mehrere Herren wurden ohnmächtig, zahlreiche Damen mussten hysterischer Krämpfe halber nach Hause getragen werden. Pinseit, der Maler, nutzte die Gelegenheit, um sofort an Ort und Stelle eine Skizze zu zeichnen, die er später für sein so berühmt gewordenes Bild »Der geschundene Marsyas« verwertete.
Als ich den Leuten hinlänglich Vergnügen bereitet hatte, hielt man es für angezeigt, meinen Leib vom Galgen zu nehmen – dies umso mehr, als der wirkliche Delinquent inzwischen wieder eingefangen und erkannt worden war. Leider erhielt ich von dieser Tatsache keine Kenntnis.
Infolge dieser Wendung der Dinge erregte meine Geschichte allgemeine Teilnahme, und da niemand meinen armen Leib für sich in Anspruch nahm, beschloss man, mich einstweilen in einem der städtischen Grabgewölbe beizusetzen.
Nach der üblichen Wartezeit tat man dies in aller Stille. Der Totengräber entfernte sich, und ich blieb allein zurück. In einer Dichtung Marstons heißt es: »Der Tod ist ein guter Geselle und öffnet ein gastliches Haus.« Diese Gastlichkeit erschien mir, muss ich gestehen, in jener Situation keineswegs erstrebenswert.
Ich stemmte mich mit aller Kraft gegen den Sargdeckel, und da es mir wirklich gelang, ihn aufzustoßen, entstieg ich so rasch wie möglich meiner harten Ruhestatt. Mein Aufenthaltsort erwies sich als düster und feucht, und alsbald übermannte mich schreckliche Langeweile. Um mir doch ein wenig Zerstreuung zu schaffen, betrachtete ich aufmerksam die vielen Särge, die um mich herumstanden. Ich hob, von einem zum anderen tretend, ihre Deckel auf und versenkte mich in eine tief nachdenkliche Betrachtung der darin enthaltenen sterblichen Überreste.
»Dieser Mann da« – so sagte ich mir beim Anblick einer aufgeschwemmten dicken Leiche – »ist sicherlich ein im wahrsten Wortsinn unglücklicher, sehr unglücklicher Mensch gewesen. Ihn traf das düstere Los, nicht flink gehen zu können, sondern watscheln zu müssen, nicht gleich einem menschlichen Wesen durch das Leben zu schreiten, sondern gleich einem Elefanten, nicht gleich einem Mann, sondern gleich einem Rhinozeros. Seine Versuche zu einer raschen Vorwärtsbewegung blieben erfolglos. Sein Missgeschick hatte zur Folge, dass ihn bei jedem Schritt seine Körperfülle bald nach rechts, bald nach links zog. Die Wunder einer Pirouette blieben ihm verschlossen, der ›pas du papillon‹ war ihm ein wesenloser Begriff. Nie hat er den Gipfel eines Berges ersteigen, nie von der Höhe eines Turmes herab das wunderbare Leben einer großen Stadt betrachten können. Die Sommerhitze war ihm ein grimmiger Feind. In den Hundstagen war sein Leben wahrlich das Leben eines Hundes. Er hat in dieser Zeit nur von Feuer und Erstickungstod geträumt, sein Elend hat ihm Berge auf Berge, den Pelion auf den Ossa getürmt. Er war kurzatmig, um alles in ein Wort zusammenzufassen, er war kurzatmig. Er war unfähig, auf einem Blasinstrument zu musizieren. Wahrscheinlich hat er selbsttätig sich bewegende Fächer, Windsegel und Ventilatoren erfunden. Er begönnerte die Bälgetreter und starb eines elenden Todes bei dem Versuch, eine Zigarre zu rauchen.« – Es war ein Fall, der mir tiefes Interesse, ein Schicksal, das mir aufrichtige Teilnahme einflößte.
»Aber hier«, sagte ich, »hier …«, und damit zerrte ich eine seltsam lange, wunderlich aussehende Gestalt aus ihrem Sarg, deren Anblick sofort unwillkommene Erinnerungen in mir erweckte, »… hier haben wir einen Burschen, der auch nicht den geringsten Anspruch auf menschliches Mitgefühl erheben darf.« –Mit diesen Worten packte ich den Gegenstand meiner Betrachtung, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen, mit Daumen und Zeigefinger an der Nase, zog ihn in die Höhe und bemühte mich, ihn in sitzende Stellung zu bringen. Dann fuhr ich, ihn auf Armeslänge von mir haltend, in meinem Monolog fort: »Nein! Dieser Mensch bedürfte sicherlich des menschlichen Mitleids nicht. Wer würde auch nur daran denken, für solch einen Schatten Sympathie zu empfinden? Hat er nicht auch wirklich ein volles Maß irdischen Glückes genießen dürfen? Gewiss war er der Schöpfer hoher Monumente, Türme, Blitzableiter. Oder er hat Abhandlungen über Schatten und Schattenbilder geschrieben und sich damit einen berühmten Namen gemacht. Er ging früh auf ein Technikum und studierte Pneumatik. Dann kam er heim, redete unausgesetzt oder musizierte auf dem französischen Horn oder dem Dudelsack. Er war ohne Frage ein …«
»Wie können Sie nur?! Oh, wie können Sie nur!«, unterbrach mich hier der Gegenstand meiner Betrachtung, riss mit verzweifelter Anstrengung die um seine Kinnlade gewundene Binde herunter und rang nach Atem, »wie können Sie so unmenschlich grausam sein und mich in so roher Weise an der Nase ziehen? Sahen Sie denn nicht – und wenn einer, so müssen Sie es wissen –, über welchen Überfluss an Atem ich zu verfügen habe? Wenn Sie es aber doch noch nicht wissen sollten, so setzen Sie sich bitte, und Sie werden sich davon überzeugen. In meiner Lage ist es wahrhaftig eine große Erleichterung, wieder zum Öffnen des Mundes fähig zu sein, sich aussprechen und mit einem Mann unterhalten zu können, der wie Sie gar nicht daran denken kann, mir den Faden meiner Rede abzuschneiden. Unterbrechungen sind immer äußerst langweilig und sollten unter gebildeten Menschen verpönt sein. Sind Sie nicht auch dieser Meinung? Antworten Sie mir nicht, ich bitte Sie! Es reicht vollkommen aus, wenn einer das Wort führt. Sobald ich ausgeredet habe, können Sie Ihrerseits zu Wort kommen. Wie zum Teufel, Herr, sind Sie hierhergeraten? Nein, antworten Sie mir nicht, ich bitte Sie! Ich selbst bin schon seit einiger Zeit hier. Es war ein schreckliches Erlebnis. Sie haben vermutlich davon gehört? Ich ging an Ihrem Hause, unter Ihren Fenstern vorbei (es war, kurz bevor Sie es mit der Theaterleidenschaft zu tun kriegten), als mich das seltsame Verhängnis traf. Ich habe nämlich, ohne es zu wollen, den Atem eines anderen aufgefangen. Na? Was sagen Sie dazu? Es war wirklich scheußlich unangenehm. Ich hatte von jeher mehr als genug an meinem eigenen Atem. Ich begegnete Blau an der Straßenecke. Er wollte mich nicht zu Wort kommen lassen. Nicht eine Silbe konnte ich einwerfen. Zu allem Unglück kriegte ich von der Aufregung darüber obendrein plötzlich einen epileptischen Anfall und fiel bewusstlos hin. Der Satan soll diese blinden Affen holen. Sie hielten mich für tot. Brachten mich in dieses Loch. Hörte alles, was Sie über mich sagten. Jedes Wort gelogen. Schändlich! beleidigend! scheußlich! unverständlich! und so weiter … und so weiter … und so weiter …«





























