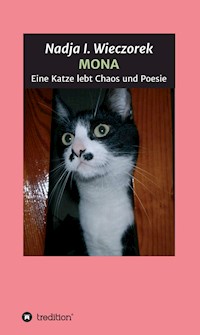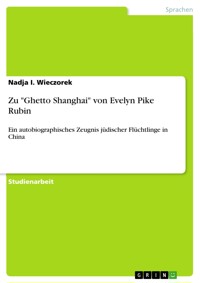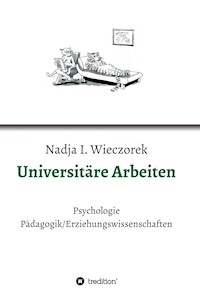
2,99 €
Mehr erfahren.
Nadja I. Wieczorek, Mag.a phil., liebt und lebt Wissenschaft und Forschung. Sie findet in jeder noch so verzwickten Lage den Notausgang. Stets fliegt sie in die richtige Richtung auf der Suche nach der perfekten Lösung. Sehen Sie selbst, lesen Sie selbst und lassen Sie sich durch ihr grandioses Schaffen bereichern. Folgende universitäre Arbeiten zu Psychologie und Pädagogik/Erziehungswissenschaften sind hier zu finden: - Psychoanalyse und Abwehrmechanismen - Die psychoanalytische Behandlung von Neurosen - Technik und Praxis des psychoanalytischen Erstgesprächs: Übertragung und Gegenübertragung - Psychodrama: Ein universitäres Weihnachtsmärchen - Psychodrama: Fallbeispiel "Walter" - Fallsucht (Epilepsie) - Die Einheitsschulbewegung und Schulreformpläne in den 1920er-Jahren - Berthold Otto und der Gesamtunterricht - Der Einfluss der Religion auf die Erziehungslehre OTTO WILLMANNS - Denkmäler und Gedenkstätten - Theorien und Ergebnisse der Sozialisationsforschung unter besonderer Berücksichtigung der schulischen Sozialisation - "GHETTO SHANGHAI" von Evelyn Pike Rubin. Ein autobiographisches Zeugnis jüdischer Flüchtlinge in China
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nadja I. Wieczorek
Universitäre Arbeiten
PsychologiePädagogik/Erziehungswissenschaften
© 2019 Nadja I. Wieczorek
Umschlaggestaltung: Nadja I. Wieczorek
Umschlagbilder: Vorderseite: A cat sits on the therapist’s couch © cartoonresource #48986556 – Fotolia.com
Rückseite: © Nadja I. Wieczorek
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-8860-2
Hardcover:
978-3-7482-8861-9
e-Book:
978-3-7482-8862-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Psychoanalyse und Abwehrmechanismen
Die psychoanalytische Behandlung von Neurosen
Technik und Praxis des psychoanalytischen Erstgesprächs:
Übertragung und Gegenübertragung
Psychodrama: Ein universitäres Weihnachtsmärchen
Psychodrama: Fallbeispiel „Walter“
Fallsucht (Epilepsie)
Die Einheitsschulbewegung und Schulreformpläne in den 1920er-Jahren
Berthold Otto und der Gesamtunterricht
Der Einfluss der Religion auf die Erziehungslehre OTTO WILLMANNS
Denkmäler und Gedenkstätten
Theorien und Ergebnisse der Sozialisationsforschung unter
besonderer Berücksichtigung der schulischen Sozialisation
„GHETTO SHANGHAI“ von Evelyn Pike Rubin. Ein autobiographisches Zeugnis jüdischer Flüchtlinge in China
Psychoanalyse und Abwehrmechanismen
Vorwort
1 Die Abwehrmechanismen bei Otto Fenichel
1.1 Sublimierung
1.2 Pathogene Abwehr
1.2.1 Verleugnung
1.2.2 Projektion
1.2.3 Introjektion
1.2.4 Verdrängung
1.2.5 Reaktionsbildung
1.2.6 Ungeschehenmachen
1.2.7 Isolierung
1.2.8 Regression
1.3 Affektabwehr
1.3.1 Blockierung (Verdrängung) von Affekten
1.3.2 Aufschub von Affekten
1.3.3 Affektverschiebung
1.3.4 Affektäquivalente
1.3.5 Reaktionsbildungen gegen Affekte
2 Die Abwehrmechanismen bei Wolfgang Loch – ein Vergleich
2.1 Definition
2.2 Verdrängung
2.3 Symptombildung
2.4 Vollständige und totale Verdrängung
2.5 Vorstadien der Abwehr
3 Ein Problemfall
Literatur
Vorwort
In der vorliegenden Seminararbeit beschäftige ich mich mit einem speziellen Gebiet der Neurosenlehre, den Abwehrmechanismen. Ich behandle dieses Thema, da diese Vorgänge im alltäglichen Leben gut beobachtbar sind. Nachdem ich meine Interaktionspartner intensiv beobachte und ihr Handeln wie ihre Reaktionen psychologisch zu deuten versuche, beschäftigt mich das Thema Abwehrmechanismen besonders.
In meiner Arbeit vergleiche ich zwei Autoren – Otto Fenichel und Wolfgang Loch – bezüglich ihrer Ausführungen zu Abwehrmechanismen. Dazu fasse ich unter Punkt 1 die Aussagen Fenichels zusammen und stelle im 2. Kapitel dar, inwiefern sich Lochs Ausführungen davon unterscheiden. Zum Abschluss führe ich ein Fallbeispiel zum behandelten Thema an.
1 Die Abwehrmechanismen bei Otto Fenichel
(vgl. FENICHEL 1974, S. 201-238)
Fenichel beschreibt die Abwehrmechanismen im 1. Band seiner psychoanalytischen Neurosenlehre. Zuallererst unterscheidet er zwischen einer erfolgreichen und einer erfolglosen Abwehr. Die pathogene Abwehr, die bei Neurosen auftritt, gehört zur erfolglosen Abwehr. Hier können Triebregungen keine Abfuhr finden. So bleibt im Unbewussten eine Spannung bestehen. Dauert diese Spannung länger an, können die gesamten Umstände zu einem Ausbruch führen. Ist die Abwehr pathogener Art, ruft sie beim Betroffenen verkrampftes Verhalten hervor, wiederholt sich immer wieder, erlaubt nie eine vollständige Entspannung und verursacht Ermüdungserscheinungen. In Folge werden die Abwehrmechanismen detailliert beschrieben.
1.1 Sublimierung
Der Begriff Sublimierung bezeichnet keinen spezifischen Mechanismus, sondern charakterisiert unterschiedliche erfolgreiche Abwehrmechanismen, z.B. den Wechsel von Passivität zu Aktivität. Allgemein kann gesagt werden, dass hier unter dem Einfluss des Ich Triebziel oder -objekt verändert werden, ohne eine adäquate Abfuhr zu blockieren. Sublimierte Triebregungen gelangen an die Oberfläche, während dies mit den anderen Triebregungen nicht geschieht. Die ursprüngliche Triebregung verschwindet. Somit wird freies Handeln ermöglicht. Es kommt zu einer Desexualisierung, wodurch die Befriedigung des Ich nicht länger offensichtlich triebhaft ist.
Das Objekt der Sublimierung sind prägenitale Bestrebungen. Wurden diese verdrängt, bleiben sie im Unbewussten und können nicht sublimiert werden.
Die Sublimierung ist durch Zielgehemmtheit, Desexualisierung, eine vollständige Absorbierung eines Triebes durch seine Folgewirkungen und eine Veränderung innerhalb des Ich gekennzeichnet. Sie hängt nach Sigmund Freud sehr eng mit der Identifizierung im Kindesalter zusammen. Sie kann infantile destruktive Impulse bekämpfen und auflösen.
1.2 Pathogene Abwehr
Im Weiteren setzt sich der Autor mit der pathogenen Abwehr auseinander. Das Verhalten bei auftretenden Konflikten entscheidet darüber, ob sie normal oder pathologisch verlaufen. Jene Triebanteile, die in der Kindheit mit Abwehrhaltungen zusammenstießen, sind von der Möglichkeit einer Abfuhr laut Fenichel ausgeschlossen. Die abgewehrten Triebe üben Druck aus. Nachdem sie nicht direkt abgelassen werden können, nehmen sie jede Gelegenheit zu indirekter Abfuhr wahr und verschieben ihre Energie auf Triebregungen, die assoziativ mit ihnen verknüpft wird (Abkömmling). Fenichel meint, alle pathogenen Abwehrhaltungen und Psychoneurosen würden in der Kindheit wurzeln.
1.2.1 Verleugnung
Die Realität wird verleugnet, wenn sie unangenehm erscheint oder schmerzhafte innere Wahrnehmungen auftreten. Als Beispiel bringt Fenichel u.a. die Aussage eines Patienten, der über eine Person in einem seiner Träume sagt: „Ich weiß nicht, wen die Person in meinem Traum darstellt; gewiß handelt es sich nicht um meine Mutter“ (S. 207). Das bedeutet, dass der Patient spürt, dass die Person seine Mutter ist, ist aber noch in der Lage, das zu verleugnen.
Solange das Ich schwach ist, behält es seine Tendenz, zu verleugnen. Nur im Falle schwerer Funktionsstörungen der Realitätsprüfung (Psychosen) behalten ernsthafte und wichtige Verleugnungen bei Erwachsenen die Oberhand. Neurotiker weisen die Eigenschaft auf, dass das Ich in einen Oberflächenteil, der die Wahrheit kennt, und einen tieferen Teil, der sie verleugnet, gespalten ist. Obwohl sie die Wahrheit kennen, handeln sie eventuell als existiere sie nicht.
Das Ich sucht oft nach Ersatzvorstellungen, den Deckerlebnissen. Dabei durchsucht es seinen Vorrat an Erinnerungen und Bildern, die es seinem Bewusstsein als Ersatz anbieten kann. Beim sogenannten Dèja-vu-Erlebnis ist eine Verdrängung bereits abgeschlossen und das Ich will nicht an das Verdrängte erinnert werden.
1.2.2 Projektion
Projektion ist ein Abkömmling der ersten Verneinung und beinhaltet das Bestreben, eine Distanz zwischen sich und dem betreffenden Objekt zu schaffen. Sie ist ein wesentlicher Teil der frühen Entwicklungsstufe des Ich, wo alles Lustvolle als zum Ich gehörig erfahren wird. Alles Schmerzhafte wird als Nicht-Ich erfahren. Solange die Trennungslinie zwischen Ich und Nicht-Ich noch nicht scharf gezogen ist, können die Mechanismen des Lust-Ichs zur Abwehr durch das Ich eingesetzt werden. Anstößige Triebregungen werden dann an anderen anstatt an einem selbst wahrgenommen.
Führt die Entwicklung der Libido zu einer Überbesetzung der Ausscheidungsfunktionen, können diese als physisches Modell der Projektion dienen. Am stärksten ist sie bei der Paranoia ausgebildet.
1.2.3 Introjektion
Sie dient der Triebbefriedigung. Sie ist der Prototyp einer Wiedererlangung der Allmacht beim Kind, die zuvor auf die Erwachsenen projiziert wurde. Es findet eine Einverleibung statt.
1.2.4 Verdrängung
Die Verdrängung besteht aus einem unbewussten absichtlichen Vergessen oder einem Nichtbewusstwerden innerer Bestrebungen oder äußerer Ereignisse, die mögliche Versuchungen oder Bestrafungen für oder bloße Anspielungen auf verbotene Triebansprüche darstellen. In der eigentlichen Verdrängung bleibt das Verdrängte aus dem Unbewussten heraus wirksam.
Konflikte entstehen, wenn neue Erfahrungen auftreten, die mit dem zusammenhängen, was zuvor verdrängt wurde. Dann bildet sich eine Tendenz dazu, das neue Ereignis als Gelegenheit zum Ausbruch zu verwenden. Das Verdrängte tendiert dazu, seine Energie auf das Ereignis zu verschieben und in einen Abkömmling zu verwandeln. Gelegentlich ist dieser Vorgang erfolgreich.
Die Verdrängung ist der Hauptmechanismus der Hysterie. Sie drückt eine Haltung aus, bei der das verpönte Ding behandelt wird, als ob es nicht da wäre.
Das Motiv der Verdrängung ist, das Verdrängte vom Zugang der Motilität fernzuhalten. Verdrängung wird nicht ein für allemal geleistet, sondern verlangt eine ständige Verausgabung von Energie, um die Verdrängung aufrechtzuerhalten, während das Verdrängte ständig versucht, einen Ausweg zu finden.
1.2.5 Reaktionsbildung
Reaktionsbildung scheint die Folge und Absicherung einer bereits hergestellten Verdrängung zu sein. In ihr tritt die Gegenbesetzung manifest auf und ruft eine definitive Veränderung der Persönlichkeit hervor. Die Person nimmt eine Haltung ein, die der ursprünglichen genau entgegengesetzt ist. So empfindet der Betroffene, dass die Gefahr ständig vorhanden ist (Zwangsneurotiker).
1.2.6 Ungeschehenmachen
Es wird etwas realiter durchgeführt, was tatsächlich oder nur magisch das Gegenteil von etwas anderem ist, das vorher wirklich oder in der Einbildung vollzogen wurde. Die zweite Handlung stellt eine genaue Umkehrung der ersten dar (Zwangsneurose), als müsste die erste Tat ungeschehen gemacht werden. Dies funktioniert nach dem Prinzip Schuld und Sühne.
1.2.7 Isolierung
Hier tritt eine Gegenbesetzung auf. Die Wirksamkeit besteht darin, dass voneinander getrennt gehalten wird, was in Wirklichkeit zusammengehört (z.B. zeitliche oder räumliche Abstände). Somit wird eine Handlung von der Möglichkeit getrennt, auf eine andere einzuwirken.
In unserer Kultur ist eine häufig auftretende Isolierung die Trennung der sinnlichen und zärtlichen Komponenten der Sexualität. Das ist eine Folge der Verdrängung des Ödipuskomplexes. Bei der Hassliebe werden in der Phantasie die beiden widersprechenden Gefühle gespalten und auf zwei verschiedene Personen aufgeteilt.
1.2.8 Regression
Wenn der Mensch eine Versagung erlebt, sehnt er sich meist nach früheren Lebenszeiten, in denen er lustvollere Erfahrungen machen konnte, und nach früheren Formen der Befriedigung, die vollständiger waren. Bei der Regression verhält sich das Ich passiver als bei anderen Mechanismen. Sie scheint durch Triebe in Gang gebracht zu werden. Voraussetzung ist eine schwache Organisation des Ich.
a) Regression von erwachsenen Formen der Sexualität auf infantile: kann auftreten, wenn die Person von der erwachsenen Sexualität enttäuscht wurde oder sich von ihr bedroht fühlt.
b) Regression zum Primärnarzissmus: Regression auf das Entwicklungsstadium vor der Differenzierung von Ich und Es. Es handelt sich dabei um eine Blockierung des Ich.
1.3 Affektabwehr
Nach Beschreibung der Abwehrmechanismen, die gegen Triebe gerichtet sind, beschreibt Fenichel die Affekte und deren Abwehr. Demnach ist jede Abwehr eine Abwehr von Affekten, deren Motiv ist, schmerzhafte Empfindungen zu vermeiden. Es gibt auch eine Abwehr, die nicht gegen Triebe gerichtet ist, und die hier beschrieben wird.
1.3.1 Blockierung (Verdrängung) von Affekten
Die blockierten unbewussten Affektdispositionen entwickeln Abkömmlinge, stellen sich in Träumen dar und zeigen sich in Symptomen und anderen Ersatzbildungen. Sie verraten sich in einer allgemeinen Schwäche, die durch einen immensen Verbrauch von Energie verursacht ist.
1.3.2 Aufschub von Affekten
Es kann eine zeitliche Verschiebung auftreten, die verursacht, dass der Motivationszusammenhang nicht erkannt wird. Diese Abwehr wird häufig bei Wut und Kummer angewandt. In gefährlichen Situationen kann ein Aufschub von Angstgefühlen Leben retten.
1.3.3 Affektverschiebung
Der Affekt, der in der Beziehung zu einem bestimmten Objekt unterdrückt wurde, bricht gegenüber einem anderen aus. Dies ist von Tierphobien bekannt.
1.3.4 Affektäquivalente
Eine Abwehr ist erfolgreicher, wenn sich jemand bei der Art seiner Gefühle irren kann. Die psychische Bedeutung der Abwehrinnervationen bleibt unbewusst. So entstehen die Affektäquivalente. Patienten klagen oft während der Analyse über Veränderungen ihrer Körperempfindungen, ohne deren psychische Bedeutung zu erkennen. Bevor sie die Affekte voll erleben können, müssen sie zu den Affektäquivalenten finden.
1.3.5 Reaktionsbildungen gegen Affekte
a) Verleugnung: Festhalten an der entgegengesetzten Gefühlshaltung
b) Frechheit: Abwehr von Schuldgefühlen
c) Mut: Abwehr von Angst
d) Scham und Ekel: Sexualabwehr
e) Projektion der Affekte nach außen
f) Introjektion des Objekts
g) Isolierung von Schuldgefühlen (bei Zwangsneurotikern)
h) Regression: Abwehr von Schuldgefühlen (beim moralischen Masochismus)
2 Die Abwehrmechanismen bei Wolfgang Loch – ein Vergleich
(vgl. LOCH 1971, S. 38-49)
Im Gegensatz zu Fenichel schenkt Wolfgang Loch den Abwehrmechanismen nicht so viel Aufmerksamkeit. Er geht neben allgemeinen Erklärungen speziell nur auf den Mechanismus der Verdrängung ein. Das Kapitel wird kurzgehalten.
2.1 Definition
Zuerst definiert Loch die Abwehrmechanismen allgemein: „Unter Abwehrmechanismen im engeren Sinne verstehen wir in der psychoanalytischen Theorie solche unbewußten, übrigens dem Ich zugeschriebenen, Vorgänge, die mit Gegenbesetzungen, d.h. mit „Motiven“, die den „ Widerstand gegen die Realisierung der unbewußten Strebungen“ aufrechterhalten wollen“…, arbeiten“ (S. 39). Hier ist erkennbar, dass Loch dazu tendiert, sich komplizierter zu formulieren als Fenichel. Dadurch wird Loch für den Laien evtl. weniger leicht verständlich.
Loch erwähnt Verdrängung, Verleugnung, Isolierung, Reaktionsbildung, Projektion, Introjektion und Ungeschehenmachen, geht aber nur auf den Mechanismus der Verdrängung näher ein. Einen Abwehrmechanismus bezeichnet er als komplexen dynamisch-kognitiven Prozess.
Der psychische Akt muss verschiedene Aufgaben lösen: die aus dem Es stammenden, die von der Außenwelt kommenden, die dem Über-Ich aufgegebenen und die vom Wiederholungszwang diktierten. Wie Fenichel erwähnt Loch, dass Gegenbesetzungen auch bei Phobien auftreten würden, die in Stellvertretung für das primär angstauslösende Objekt gebildet wurden. Gegenbesetzungen zeigen sich bei Hysterikern durch übermäßige Schreckhaftigkeit und Wachsamkeit. Zu den einzelnen Bereichen führt der Autor praktische Beispiele an.
2.2 Verdrängung
Loch widmet sich intensiv dem Mechanismus der Verdrängung, da sie die erste Abwehrart war, mit der sich Freud beschäftigte und weil alle anderen Abwehrmechanismen im Grunde mit Material zu tun haben, das der Verdrängung entgangen ist bzw. eine Verdrängung mittels sekundärer Gegenbesetzungen verhindert. Von vollständiger Verdrängung kann man nur sprechen, wenn der konfliktauslösende Trieb durch den Verdrängungsmechanismus an seinem Übertritt in das Vorbewusste bzw. Bewusste gehindert wurde. Freud nannte den Vorgang, der dem zugrunde liegt, Urverdrängung. Mit dieser geht laut Freud eine Fixierung einher, so dass der betroffene Trieb oder Triebanteil die normale Entwicklung nicht mitmacht und dadurch in einem infantileren Stadium bleibt. Unter der sekundären Verdrängung versteht man, dass den schon einmal vorbewusst bzw. bewusst gewordenen Triebrepräsentanzen die Besetzungen sekundär entzogen werden.
Was sich im Bewusstsein abbilden kann, ist das Ergebnis eines Kompromisses zwischen dem Unbewussten, Über-Ich und Ich.
2.3 Symptombildung
Als dritten Punkt beschreibt Loch die Symptombildung. Der manifeste Traum z.B. resultiert aus einem zum Bewusstsein vorgestoßenen Triebwunsch und dessen Bearbeitung durch die Abwehr. Laut Autor wäre ein Schreibkrampf eine Kompromissbildung zwischen einem Onaniewunsch und seiner Abwehr, was in diesem Fall die Verurteilung durch das Über-Ich wäre.
Wie auch Fenichel dargelegt hat, schreibt Loch, dass die Abwehr größtenteils durch Angst- und Schuldgefühle ausgelöst werden würde. Angst und Schuld sind das Signal für das (unbewusste) Ich, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die bewirken, dass die diesen Gefühlen zugeordnete Wahrnehmung oder Handlung vermieden oder so abgeändert wird, dass sie keine zu große Traumatisierung für das bewusste Ich bedeutet.
Die inhaltlichen Momente der Neurosen stammen aus der „Zufälligkeit“ der Biographie. Die formale Struktur leitet sich aus der speziellen Bearbeitungsweise ab, die dem Erfahrungsmaterial zuteilwird. Für Loch steht fest, dass es kulturspezifische, gruppenspezifische und familienspezifische Abwehrformen gibt, die auf die Kinder übertragen werden.
2.4 Vollständige und totale Verdrängung
Bei der vollständigen Verdrängung gelingt vorerst eine vollständige Abwehr, d.h. der Triebwunsch findet keine bewusste Repräsentanz. Allerdings wird die potentielle Effektivität nicht beseitigt. Der Triebwunsch behält seine unbewusste Besetzung, so dass später eventuell eine Wiederkehr des Verdrängten möglich wird, was zustande kommt, wenn die Triebe z.B. in der Pubertät biologisch verstärkt werden oder in der Realität der Person etwas eintritt, das zum verdrängten Wunsch oder Trieb in Beziehung steht.
Von totaler Verdrängung wird gesprochen, wenn es zur Aufhebung einer Triebregung kommt. Das spielt sich bei der Errichtung des Über-Ichs ab, und Freud meinte, dass wenn dieser Vorgang erfolgreich ablaufen würde, dies einer Aufhebung des Ödipuskomplexes gleichkommen würde.
Die menschliche Persönlichkeit wird von psychischen Mechanismen aufgebaut, die auch der Abwehr dienen können. Entscheidend ist, ob die Konflikte eine Lösung finden, die die Ich-Funktion nicht fixieren oder beeinträchtigen. Ob ein Abwehrmechanismus einer gesunden Anpassung oder einer pathologischen Konfliktbearbeitung dient, hängt davon ab, ob er einer Triebbefriedigung dient.
2.5 Vorstadien der Abwehr
Ziel ist, die Funktion des Organismus zu schützen und die Integration mit der lebensnotwendigen Umwelt sicherzustellen. Vor allem sind es Spaltungen, Introjektionen, projektive Identifikationen, Verkehrung ins Gegenteil, Wendung gegen die eigene Person und Verschiebungen. Diese primitiven Abwehrformen spielen sich am Objekt ab. Sie sind Arten des Umgangs mit dem Objekt in einem Stadium, in dem dieses Erlebnis noch seine primäre Ganzheit besitzt.
Die Urverdrängung wird von derjenigen primären Gegenbesetzung unterhalten, die den primär handelnden und erlebten Umgang mit dem Objekt in seine Faktoren aufspaltet. So bilden sich die verschiedenen Repräsentanzen als Teile des ursprünglichen Ereignisses. Die Leistung der Gegenbesetzung ist, dass auf dem Niveau des psychischen Primärprozesses jene Faktoren fixiert und von einer weiteren Entwicklung ausgeschlossen werden, die nicht an einem weiteren Verkehr und Austausch teilnehmen können. Die Vorstadien der Abwehr werden von nahezu vollständiger Triebabfuhr begleitet.
„Im Fall von Fehlsteuerung führen Abwehrvorgänge zu psychischen und/oder psychosomatischen Krankheitsbildern bzw. zur Soziopathie und Delinquenz“ (S. 49).