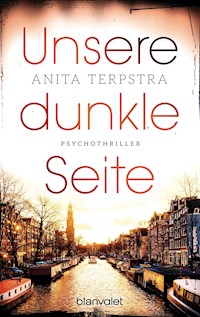
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein weltberühmtes Tänzerpaar, gefangen in einem zerstörerischen Ehedrama mit fatalen Konsequenzen ...
Mischa und Nikolaj sind die Stars der internationalen Ballettwelt. Beruflich erfolgreich, musste das Ehepaar jedoch einen tragischen Schicksalsschlag hinnehmen: Bei einem Autounfall kam ihre gemeinsame Tochter ums Leben. Für einen Neuanfang zogen sie daraufhin von London zurück nach Amsterdam. Als in ihrer Wohnung ein schreckliches Feuer ausbricht, kommen die beiden mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, und plötzlich beschuldigt sich das vermeintliche Traumpaar gegenseitig des versuchten Mordes. Beide haben etwas zu verbergen und nur einer von ihnen sagt die Wahrheit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Mischa und Nikolaj sind die Stars der internationalen Ballettwelt. Beruflich erfolgreich, musste das Ehepaar jedoch einen tragischen Schicksalsschlag hinnehmen: Bei einem Autounfall kam ihre gemeinsame Tochter ums Leben. Für einen Neuanfang zogen sie daraufhin von London zurück nach Amsterdam. Als in ihrer Wohnung ein schreckliches Feuer ausbricht, kommen die beiden mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, und plötzlich beschuldigt sich das vermeintliche Traumpaar gegenseitig des versuchten Mordes. Beide haben etwas zu verbergen und nur einer von ihnen sagt die Wahrheit …
Autorin
Die niederländische Schriftstellerin Anita Terpstra, geboren 1975, studierte Journalismus und Kunstgeschichte und arbeitete danach als freie Journalistin für einige Zeitschriften. Nach »Anders« und »Die Braut« ist »Unsere dunkle Seite« ihr dritter Roman bei Blanvalet.
Von Anita Terpstra bereits erschienen
Anders · Die Braut
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet undwww.twitter.com/BlanvaletVerlag
ANITA TERPSTRA
UNSERE DUNKLE SEITE
Psychothriller
Deutsch von Simone Schroth
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Vonk« bei Cargo, an imprint of Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Anita Terpstra
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung eines Motivs von headspinphoto/photocase.de
JaB · Herstellung: kw/wag
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24672-3V001
www.blanvalet.de
Prolog
So fängt es an
Liebe und Hass liegen dicht beieinander. Für die meisten Leute ist das ganz einfach irgendeine Redensart. Bis etwas passiert und die Welt mit einem Schlag völlig auf dem Kopf steht. Zack-Bumm.
Bei mir war das der Unfall.
Aber davon später mehr.
Hass kommt niemals allein, habe ich festgestellt. Mit ihm kommen so viele andere negative Gefühle: Abscheu. Wut. Selbstmitleid. Wie diese kleinen Fische im Kielwasser von Haien, Walen oder irgendwelchen anderen Meerestieren, die sich auf diese Weise ihren Anteil sichern. Sie können nur dank des anderen, viel größeren Lebewesens bestehen.
Ich glaube, die Schmerzmittel haben mich high gemacht.
Normalerweise bin ich ganz anders.
Noch so eine Redensart, die ich mittlerweile am eigenen Leib erfahren habe: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Stärker, ja, aber nicht unbedingt besser. Denn das fügen Leute, die einem einen solchen Quatsch weismachen wollen, immer sofort hinzu: Ich bin froh, dass mir das passiert ist – es hat mich zu einem besseren Menschen werden lassen.
Wenn jemand so etwas behauptet, wird mir speiübel. Solche Leute gehören zu denen, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass manchmal völlig sinnlose Dinge geschehen. Was soll ein dreizehnjähriges Mädchen daraus lernen, dass es einen Unterschenkel verliert? Oder ein junger Vater daraus, dass er einen Schlaganfall erleidet und im Rollstuhl landet?
Oder ich zum Beispiel, Opfer eines Brandes. Wieso sollte ich dadurch ein besserer Mensch werden, dass die Flammen über meinen Körper hergefallen sind?
Solche Leute kann ich einfach nicht riechen. Wobei das jetzt kein großes Problem mehr darstellen wird, so ohne Nase. Tut mir leid. Galgenhumor. Der Schönheitschirurg hat gesagt, er kann mir eine neue Nase machen. Vielleicht sollte ich zumindest dafür dankbar sein? Dafür, endlich eine hübsche Nase zu bekommen?
Manchmal habe ich Angst, ich werde verrückt. Das macht dieser Ort mit einem. Es liegt an der Stille, die hier herrscht, wenn ich allein bin. Ich habe immer gedacht, ich hätte so langsam alle möglichen Arten der Stille erlebt – die spannungsvolle Stille zwischen dem letzten Tanzschritt auf der Bühne und dem Applaus des Publikums, die verblüffte Stille, wenn ich einen geliebten Menschen ganz tief beleidigt habe, oder er mich –, aber inzwischen weiß ich es besser. Da gibt es zum Beispiel die Stille, wenn mich Angehörige oder Freunde zum ersten Mal sehen.
Oder besser gesagt: das, was von mir übrig ist.
1.
Mischa
»Frau de Kooning?« Eine Frauenstimme, die ich nicht kannte. Freundlich. Ruhig. Leise.
Ich hatte das hier schon einmal erlebt. Ein Déjà-vu. Wasser. Die Kinder.
Ja?
»Frau de Kooning? Mischa?«
Ich sage doch Ja? Himmel, was für eine Nervensäge.
»Sie reagiert nicht.«
Ich antworte doch aber?
Warum war es so dunkel um mich herum? Es gab Lärm und Geraschel. Mir wurde das Augenlid hochgezogen, und jemand leuchtete mir mit einem Lämpchen ins Auge.
»Ah, sehr gut, ihre Pupille reagiert. Sie ist wach.«
Ich wollte, dass die Frau mir das Augenlid noch einmal hochzog. Mit aller Kraft versuchte ich es selbst, aber es gelang mir nicht. Ich glaubte, einen Blick auf etwas Grünes erhascht zu haben, nur konnte ich die Farbe nicht einordnen.
Eine Hand kniff mir in die rechte Schulter. Das tat schrecklich weh.
»Sie reagiert auf Schmerzreize.«
Ach tatsächlich? Soll ich dir mal Schmerzen zufügen?
»Versuchen Sie die Augen zu öffnen, Mischa. Sie liegen im Zentrum für Schwerbrandverletzte.«
Kein Wasser. Feuer diesmal.
»Mein Name ist Jantien, ich bin eine der Pflegekräfte hier.« Kurz wurde es still. Ich wollte, dass sie weitersprach. Sie räusperte sich. »Bei Ihnen zu Hause hat es gebrannt. Sie sind verletzt worden. Aber machen Sie sich keine Sorgen, hier sind Sie in guten Händen.« Ihre Worte waren beruhigend gemeint, wie ein Streicheln über den Kopf, aber bei mir lösten sie ein Prickeln im Nacken aus. Gebrannt hatte es, ja, das wusste ich noch. Der Rauch hatte sich wie eine Würgeschlange um mich gewickelt, die rasenden Flammen hatten Jagd auf mich gemacht.
So anders als Wasser, und trotzdem machte es keinen Unterschied. Kalt gegen heiß, aber beide tödlich. Lebensnotwendig, aber in großen Mengen nicht zu überleben – war das nicht grässlich? Und grauenhaft. Ja, grässlich und grauenhaft. Ohne jedes Zögern nahm das Element einem alles. Nicht, weil es das konnte oder musste, sondern einfach, weil es so war, wie es war. Feuer und Wasser haben kein Gewissen. Irgendwo in meinem Hinterkopf flackerte wie eine kaputte Neonröhre der Gedanke in meinem Bewusstsein auf, dass mich jemand dieser vernichtenden Kraft ausgesetzt hatte.
Die Stimme rief mich ins Jetzt zurück, bevor sich in meinem Kopf ein Name formen konnte. Ich versuchte den Mund zu öffnen, aber das gelang mir genauso wenig wie bei meinen Augen. Ich versuchte meinen Körper zu spüren. Normalerweise hatte ich immer irgendwo Schmerzen. Kein Tag verging, an dem ich mir nicht während der Übungen an der Stange den Schmerz verbiss. Mich steif fühlte. Vor allem im unteren Rücken. Blaue Flecken bekam. Von Hornhaut, Hühneraugen, kleinen Schnitten und Wunden oder fehlenden Zehennägeln ganz zu schweigen.
Nun spürte ich nichts. Und das erschreckte mich. Wenn man nichts spürte, stimmte etwas nicht.
2.
Nikolaj
»Herr Iwanow?«
Ich drehte den Kopf zu der Schiebetür aus Glas. Dahinter ging es zur Schleuse, wie man das Nebenzimmer nannte. Eine junge Krankenschwester – klein und mollig, von Kopf bis Fuß in grüne Schutzkleidung gehüllt, inklusive Handschuhen, Mundschutz und Kappe – schaute mich fragend an.
Ich lag auf der Intensivstation, in einem speziellen Zimmer, das mit einem Luftbefeuchtungssystem ausgestattet war. Auf diese Weise wurde die Luft gereinigt. Der Apparat an der Decke machte ordentlich Krach und hing genau über dem Bett. Ich hätte gar nicht mehr sagen können, welcher Arzt mir das erklärt hatte, denn in den vergangenen Tagen war eine ganze Kompanie von Medizinern an mir vorbeigezogen, um alles Mögliche zu überprüfen, sodass ich es aufgegeben hatte, mir alle genau zu merken: Die Haut schützt uns vor Infektionen, sie regelt die Körpertemperatur und den Feuchtigkeitshaushalt. Durch die Brandwunden hatte meine Haut diese Schutzfunktion verloren. Deswegen lag ich in diesem Zimmer. Um das Infektionsrisiko zu senken, trug das Personal diese Kleidung. Sie erinnerte mich an Filme über den Ausbruch lebensgefährlicher Viren.
Ich wusste, dass es darum ging, mich zu schützen, aber ich fühlte mich dadurch schmutzig. Ich hatte nie den Drang gekannt, mich zu verstecken – das Gegenteil war der Fall gewesen –, doch jetzt empfand ich dieses Gefühl. Denn nun stand ich aus den falschen Gründen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, und daran war Mischa schuld. Wenn ich meine Hände noch hätte gebrauchen können, hätte ich sie ihr um den zarten Hals gelegt und voller Wonne zugedrückt, bis alles Leben aus ihr gewichen wäre. Sie hätte tot sein sollen. Dann wären alle meine Probleme gelöst gewesen.
Über ihren Zustand wusste ich nur, dass sie wegen einer Rauchvergiftung beatmet und im künstlichen Koma gehalten wurde. Das Feuer hatte ihre Atemwege angegriffen, wodurch ein Lungenödem entstanden war.
»Wann nennen Sie mich endlich Nikolaj?«, wandte ich mich an die Schwester.
»Die Polizei ist hier … Nikolaj. Ein gewisser Hans Waanders, ein Ermittler. Er möchte Ihnen einige Fragen im Zusammenhang mit dem Brand stellen. Der Arzt hat ihm die Zustimmung erteilt.«
Ich nickte. Ich wusste, dass der Ermittler schon einmal hier gewesen war, die Ärzte ihn aber nicht zu mir gelassen hatten.
»Gut, dann hole ich ihn jetzt. Das kann einen Moment dauern. Er muss die ganzen Sicherheitsvorkehrungen durchlaufen.« Unter großem Rascheln ging sie weg.
Ich schaute auf meine bandagierten Hände, die vor mir auf dem Tisch lagen. Im Bett bleiben ging nicht. So viel wie möglich aufrecht sitzen, mich bewegen, hatte man mir gesagt: Das erhöhte die Überlebenschancen. Bewegung war gut für meine Lungen, Muskeln und Gelenke.
Hinter mir befand sich ein Wirrwarr aus Apparaten und Drähten, von denen einige mit meinem Körper verbunden waren. Alles um mich herum piepste, pumpte und seufzte.
Würde ich wieder tanzen können?
Als mir die Ärztin erklärt hatte, was mit mir los war, war das meine erste Frage gewesen. Verbrennungen dritten Grades auf dem Rücken, auf der rechten Schulter, an beiden Händen und am rechten Oberschenkel, hier und da Verbrennungen zweiten Grades am Rest meines Körpers. Die Verbrennungen dritten Grades mussten operativ behandelt werden, weil sie nicht von selbst heilen würden. Bei einem Teil der Verbrennungen zweiten Grades geschah das meistens von allein, doch trat dieser Prozess nicht innerhalb von zwei Wochen ein, so operierte man. Bei diesem Eingriff schabte der Chirurg die verbrannte Haut ab, bis wieder gesundes Gewebe zum Vorschein kam. Weil dabei ordentlich Blut floss, konnte man jedes Mal nur eine kleine Fläche operieren. Wahrscheinlich waren mehrere Operationen nötig, um mich zusammenzuflicken. An die Stellen, an denen man die Haut entfernt hatte, verpflanzte der Chirurg ein Hauttransplantat von den intakten Teilen meiner Oberschenkel.
Weil transplantierte Haut zum Zusammenziehen neigt und nicht mitwächst, entstehen im Nachgang oft Probleme. Manchmal strafft sich die Haut so sehr, zum Beispiel an den Gelenken, dass man sich nicht gut bewegen kann. Von den Narben ganz zu schweigen.
»Mein Körper ist mein Instrument«, hatte ich herausgebracht. Mit Händen und Armen musste ich meine Partnerin in die Luft heben, mit Beinen und Füßen Bewegungen wie eine Pirouette, eine Arabesque und ein Grand Allegro ausführen können.
»Sie werden auf alle Fälle in der Lage sein, Ihre Hände wieder für normale Tätigkeiten zu benutzen.«
Normale Tätigkeiten? Meinte sie damit Anziehen, Rasieren, Zähneputzen, Einkaufen und lauter solche geistestötenden Dinge? Die gingen mir wirklich völlig am Arsch vorbei. Das sagte ich auch laut, und die Ärztin quittierte meinen Wutausbruch mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ich will wieder tanzen können, und wenn ihr das hier nicht auf die Reihe bekommt, sorgt gefälligst dafür, dass ich in ein Brandwundenzentrum verlegt werde, wo man das hinkriegt. Egal ob hier oder im Ausland!«
»Dort wird man Ihnen dasselbe sagen wie hier«, hatte sie erwidert. Ihr Blick war ernst, und eine tiefe Falte durchzog die Mitte ihrer Stirn.
»Das werden wir dann ja sehen.« Diese Person begriff ganz offensichtlich nicht, worum es hier ging. »Stellen Sie sich vor, ich sage Ihnen, dass Sie nie wieder operieren können – na?«
»Natürlich würde ich das sehr schlimm finden«, antwortete sie beschwichtigend. »Aber dann würde ich mir eine andere Tätigkeit suchen. In die Forschung gehen oder in die Lehre …«
Ich ließ sie nicht ausreden. »Nicht tanzen zu können bedeutet, nicht zu leben.«
»Wir lassen uns gerade zu voreiligen Überlegungen hinreißen«, meinte sie ruhig und zugleich energisch. »Wir müssen …«
Ihre restlichen Worte gingen im Piepsen verschiedener Apparate unter. Die Ärztin überprüfte alles und fand das Resultat offensichtlich beruhigend, denn sie legte mir die Hand auf die Schulter.
»Es tut mir leid. Ich habe Sie aufgewühlt, das wollte ich nicht. Dieses Gespräch kommt viel zu früh, und eigentlich sollten wir es noch gar nicht führen. Ich muss Sie nachdrücklich bitten, ruhig zu bleiben. So viel Aufregung ist in Ihrem Zustand nicht gut.«
Ich hatte ihr widersprechen wollen, aber tatsächlich fühlte ich mich sehr angeschlagen. Ich war es gewohnt, drei Stunden hintereinander zu tanzen, Hochleistungssport zu betreiben, aber die Erschöpfung, die meinen Körper jetzt quälte, war eine neue Erfahrung für mich. Eine sehr unangenehme. Ich war völlig fertig. Eine Krankenschwester hatte mir gesagt, meine Genesung lasse sich mit einem Marathon vergleichen, der aber nicht nach wenigen Stunden geschafft sei, sondern bis zu einer Woche dauere. Ich erhielt spezielle Nahrung, viertausend Kalorien am Tag. Durch die Brandwunden war mein Stoffwechsel schneller, und wenn ich nicht genügend Kalorien bekäme, würde mein Körper Muskelgewebe abbauen, weil er nun einmal Energie benötigte.
»Ich begreife sehr gut, dass Sie sich Sorgen machen, aber es ist wirklich noch zu früh, um etwas Eindeutiges über Ihre Genesung sagen zu können«, fuhr die Ärztin fort. »Sie haben gerade eine entsetzliche, traumatische Feuersbrunst miterlebt. Wir belassen es fürs Erste dabei. Versuchen Sie ein wenig zu schlafen. Die Ruhe wird Ihnen guttun.«
»Kann ich Mischa sehen?«
»Im Moment können wir weder Sie noch Ihre Frau transportieren. Wegen der Infektionsgefahr«, erklärte die Ärztin.
»Darf ich Besuch bekommen?«
»Am liebsten so wenig wie möglich, aber Sie können ja auch einfach anrufen. Oder vielleicht skypen? Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie einen Sohn. Ihr Gesicht ist unverletzt geblieben, Skypen ist also kein Problem.«
Eine der Pflegekräfte hatte sich behutsam nach Angehörigen erkundigt. Sollte sie vielleicht jemanden für mich kontaktieren? Ganz eindeutig hatte sie Mitleid mit mir gehabt, als ich erwiderte, das sei nicht nötig. Meine Schwiegermutter Dorothée hatte wissen wollen, ob sie mich besuchen dürfe, aber dafür hatte ich keine Zustimmung erteilt.
»Dann vielleicht Freunde?«, hatte die Schwester vorgeschlagen, aber mir war niemand eingefallen, den ich hätte anrufen können; zwar hatte ich beim Ballett einige Freunde, aber keinen Busenfreund. Ein paar Stunden später war die Krankenschwester mit Kleidungsstücken erschienen, die ehemalige Patienten zurückgelassen hatten. »Sie wollen doch sicher nicht den ganzen Tag in einem Krankenhauskittel herumlaufen.« Ich hatte mich überwinden müssen, die Sachen anzuziehen, aber es hätte mich noch größere Überwindung gekostet, einen der Tänzer anzurufen und ihn zu bitten, für mich Unterhosen zu kaufen. Sobald ich von der Intensivstation käme, würde ich das sicher selbst tun können, auch wenn ich kein Geld zur Verfügung hatte. Nicht einmal ein Handy besaß ich mehr.
Natürlich konnte ich das Festnetz benutzen, aber ich hatte mich noch nicht bei Gregory gemeldet. Was um Himmels willen sollte ich zu dem Jungen sagen? Ich schaute aus dem Fenster. Nicht, dass es da viel zu sehen gegeben hätte. Eine Mauer, Glasscheiben, dahinter Zimmer voller kranker Menschen. Ich war überhaupt nicht dazu in der Lage, etwas aufzunehmen. In meinem Hirn herrschte ein dichter Nebel, und das ärgerte mich. Für das, was jetzt ganz unvermeidlich auf mich zukam, musste ich völlig klar im Kopf sein.
3.
Nikolaj
Die Glastür öffnete sich. Die Gestalt, die da hereingewatschelt kam, erinnerte mich an ET, nachdem ihn Elliott in eine Decke gewickelt hatte. Der Mann maß höchstens einen Meter sechzig, und was ich von seinem Gesicht erkennen konnte, war voller Falten. Seine braunen Augen, die unter den buschigen Augenbrauen und der großen Brille mit den dicken Gläsern fast verloren gingen, lagen tief in ihren Höhlen.
»Hans Waanders, Ermittler.« Er streckte seine in Latex gehüllte Hand aus. Durch den Mundschutz klang seine Stimme gedämpft.
Ich hob beide Arme, die von oben bis unten bandagiert waren.
»Bitte entschuldigen Sie.«
Waanders studierte meinen nackten Oberkörper mit den vielen Tätowierungen. Die meisten waren schwarz-weiß. Auf meiner rechten Schulter prangte James Dean, jetzt allerdings halb verbrannt. Auf meiner linken Schulter befand sich der Joker. Auf meiner linken Brust, auf der Höhe meines Herzens, gab es drei rote Schrammen, die die Spur einer Tigerkralle darstellen sollten; die hatte ich mir selbst verpasst. Auf dem Bauch hatte ich ein Kolovrat-Zeichen, ein altes slawisches Symbol für Sonne, Energie und Licht. Auf meiner rechten Hüfte war ein heulender Wolf zu sehen, ein Verweis auf meine Rolle in Prokofjews Peterund der Wolf, die ich mit neunzehn Jahren getanzt hatte.
Auf dem Rücken hatte ich noch weitere Tattoos, auch wenn die wahrscheinlich größtenteils verschwunden waren. Die Kirche des kleinen Dorfes, in dem ich geboren war, Tränen über dem Wort »Memories« und das Nationalsymbol von Russland, einen Doppeladler mit Schild. Auf der Innenseite meines linken Arms prangte ein großes Kreuz, und auf meiner linken Ferse stand das Wort »Achilles« auf Altgriechisch.
»Das heilt schnell wieder«, meinte Waanders mit einer Geste in Richtung meiner Brusttätowierung, die jetzt halb aus Narbengewebe bestand.
»Mein erstes Tattoo. Mir war es zu orange geraten, deswegen habe ich die Tinte rausgeschnitten.«
»Nehmen Sie mir das nicht übel«, entschuldigte sich Waanders noch einmal. »Ich dachte …« Er machte eine wegwerfende Geste. »Small Talk liegt mir nicht so, deswegen möchte ich auch sofort zur Sache kommen. Die Ärzte sagen, Sie sind in der Lage, einige Fragen zu beantworten. Es tut mir leid, dass ich Sie unter den gegebenen Umständen damit belästigen muss.«
»Sie tun Ihre Arbeit. Dafür habe ich Verständnis.«
»In ein paar Wochen gehe ich in Pension. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, meinen letzten Fall bereits abgeschlossen zu haben.«
»Haben Sie schon mit Mischa gesprochen?«
»Ihre Frau ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Hat man Ihnen das nicht gesagt?«
»Und das Haus?«
»Das Haus ist …« Waanders suchte nach Worten, um den Zustand zu beschreiben, fand jedoch keine. Er setzte sich mir gegenüber und legte ein Handy auf den Tisch. Damit zeigte er mir Fotos des abgebrannten Hauses. Die vordere Fassade stand noch, war aber zum größten Teil schwarz versengt. Die zwei großen Löcher, in denen sich die Fenster der unteren Etage befunden hatten – Wohnzimmer mit Küche und unser Schlafzimmer –, sahen aus wie die hohlen Augen eines Totenschädels. Dahinter standen noch einige Wände aufrecht. Dasselbe galt für den zweiten Stock, also für Bad, Spielzimmer und Gregorys Schlafzimmer. Der Dachboden, ein drittes, kleineres Stockwerk mit spitzem Giebel, existierte nicht mehr. »Eingestürzt«, erklärte mir Waanders. »Das Gebäude wurde als unbewohnbar eingestuft.«
»Das Haus gehört … gehörte Freunden von uns«, sagte ich. »Sie sind gerade auf Weltreise. Wir wollten ein Haus kaufen, waren aber bisher nicht dazu gekommen, weil unser Haus in London noch verkauft werden musste. Erst dann wollten wir unsere Möbel und den größten Teil unserer anderen Sachen rüberholen.« Ich betrachtete noch einmal das letzte Foto. »Mein Gott, was für ein Chaos.«
Waanders räusperte sich. »Die Feuerwehr hat inzwischen die ersten vorläufigen Untersuchungen abgeschlossen, aber man weiß noch nicht, wie das Feuer entstanden ist.«
»Man weiß es noch nicht?«, wiederholte ich. Ich ärgerte mich über meinen Akzent, weil er stärker wird, wenn ich müde bin. Ich hatte Sprachunterricht genommen, um mein Niederländisch und mein Englisch zu perfektionieren. Andere Leute fanden den Akzent meiner russischen Kollegen niedlich, aber ich nicht. Es war, als würde ich dann weniger ernst genommen. Meine Muttersprache zu benutzen erlaubte ich mir nur, wenn ich wütend war. Das machte immer Eindruck.
Waanders’ Augen verengten sich. »Sie wissen, wie das Feuer verursacht wurde?«
»Das weiß ich in der Tat. Meine Frau … Mischa. Sie hat das Haus in Brand gesteckt. Sie hat versucht, mich umzubringen.«
4.
Nikolaj
»Ihre Frau hat versucht, Sie umzubringen?«
Waanders klang überrascht.
Ich nickte.
Der Ermittler räusperte sich noch einmal. Langsam nervte mich das. »Warum sollte sie Sie umbringen wollen?«
»Das müssen Sie sie selber fragen«, erwiderte ich kurz angebunden. Kühl.
»Entschuldigung, ich werde die Frage umformulieren. Warum glauben Sie, Ihre Frau würde Sie umbringen wollen?«
»Weil ich mich scheiden lassen wollte.«
»Und das haben Sie ihr am Abend des Brandes gesagt?«
Ich nickte wieder.
»Es gibt ja so einige Ehen, die nicht gut laufen, meine eingeschlossen. Aber dass man darum seinen Partner umbringt, erscheint mir, äh … doch sehr drastisch?« Er ließ den letzten Satz wie eine Frage klingen.
»Ich habe gesagt, ich würde ihren Sohn mitnehmen.«
»Warum das?«
»Seit dem Unfall … Sie wissen von dem Unfall?«
Waanders nickte.
»Seit dem Unfall ist Mischa … Ich erkenne sie nicht mehr wieder. Sie trinkt. Ich habe schon so oft versucht, das Ganze anzusprechen, sie angefleht, sich Hilfe zu suchen, aber ich finde keinen Zugang zu ihr. Und ihr Zustand hat Auswirkungen auf meinen Sohn. Sie sorgt nicht richtig für ihn, darum habe ich auch eine Nanny eingestellt. Ich bin wegen meiner Arbeit nicht oft zu Hause, und nur so kann ich ruhigen Gewissens das Haus verlassen, weil ich weiß, dass man sich gut um Gregory kümmert. Ich finde es abscheulich, Mischa im Stich zu lassen, aber ich kann nicht länger dabei zusehen, wie sie uns mit in den Abgrund reißt.«
Waanders nickte langsam. Verständnisvoll.
Eine ältere Krankenschwester mit dunklen Augen betrat das Zimmer. Ihren Namen vergaß ich immer wieder. Ich schielte auf ihr Namensschild. Willy. Sie kontrollierte den Infusionsständer und maß meinen Blutdruck. Als sie den Wert ablas, schaute sie missmutig drein. »Dauert es noch lange? Mir ist wichtig, dass sich Herr Iwanow jetzt ein wenig ausruht.«
»Eine Frage noch, dann gehe ich. Versprochen«, antwortete Waanders. »Das würde mir bei den weiteren Ermittlungen sehr helfen.«
»Ist das in Ordnung für Sie?«, wandte sich Willy an mich.
Ich war zwar schrecklich erschöpft, wollte das Ganze aber so schnell wie möglich hinter mich bringen.
»Wie sieht es mit den Schmerzen aus?«
Die waren fast unerträglich, aber das hätte ich niemals zugegeben. Außer Paracetamol bekam ich Morphiumpflaster. Als Balletttänzer war ich es gewohnt, Schmerzen auszuhalten. Schmerz war keine feste Größe – er lebte, wurde größer, kleiner, stechender, schwächer, härter, kantiger, je nachdem, wie sehr ich mich anspannte oder mit welcher Verletzung ich mich gerade herumschlug. Wie kein anderer vermochte ich den Schmerz zu beherrschen, ihn mir zu verbeißen, ihn wegzustoßen, umzuformen, weil ich wusste, dass darin der Preis bestand, den ich zu bezahlen hatte, um noch höher zu kommen, um zu glänzen. Die Kunst bestand darin, so auf der Bühne zu stehen, als verlange einem der Tanz nicht die geringste Mühe ab; das Publikum musste glauben, es sei einfach, seine Partnerin mit einer Hand über den Kopf zu heben oder zehn Pirouetten hintereinander zu vollführen.
Natürlich war dem nicht so. In den Muskeln reicherte sich Säure an, das Herz pumpte wie verrückt Blut durch den Körper, man geriet außer Atem, ganz egal, wie oft und wie lange man geübt hatte. Und dann die Verletzungen. Ich kannte keinen einzigen Tänzer, der noch nie mit einem verstauchten Knöchel, offenen Blasen oder einer gezerrten Wade sein Programm absolviert hatte.
Aber dieser Schmerz war ein ganz anderes Kaliber. Er erwies sich als neu für mich. Hier ging es nicht um eine Leistung, nicht um Freude, einen Höhepunkt, Adrenalin; es gab keine begeisterten Rezensionen und keinen reinigenden Applaus eines vollen Saals.
»Schon in Ordnung«, sagte ich.
Willy nickte und verschwand, nachdem sie Waanders einen strengen Blick zugeworfen hatte. Der nickte demütig, doch in seinen Augen las ich etwas ganz anderes.
»Können Sie mir erzählen, was am Abend des Feuers genau vorgefallen ist?«
5.
Nikolaj
Nach einem langen Probentag kam ich nach Hause. Drinnen brannte kein Licht, und das befremdete mich, denn Mischa war früher aufgebrochen als ich. Das wusste ich, weil der Portier beim Nationalballett mir sagte, ich hätte sie knapp verpasst. Aber vielleicht kaufte sie ja noch ein. Gregory war nicht da, er übernachtete zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Freund.
Mischa war allerdings doch zu Hause, stellte ich beim Betreten der Küche fest. Sie saß bei ausgeschaltetem Licht mit einem Glas Wein am Tisch. Vor ihr stand die noch zu einem Viertel gefüllte Flasche.
»Auch einen Schluck?«, hatte sie gefragt.
»Mir scheint, du hattest schon genug.«
»Das hier ist mein erstes Glas.«
Ich schaltete das Licht ein. »Danach sieht es aber nicht aus«, sagte ich und hielt demonstrativ die Flasche hoch.
»Die habe ich schon vor einer Woche aufgemacht.«
»Bist du sicher, dass das keine andere Flasche war?«
»Was meinst du damit?«, fragte sie giftig.
»Du trinkst viel zu viel.«
Auseinandersetzungen mit Mischa waren anders als die, die ich von anderen Partnerinnen kannte. Mit denen war es einfach gewesen: Ich griff sie an, sie mich. Beschuldigungen flogen hin und her, es gab Geschrei und Tränen. Mit Mischa war das nicht so. Manchmal lief sie davon, manchmal reagierte sie gar nicht auf das, was ich sagte, sondern machte einfach mit dem weiter, was sie gerade tat, als hätte sie mich überhaupt nicht gehört; manchmal entschuldigte sie sich mit einem freundlichen Lachen, und manchmal sprach sie plötzlich über etwas ganz anderes. Was sie jetzt tat, hatte sie noch nie zuvor gemacht.
Sie schlug mich. Mit der flachen Hand. Auf die Wange.
Ich brach in Gelächter aus, ich konnte einfach nicht anders. »Ist das alles?«, wollte ich wissen.
Daraufhin hatte sie mir den Wein ins Gesicht geschleudert. »Wie kannst du es wagen?«, schrie sie.
»Wie kannst du es wagen?«, blaffte ich zurück.
»Du machst mich kaputt.«
»Du machst dich selbst kaputt, indem du so viel trinkst. Und schrei mich nicht so an.« Mit einem Geschirrtuch tupfte ich mir das Gesicht ab.
Sie senkte die Stimme; ihre Wut war trotzdem noch deutlich wahrnehmbar. »Jetzt übertreib doch nicht so schrecklich. Ich trinke ein Glas Wein, weil ich mich nach einem harten Arbeitstag entspannen will. Was ist denn daran so falsch?«
»Für heute Abend ist eine Bühnenprobe angesetzt, an der du teilnehmen solltest, das ist daran so falsch.« In ein paar Tagen würde die Premiere von Mata Hari stattfinden. »Früher hast du nie getrunken.«
»Früher habe ich so einige Dinge nicht getan.« Das klang wie eine unschuldige Bemerkung, aber sie war natürlich alles andere als unschuldig. In dieser Phase unseres Streits wirkten alle Worte wie Giftpfeile. Sie sollten den anderen verletzen, ihn ausschalten.
Aber noch viel mehr waren sie eine Grenze. Seit dieser einen Nacht hatte sich alles unwiderruflich verändert, auch wenn wir uns krampfhaft bemühten, weiterzumachen wie bisher. Wenn ich fragte, was sie mit ihrer Bemerkung meinte, überquerten wir diese Grenze. Und etwas sagte mir, dass es dann keinen Weg zurück geben würde. War ich dazu bereit? Konnte ich mir das zum jetzigen Zeitpunkt erlauben?
Nach einem ganzen Tag Proben war ich völlig erschöpft und wollte vor dem Essen ein Nickerchen machen, statt einen alles versengenden, vernichtenden Streit zu führen, der mich noch zusätzliche Kraft kosten würde. Nein, entschied ich, jetzt war nicht der geeignete Moment. Ich brauchte meine gesamte Energie für die anstehende Nussknacker-Vorstellung. Dieses Stück hatte vor einigen Wochen Premiere gefeiert. Ich tanzte zusammen mit Maja, meiner Landsfrau, die Hauptrolle. Mit ihr zu arbeiten war schön. Wir teilten dieselbe Mentalität: hart arbeiten, nicht jammern, tanzen bis zum Umfallen. Und ich brauchte mehr Zeit, um meine Probleme zu lösen. Ich war dabei, einem bereits existierenden Ballett neues Leben einzuhauchen, dem ersten Akt der Giselle. In meinen Augen erhielt eine ganze Reihe klassischer Ballettstücke nicht die angemessene Aufmerksamkeit, und ich wollte das ändern, indem ich neue Inszenierungen schuf.
»Wie ist es heute gelaufen?«, wechselte ich das Thema, doch sie zuckte nur mit den Schultern. »Ich bin Kai begegnet. Er sagte, er ist sehr zufrieden.« »Zufrieden« bedeutete bei Kai van Wijnen, dem Direktor des Nationalballetts, so viel wie »begeistert«. Das hatte er zwar ganz und gar nicht gesagt, aber ich war neugierig, ob mich Mischa ins Vertrauen ziehen würde.
Sie lachte heiser. »Warum spricht er mit dir über mich?«
»So war das nicht«, gab ich zurück. Und das weißt du auchganz genau, dachte ich. Ganz offensichtlich war sie auf Streit aus. Jedes Gespräch, das wir in der letzten Zeit miteinander führten, glich einem Minenfeld. Ein einziges falsches Wort konnte eine Explosion verursachen. Nur in Gregorys Gegenwart hielten wir uns zurück. Unser Sohn war eine Art menschliche Sicherung für Minen.
»Wir sind uns im Flur begegnet, nach eurer Durchlaufprobe.« Kai war der Choreograf von Mata Hari. Dass ich ihm begegnet war, entsprach der Wahrheit, aber danach hatten wir das Gespräch unter vier Augen in seinem Büro fortgesetzt. Kai hatte wissen wollen, wie es Mischa ging. Wie alle anderen im Corps de Ballet wusste er, dass sie trank. Vor einigen Wochen hatte Kai uns beide zu sich gerufen und uns ohne Umschweife gefragt, was los sei. Wir hatten jahrelang als Tänzer beim Royal Ballet in London gearbeitet, und man hatte uns als Stars ans Niederländische Nationalballett geholt, weil man sich davon ein volles Haus erhoffte. Eine ordentliche Investition, deswegen war es nur logisch, dass sich Kai Sorgen machte. Mischa hatte ihn beschworen, das Ganze sei Unsinn, sie trinke hin und wieder ein Glas zur Entspannung, mehr nicht. Sie hatte Besserung gelobt, gesagt, sie habe eine schwere Zeit hinter sich, und das wisse er auch nur allzu gut. Dieses Gespräch sei für sie aber ein Weckruf, und sie werde sich jetzt einzig und allein aufs Tanzen konzentrieren.
Kai hatte ihr geglaubt – was blieb ihm auch anderes übrig? Aber ich wusste, dass er überall Augen und Ohren hatte. Spione, wenn man das so nennen wollte. Neulich hatte eine der Tänzerinnen aus dem Ensemble einen Schluck aus Mischas Teetasse getrunken, die auf dem Klavier stand. Nur hatte sich herausgestellt, dass sich darin kein Tee, sondern Wodka befand. Außerdem gab es Beschwerden über Mischa. Oft verschwand sie ganz plötzlich, und niemand wusste, wo sie steckte. Wenn sie dann wieder erschien, hatte sie irgendeine vage Ausrede auf Lager und erklärte, es »wäre nichts«.
Ich hatte keine andere Möglichkeit gesehen als den Angriff. Tanzte Mischa vielleicht nicht gut? Kai hatte zugeben müssen, dass das nicht der Fall war. »Noch nicht«, hatte er hinzugefügt. Eine ganz deutliche Warnung.
Natürlich wusste Kai, dass wir nicht ohne Konflikte vom Royal Ballet weggegangen waren – er hatte ja überall Kontakte. Aber diese Probleme hatten mich betroffen, nicht Mischa. Ich betrachtete das Ganze immer noch als Beweis für bürgerliche Spießigkeit. Hatte ich denn jemals weniger Leistung gebracht, weil ich hin und wieder Hasch rauchte oder Kokain nahm? Ich tanzte dann sogar besser, konnte länger durchhalten. Aber gut, das war einer der Gründe für unsere Rückkehr ans Niederländische Nationalballett gewesen.
Und was Kai anging: Der führte nur ein wenig Theater auf, um uns zu zeigen, wer hier der Boss war. Ich kannte ihn noch aus der Zeit, bevor Mischa und ich nach London gegangen waren. Er wusste, was er sich da ins Haus geholt hatte, oder besser gesagt, wen. Ich fand, er hätte keinen Grund zum Rumjammern. Unsere Namen waren ein Publikumsgarant, trotz des allgegenwärtigen Klatschs. Oder vielleicht genau deswegen. Mischa und ich bildeten ein Traumpaar. Ein Traumpaar, das tief gefallen, dann jedoch wie ein Phönix aus der Asche wiederauferstanden war, stärker als jemals zuvor.
Dieses Bild vermittelten wir zumindest nach außen hin.
Ich hatte mich im Griff, aber Mischa? Ich wusste, ich musste mit ihr reden, nur wie? Wann? Und wie sollte mir das gelingen, ohne einen Streit anzufangen, ohne dass sie mir vorwarf, das alles wäre meine Schuld – ohne ihre Drohung, allen die Wahrheit zu sagen?
Bei meinem letzten Versuch, mit ihr über ihre Alkoholsucht zu sprechen, hatte sie mir ein Glas an den Kopf werfen wollen. Es hatte mich nur ganz knapp verfehlt.
»Kai weiß, dass du trinkst. Alle wissen das inzwischen.«
»Jetzt übertreib doch nicht so. Trinken! Ab und zu ein Gläschen zur Entspannung. Das tun ganz viele andere Leute auch.«
»Auf der Arbeit? Während der Proben?«
»Das ist völliger Unsinn. Und du, du mit deinem Kokain?« Sie wandte den Blick ab, wollte mir nicht in die Augen schauen.
Ich ignorierte ihre Frage. »Letzte Woche hat mich Kai einbestellt, weil eine der Tänzerinnen im Corps de Ballet einen Schluck von deinem Tee getrunken hatte.«
Ganz kurz verbarg Mischa das Gesicht in den Händen, und als sie aufblickte, sah ich, dass sie lächelte. »Ist das alles? Ich war erkältet und hatte Halsschmerzen. Deswegen habe ich ein paar Tropfen Echinaforce-Tinktur in meinen Tee getan. Um meine Widerstandskräfte zu stärken. Da ist ein ganz kleines bisschen Alkohol drin. Du meine Güte, also wirklich«, sagte sie bissig.
Eines musste ich Mischa lassen: Sie konnte so gut lügen wie niemand sonst. So gut, dass sie überall durchkam, das hatte ich nur allzu oft miterlebt.
»Wer hat denn diesen Schluck aus meiner Tasse getrunken? Anna vielleicht? Die hasst mich, und das weißt du auch. Sie hätte erste Solistin werden sollen, aber dann kam ich. Kein Wunder, dass sie bösartigen Klatsch über mich verbreitet.«
Ich musste zugeben, dass ich nicht wusste, von wem die Information stammte. Danach hatte ich nicht gefragt.
Mischas Augen füllten sich mit Tränen. »Wie kannst du nur, Nikolaj? Warum glaubst du einer Wildfremden wie Anna mehr als mir?«
Eine wütende Mischa war mir lieber als eine verletzte Mischa. Ich kannte keinen einzigen Mann, der mit den Tränen einer Frau umgehen konnte, und ich selbst war da keine Ausnahme.
»Mischa …«
Sie beugte sich zu mir, legte mir eine Hand auf den Arm und streichelte ihn zärtlich. »Wir waren einmal ein so gutes Tanzpaar, du und ich. Wir haben einander perfekt ergänzt. Was ist nur mit uns passiert?«, flüsterte sie. Dann ließ sie die Finger langsam nach oben wandern, in Richtung meiner Brust. Sie berührte die Knöpfe meines Hemdes und öffnete einen nach dem anderen.
Ich packte ihre Finger und hielt sie fest umklammert. Ich durfte mich nicht ablenken lassen, nicht vergessen, wie berechnend Mischa war. Sie bekam immer, was sie wollte. Heute Abend würde sie ganz einfach zugeben müssen, dass sie ein Problem hatte und Hilfe brauchte. »Eine gute Frage, Mischa. Warum vertraust du mir nicht? Sei ehrlich. Warum kannst du mir gegenüber nicht eingestehen, dass du zu viel trinkst? Lass mich dir helfen. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn du eine Weile in eine Suchtklinik gehst.« Dann hätte ich auch mehr Zeit. »Das braucht niemand zu wissen, niemand außer mir. Bei mir darfst du schwach sein, ich werde dir …«
Sie riss ihre Hand los und zog mir die Fingernägel wie eine Kralle über die Brust, sodass dort rote Striemen zurückblieben. »Dreh das Ganze jetzt nicht um, Nik! Du hasst Schwäche, du liebst nur starke Menschen. Du hast doch keine Ahnung, wie man mit Schwäche umgeht. Du meidest sie wie eine ansteckende Krankheit. Wie eine heiße Kartoffel würdest du mich fallen lassen.«
»Das ist doch nicht wahr! Habe ich das vielleicht getan, als sich herausgestellt hat, dass du schwanger bist?«
»Ha! Wenn du dann nicht in der ganzen Ballettszene untendurch gewesen wärst, weil du dich aus dem Staub machst, und das nach alldem, was du dir schon geleistet hattest, dann hättest du das getan, ja.«
»Jetzt gehst du zu weit.«
»Du wolltest doch, dass ich ehrlich zu dir bin? Hast du dich in deiner ach so großen Güte auch schon mal gefragt, warum ich trinke, hm?«
»Ich warne dich …«
»Wovor denn? Was willst du denn tun? Lass mich raten: nichts. So wie du immer nichts tust, gar nichts. Nein, warte, das stimmt nicht: Du tust alles, solange es dir nutzt.«
Mich juckte es in den Fingern – am liebsten hätte ich ihr eine gelangt. In Gedanken hatte ich das bereits unzählige Male getan. Ihr eine ordentliche Ohrfeige versetzt, die sie zum Schweigen brachte und ihr wieder ins Gedächtnis rief, wer hier der Boss war.
Mischa goss sich ein weiteres Glas ein. Ich ignorierte das. »Bist du bereit für die Premiere?«, wechselte ich wieder das Thema, weil ich sie auf diese Weise beruhigen wollte. Dafür verachtete ich mich selbst, diese Version meiner selbst, aber ich rief mir ins Gedächtnis, dass ich die Sache vorerst mit Vernunft anzugehen plante.
»Wenn du mit mir hättest tanzen wollen, wüsstest du das längst.«
Ich ermahnte mich innerlich zur Ruhe.
»Mies …«
»Nenn mich verdammt noch mal nicht Mies!«, schrie sie. In ihren Augen schimmerte ein wütender Glanz.
Nein, der Alkohol machte meine Frau alles andere als umgänglich. »Mischa … So war es nicht, und das weißt du auch.« Wie oft hatte ich ihr das schon erklärt? »Als wir ans Nationalballett gegangen sind, haben wir besprochen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, uns getrennt weiterzuentwickeln.«
»Von wegen besprochen! Du hast es damals vorgeschlagen, und ich war dagegen.«
»Dann hättest du das sagen müssen.«
»Ha, guter Witz! Du hast mich auflaufen lassen, und alle waren dabei. Hätte ich da sagen sollen, dass ich das nicht will? Dann wäre ich die Bitch gewesen, die dir nichts gönnt oder die sich ohne dich nichts zutraut.«
Sie sprach von der Zeit, als die Rollen für den Nussknacker und Mata Hari verteilt wurden. Vom Royal Ballet waren wir es gewohnt, dass die Ergebnisse am Schwarzen Brett ausgehängt wurden, aber Kai handhabte es anders: Er rief alle Tänzer zusammen und verkündete vor versammelter Mannschaft, wer welche Rolle bekam. Oder gar keine. Dann waren immer alle entsetzlich nervös. Die ersten Solisten, wie Mischa und mich und noch ein paar andere, die genau wussten, sie würden in einem der beiden Stücke die Hauptrollen bekommen, betraf das nicht so sehr. Jeder Tänzer im Corps de Ballet hoffte darauf, sich im Laufe der Jahre zum ersten Solisten hochzuarbeiten, was natürlich nur die wenigsten schafften.
Bei dieser Gelegenheit hatte ich verkündet, Mischa und ich wären übereingekommen, unsere Rollen mit anderen Partnern zu tanzen, um uns künstlerisch weiterentwickeln zu können.
Das hatte ich vorher mit Kai besprochen, und damals hatte er abwehrend reagiert. Die Aktion war gemein von mir gewesen, das wusste ich ganz genau; aber ich wusste auch, dass sich Mischa niemals dazu bereit erklärt hätte. Deswegen bestand meine einzige Chance darin, sie unvorbereitet damit zu konfrontieren. Ich kannte sie gut genug, um zu wissen: Sie wollte keinen Gesichtsverlust riskieren. Und für Kai galt dasselbe.
Wie sich herausstellte, hatte ich mich nicht getäuscht. Mischa glänzte auf der Bühne nicht nur wegen ihrer fabelhaften Technik, sondern auch wegen ihrer großartigen Schauspielkunst. Nach meinen Worten, die ein heftiges Gemurmel auslösten, entgleisten ihr nicht eine Sekunde lang die Gesichtszüge. Nur ich erkannte die Wut, die die Iris in ihren Augen ein ganz klein wenig dunkler werden ließ, und Kais verzerrtes Lächeln. Danach hatte er mich zu sich gerufen, und ich hatte mich von ihm zusammenstauchen lassen. Diesen Preis hatte ich nur zu gern bezahlt, und außerdem hatte mir das Schlimmste noch bevorgestanden, denn zu Hause hatten Mischa und ich eine heftige Auseinandersetzung ausgefochten.
»Wie oft muss ich es dir denn noch erklären? Das ist für uns beide die beste Lösung. Auf diese Weise können wir den Kritikern den Mund stopfen, die sagen, dass wir einzig und allein gut sind, weil die Chemie zwischen uns stimmt. Wir können zeigen, dass wir genauso viel leisten, wenn wir mit anderen tanzen.«
»Manchmal denke ich, du glaubst deine eigenen Lügen sogar.« Sie leerte ihr Glas und knallte es heftig auf die Kücheninsel. Sofort nahm sie die Flasche und schenkte es wieder voll. »Ich darf doch?«
»So geht es nicht weiter, Mischa. Ich dringe einfach nicht zu dir durch. Ich glaube, es ist besser, wenn ich eine Zeit lang weggehe. Und Gregory nehme ich mit.« Ich war kein Therapeut. Ich will eine Partnerin, eine mir ebenbürtige Partnerin, niemanden, der sich an mir festklammert. Ich will jemanden, der mich herausfordert, mich zu einer Steigerung treibt, nicht jemanden, der mich in seinem Elend mit in den Abgrund zieht.
Das dachte ich, aber ich sprach es nicht aus. Die krasse Wahrheit bestand darin, dass Mischa zu einer Belastung geworden war. Zum Teil durch meine eigene Schuld, das schon, aber ich hatte nicht vor, mir den Rest meines Lebens oder meine Karriere dadurch versauen zu lassen.
Der zweite Schlag kam rascher und auch heftiger als erwartet.
»Du Arschloch, wage das ja nicht. Wage es nicht, mir noch mehr wegzunehmen.« Ihre Stimme klang heiser. Laut und stoßweise holte sie Atem.
Wir wussten beide, was sie meinte.
Ich rieb mir über die Wange. »Lass dir helfen.«
»Und wenn nicht?«
Ich wandte den Blick ab, schaute auf das durchgesessene Ledersofa, die ausgeblichenen Gardinen und das altmodische große Fernsehgerät. Unsere Freunde hatten jahrelang für ihre Weltreise gespart und in diesem Zeitraum nichts Neues angeschafft. »Sein Geld kann man nur ein einziges Mal ausgeben«, hatten sie erklärt. Prioritäten, darauf kam es an. »Ich weiß nicht, ob das Ganze überhaupt noch einen Sinn hat. Vielleicht ist es besser, wir gehen für eine Weile auf Distanz zueinander. Wir machen eine Pause …«
»Eine Pause? Eine Pause ist der Anfang vom Ende, das weiß doch jeder.«
»Das sagst du.«
»Warum bist du nur so feige? Du hast vor, unsere Ehe ganz einfach langsam sterben zu lassen, weil du mir nicht ins Gesicht zu sagen wagst, dass du mich loswerden willst. Erst als Tanzpartnerin, jetzt als Frau …«
»So ist das nicht …«
»Wie denn sonst?«
Wir schwiegen.
»Wenn du mich verlässt, halte ich nicht mehr länger den Mund. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen? Jetzt, wo du so damit beschäftigt bist, dich karrieretechnisch neu zu orientieren?«, sagte sie dann. Eine unverhohlene Drohung. Mit diesen Worten schnitt sie außerdem ein schmerzliches Thema an, aber das konnte sie nicht wissen, und ich hatte auch nicht vor, es ihr zu sagen. Sie hatte schon mehr als genug gegen mich in der Hand.
»Und du? Wegen dir …«
»Ich habe weniger zu verlieren als du. Viel weniger. Das solltest du lieber nicht vergessen.«
Ich wandte den Blick ab. Schwieg. An diesen Punkt kamen wir früher oder später jedes Mal. Mischa hatte die Macht, und das wusste sie nur zu gut. Wie sollte ich sie nur jemals loswerden?
6.
Nikolaj
Ich hatte mir bei meinem Bericht einige Lügen erlaubt. Eine davon betraf den Schluss, nämlich dass ich ins Schlafzimmer gegangen war, um meine Sachen zu packen.
»Und dann?«, fragte Hans Waanders, der in der pedantischsten Handschrift mitschrieb, die ich je gesehen hatte, mit der Nase ganz dicht über dem Papier. Er hatte mich kein einziges Mal unterbrochen.
»Ich war von den Proben schrecklich müde und habe mich kurz hingelegt. Dann muss ich eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, war das ganze Zimmer voller Rauch.«
»Stand die Schlafzimmertür auf oder war sie geschlossen?«
»Das weiß ich nicht mehr.«
»Okay, erzählen Sie weiter.«
»Ich wollte wissen, ob der Alarm ausgelöst worden war – in der Küche hängt ein Rauchmelder –, aber das war nicht der Fall.«
»Ist der Rauchmelder schon einmal zu einer anderen Gelegenheit angesprungen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Sie wissen also nicht, ob das Gerät kaputt war oder ob es jemand ausgeschaltet hat?«
»Ich habe wirklich keine Ahnung.«
Hans Waanders nickte, schaute mich fragend an und bedeutete mir auf diese Weise, dass ich weiter berichten sollte.
Ich räusperte mich. »Ich habe schrecklichen Durst. Können Sie mir bitte das Glas da reichen?«
Hans Waanders tat, worum ich ihn gebeten hatte. Wegen meiner verbundenen Hände fand ich es schwierig, das Glas zu halten, und schüttete mir etwas Wasser auf die Hose. »Das ganze Schlafzimmer war voller Rauch … Ich dachte, es wäre irgendetwas beim Kochen schiefgegangen.« Ich wandte den Blick ab.
»Dachten Sie das wirklich?«
»Ich … Ich hatte Angst, Mischa hätte vielleicht etwas gekocht und vergessen …«
»Ich verstehe. Was ist dann passiert?«
»Als ich aus dem Schlafzimmer kam, konnte ich fast die Hand nicht vor Augen sehen. Ich rief nach Mischa und bin ins Wohnzimmer gegangen, wo es bereits überall brannte. Und dann wurde ich von hinten niedergeschlagen.« Stirnrunzelnd befühlte ich die Stelle. An meinem Hinterkopf prangte eine riesige Beule. »Ich bin zu Boden gegangen, und sie hat mich immer weiter geschlagen. Ich habe versucht, sie davon abzuhalten. ›Was hast du getan?‹, habe ich gerufen, immer wieder, aber sie hat keine Antwort gegeben. Es war, als wäre sie verrückt geworden.«
»Wie sind Sie aus dem Haus gekommen?«
»Keine Ahnung. Ich muss bewusstlos geworden sein, und als ich wieder zu mir kam, brannte alles lichterloh. Im nächsten Moment war ich draußen.«
»Sie haben nicht sofort die Polizei gerufen.«
»Ich hatte mein Handy nicht bei mir.«
»Bei den Nachbarn, meine ich. Sie haben die Nachbarn nicht alarmiert.«
»Nein? Ich weiß es nicht, ich muss einen Schock gehabt haben. Ich bin wohl davon ausgegangen, sie hätten die Feuerwehr schon gerufen.«
»Noch mal zurück zum Anfang: Sie haben gesagt, Frau de Kooning will Sie umbringen. Da gibt es einfachere Methoden, als das Haus anzuzünden.«
»Vielleicht wollte sie, dass das Ganze wie ein Unfall aussieht? Das fällt in Ihren Arbeitsbereich, nicht in meinen«, gab ich zurück.
»Frau de Kooning ist ein großes Risiko eingegangen. Sie selbst wurde auch verletzt. Warum ist sie nicht sofort aus dem Haus geflüchtet, nachdem sie den Brand verursacht hatte?«
»Sie muss abgewartet haben, bis ich schlief. Wahrscheinlich hat sie nicht damit gerechnet, dass ich so rasch aufwache, und deswegen beschlossen, mich niederzuschlagen. Oder so was? Das ist jetzt alles frei spekuliert – wie es genau abgelaufen ist, müssen Sie sie selbst fragen.«
»Das werde ich auch ganz bestimmt tun, sobald sie das Bewusstsein wiedererlangt hat.«
In diesem Augenblick betrat Willy erneut das Zimmer, ganz offensichtlich aufgeregt, und forderte Hans Waanders auf, sofort zu gehen. »Eine Frage, haben Sie gesagt. Er braucht Ruhe«, erklärte sie. »Ich begreife ja, dass Sie Ihre Arbeit erledigen müssen, aber das müssen wir auch.«
»Kein Problem«, erwiderte Hans Waanders munter. »Ich weiß vorläufig genug. Wir belassen es hierbei. Für den Moment.« An der Tür zur Schleuse drehte er sich noch einmal zu mir um: »Sie wollen also eigentlich sagen, dass Ihre Frau Sie umbringen wollte, weil Sie Ihre Beziehung beenden wollen.« Noch immer klang in seiner Stimme Erstaunen durch.
»Sie kennen Mischa nicht. Sie ist eifersüchtig und sehr besitzergreifend. Wenn sie mich nicht haben kann, soll mich niemand haben.«
7.
Mischa
»Guten Morgen, Mischa. Ich bin Willy, Ihre Krankenschwester für heute. Zusammen mit Jantien, die ist auch hier. Wir werden Sie jetzt erst mal waschen.«





























