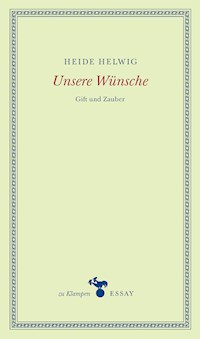
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: zu Klampen Essays
- Sprache: Deutsch
Wünsche – wie oft kommen sie uns im Alltag reflexhaft über die Lippen. Allerdings gibt es auch Wunschvorstellungen, die wir lieber verbergen, dann nämlich, wenn unser Eigennutz anderen zum Nachteil gereichen würde, das Gift den Zauber zersetzte. In Mythen und Märchen erscheinen Wünsche meist unverstellt, und dabei rangieren Reichtum, Macht, Weisheit und Wandelbarkeit ganz oben auf der Liste. Auch in der Literatur begegnen wir Wünschen auf Schritt und Tritt, hier wird die ganze Fülle menschlicher Sehnsüchte, Träume und Hoffnungen vor uns ausgebreitet. Heide Helwig begibt sich auf eine faszinierende Erkundungstour durch das literarische Reich der Wunschvorstellungen, in denen die Wünsche aus Mythen und Märchen weiterleben, in denen aber auch von irren Träumen und wütendem Aufbegehren die Rede ist, von der ernsthaften Sehnsucht des Weltverbesserers und dem reizvollen Spiel mit dem Was-wäre-wenn, von Machttaumel und menschlichen Abgründen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reihe zu Klampen Essay Herausgegeben von Anne Hamilton
Heide Helwig, geboren 1960 in Salzburg, studierte Germanistik und Romanistik und wurde mit einer Arbeit über die Sprachauffassung von Elias Canetti promoviert. Seit Herbst 2018 wirkt sie an der Kritischen Ausgabe der Werke von Elias Canetti mit. Bisher sind von ihr erschienen: »›Ob niemand mich ruft‹. Das Leben der Paula Ludwig« (2000) und »Johann Peter Hebel. Biographie« (2010).
HEIDE HELWIG
Unsere Wünsche
Gift und Zauber
zu KlampenEssay
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Einstieg mit Ernst Jandl
Wortgeschichte
Die Macht der Dinge
Drei Wünsche oder viele und die Qualität der Quantität
In der Kernzone des Wünschens: Reichtum und Verstand
Die Welt verändern
Ein anderer sein
Zum Schluss: eine Ermutigung
Literatur
Einstieg mit Ernst Jandl
GLÜCKWUNSCH
wir alle wünschen jedem alles gute:
dass der gezielte schlag ihn just verfehle;
dass er, getroffen zwar, sichtbar nicht blute;
dass, blutend wohl, er keinesfalls verblute;
dass, falls verblutend, er nicht schmerz empfinde;
dass er, von schmerz zerfetzt, zurück zur stelle finde
wo er den ersten falschen schritt noch nicht gesetzt –
wir jeder wünschen allen alles gute1
Wir beschwören das Glück und taumeln ins Unglück: Die Schizophrenie des Wünschens lässt sich kaum eindringlicher vor Augen führen. Zählebige Zuversicht auf der einen Seite, Totalversagen auf der anderen. Geschmeidig passt sich der Wunsch allen Schicksalswenden an, hebt mit einer Unverdrossenheit, die politischer Rhetorik zur Ehre gereicht, aus jedem Desaster neue Ziele und hält sie hoch wie Trophäen. Ein Stehaufmännchen, nicht tot zu kriegen, selbst angesichts des Todes und in diesen hineingreifend. Das Grauen, das Ernst Jandl auf wenigen Verszeilen erstehen lässt, dieses Schlachtfeld aus Blut, Schmerz und zerfetztem Menschenleib, das von körperlicher oder metaphorischer Kriegsgewalt, von Vernichtungswillen oder schlichtweg vom unvermeidbar tragischen Irregehen menschlicher Existenz kündet, bleibt eingerahmt vom Singsang der Wünsche: Gutes von allen für alle.
Der Wunsch kapituliert nicht. In Schnörkelschrift bekundet er sein Dasein. Und er kennt keine Schwellenangst. Er ist im Hunger ebenso zu Hause wie im Überfluss, in der Kälte wie in der Wärme, in der Vereinzelung wie im Kollektiv, im Guten wie im Bösen. Ein vitaler Reflex, der den Menschen umtreibt, und ein Phantomschmerz, der ihn weitertreibt und Mangel signalisiert, wo längst keiner mehr ist. Mangel, sagt der Wunsch, Mangel ist immer. Der Appetit auf Neues und Anderes ist seiner Natur nach unstillbar; verliert doch das jeweils Neue und Andere, sobald es Teil der eigenen Welt geworden ist, den ihm eigentümlichen Reiz. Es ist nicht mehr neu und auch nicht mehr anders. Wohl auch darum sind die Sprachformeln aufs Ganze angelegt. Man wünscht nicht nur etwas, sondern gleich alles Gute. Was als blasse Floskel die Runde macht, trägt einen totalitären Zug.
Dabei ist an der Wirkungslosigkeit des Wünschens nicht zu rütteln. Der Wunsch ist keine Kraft, die Verhängnis aufhält, und keine, die Rettung beschleunigt. Sollte trotzdem der erfreuliche und vielleicht gar nicht so exzeptionelle Fall eintreten, dass die empirische Realität sich wunschgemäß verhält, so gewiss nicht in gehorsamer Angleichung an die magischen Kräfte, die ihr entgegengeschickt werden. Eher in gehorsamer Angleichung unserer Wünsche an das Mögliche und Wahrscheinliche; es ist die lebenspraktische Revision unserer Ziele, die uns ein Entgegenkommen des Schicksals vorgaukelt. Wir feiern Gelingen, Sieg, Erfüllung, wo wir uns zuallererst den Regeln der Welt unterworfen haben. Unsere Wunschzettel sind verkappte Einkaufslisten, mit denen wir keine andere Kraft als unsere Kaufkraft bemühen, wie vielfältig und bunt sie sich auch gibt, in Supermärkten, Reisebüros, Opernhäusern, Sportstudios, Immobilienfirmen oder sonstwo. Der kleine Kreislauf realer Wunscherfüllung lenkt ab vom Unabänderlichen des großen Kreislaufs, von Leben und Tod. Was erfüllt wird, ist immer das Zweitrangige. Worauf es ankommt, ist unerfüllbar. Dies nennt sich Realitätssinn, und man wappnet sich damit; darunter aber, unzerstörbar, unauslöschlich, schwelt weiter die aberwitzige Hoffnung: Wer weiß? Vielleicht?
Festzuhalten ist: In der Sphäre der empirischen Realität hat der Wunsch keine Handlungsbefugnis. Dafür umso mehr im Reich der Phantasie: Der Wunsch des Wunsches ist seine Erfüllbarkeit. Dergestalt sitzt der Wunsch fest zwischen zwei Extremen, dem Eingeständnis der Ohnmacht – sonst würde man nicht wünschen müssen – und dem Verlangen nach einer Machtfülle, die über das real Verfügbare hinausgeht. Nach einer Macht über das Schicksal, wie sie dem Menschen nicht zukommt. Nach einer Macht, die ins Große und Grundsätzliche geht, die Wunsch und Wunder verschmilzt, so als könnte es tatsächlich sein, dass der Gestorbene wieder ins Leben zurückkehrt, dass Todesurteile aufgehoben werden und die Schlinge, die immer schon um jedermanns Hals liegt, abgenommen wird.
Es ist, als hätte es im Paradies neben dem Baum der Erkenntnis noch einen weiteren verbotenen Baum gegeben, den Baum der unbegrenzten, allumfassenden Machbarkeit. Von dessen Früchten hat der Mensch nicht gekostet, aber seine Existenz ist ihm in dunkler Erinnerung geblieben, so dass er denken und träumen kann, was sich seiner Kraft entzieht: Aufhebung physikalischer, biologischer, kausaler Gesetzmäßigkeiten. »Zurück zur Stelle finden, wo er den ersten falschen Schritt noch nicht gesetzt«. – Jandls Gedicht bewegt sich vom immerhin Möglichen zum grundsätzlich Unmöglichen eines Lebensneustarts. Das Rad zurückdrehen, die Textur des Lebens auftrennen und von vorne beginnen, das lässt sich denken, das lässt sich in virtuellen Welten und mit dem Fingerdruck auf Rücklauf tasten durchspielen, im Modus des Als-Ob, der nur um so schmerzhafter daran erinnert, dass dem tatsächlichen Vermögen Grenzen gesetzt sind.
In jedem ohnmächtigen Wunsch steckt etwas von einem abstrusen, widersinnigen Aufbegehren gegen die Härte der Faktizität, gegen die unabwendbaren »Schläge«. Es steckt darin der Traum von der Herrschaft des einzelnen über den Gang der Dinge, seine subjektive, zeitbestimmte Vorstellung vom Besserwissen und Bessermachen. Sanierung der Welt. Lohn und Strafe, gerecht bemessen. Rettung der Bedrohten, Freiheit für die Unschuldigen, dem Feind ein schmähliches Ende. Wohltaten für alle, auch für sich selber. Die Marschrichtung ist klar, Einzelheiten bleiben ausgespart. »Verlange, was du wünschest!« ist der Märchen-Satz, der uns einst elektrisierend durchfuhr. Mit diesen Worten pflegen Geister, die etwa durch Reiben einer Lampe herbeizitiert werden, kommentarlos und kritiklos jeden Auftrag zu übernehmen, unbegrenzte Macht vereinigt sich bei diesen Diener-Dämonen mit unbegrenzter Dienstbarkeit. Herr über alles, aber Knecht für den Herrn, der befiehlt, ein verlockenderes Konstrukt ist kaum denkbar.
Nur noch Gutes, immer für alle.
Wortgeschichte
Definitionen, Positionen
WER der Herkunft des Wortes Wunsch nachgeht, wird über das althochdeutsche wunsc, über altenglische, altnordische und altindische Verwandtschaften in die Sprachvergangenheit des Indoeuropäischen zurückverwiesen zu der rekonstruierten gemeinsamen Wurzel *uen-, die nach etwas streben bedeutet, auch erarbeiten und, als Ergebnis: erreichen, gewinnen. Das lateinische venus (Liebe, Liebesgenuss) geht ebenso darauf zurück wie Wahn und wohnen. Ein und dieselbe Grundregung wird also in wechselnder Perspektive gezeigt: Es ist einmal das Begehren an sich, einmal sein Resultat; das eine wie das andere tritt unter positivem wie negativem Vorzeichen auf, ist erfolgreich als Gewinn und Genuss oder ein Fehlschlag als vergebliche Hoffnung und leerer Wahn.
Wer der Wortgeschichte nachgeht, wird auch auf Jacob Grimm und seine »Deutsche Mythologie« (1835) stoßen. Auf mehr als tausend Seiten liefert Grimm, in konsequenter Kleinschreibung, Material zu einer Kultur, die in Sagen, Märchen und Legenden überlebt hat und sich doch zweifach diskreditiert findet, zum einen als Relikt heidnischen Glaubens, zum andern weil sie im Schatten der stilbildenden griechischen und römischen Mythologie steht. Nachdrücklich spricht sich Grimm gegen den kulturellen Dünkel späterer Epochen aus, auch gegen die nur scheinbar klare und nicht wertfrei betriebene Trennung zwischen Polytheismus und Monotheismus. Zu relativieren sei etwa der Vorwurf des Fetischismus, der die polytheistischen Religionen trifft, denn die Verehrung von Hammer, Speer, Kiesel oder Phallus lässt sich nicht losgelöst von einer Gottheit und ihrer fluktuierenden Kraft denken. Der einzelne Gegenstand wird zum Stellvertreter des Göttlichen und findet sich als solcher angereichert mit einem Vermögen, das sich im Glauben an magische Objekte, an Wunschdinge erhalten hat.
Der Wunsch steht in Grimms »Mythologie« an prominenter Stelle: Die höchste Gottheit, der allmächtige Wuotan (althochdeutsch) oder Odin (nordisch), ist geradezu ein Wunsch-Gott. Er ist mächtig und weise, auch wild und ungestüm, hat eine düstere Seite und eine liebliche, verleiht den Menschen und Dingen Gestalt und Schönheit, den Feldern Fruchtbarkeit, lenkt Kriege, gibt Tod und Sieg. Alles mündet bei diesem Gott, alles nimmt hier seinen Ausgang. Wunsch ist die Seligkeit und Erfüllung, die Wuotan / Odin gewähren kann. Wunsch ist aber auch die Gottheit selbst, Personifikation einer eindrücklich wirkenden Macht und darüber hinaus Inbegriff jedweder Vollkommenheit – das, was wir Ideal nennen. Die in der Neuzeit dominierende Semantik des Begehrens und Verlangens verbirgt sich vorläufig unausgesprochen im Hintergrund.
Noch im Mittelhochdeutschen umschließt der Wunsch mehr und anderes als heute. Das »Deutsche Wörterbuch« und Epochenwörterbücher geben Aufschluss: Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer objektiven und einer subjektiven Bedeutung, erstere führt das mythologische Erbe weiter und gibt im mittelalterlichen Sprachgebrauch den Ton an. In eben dieser objektiven Bedeutung bezeichnet der Wunsch alles Vollkommene und Außerordentliche, aber auch die Kraft, solches an Personen und Dingen zu bewirken, »manchmal nahezu im sinne des schöpferischen wortes gottes«. Dazu die handfesten Mittel, mit deren Hilfe Außergewöhnliches geschaffen wird: Zauberstab, Wünschelrute. Und schließlich, weiterhin unter dem Vorzeichen der Objektivität: Fürbitte, Segen, gelegentlich auch Fluch.
Ze wunsche bedeutet vollkommen, als Quasi-Synonym der Vollkommenheit dient das Wort zur Beschreibung edler Ritter oder des perfekten Lebens. Der junge Parzival wird damit bei seiner Ankunft am Artushof als Ausnahmeerscheinung gepriesen, er ist der, »an dem got wunsches hete erdâht«. – »ein Meisterwerk Gottes«, heißt es in der neuhochdeutschen Übersetzung von Wolfgang Spiewok. Auch der Gral selbst ist gar nicht anders als mit dieser Kategorie des Außerordentlichen zu fassen: Er ist der »wunsch von pardîs«, »erden wunsches überwal« – der »Inbegriff paradiesischer Vollkommenheit«, »alle Vorstellungen irdischer Glückseligkeit« übertreffend.
Die im Mittelalter vorherrschende objektive Bedeutung tritt mit der Zeit zurück gegenüber einer subjektiven Einfärbung. Wie im »Deutschen Wörterbuch« nachzulesen ist: Psychische Aktionen, eigene Vorstellungen und Hoffnungen, etwa auf den Besitz einer Sache oder die Verwirklichung einer Situation, füllen das Wort mit neuem Gehalt. In dieser neuzeitlichen Wortsemantik ist Wunsch nun das Begehren oder Verlangen, das sich auf die Erfüllung richtet, »und zwar in dem sinne, dass die befriedigung des verlangens nicht von dem bemühen dessen abhängt, der es empfindet oder äußert«. Die tragische oder auch tragikomische Kluft, ohne die das Wünschen heutzutage nicht zu denken ist, tut sich auf – der gähnende Abgrund zwischen dem Verlangen und der Erfüllung, zwischen der Grenzenlosigkeit des Vorstellbaren und der Begrenztheit dessen, was sich zuwege bringen lässt.
Nicht von ungefähr geht die Bedeutungsverlagerung Hand in Hand mit sozialen Umbrüchen. Im Ständesystem des Mittelalters keimt eigenmächtiges Wollen auf, das gegen die als gottgegeben etablierte Gesellschaftshierarchie opponiert. Konservative Erzähler warnen vor solchen Störungen, wie etwa Wernher der Gartenaere mit seinem berühmten »Helmbrecht« (13. Jahrhundert), und verhängen Höchststrafen über ihre unbotmäßigen Protagonisten: Ordo-widriges Wollen wird im Sinne der Systemerhaltung nicht als systemgefährdend, sondern als selbstzerstörerisch gebrandmarkt. Je dringlicher der Mensch, im speziellen der Vertreter des machtlosen dritten Standes, auf seinem Begehren nach sozialer Besserstellung beharrt, desto heftiger wird er ins Unglück eingetunkt. Der eigenmächtig und gegen Gottes Bestimmung Wünschende des Mittelalters darf keine Nachsicht erwarten. Dabei ist gerade er ein Vorbote der neuen Zeit, der heraustritt aus der Schirmherrschaft der objektiven Ordnung und der Welt ein Begehren entgegenhält, das er als sein höchst eigenes versteht. Persönliche Hoffnungen und persönliche Interessen, wie sie der Wunsch im neuhochdeutschen Sprachgebrauch als konstituierend eingelagert hat, tauchen mit der Emanzipation aus dem theozentrischen Weltbild als Neuland auf, das zu erkunden ist. Wo kollektives Licht war, ist Dunkel eingekehrt, ein Dunkel, das in individuellen heroischen Geistesakten wieder durch Licht ersetzt werden soll. Das ins Selberdenken geworfene Individuum sucht und braucht Erkenntnis über sich selbst, über das, was es aus sich machen kann und soll, nicht zuletzt auch über seine Disponiertheit, für manche Dinge Hingabe und Energie zu entwickeln, für andere nicht.
Vom Willen und Wollen, von Eros und Streben, vom Begehren und der Begierde handeln die großen philosophischen Konzepte von der Antike bis in die Neuzeit, ab dem 19. Jahrhundert flankiert von der als Wissenschaft etablierten Psychologie. Je spezifisch und doch überlappend sind die zentralen Begrifflichkeiten, gleichgestimmt in ihrem Zukunftsbezug, hingespannt auf ein Ziel, ein großes Endziel, das als Teil der menschlichen Natur oder des menschlichen Seins gefasst wird und dem sich episodische, punktuelle Teilziele vorlagern. Im Begehren steckt etymologisch die Begierde und mit ihr die Gier. Die Wurzel ist germanisch ger, indogermanisch *gher-, die Bedeutung in alter Sprache zunächst weiter und allgemeiner: seelische Grundkraft, allgemeines Verlangen, Bedürfnis, häufig zielgerichtet als Streben, Wunsch, Wille (»Deutsches Wörterbuch«). Vom allgemeinen Verlangen verschiebt sich die Bedeutung allmählich zur Heftigkeit und Intensität des Begehrens, in meist abschätziger Wertung. Eine andere indogermanische Wurzel *ghei-, »gähnen, klaffen, den Mund aufsperren«, spielt in die Wortgeschichte der Gier mit herein und legt eine bildhaft ergiebige Spur. Man könnte sagen: Es klafft eine Lücke, eine Leere, welche von der Gier oder Begierde sozusagen in Personalunion geschaffen und zu schließen bestrebt wird.
Lücken, Defizite, Mängel – das ist es, woran sich der Mensch in seiner Begrenztheit unentwegt stößt. Er kann nicht etwas und alles sein, aber sein Blick wandert hin und her zwischen der ihn umgebenden Fülle der Möglichkeiten und seiner eigenen beschränkten Existenz, und er entbrennt in der Sehnsucht, Grenzen zu sprengen, mehr zu werden, Anderes, Besseres. Der Komparativ ist das Vehikel, mit dem sich die Gedanken hinaufschrauben, der Vergleich ist der Unruhestifter, der das Aufbegehren gegen das schicksalhaft Verhängte schürt. Wie ja das Aufbegehren und das Begehren schon sprachlich zusammenhängen.
Platons Eros, dessen Geschichte Diotima im »Symposion« erzählt, ist der Sohn des Poros und der Penia, gezeugt auf dem Fest zur Geburt der Aphrodite. Poros, Sohn der Metis (der Klugheit und des Einfalls), verkörpert die Fähigkeit, Wege und Auswege zu finden, Penia ist die personifizierte Armut. Ihr Sohn Eros erscheint bei Diotima nicht als neckisches Büblein, das mit Pfeil und Bogen Verwirrung stiftet, sondern als rauher und struppiger Geselle, unbeschuht und unbehaust. Er schläft unter freiem Himmel, liegt unbedeckt auf dem bloßen Boden. Seine Dürftigkeit ist das Erbe der Mutter, die Natur des Vaters aber hat aus ihm einen unermüdlichen Wegsucher gemacht, einen tapferen und unerschrockenen Jäger, der dem Guten und Schönen auf der Spur ist. Eros, der nicht schöne Liebende des Schönen, der Wissens- und Wahrheitssuchende, strebt unablässig nach dem, was ihm selber fehlt, nach Schönheit und Weisheit, doch ist sein Streben kein gradlinig erfolgsgekröntes, sondern von Schwankungen und Rückschlägen bestimmt: Bald ist er blühend und gedeihend, wie es heißt, bald dahinsterbend, er lebt auf, wenn er dank der Natur seines Vaters einen Ausweg findet, und verliert wieder, was er gefunden hat.
Die Dynamik des Begehrens, die aus dem Mangel erwächst, schließt die vitalen Bedürfnisse ein und geht über sie hinaus, sie richtet sich auf die körperliche Schönheit wie auf die geistige, lässt die Lockungen des Sinnlichen für die höhere Schönheit der Weisheit zurück und bleibt doch insgesamt störanfällig, insofern die menschliche Seele unterschiedliche Bestrebungen in sich vereint. In Platons Seelenwagen aus dem »Phaidros« versinnbildlichen die zwei geflügelten Pferde, die dem Wagen vorgespannt sind, diese schwer zu harmonisierenden Kräfte, das eine Pferd steht für Mut und Tatkraft, das andere für körperliche Lust. Alles Fortkommen liegt in der Hand des Wagenlenkers, der Vernunft. Von seinem Geschick hängt ab, ob ein Zusammenspiel der Kräfte gelingt und der Seelenwagen aufwärts steuert.
Wie man sieht: Das Streben ist dem Begehren eingelagert, das Begehren dem Streben, beide leisten sich definitorische Schützenhilfe, ohne ineinander aufzugehen. Bei Aristoteles ist das Begehren Streben nach Lust, nicht von Vernunft geleitet, so wie auch die Stoiker die Begierde als vernunftloses Streben bestimmten. Zugleich aber stellt bei Aristoteles das Streben, ohne den Akzent des Mangels, jenen uranfänglichen Impuls dar, der Aktivität auslöst: »Alle Menschen streben nach Wissen aus Veranlagung«, beginnt seine »Metaphysik«, und auch die »Nikomachische Ethik« setzt das Streben an den Anfang, als Streben nach einem Gut oder etwas Gutem, dessen unterschiedliche Beschaffenheit in letzter Instanz auf ein übergeordnetes, abschließendes und autarkes Ziel hin orientiert ist: das Glück, Eudaimonia, die Gunst des Dämons, durch Platon und Aristoteles einer der wichtigsten Begriffe der philosophischen Ethik.1 Dass der Dämon, von dem alles abhängt, nicht in einem schwer fassbaren Außen beheimatet ist, sondern im Menschen selber – diese entscheidende Umdeutung haben bereits Heraklit und Demokrit vollzogen. Das Streben, das Begehren, das Wünschen, alle drehen sich nach dem Sonnenlicht der Eudaimonia. Die Glückseligkeit aber hebt sich von allen anderen Zielen ab, insofern sie ein vollkommenes Ziel ist, stets wegen ihrer selbst und niemals wegen einem anderen gesucht (Aristoteles: »Nikomachische Ethik«).
Für René Descartes, der in seinen »Passions de l’Âme« (»Die Leidenschaften der Seele«, 1649) eine systematische Erkundung der menschlichen Affekte vornimmt, trägt das Begehren bzw. die Begierde (im französischen Original: le désir) den Stempel des Zukunftsbezugs. Angemessenes zu wollen, also: Anwesenheit eines abwesenden und Fortbestand eines gegenwärtigen Guts sowie Abwesenheit eines schon erfahrenen oder möglichen Übels – die erschöpfend durchkonjugierten Inhalte des Begehrens zielen samt und sonders auf einen Moment jenseits des hic et nunc. Das Begehren zählt dabei für Descartes zu den sechs Grundaffekten, an deren erster Stelle die admiration (Verwunderung) steht, die frei von Begierde und Neigung ist, ähnlich dem antiken Staunen, das Platon und Aristoteles als Urbeginn alles Philosophierens setzten. Des weiteren Liebe und Hass, Freude und Traurigkeit; mit der Trennung von Liebe und Begehren entfernt sich Descartes deutlich vom Eros Platons. Liebe, so Descartes, empfinden wir, »wenn uns eine Sache als unserer Ansicht nach gut vorgestellt wird, d. h. als uns zuträglich« (Artikel 56); man betrachtet sich in der Gegenwart als verbunden, als ein Teil des Ganzen und die geliebte Sache als der andere (Artikel 80). Die einleuchtende Unterscheidung zwischen einer im Jetzt angesiedelten Liebe und einem zukunftsgerichteten Begehren bleibt für die weitere Entwicklung der Philosophie allerdings ohne tiefgreifende Konsequenzen, sie ist, wie es lakonisch heißt, verlorengegangen.2
Die Frage nach der Auswahl dessen, was wir begehren, beantwortet Spinoza zunächst mit einer irritierenden Umkehr von Ursache und Wirkung, nämlich »dass wir nicht streben, wollen, verlangen oder begehren, weil wir es als gut beurteilen, sondern umgekehrt, dass wir darum etwas als gut beurteilen, weil wir es erstreben, wollen, verlangen und begehren« (9. Lehrsatz). Die Zuschreibungen der Werte sind die Sprache des Begehrens. »Gut« wäre damit schlichtweg das, was dem Streben nach Selbsterhaltung nützlich erscheint, eine Bestimmung, von der sich in der Folge die im 4. Teil der »Ethik« entwickelte Definition des Guten abhebt: Das Gute positioniert sich nunmehr als ein sicheres, unbestreitbares Wissen und wahrhaft Nützliches. Die Vernunft hat hier ihren Einsatzbereich, insofern sich das vernunftlose Begehren an ihr orientieren soll und sie die Affekte unter ihre Oberherrschaft weist. Denn beide, so viel ist klar, machen nicht von Haus aus gemeinsame Sache, für die Rationalisten der Neuzeit so wenig wie für die Philosophen der griechischen Antike.
Vom Begehren zum Begehrungsvermögen: Eben dieses ist Untersuchungsgegenstand der deutschen Aufklärungsphilosophie, von Christian Wolff (1679–1754) über Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) bis zu Kant. Das Begehrungsvermögen ist gleichsam der Pulsschlag des Lebens selbst, ist doch Leben nach Kant »das Vermögen eines Wesens, nach Gesetzen des Begehrungsvermögens zu handeln« (»Kritik der praktischen Vernunft«. Vorrede, 1788). Es unterteilt sich, wie schon bei Wolff und Baumgarten, in ein unteres und oberes, in die Begierde und den reinen Willen. Nur in den unteren Regionen des Begehrungsvermögens, sprich: im Bereich der Begierde (appetitio), ist ein Gefühl der Lust die vorausgehende Ursache des Wollens, in unterschiedlichen Ausprägungen: »Die habituelle sinnliche Begierde heißt Neigung. Das Begehren ohne Kraftanwendung zu Hervorbringung des Objekts ist der Wunsch. Dieser kann auf Gegenstände gerichtet sein, zu deren Herbeischaffung das Subjekt sich selbst unvermögend fühlt, und ist dann ein leerer (müßiger) Wunsch. Der leere Wunsch, die Zeit zwischen dem Begehren und Erwerben des Begehrten vernichten zu können, ist Sehnsucht. Die in Ansehung des Objekts unbestimmte Begierde (appetitio vaga), welche das Subjekt nur antreibt, aus seinem gegenwärtigen Zustande herauszugehen, ohne zu wissen, in welchen es denn eintreten will, kann der launische Wunsch genannt werden (den nichts befriedigt).« (»Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«, 1798)
Kants Definition und seine Unterkategorien lassen den Wunsch recht arm aussehen, wie einen kahlgerupften Vogel, der ohne seine schönen bunten Federn wenig hergibt. Die phantasievoll ausgemalten Momente der Wunsch-Erfüllung, die freudigen Ziel-Zustände sind einer Diktion der Desillusionierung geopfert worden. Nicht viel besser ergeht es den Wunschinhalten und dem Glück selber, diesem Herzenskompagnon aller Sehnsüchte. Ähnlich dem römischen Satiriker Juvenal (von ihm wird noch zu reden sein) demontiert Kant mit raschen Griffen ein paar Standardwünsche: Reichtum bringt Sorge und Nachstellung, langes Leben möglicherweise langes Elend, Erkenntnis die Einsicht belastender Übel etc. Da selbst das einsehendste Wesen nicht allwissend ist, wünscht es mit jedem Wunsch ungewollte Begleiterscheinungen dazu. Glückseligkeit als das absolute Ganze und angestrebtes Maximum ist nicht in dieser Welt einzulösen und nicht via Prinzipien zu erobern. Was alle wollen, entzieht sich hartnäckig: »Allein es ist ein Unglück, dass der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, dass, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und mit sich selber einstimmig sagen kann, was er eigentlich wünsche und wolle.« (»Grundlegung zur Metaphysik der Sitten«)
Es gibt Gegenmeinungen. Zumindest wenn man, wie Goethe, einer Wunschtheorie anhängt, die nicht die Unwägbarkeiten und bösen Überraschungen herauskehrt, auch nicht den begrenzten menschlichen Sinn als Argument gegen das Wünschen ins Feld führt, sondern die Bestrebungen des einzelnen in ein allgemeinmenschliches Fortschreiten eingeschrieben sieht. Wünsche, so will es die optimistische Sicht, sind im gesellschaftlichen Ganzen eingebettet und damit nicht nur Ausdruck individuell beschränkter Glückshoffnungen. Sie sind in der eigenen Persönlichkeit verwurzelt und damit so etwas wie zukunftsgewisse Vorausdeutungen: »Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten im Stande sein werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns und in der Zukunft dar; wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreifen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche.« (»Dichtung und Wahrheit«) Mag auch das Bestreben der einen auf irdische Güter gerichtet sein, das der anderen auf geistige Vorteile, so gibt es eben noch jene bedeutsame dritte Richtung, aus den beiden ersten gemischt, die über den selbstbezüglichen Ehrgeiz hinausgeht, sich in tätiger Teilnahme äußert und aus der Verbundenheit mit der Epoche lebt. Dass sich nicht alles realisieren lässt, versteht sich von selbst, doch wenn die Wünsche »aus einem reinen Herzen« entspringen und »dem Bedürfnis der Zeit gemäß« sind, wird die Saat trotz allem aufgehen – in dem selbstlos-kollektiven Sinn, der für diese höhere Art des Wünschens kennzeichnend ist. Man wird andere verwirklichen sehen, was einem selbst verwehrt war und manches darüber hinaus – »dann tritt das schöne Gefühl ein, dass die Menschheit zusammen erst der wahre Mensch ist, und dass der Einzelne nur froh und glücklich sein kann, wenn er den Mut hat, sich im Ganzen zu fühlen«.
Nicht immer fügen sich Wollen, Können und Gelingen so ideal zusammen. Und das ist schon fast eine Überleitung zum Wunsch in der Romantik, die den Zustand des Begehrens als solchen zu ihrem glühenden Mittelpunkt macht. Der selbstgewisse »komplette« Mensch der Klassik mag durch beherztes Bemühen zur Erfüllung gelangen, der Romantiker überwindet die Diskrepanz von Realität und Irrealität auf seine Weise, indem er die Erfüllung geradewegs in den Wunsch hineinverlegt. So kann der Wunsch wunderbarerweise in sich beherbergen, was sonst außerhalb gesucht und (nicht) gefunden wurde: Glück, Antwort, Ziel. Er wird zu einer imaginären Bühne, zu einem Freiraum des Schaffens und Erschaffens. Das Spiel auf dieser Bühne ist Wirklichkeit höheren Grades, die mit der Wirklichkeit ersten Grades interagiert, prophetisch ihre Schatten wirft, vielleicht ins Nirgendwo führt und so nebenbei auch das tut, was Kant, wenig freundlich, der »Sehnsucht« als Merkmal zuspricht: Sie sei der »leere Wunsch«, dem es zufällt, die Zeit zwischen dem Begehren und Erwerben des Begehrten zu vernichten.
Eines der Werke, das zum Inbegriff romantischer Poesie wurde: Novalis’ »Heinrich von Ofterdingen«, entfaltet schon auf den ersten Seiten, mit dem Traum des jungen Heinrich, die Gefühlsspannung des Begehrens in irisierender Fülle. Ein »unaussprechliches Verlangen«, eine »seltsame Leidenschaft« nach der blauen Blume hat den Jüngling Heinrich erfasst. Nicht zu besitzen strebt er sie, aber zu erblicken. Sie liegt ihm »unaufhörlich im Sinn«, nichts anderes kann er mehr dichten und denken. Er befindet sich in einem wunderlichen und für den Rest der Welt unbegreiflichen Zustand, wie ein weites Rad greift der Traum in seine Seele hinein und treibt sie »in mächtigem Schwunge« fort. – A. W. Schlegel stellt in seiner ersten Vorlesung »Über dramatische Kunst und Literatur« eine Opposition auf, die sich unschwer als Paraphrase auf Begehren und Erfüllung lesen lässt: Sehnsucht versus Besitz. Sehnsucht – das sind die frei modellierbaren Wunschwelten, die Tauben auf dem Dach sozusagen, die dem Spatz in der Hand den Rang abgelaufen haben: »[D]ie Poesie der Alten war die des Besitzes, die unsrige ist die der Sehnsucht; jene steht fest auf dem Boden der Gegenwart, diese wiegt sich zwischen Erinnerung und Ahnung.« Das neuzeitliche (romantische) Wünschen umkreist das Un-Fassbare: das Wunderbare und sein Zauberwort. Die Wünschenden sind Suchende auf Lebenszeit, sie leiden wechselweise Sehnsucht nach (transzendentaler) Heimat oder Ferne. Wohin ihre Schritte sie auch führen, der Bogen aus Erinnerung und Ahnung wölbt sich unabänderlich über ihnen. In heiter-ironischem Licht zeigt Eichendorffs »Taugenichts« die romantische Autonomie des Begehrens, das seine Ziele wie Sterne an den Himmel hängt und sich um ein zweckmäßiges »Tun und Leisten« (Goethe) wenig bekümmert. Nach Italien will der Taugenichts, dass er den rechten Weg nicht weiß, fällt ihm erst später ein und tut seinem frohgemuten Fortstreben keinen Abbruch.





























