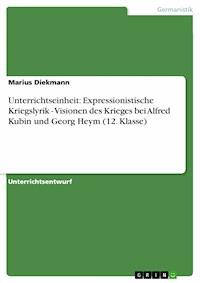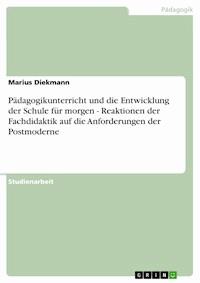Unsichtbare Hand, natürlicher grammatischer Wandel und Sprachökonomie. Beiträge zu Theorien des Sprachwandels von Keller und Wurzel E-Book
Marius Diekmann
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Universität Bielefeld (Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft), Veranstaltung: Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache, Sprache: Deutsch, Abstract: Phänomene sprachlichen Wandels erregen eine ungleich stärkere öffentliche Aufmerksamkeit und vor allem Kritik als alle anderen Fragen und Gegenstände der Linguistik (Crystal 1995). Auffällig ist, dass Sprachwandel sowohl kulturübergreifend als auch über alle Epochen hinweg vornehmlich mit Sprachverfall gleichgesetzt wird (Keller 2002). Aus linguistischer Perspektive erweisen sich derartige Sprachverfallsthesen allerdings als nicht haltbar. Die vorliegende Arbeit geht zunächst der Frage nach, was sich jeweils an einer Sprache verändert, wenn von Sprachwandel bzw. -verfall die Rede ist. Daran anschließend wird – vor allem im Rückgriff auf Arbeiten von Keller und Wurzel – untersucht, auf welche Faktoren sprachlicher Wandel zurückzuführen ist. Angesichts der jeweiligen Stärken und Schwächen beider Theorieansätze wird abschließend dafür plädiert, sie als – miteinander zu verknüpfende - Beiträge zu einer umfassenderen Sprachwandeltheorie zu begreifen. Als ein mögliches Bindeglied zwischen den Arbeiten Kellers und Wurzels erweist sich der – u.a. von Werner vertretene – Ansatz der Sprachökonomie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
0. Einleitung
1. Grundsätzliches zum Sprachwandel
1.1 Was verändert sich? – Versuch einer Definition von »Sprachwandel«
1.2 Mit welcher Geschwindigkeit und innerhalb welcher Grenzen vollzieht sich der Sprachwandel in den einzelnen Subsystemen?
1.3 Warum wandeln sich Sprachen? –Sprachsysteminterne und sprachsystemexterne Erklärungsmuster
2. Sprachsystemintern und sprachsystemextern fundierte Erklärungsmodelle in der Sprachwandelforschung: Natürlichkeit vs. unsichtbare Hand
2.1 Kellers Sprachwandeltheorie: »Von der unsichtbaren Hand in der Sprache«
2.1.1 Die Ausgangssituation: Universalität des Wandels, theoretisches Erklärungsdefizit und tückische Fragestellungen
2.1.2 Phänomene der ersten, zweiten und dritten Art
2.1.3 Erklärungen mittels der unsichtbaren Hand
2.1.4 Wahrheitsgehalt und Güte einer Invisible-hand-Theorie
2.1.5 Der Wandel von Berufsbezeichnungen: Wie aus Frisören Coiffeure und Hair-Stylisten werden
2.1.6 Erklärungskraft und Grenzen der Invisible-hand-Theorie
2.2 Wurzels Theorie des natürlichen grammatischen Wandels
2.2.1 Sprachwandeltypen und Erklärungsanspruch der Theorie
2.2.2 Natürlichkeit und Wandel in der Grammatik
2.2.3 Natürlichkeit und Wandel in der Phonologie (Stampe)
2.2.4 Wandel und (universelle) Natürlichkeit in der Morphologie (Mayerthaler)
2.2.5 Natürlichkeitskonflikte zwischen den Komponenten als »Triebkraft der Sprachveränderung«
2.2.7 Systemabhängige Natürlichkeitsprinzipien (Wurzel)
2.2.8 Prinzipien der morphologischen Strukturbildung als Faktoren des natürlichen grammatischen Wandels
3. Unsichtbare Hand, natürlicher grammatischer Wandel, Sprachökonomie Beiträge zu einer „Theorie des Sprachwandels, die diese Bezeichnung wirklich verdient“
4. Literatur
0. Einleitung
»Das Phänomen des Sprachwandels erregt wahrscheinlich stärkere öffentliche Aufmerksamkeit und Kritik als jede andere linguistische Frage« (Crystal 1995, S.4). Dabei fällt auf, dass Sprachwandel »in allen Kulturnationen und über alle Zeiten hinweg: von Platon über Quintilian und Rousseau bis hin zu Kemal Pascha, Helmut Kohl oder Prinz Charles« (Keller 2002, S.1) immer wieder mit Sprachverfall gleichgesetzt wird.
Dieser vermeintliche Verfall der Sprache wird dabei an durchaus unterschiedlichen Erscheinungen festgemacht. So zeigt sich beispielsweise Prinz Charles angesichts der »zunehmenden Verunreinigung der britischen Variante des Englischen durch die amerikanische« besorgt (ebd.), während wiederum andere (bezogen auf das Deutsche) den Abbau der starken Verbkonjugation oder den Rückgang des Konjunktiv II beklagen. Insgesamt betrachtet ist die vorherrschende Meinung in Bezug auf Sprachwandel – so Keller - häufig folgende: »Der gegenwärtige Zustand meiner Sprache ist der korrekte, gute und schöne und von nun an geht´s rapide bergab« (ebd. S.2).
Einigkeit besteht im allgemeinen auch, wenn es darum geht, die Schuldigen dafür zu bestimmen, dass »die deutsche Sprache in akuter Gefahr ist [....] und verludert«. In den allermeisten Fällen sind es die »Flut der „neuen“ Medien und die Schule« (ebd. S.1), die genannt werden, wenn es zu erklären gilt, warum der deutschen Sprache »irgendetwas unermesslich Zerstörendes [...] widerfährt«, oder auch warum die heutige Sprache, »wie sie über den Rundfunk oder im deutschen Bundestag gesprochen wird [...] nicht mehr die Sprache Goethes, Heines oder Nietzsches, [...] nicht einmal mehr die Sprache Thomas Manns« ist (G. Steiner 1960, zit. n. Linke u.a. 1996, S. 381).
Während G. Steiner sich vornehmlich über den „ästhetischen“ Verfall der deutschen Sprache beklagt, befürchtet der „Verein Deutsche Sprache e.V.“ (VDS) darüber hinaus sogar verheerende gesellschaftliche Konsequenzen des Sprachwandels. Die »in den deutschsprachigen Ländern [...] besonders weit fortgeschrittene« »Anglisierung und Amerikanisierung der Landessprachen [...] beeinträchtigt« - so der VDS - nicht nur die Fähigkeit sowie »Bereitschaft unserer Kinder und Enkel, die deutsche Sprache weiterhin schöpferisch zu nutzen und die Wirklichkeit mit ihrer Hilfe treffsicher zu bezeichnen«. Nein: Wenn »wir nicht nur in den privaten, sondern sogar in den öffentlich-rechtlichen Medien aus gedankenloser Effekthascherei mit Amerikanismen und Anglizismen traktiert werden«, so führt dies – so der VDS – auch dazu, dass »ganze Bevölkerungsgruppen durch die Mischmaschsprache „Denglisch“ vom sozialen Leben ausgegrenzt werden«, sich »Verständigungs- und Eingliederungsprobleme« ergeben, die bis hin zur sprachlichen Diskriminierung entgegen Artikel 3, Absatz 3 unseres Grundgesetzes („Niemand darf wegen (...) seiner Sprache (...) benachteiligt (...) werden.“)« reichen (VDS 2004, S.1f.).