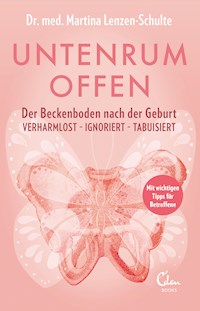
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ihren Beckenboden bemerken viele Frauen erst, wenn er nach der Geburt ihres ersten Kindes verletzt wurde. Oft hören sie dann Phrasen wie: »Das haben doch viele« oder »Das vergeht schon wieder«. Über bereits bekannte Risiken wurden sie zuvor häufig nicht aufgeklärt. Dabei sprechen die Zahlen für sich: Jede fünfte Frau ist nach einer Entbindung inkontinent, oft bleibend – bei fast 800.000 Geburten pro Jahr allein in Deutschland. Die üblichen Rückbildungskurse sind für die meisten nur ein Tropfen auf den heißen Stein, die Schädigung des Beckenbodens muss umfänglicher behandelt werden. Dieses Buch hilft Frauen dabei, sich die Kontrolle über ihren Körper zurückzuholen und beantwortet viele Fragen: Wie funktioniert der Beckenboden? Wie entlaste ich ihn nach einer Geburt? Wie können Beckenbodenschäden im Kreißsaal mit einem Geburtsplan vermieden werden? Was ist die beste Strategie, wenn es bereits zu Schäden gekommen ist? Martina Lenzen-Schulte führt durch das Labyrinth dieser Fragen und ermutigt Frauen: Lasst euch nicht mundtot machen! Ein wichtiges Buch zu einem Tabu-Thema, welches in den nächsten Jahren immer stärker ins Bewusstsein von Frauen und Ärzt*innen rücken wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Wie dieses Buch entstand
1.Geschädigte und das System
1.1Untenrum offen – was Frauen fühlen
1.2Beckenbodenschäden: Tabuisiert, ignoriert, verharmlost
2.Der Beckenboden: Vorher – nachher
2.1Halt für alle Fälle: Das Becken und sein Boden
2.2After-Baby-Body und After-Baby-Beckenboden
3.Frauenleben, Frauen leben mit Geburtstraumen
3.1Im freien Fall – Gebärmutterprolaps
3.2Kein Pipifax –Harninkontinenz
3.3Die große Scham –Stuhlinkontinenz
3.4Lost Penis, lost Sex – (k)ein Thema nach der Geburt
4.Der Kreißsaal als Tatort
4.1Und bist du nicht willig – Zange und Saugglocke
4.2Dammschutz – ein hohles Versprechen?
4.3Schneller mit Kristeller?
5.Alles muss in die Waagschale: Risiken, Alternativen, Geld
5.1Zu alt, zu schwer, zu schwach? – Abwägen vor jeder Geburt
5.2Kein Muttermauerblümchen sein – Kaiserschnitt als Plan B
5.3Mehr als Schmerzensgeld: Juristische Genugtuung
6.Schuld zuweisen
6.1Frauen werden verletzt, Männer werden wütend
6.2Provozieren wir!
Glossar
Literatur und Links
Wie dieses Buch entstand
Dieses Buch basiert auf gefühlt unendlich vielen Gesprächen mit Frauen, deren Beckenboden infolge einer natürlichen Geburt beschädigt worden ist und die sich über meinen Blog an mich gewandt haben. Sie gaben den Anstoß, ihre Nöte aufzuschreiben. Als Frau, Mutter und Ärztin war ich zutiefst von ihren Geschichten berührt. Als Medizinjournalistin wollte ich die Ignoranz gegenüber solchen Schicksalen anprangern. Gleichzeitig belege ich das, was mir berichtet worden ist, mithilfe der Wissenschaft: Alles ist durch Studien nachgewiesen. Ich hoffe, Mütter, Schwestern, Freundinnen, Partnerinnen und Partner, Männer und Bekannte von Betroffenen sowie Ärztinnen und Ärzte und alle, die beruflich mit Geburten zu tun haben, lesen das ebenfalls und haben danach mehr Verständnis und Mitgefühl.
Mein großer Dank gilt all jenen Frauen, die sich mir anvertraut und mir vertraut haben, ebenso allen Expertinnen und Experten, die mich nimmermüde unterstützt haben. Nicht zuletzt danke ich Julia Gommel-Baharov und Nina Schumacher, ohne die das Buch nicht möglich gewesen wäre.
Martina Lenzen-Schulte
1GESCHÄDIGTE UND DAS SYSTEM
1.1Untenrum offen – was Frauen fühlen
»A woman is a woman until she is a mother.«Anna Prushinskaya1
Sie sind 28 oder 33 oder 37 oder 41 Jahre alt, sie haben ihr erstes Kind geboren, ihnen fällt ihre Gebärmutter nach unten aus der Scheide heraus oder ihr Partner stößt beim Sex dagegen, sie können ihren Urin nicht halten, wenn sie lachen, sie kommen vom Joggen nach Hause und merken, dass die Unterhose stuhlverschmiert ist. Sie haben Angst und fragen sich, was sie haben. Sie versuchen es mit Physiotherapie, Pilates oder Pessaren. Sie sind viele, es werden immer mehr und sie tauschen sich immer öfter auf Facebook aus.
In Deutschland bekommen jedes Jahr fast 800.000 Schwangere ein Kind, fast die Hälfte davon zum ersten Mal. Etliche Frauen werden nach einer natürlichen Geburt von ihrem Beckenbodenschaden überrumpelt. Völlig unvorbereitet trifft sie der Schock, dass etwas untenrum nicht mehr stimmt. Sie wussten nicht, dass sich nach einer Entbindung plötzlich das Wasserlassen, das Sitzen, das, was man unten zwischen den Beinen hat, anders anfühlt als zuvor. Sie glauben zunächst der Hebamme, die ihnen sagt, das könne vorkommen nach einer Geburt, aber es werde schon wieder: »Das gibt sich«, lautet eine der Standardformulierungen. Aber nach mehreren Tagen oder Wochen, schon längst zu Hause und im Stress mit Kind und Haushalt, werden die Frauen plötzlich misstrauisch. Etliche verlieren nur unwillkürlich ein wenig Urin bei Anstrengung, bei manchen ist jedoch der Darmausgang nicht mehr ganz dicht, sie können ihren Stuhl nicht halten. Andere fühlen sich schwach, so als sacke ihr Körperinneres nach unten, als sei da nicht mehr genug Festigkeit, nichts mehr, das ihnen Halt gibt. Sie trauen sich nicht mehr, zu hüpfen oder zu laufen. Wieder andere spüren, dass direkt etwas in ihre Scheide drückt wie ein Ei, irgendwie von oben, entweder abends, nach einem langen Tag oder immer – und es wird schlimmer. Manche haben Schmerzen, weil die Organe der Schwerkraft folgen, nach unten ziehen, wenn der Beckenboden nicht mehr trägt.
All diese Frauen sind erstaunt, weil ihnen vor der Geburt niemand gesagt hat, dass es nach der Geburt so sein könnte. Jetzt weiß plötzlich jeder, dass dies nicht ungewöhnlich ist: »Hast du das denn nicht gewusst?« Der Preis der Mutterschaft. Es sind nicht wenige, die ihn zahlen. Rund 25 Prozent aller Schwangeren sind beispielsweise nach der Geburt inkontinent, können ihren Urin nicht mehr halten. Nicht alle verlieren ihn gleich im Schwall, bei manchen sind es »nur« Tropfen, aber unangenehm ist es allemal. Der Markt der parfümierten Slipeinlagen für Frauen boomt. Bei mehr als zwei Dritteln wird die Urininkontinenz nach der Geburt zu einem Dauerproblem. Andere finden fast zu alter Form zurück, manche erholen sich schließlich – allerdings nicht ohne erheblichen Trainingsaufwand.
Oft vergehen etliche Monate, bis den Betroffenen ihre Lage richtig bewusst wird. Die jungen oder nicht mehr ganz so jungen Mütter beginnen, Fragen zu stellen. In der Frauenarztpraxis, im Internet, sie wenden sich an beste Freundinnen. Die einen wiegeln ab, die anderen sind peinlich berührt. Sie googeln und finden zur Facebook-Gruppe »Gebärmuttersenkung, Blasensenkung, Rektozele, Inkontinenz, Beckenboden« – ein pragmatischer Name, der sicherstellt, dass möglichst viele Frauen über passende Suchwörter dort landen. Wer ihre Beschreibungen liest, ist erschüttert. Viele begreifen an diesem Punkt erstmals, dass sie vor, während und nach der natürlichen Geburt mangelhaft beraten, falsch angeleitet, oberflächlich untersucht und unzureichend versorgt worden sind.
Wichtig ist, dass überhaupt irgendjemand auf die richtige Diagnose kommt. Warum? Damit die Beschwerden frühzeitig richtig zugeordnet werden, damit die Betroffenen sich konsequent schonen, damit sie lernen, welche passiven Stützhilfen es gibt. Denn für einen geschädigten Beckenboden ist Entlastung erste Bürgerinnenpflicht. Ein solcher Schaden macht sich auf vielfältige Weise bemerkbar, das macht es nicht leicht, die Symptome richtig zu deuten.
Wie fühlt es sich an, wenn eine Frau nach der Geburt »untenrum offen« ist?
»Mit meinen Kindern rennen oder springen auf der Hüpfburg kann ich nicht, ratzfatz ist der Slip nass – oder mehr, eine Tasse voll, es ging eigentlich direkt nach der Geburt los.«
»Ich merke nicht, wenn ich Stuhl verliere. Die Unterhose ist manchmal schmutzig, Stuhlschmieren nennt es mein Arzt.«
»Wenn ich meinen Finger in die Scheide stecke, spüre ich nach zwei Zentimetern was, da ist was, das nach unten drückt.«
»Bei Yoga in die Hocke gehen geht gar nicht, nach unten pressen – niemals.«
»Beim Sex verliere ich regelmäßig Urin, nicht weil ich so in Ekstase wäre, es läuft schon vorher raus.«
»Im Schwimmbad kommt ständig Wasser in die Scheide.«
»Auch wenn ich keine Blähungen habe, geht Wind ab; plötzlich stinkt es. Treffen mit Freunden sind passé.«
»Beim Joggen laufe ich nur Wege, auf denen ich ab und zu unbemerkt Pipi machen kann.«
»Auf Sport muss ich verzichten, weil ich mich untenrum ganz schwach fühle, alles wie durchhängend, ich habe seit der Geburt deshalb viel an Gewicht zugenommen.«
»Bei mir sprüht der Urin in alle Richtungen, wenn ich Wasser lassen will.«
»Ich wurde lange genäht nach der Geburt, ich konnte wochenlang nicht ohne Schmerzen sitzen, jetzt tut es immer noch manchmal weh beim Sex mit meinem Mann, es ist schon länger als ein Jahr her.«
»Als ich meiner Frauenärztin meine Beschwerden schilderte, sagte sie, Sex werde überbewertet.«
»Als ich meinem Frauenarzt meine Beschwerden schilderte, sagte er, es sei ja schrecklich, dass ich keinen Sex habe.«
»Mein Mann hat großes Verständnis, aber das hilft nicht, ich fühle mich minderwertig als Frau, weil ich ›da unten‹ so völlig verändert bin.«
»Ich gehe morgens zur Toilette, reize dann meinen Darm, indem ich den Finger in die Scheide reinstecke und drücke, erst dadurch kommt der Stuhl raus.«
»Ich spüre kleine Knubbel unten, dort tut es weh beim Sex; meine Ärztin sagt, der Dammriss wäre bei mir grad gar nicht hübsch genäht worden.«
»Ich trage einen ganz dicken Tampon im Darm, wenn ich mal rausgehe zum Einkaufen, weil ich Angst habe, dass ich Inhalt aus dem Darm verliere, wenn ich im Laden bin; ich trage keine hellen Röcke oder Hosen mehr.«
»Meine Hebamme sagte, dass sei bei ihr auch passiert, das sei eben der Preis für Kinder.«
»Nach einer Zangengeburt war viel kaputt, der Arzt, der mich zusammennähte, war ganz jung, der Oberarzt, der die Zange verwendete, ging nach der Geburt weg.«
»Mein Mann sagt nichts, aber ich spüre ihn kaum noch, wenn er in mir ist.«
»Wenn ich unter der Dusche stehe und in meine Vagina hineinfasse, ertaste ich eine Kugel und weiß nicht, was das ist, im Stehen ist es immer da; ich habe keine Beschwerden, aber es macht mir Angst.«
Ist das nur subjektiv, sind das Horrorgeschichten von einigen wenigen Frauen? Keineswegs. Denn Beckenbodenschäden nach Geburten sind inzwischen so häufig, dass sich die Fachwelt immer eingehender damit beschäftigt. Frauen, denen diese Beschreibungen bekannt vorkommen, brauchen professionelle Hilfe, Beratung, möglicherweise Therapie. Jedenfalls mehr als einfache Rückbildungsübungen. Betroffene sollten sich vor allem nicht in der Geburtsklinik, von der Hebamme oder von ihrer Frauenärztin, ihrem Frauenarzt abspeisen und beschwichtigen lassen mit: »Das geht allen in der ersten Zeit so«, »Sieht normal aus«. Nein, solche Sätze müssen eher hellhörig werden lassen. Dahinter verbergen sich wahlweise Hinhaltetaktiken, Abwiegeln, Inkompetenz oder aber ein schlechtes Gewissen – weil womöglich die Anleitung zum Pressen zu früh kam, über eine Risikoschwangerschaft nicht umfassend aufgeklärt wurde oder unerfahrene Ärztinnen oder Ärzte im Kreißsaal die Geburtsverletzungen nicht fachgerecht versorgt haben.
Es gilt, sich so früh wie möglich Unterstützung zu sichern. Bei einer guten Physiotherapeutin, die auf den Beckenboden spezialisiert ist, bei verständnisvollen Frauenärztinnen und -ärzten, in einem Beckenbodenzentrum mit Expertise. Keine Scheu sollte frau haben, sie alle zu löchern, zu nerven, ihnen immer wieder Fragen zu stellen. Jede Wöchnerin, jede Mutter hat ein Recht auf kompetente und professionelle Hilfe. Erklärungsbedürftig ist nicht dieser Anspruch, erklärungsbedürftig ist vielmehr, warum sie geschädigt worden ist.
1.2Beckenbodenschäden: Tabuisiert, ignoriert, verharmlost
»The loser’s standing small.«
ABBA1
Wer als Mutter einen Schaden am Beckenboden erlitten hat, spricht nicht darüber. Sie erzählt nicht, dass sie den Urin nicht halten kann, wenn sie lacht, dass sie nur mit dichter Vorlage in der Unterhose das Haus verlässt, dass sie seit Monaten nach der Geburt keinen Sex hatte und der seither ohnehin nur bedingt gut ist. Sie redet nicht mit der Mutter, nicht mit der Schwester und nicht mit der besten Freundin darüber. »Ich sage, ich habe was mit dem Darm, mit der Verdauung – auch in der Verwandtschaft«, vertraute mir eine geschädigte Frau an. Darmprobleme, so etwas wie Reizdarm, das sei für viele okay, Einkoten sei definitiv kein Gesprächsthema.
Allenfalls forschen Frauen in sozialen Medien nach, treten geschlossenen Gruppen bei, um anonym ihre Beschwerden mit den übrigen Betroffenen abzugleichen, ihre eigenen zu schildern, sich Tipps zu holen. Das ist ein Muster, das sich bis ins ärztliche System fortsetzt. Viele berichten über ihre Symptome nach der Geburt zunächst nicht oder eher zögerlich in der Frauenarztpraxis. Weil die Sache so schambehaftet und erniedrigend ist, trauen sich selbst Mutige kaum, aufzubegehren. Die Verliererin fühlt sich klein. Die Geschädigten bräuchten nachhaltige Ermunterung, frei zu sprechen, doch die fehlt. Eher werden sie abgebügelt. Von einer solch schwachen Position aus fällt es schwer, auf mehr Diagnostik zu pochen, darauf zu bestehen, ernst genommen zu werden. Deshalb funktioniert das Abwiegeln, das Beruhigen, das Beschwichtigen so gut. Es sei unendlich demütigend, schrieb eine der Frauen, und schildert die Widerstände: »Bei mir ist es ja so, dass ich einen Prolaps uteri (Gebärmuttersenkung) habe … sprich, mein Mumu (Muttermund) schaute im Stehen aus mir raus. Ich musste allen Ernstes Fotos davon machen und die meinem Arzt um die Ohren werfen, weil er immer sagte, ich hätte keine Senkung und dass das alles nicht sein kann …«
Fachgesellschaften erkennen das Problem an, aber …
Beckenbodenschäden sind so real wie häufig: Deshalb entstehen schließlich immer mehr Beckenbodenzentren für geschädigte Frauen, deshalb gibt es die AGUB, die Arbeitsgemeinschaft Urogynäkologie und Beckenbodenrekonstruktion, als eigene Sektion innerhalb der Fachgesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG). Deshalb gibt es nicht zuletzt Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, die sich eigens für solche Therapien haben ausbilden lassen (https://www.ag-ggup.de/therapeutenliste/therapeutenliste-beckenboden/).
Warum, so fragen sich viele Geschädigte, haben wir vor der Geburt nie etwas über Beckenbodenschäden gehört? Und warum werden wir jetzt nicht ernst genommen? Beides hängt miteinander zusammen. Viele Frauenärztinnen und -ärzte, ebenso die Hebammen, wissen nur ungenügend über Beckenbodenschäden Bescheid. Das war früher kein Lerninhalt im Studium, es ist immer noch kein Topthema der Gynäkologie und keines in der Hebammenausbildung. Betroffenen, die das wissen, gelingt es eher, Motive und Unzulänglichkeiten bei der Versorgung zu begreifen, abzuschätzen, wo die besten Ratschläge zu holen sind, wer die wirklich guten Therapien anzubieten hat und nicht zuletzt: wem man trauen kann. Und nur wer das System durchschaut, bringt als Geschädigte, als jemand, die sich »klein« fühlt, den Mut und das Durchhaltevermögen auf, die Praxis oder die Klinik zu wechseln, weil dort absehbar keine Hilfe zu erwarten sein wird.
… das Wissen über Beckenbodenschäden ist noch nicht im Kreißsaal angekommen
Öffentlich über Beckenbodenschäden zu sprechen, ist im Grunde ein Angriff auf das Selbstverständnis der Geburtshilfe. Hieße das doch einzuräumen, wie viel körperlicher Schaden manchen Schwangeren im Verlauf einer natürlichen Geburt droht, wenn erkennbare Risiken unbeachtet bleiben. Das steht zwar mittlerweile zur Genüge in medizinischen Fachzeitschriften, wird jedoch vielfach von denen verdrängt, die im Kreißsaal arbeiten. Für Geschädigte stellt es sich so dar, als stecken Verantwortliche den Kopf in den Sand und negieren die Beckenbodenschäden. Der Druck steigt jedoch. Zunehmend mehr Frauen drängen mit ihren Beschwerden und Nachfragen in die Praxen, wollen zu Beckenbodenspezialkliniken überwiesen werden, bitten ständig um Rezepte für Physiotherapie.
Die Berufe, die mit Geburten zu tun haben, sind jedoch im Zwiespalt zwischen Zurückhaltung und Aufklärung. Hebammen, Geburtshelferinnen und Geburtshelfer kennen Geburtsverletzungen, aber dieses Wissen weiterzugeben, davor schrecken viele zurück. Sie fürchten, das rufe Panik hervor. Aber das ist falsch. »Tearing is a reality and it is better to be informed« (dass es reißt, ist eine Tatsache, und es ist besser, darüber informiert zu sein) – so lautet eine der zentralen Aussagen von Frauen, die sich in einem Forschungsprojekt über Verletzungen des Darmschließmuskels am Anus während der Geburt äußerten.2 Die Fachwelt selbst redet längst darüber, sie gibt den Problemen sogar Namen. Es gibt zum Beispiel in der Geburtshilfe den Ausdruck »offen wie ein Scheunentor« – für eine Frau, deren Genitalbereich nach einer Geburt weit auseinanderklafft. Nach meinem persönlichen Dafürhalten ist das eine widerwärtige Ausdrucksweise. Aber es gibt diese Redewendung. Es gibt sie, weil es etwas gibt, das als »Scheunentor« beschrieben wird. Dass damit unter Umständen ein schlimmes Schicksal besiegelt ist, genau das ist nicht jedem klar. Hier wird oft nicht weitergedacht als bis zur Kreißsaaltür. Wenn ich also die Klage höre, »die müssten das doch wissen«, so stimme ich zur Hälfte zu, denn diese Berufsgruppen haben die Schäden gewiss vor Augen. Sie sehen jedoch nicht, was dies für das weitere Leben einer Patientin bedeutet. Dies der Zunft beizubringen, wird noch dauern.
Die Verkennung der Risiken habe schließlich damit zu tun, »dass die Geburtshelfer und Hebammen die Frauen dann, wenn die Beeinträchtigungen offenbar wurden, meist nicht mehr als Patientinnen hatten«, erläuterte mir PD Dr. med. Kaven Baeßler, die Leiterin des Beckenbodenzentrums am Franziskus- und St. Joseph Krankenhaus in Berlin, als ich für einen Fachartikel recherchierte. In anderen Disziplinen der Medizin ist es üblich, die Langzeitfolgen ärztlichen Tuns zu evaluieren. Wer am Herzen eine neue Klappe einbaut, einen Tumor entfernt, Tabletten verschreibt, der muss fragen: Wie geht es dem Kranken mit der neuen Herzklappe nach fünf Jahren, ist der Tumor wirklich ganz entfernt, hat die Tablette Nebenwirkungen? Die Geburtshilfe tut das nicht. Denn andere Facharztgruppen als diejenigen, die die Zange bei der Geburt anwenden, operieren später die Frau, die dadurch verletzt wurde. Diese Frauen kehren weder in den Wochen nach der Geburt in den Kreißsaal zurück, noch stellen sie sich dort nach fünf Jahren vor und klagen über ihre Beschwerden. Im Kreißsaal kommt kein Feedback über Beckenbodenschäden an. Dort weiß man also weder, an wie vielen Frauen Schaden angerichtet worden ist, noch, wie gravierend im Einzelfall der Schaden war. Trotzdem beteuern diese Berufsgruppen: »Nichts heilt so gut wie der Beckenboden nach einer Geburt.« Ich weiß nicht, wer dieses Mantra erfunden hat – es tröstet allenfalls das Personal im Kreißsaal.
Fächerwirrwarr und Prestige
Es mangelt zudem an Fortbildung für die Profession. Als ich Ende 2018 im Deutschen Ärzteblatt einen Artikel mit dem Titel »Besser über Beckenbodenschäden nach vaginaler Geburt aufklären« veröffentlicht habe, waren die darin genannten Fakten vielen unbekannt.3 Gynäkologinnen und Gynäkologen oder Frauenärztinnen und -ärzte haben eine mehrjährige Ausbildung. Sie füllen den Mutterpass vor der Geburt mit ellenlangen Befunden aus, aber nach der Geburt steht oft nur eine Zeile drin. Ein Großteil der Betroffenen hat den Eindruck, dass just für die Zeit nach der Geburt wenig Sensibilität und oft noch weniger Fachwissen vorhanden sind. Mitunter haben sich die Patientinnen aus Not und Verzweiflung in sozialen Medien und im Internet mehr Wissen angeeignet als ihr Gegenüber in der Frauenarztpraxis. »Ich fragte, ob ich vielleicht eine Levatoravulsion haben könnte. Da schaute mich meine Frauenärztin mit großen Augen an. Sie kannte den Ausdruck gar nicht«, schilderte mir eine Patientin so frustriert wie enttäuscht.
Hinzu kommt, dass viele der Beckenbodenspezialistinnen und -spezialisten aus ganz verschiedenen medizinischen Fachrichtungen kommen. Es gibt Urogynäkologinnen und -gynäkologen, die zunächst in Gynäkologie ausgebildet worden sind und sich danach auf Urogynäkologie spezialisiert haben. Manche, die Beckenbodenschäden therapieren und operieren, kommen jedoch aus der Urologie, einem völlig anderen Fach. Dort ist die Therapie von Prostatakrebs angesiedelt. Harnblasenprobleme gehören zwar ebenfalls zur Urologie, aber diese Fachgruppe hat keine Ahnung von Geburten. Gleiches gilt für die Proktologie oder Analchirurgie. Das sind die für den Enddarm zuständigen Fächer. Hierzulande gibt es keine Fachrichtung, die für das, was »untenrum« bei einer Frau nach einer Geburt verletzt sein kann, eigentlich und ausschließlich zuständig wäre. Da ist die Medizin andernorts erheblich weiter. So etablieren sich vor allem in den USA, inzwischen auch in Großbritannien, Italien und Frankreich, exklusive Zentren für den Beckenboden, die »post partum«, unmittelbar nach einer Geburt, die verletzten Frauen betreuen.
Ein weiterer Umstand hat sich für die Fortschritte in der Beckenbodentherapie als Bremsklotz herausgestellt: Die Urogynäkologie zählt nämlich traditionell nicht zu den Spitzenfächern mit hohem Ansehen innerhalb der Frauenheilkunde. Es gibt nur wenige urogynäkologische Abteilungen an den Universitätskliniken, die die Forschung nennenswert vorangetrieben und neue Erkenntnisse zutage gefördert hätten. Anders ist das in der Brustkrebsforschung, für die viel Forschungsgeld von den profitorientierten Pharmakonzernen zur Verfügung steht. Bei der Behandlung von Krebspatientinnen ist mithin »viel mehr Prestige zu holen« als in der Urogynäkologie, wie es ein Oberarzt, der sich dennoch für die Beckenbodenforschung entschieden hatte, einmal ausdrückte.
Tricksen statt tasten
Wäre es denn wünschenswert, wenn die Urogynäkologie laut über Beckenbodenprobleme sprechen würde? Nein. Zwar gilt es überall sonst in der Medizin als erstrebenswert, keine Diagnose zu übersehen. In der Geburtshilfe ist es jedoch genau umgekehrt. Denn würde rigoros dokumentiert, wie viele Verletzungen eine Frau bei einer Geburt am Beckenboden davongetragen hat, würde dies dem Kreißsaal einer Klinik kein gutes Zeugnis ausstellen. Niemand hat folglich großes Interesse daran, alle Traumata lückenlos und penibel aufzulisten.
Eine der Mütter, die ich beraten habe, berichtete mir von ihren massiven Schmerzen, sie konnte ihren Stuhl nicht halten. Allerdings stand in ihrem Geburtsbericht, sie habe lediglich eine oberflächliche Verletzung erlitten – einen Dammriss Grad 1. Sie erzählte mir ausführlich von der Geburt und schilderte, wie lange sie genäht worden war. Das passte schlicht nicht zusammen. Ich bat sie, bei ihrer Krankenkasse nachzufragen. Daraufhin erfuhr die schwer geschädigte Frau, dass man die Versorgung eines Dammrisses Grad 4 statt Grad 1 (!) abgerechnet habe. Somit war die tief gehende Verletzung erkannt, aber nicht benannt worden. Es handelte sich um eine dreiste Lüge im Geburtsbericht.
Weil von den Schäden möglichst wenig Aufhebens gemacht werden soll, hört man ungern, wenn Mütter vielleicht schon auf der Wöchnerinnenstation ihre Beschwerden schildern. Es sollte eigentlich alle an der Versorgung Beteiligten aufhorchen lassen, wenn sie von solchen Symptomen erfahren. Nicht so in der Geburtshilfe. Wenn nicht gerade Wundheilungsstörungen die Frauen im Krankenhaus festhalten, streben die meisten mit ihrem Baby rasch nach Hause. So schaffen sich die Kliniken die Probleme zunächst vom Hals. Dabei konnte eine französische Untersuchung eindeutig zeigen, dass es zum Beispiel Frauen mit tief reichenden Dammrissen besser geht, wenn sie direkt nach der Geburt eigens über eine optimale Physiotherapie beraten werden.4
Mangelnde Fehlerkultur, gezieltes Framing
Es greift folglich eins ins andere zum Schaden der Patientinnen: Verletzungen erkennen können nur wenige, es erlernen nur wenige und – es wollen nur wenige. Das hat nicht zuletzt mit fehlender Fehlerkultur zu tun. Auch in der Chirurgie war es lange verpönt, chirurgische Fehler – das Liegenlassen von Tupfern im Bauch zum Beispiel – gnadenlos aufzudecken. Bis irgendwann die Stimmung kippte und die Meinungsführer forderten: »So geht es nicht weiter.« Plötzlich war es okay, von höchster Ebene abgesegnet, offen über Fehler zu sprechen, damit andere daraus lernen und sie vermeiden können.
In der Geburtshilfe ist es noch nicht so weit. So taucht zum Beispiel in einer Erfassung von mütterlichen Schäden während Schwangerschaft und Geburt aus 22 Ländern Europas über das EURO-PERISTAT-Projekt der Beckenboden nicht einmal auf.5 Dies, obwohl die Studie sich explizit der Frage widmet, was den Müttern bei einer Geburt zustoßen kann. Das Verschweigen von Beckenbodenschäden in wissenschaftlichen Artikeln trägt so dazu bei, dass deren Bedeutung unterschätzt wird.
Dabei kann es nicht bleiben. Mit der selbstverständlichen Berufstätigkeit vieler Frauen, mit ihren Ansprüchen an ein modernes, emanzipiertes Frauenleben ist der Rückzug ins Private keine Lösung für Geschädigte. Wer als Lehrerin vor einer Klasse steht und ständig Winde lässt, muss etwas unternehmen. Die Betroffenen geben sich nicht mehr damit zufrieden, dass das, was ihnen widerfahren ist, nun ihr privates Problem sein soll. Das mussten seinerzeit die meisten so hinnehmen, den Austausch mit anderen verhinderte das Tabu. Entweder schämten sie sich, Freundinnen, Bekannte, Verwandte anzusprechen, oder diese selbst bekannten sich aus Schamgefühl nicht zu ihren Beschwerden – frau war allein mit ihrer Not. Jetzt geraten sie über soziale Medien an andere Betroffene und erfahren: »Ich bin nicht allein« und »Es war nicht meine Schuld«. Plötzlich erkennen Frauen, dass offenbar Fehler gemacht worden sind, ihr Schicksal vermutlich hätte vermieden werden können.
2DER BECKENBODEN: VORHER – NACHHER
2.1Halt für alle Fälle: Das Becken und sein Boden
»My vagina split.«
Keira Knightley
Keira Knightley hatte 2018 viel Kritik auf sich gezogen, als sie die Beschönigung der natürlichen Geburt anprangerte und mit dem Satz »My vagina split« plötzlich Schlagzeilen machte.1 Gut, dass eine Celebrity das mal ausgesprochen hat. Tatsächlich kommen Scheidenrisse nicht selten vor – vorausgesetzt, es wird sorgfältig danach gefahndet, wie in der POPRACT-Studie (Pelvic Floor in Pregnancy And Childbirth) in Schweden bei 644 Müttern nach ihrer ersten Geburt. Große vaginale Risse im oberen Scheidendrittel hatten 14 Prozent der Frauen zu beklagen, bei etwa genauso vielen (14,9 Prozent) blieb die Vagina unversehrt, die übrigen Einrisse (71,1 Prozent) waren unbedeutender.2 Die Statistik verschont niemanden, auch Schauspielerinnen nicht. Wie kommt es zu solchen Verletzungen, welche Strukturen am weiblichen Beckenboden sind in Gefahr? Wer verstehen will, warum sich bei vielen Frauen »untenrum« nach einer Geburt nichts mehr so anfühlt wie früher, sollte den weiblichen Beckenboden kennenlernen.
Der Damm als Anker
Beginnen wir mit dem tiefsten Punkt des weiblichen Rumpfes. Er liegt zwischen dem Anus, dem Darmausgang zwischen den Pobacken, und der hinteren Begrenzung der Vagina, der Scheide (Abb. 1, 2). Das ist der Damm, das Perineum – ein ziemlich festes Stück aus Bindegewebe und Muskulatur –, dessen hoffentlich erhaltene Stabilität nach der Geburt durch eine Tastuntersuchung überprüft werden sollte. Stellt sich eine Frau aufrecht hin, zeigen die Ausgänge von Darm, Harnblase und Scheide keineswegs lotrecht nach unten. Schon die Scheide und der Anus sind in einem leicht schrägen Winkel nach vorn beziehungsweise hinten ausgerichtet (Abb. 4). Wir haben es also in der Tiefe des Beckens mit einer Art Trichter zu tun, nicht mit einer völlig flachen Ebene, wie der Ausdruck Becken-»Boden« vermuten ließe. Die »Ausgänge« befinden sich somit nicht in der Waagerechten. Deshalb streben Organe wie der Darm oder die Blase nicht lotrecht nach unten, sobald der Halt im Beckenboden verloren geht, sondern sie drücken zur Mitte hin, zur Scheide.
Die sehnige Platte in der Mitte des Dammes dient den zahlreichen Muskeln des Beckenbodens als gemeinsamer Fixierpunkt. Dazu zählen nicht zuletzt kleinere Muskeln, die dabei helfen, das Gewebe bei sexueller Erregung anschwellen zu lassen. Der Damm ist deshalb das Zentrum, der Anker des Beckenbodens.
Die vordere Beckenbegrenzung, die alle gut tasten und fühlen können, ist die Symphyse, die die beiden Schambeinknochen miteinander verbindet. Einen weiteren Fixpunkt bildet hinten das Steißbein, der knöcherne Ausläufer der Wirbelsäule, darunter rechts und links die Sitzhöcker (Abb. 1). Umrundet wird das Ganze von der unteren Begrenzung der Beckenknochen. Damit durch diese ovale Knochenöffnung die Beckenorgane nicht herausfallen, gibt es die aus Bindegewebe und Muskeln zusammengesetzten Beckenbodenstrukturen. Sie sind als Stränge, als Platten (Faszien), fächerförmig oder in Schlingen miteinander verwoben. Zahlreiche Blutgefäße versorgen diese Gewebestrukturen mit Sauerstoff und Nährstoffen. Sie werden außerdem von Nerven durchzogen, die ihre Befehle an die Muskeln weitergeben, um dafür zu sorgen, dass die Ausgänge von Darm und Harnblase je nach Bedarf dicht halten oder sich öffnen. Die Nerven haben darüber hinaus die wichtige Aufgabe, Empfindungen an unser Gehirn zurückzumelden – das kann das Gefühl von Harn- oder Stuhldrang sein, das können Schmerzen sein oder Lustgefühle bei sexueller Erregung.
Was die Befestigung angeht, so stellt frau sich am besten eine Hängematte vor, die vorn an den Schambeinen und hinten am Steißbein aufgehängt ist (Abb. 2). Diese Hängematte ist zwar in mehreren Lagen verstrebt und seitlich an den Beckenknochen mehrfach befestigt. Entscheidend für das Verständnis von Beckenbodenschäden ist jedoch: Die Hauptaufhängung befindet sich vorn – rechts und links der Symphyse an den Schambeinen. Schwächelt die Hängematte, schwächelt das ganze Gefüge des Beckenbodens.
Von kleinen Muskeln und vielen Wollustkörperchen
Die Austrittspforten der Urogenital- und Darmorgane beginnen von vorn betrachtet mit der Mündung der Harnröhre für den Urinstrahl (Abb. 1, 2). Bis zu 2 Zentimeter dahinter befindet sich die vordere Grenze des Scheidenausganges und schließlich weitere 1,5 bis 3 Zentimeter von ihrer hinteren Begrenzung aus gemessen der Anus, dessen Schließmuskeln den Darm dicht halten. Das sind Durchschnittswerte, die Variabilität ist groß – vor allem bei Beckenbodenschäden verändern sich diese Messgrößen. Dennoch wird klar: »Da unten« liegt alles dicht nebeneinander (Abb. 3). Die Ausgänge mindern die Tragkraft des Beckenbodens, mit der Scheide haben Frauen daher im Vergleich zu Männern eine zusätzliche »Schwachstelle«.
Die Region heißt nicht ohne Grund Urogenitalregion und die Organe Urogenitalorgane. Die Genitalien und die Ausscheidungsorgane sind embryologisch, im Zuge der Entwicklung der Organe, aus gemeinsamen Ursprüngen hervorgegangen. Sie liegen anatomisch räumlich eng benachbart. Deshalb tragen außer Blase und Darm nicht zuletzt die Geschlechtsorgane Beckenbodenverletzungen davon. Die äußere genitale Zone heißt Vulva, dies ist die Region um den Scheideneingang, begrenzt von den kleinen und großen Vulvalippen, früher hießen sie Schamlippen (Abb. 1). Oben vor der Harnröhre liegt die Klitoriseichel als eines der Haupterregungszentren der Frau. Das ganze Klitorisorgan ist viel größer und erstreckt sich weit ins Innere des Beckenbodens, außerdem sind Muskeln und Schwellkörper in der Tiefe der Urogenitalregion von großer Bedeutung für ein erfülltes Sexleben (Abb. 10). Dass es auf jede Struktur ankommt, soll ein Beispiel erläutern. Einer der Muskeln des Beckenbodens ist der M. (Musculus) bulbospongiosus (Abb. 8). Dieser Muskel übt unter anderem Druck auf die Scheidenvorhofdrüsen aus, die rechts und links vom Scheidenausgang liegen und mit ihren winzigen Ausgängen in die Innenseite der kleinen Schamlippen münden. Sexuelle Erregung bedeutet Anschwellen, bedeutet Verengung des Scheideneinganges, bedeutet Feuchtwerden – unter anderem mithilfe dieser Drüsen. Der erwähnte Muskel wird bei manchen Dammschnitten bewusst durchtrennt – obwohl er für die Sexualität eine Rolle spielt. »Männer würden eine Durchtrennung strikt ablehnen«, schreibt dazu ein in der Geburtshilfe erfahrener Arzt, Prof. Dr. med. Wenderlein, in einem Leserbrief an das Deutsche Ärzteblatt.3 Er rügt, dass dies bei Frauen immer noch kritiklos hingenommen würde.
Im Vorhofbereich der Scheide gibt es neben den erwähnten größeren Vorhofdrüsen oder Bartholin-Drüsen noch weitere kleine Drüsen, die beim Sex aktiv werden und für Befeuchtung sorgen. Hinzu kommen die zahlreichen paraurethralen Drüsen in der Umgebung der Harnröhre (Urethra), deren größte rechts und links als Skene-Drüsen bezeichnet werden. Deren Ausgänge münden variabel in die Harnröhre oder daneben nach außen (Abb. 9). Die gesamte Region – von der Klitoris vorn oben bis zum Anus hinten – ist somit eine einzige erogene Zone für die Frau. Sie ist intensiv mit Nerven bestückt, damit frau höchst empfindsam auf Berührung und andere Reize reagieren kann. Allein die Klitoris versammelt an ihrer Spitze zahllose Sinneszellen, die Genitalkörperchen, Wollustkörperchen oder G-Körperchen genannt werden, weil sie als Hauptsensoren der Lust gelten. Andere, die Vater-Pacini-Körperchen, sind für Vibration zuständig. Vibratoren als Sextoys sind zum Beispiel exakt auf jene Schwingungsfrequenzen abgestimmt, durch die diese Sinneszellen stimuliert werden. Wollustkörperchen reagieren vor allem auf Berührung und gleitenden Druck. An der weiblichen Klitoriseichel sitzen sie doppelt so dicht wie an der Penisspitze. Zusammen mit zahlreichen anderen Sinneszellen und Nervenendigungen sind es rund 8.000 an der Zahl. Da jedoch die Oberfläche der Klitoris so viel kleiner ist als die der Peniseichel, verleiht die ungleich höhere Dichte ihrer Besitzerin eine 50-fach höhere Empfindsamkeit, als Männer sie spüren. Deshalb verwundert es nicht, dass der Nerv, der von der Klitoris wegführt und all diese Eindrücke von dort ins Gehirn transportiert, drei- bis viermal so dick ist wie der entsprechende Nerv beim Mann. Er ist sogar so dick, dass diese ungewöhnliche Nervenmasse Genitalforscher immer wieder in Erstaunen versetzt hat. Aus diesem Grund ist die Klitoris einzigartig empfindlich und erregbar.4
Aber nicht allein dort verfügt eine Frau über Wollustkörperchen. Diese empfindlichen Sensoren finden sich – in jeweils individuellem Dichtemuster – zusammen mit den vibrationsempfindlichen Vater-Pacini-Körperchen überall verteilt über die erogene Zone des Beckenbodens, beispielsweise in der Vulva um den Scheidenvorhof, hinten an der Scheidenmitte, wo diese in den Damm übergeht, sie umgeben den Austritt der Harnröhre, es gibt sie nicht zuletzt in der Analzone. Alles, was von diesen Lustantennen empfangen wird, mündet über Nerven, die sich zu Geflechten bündeln, schließlich über die dickeren Verzweigungen des Beckenbodennervs – Nervus pudendus oder N. pudendus – in das Rückenmark. Über ihn gelangt Lust ins Gehirn. Verletzungen, Vernarbungen oder Druckschäden in dieser Urogenitalregion können mithin das einzigartige und sonst nirgends in dieser Intensität vorhandene Erregungssystem empfindlich stören. Das Wissen um die üppige erogene Ausstattung des weiblichen Beckenbodens ist indes nicht weitverbreitet, selbst in der Medizin nicht. Interessanterweise kommen Wollustkörperchen nicht einmal in allen Anatomiebüchern für die Studierenden der Medizin vor.
Levator ani, der König der Beckenbodenmuskeln
Der Beckenboden ist Schicht für Schicht gesichert. Nach unten außen dichtet das Diaphragma urogenitale ab. Dessen Muskeln lassen sich willkürlich anspannen, etwa beim Beckenbodentraining. Wer die Urogenitalregion mit dem Spiegel von außen inspiziert, kann am Damm eine Art Ministrang entdecken, intensiver gefärbt als die übrige Haut und wie eine Naht zwischen Anus und dem hinteren Scheidenausgang imponierend. Diese Raphe perinei oder Dammnaht markiert die Mittellinie des darüberliegenden Dammgewebes, der zentralen Festung des Beckenbodens (Abb. 1). Ist sie nach einer Seite hin verzogen, deutet dies auf einseitig abgerissene Muskeln im Innern hin.
Auf die äußerste Beckenbodenschicht folgt nach innen das Diaphragma pelvis, das sich wie ein Trichter nach unten verjüngt. Es besteht hauptsächlich aus dem Musculus levator ani, der auch als Afterhebemuskel bezeichnet wird. Am gebräuchlichsten sind die Ausdrücke Levator oder Levator ani. Ihm kommt für die Integrität des Beckenbodens eine absolute Schlüsselposition zu. Vergleichbar mit einer Hängematte spannen sich die Muskelfasern des Levator ani von vorn an der Symphyse bis nach hinten zum Steißbein (Abb. 2). Einige Anteile sind noch seitlich am Becken befestigt. Ausläufer ziehen außerdem in die Wand der Scheide, einige Levatormuskelzüge sind zusätzlich am Aufbau des äußeren Darmschließmuskels beteiligt. Am Levator »hängt« sprichwörtlich und konkret der Beckenboden.
Ein Abriss eines der beiden Levatormuskelzüge am Schambein heißt Avulsion, ist einer der Levatormuskelzüge nur teilweise abgerissen, heißt es Teilavulsion – eine Diagnose, die viele Frauenärztinnen und -ärzte nicht kennen. Letztlich handelt es sich bei einer Avulsion um einen Muskelabriss, wie er bei schwerwiegenden Sportverletzungen vorkommt. In vielen Studien ist die Bedeutung einer Levatoravulsion für das Schicksal des Beckenbodens im weiteren Leben untersucht worden. Das Beckenbodentraining hilft in solchen Fällen wenig, da den Muskelzügen die Verspannung fehlt. Muskeln werden durch Anspannen und Loslassen trainiert – wozu ein Muskel Widerstand braucht. Er muss zum Beispiel wie der Bizeps zwischen Schulter und Unterarmknochen fixiert sein, um diese beiden Pole einander anzunähern und damit den Arm zu beugen. Ist der Bizeps am Unterarm abgerissen, fehlt das Widerlager – der Unterarm lässt sich nicht mehr mit dem Muskel heranziehen, nicht mehr beugen. Im Beckenboden ist das so, als hinge auf einer Seite ein Teil der Hängematte herunter, das Ganze kippelt nach einer Seite. Beckenbodentraining wirkt dann lediglich einseitig, die Gegenseite bleibt schlaff. Wer das nicht weiß oder nicht richtig angeleitet wird, übt sich eher in eine Asymmetrie hinein: Nur eine Seite wird krass auftrainiert. Das erst lässt verstehen, warum es unsinnig ist, diese Frauen zu intensiverem Beckenbodentraining zu motivieren oder ihnen gar mit der beliebten Frage »Üben Sie wirklich fleißig?« ein schlechtes Gewissen zu machen.
Warum wir unten dicht sind





























