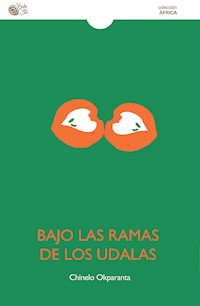Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Das Wunderhorn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reihe für zeitgenössische Afrikanische Literatur
- Sprache: Deutsch
Die Coming-out-Geschichte des Mädchens Ijeoma beginnt 1968, ein Jahr nach Beginn des Biafra-Kriegs in Nigeria. In den Kriegswirren wird die 11-Jährige von ihrer Mutter zu Freunden der Familie geschickt, wo sie Amina kennenlernt, die wie sie alleine ist. Zwischen Ijeoma, einer christlichen Igbo, und Amina, einer muslimischen Hausa, beginnt eine Freundschaft, die zur Leidenschaft wird. Als ihre Beziehung entdeckt wird, lernt Ijeoma einen Teil von sich zu verleugnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reihe für zeitgenössische afrikanische LiteraturHerausgegeben von Indra Wussow
ChineloOkparanta
Unter denUdala Bäumen
Aus dem nigerianischen Englischvon Sonja Finckund Maria Hummitzsch
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde mit Mitteln des AuswärtigenAmts unterstützt durch Litprom e.V. – Literaturen der Welt
Titel der Originalausgabe: Under the Udala Trees
Copyright © 2015 Chinelo Okparanta
© 2018 Verlag Das Wunderhorn GmbH
Rohrbacherstrasse 18, D-69115 Heidelberg
www.wunderhorn.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form(durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftlicheGenehmigung des Verlags reproduziert werden oder unter Verwendungelektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Foto der Autorin S.2: © Manfred Metzner
Gesamtgestaltung: sans serif, Berlin
eISBN 978-3-88423-592-8
Für Constance, Chibueze, Chinenye, ChidinmaUnd für Obiora
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen,was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem,was man nicht sieht.
HEBRÄER 11:1
Inhalt
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
ZWEITER TEIL
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
DRITTER TEIL
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
VIERTER TEIL
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
FÜNFTER TEIL
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
SECHSTER TEIL
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
EPILOG
ANMERKUNG DER AUTORIN
DANKSAGUNG
ERSTER TEIL
1
Zwischen der Old Oba-Nnewi Road und der New Oba-Nnewi Road, in dem Teil von Ojoto zwischen der Kirche und der Grundschule, da, wo die Mmiri John Road aufhört und auf der anderen Seite weitergeht, befand sich unser Haus. Es war zweistöckig und aus Beton, mit gelben Außenwänden, und stand an einem der staubbraunen Wege südlich des River John, in dem Papas Mama als Kind fast ertrunken wäre, damals, als die Leute ihre Wäsche noch auf den Felsen am Ufer gewaschen haben.
Unser Grundstück war von einer Mauer umgeben, und rechts und links vom Eingangstor wuchsen dichte Rosen- und Hibiskusbüsche. Sie gingen in zwei grüne Hecken mit unzähligen rosafarbenen Sprenkeln über, kleine sternförmige Ixora- Blüten. Auf dem Weg vor der Hecke standen Straßenhändler und Bäume voller Früchte und Nüsse: Orangen, Guaven, Cashews und Mangos. In den Gräben neben dem Weg, in denen das Gebüsch wucherte wie ein Wald, standen weitere Bäume: riesige Irokos, raschelnde Kiefern und hier und dort ein paar Öl- oder Kokospalmen. Wenn wir ihre Wipfel sehen wollten, mussten wir den Kopf in den Nacken legen. So groß waren die Büsche, so hoch wuchsen die Bäume. In den Monaten, in denen der Harmattan blies, wirbelten Saharawinde den Staub auf, trübten die Luft, brachten die Bäume zum Flimmern und verschleierten die Sonne, die als verschwommene Scheibe am Himmel hing.
In der Regenzeit zähmte der Regen den Staub, und alle Dinge waren wieder klar umrissen.
Es war der immergleiche Rhythmus: auf die Regenzeit folgte die Trockenzeit, und der Harmattan zwängte sich mitten in die Trockenzeit hinein. Ziegen meckerten. Hunde bellten. Hühner scharrten am Straßenrand, ohne sich allzu weit von dem Grundstück zu entfernen, zu dem sie gehörten. Schwalbenschwänze und Monarchen, Gelblinge und Feuerfalter flatterten von Blüte zu Blüte.
Wie die Schmetterlinge hatten auch wir es nicht eilig, wir bewegten uns träge, als wäre die Luft immer lau und die Sonne ein Streicheln auf unserer Haut. Als könnte man beides nur genießen, wenn man sich Zeit ließ. So war es vor dem Krieg: Das Leben nahm gemütlich seinen Lauf.
1967 brach der Krieg über uns herein und breitete sich überall aus. Ein Jahr später bebte Ojoto von den Einschüssen der Panzer und Granatwerfer, und das Grollen der Kampfflugzeuge schickte uns Schockwellen durch den Körper.
Ein Jahr später hatten die Männer plötzlich Gewehre um und waren mit Äxten und Macheten bewaffnet, deren Klingen in der Sonne blitzten; an Nachmittagen und Abenden zogen sie alle paar Stunden auf der Straße vorbei, und lauter Gesang schallte aus ihren Kehlen: »Biafra wird siegen!«
In diesem zweiten Kriegsjahr – 1968 – schickte Mama mich weg.
Die Gespräche über die Feierlichkeiten, die stattfinden würden, wenn Biafra den Krieg gegen Nigeria gewann, waren verstummt. Stattdessen machten sich alle darüber Sorgen, was nach einem Sieg Nigerias aus uns werden würde: Würde man uns aus unseren Häusern jagen und uns unser Land wegnehmen? Würde man uns unterdrücken? Würden die Lebensmittel rationiert werden? Wie lange würden wir Not leiden müssen? Würden wir uns jemals von der Niederlage erholen?
Die Leute stellten sich diese Fragen, weil 1968 schon absehbar war, dass Nigeria den Krieg gewann und nichts mehr sein würde wie vorher.
Doch es kamen noch ganz andere Veränderungen auf uns zu.
Ich kann Aminas und meine Geschichte nicht erzählen, ohne zu erzählen, wie Mama mich von zu Hause weggeschickt hat. Und genauso wenig kann ich erzählen, wie Mama mich von zu Hause weggeschickt hat, ohne zu erzählen, wie Papa sich geweigert hat, mit uns in den Bunker zu kommen. Wenn er sich nicht geweigert hätte, hätte Mama mich bestimmt nicht weggeschickt, und wenn Mama mich nicht weggeschickt hätte, wäre ich Amina nie begegnet.
Und wenn ich Amina nicht begegnet wäre, dann gäbe es vielleicht gar keine Geschichte zu erzählen.
Deshalb beginnt diese Geschichte noch vor der eigentlichen Geschichte, und zwar am 23. Juni 1968. Ubosi chi ji ehihe jie: Der Tag, an dem die Nacht schon am Nachmittag anbrach, wie es in dem Sprichwort heißt. Oder wie Mama manchmal sagt: Der Tag, an dem die Nacht den Tag besiegte. Der Tag, an dem Papa uns verließ.
Es war ein Sonntag, aber wegen des Fliegeralarms waren wir nicht in die Kirche gegangen. Am Abend zuvor war im Radio davor gewarnt worden, dass feindliche Flugzeuge Angriffe fliegen würden, mindestens zwei Tage lang, wie so oft. Da war es das Vernünftigste, zu Hause zu bleiben, hatte Papa gesagt, und Mama stimmte ihm zu.
Papa und ich waren im Wohnzimmer, er saß vornübergebeugt an seinem Schreibtisch, die Ellbogen auf den Oberschenkeln, den Kopf auf die Fäuste gestützt. Aus der Küche roch es nach Mamas frittierten Akara, der süßlich-scharfe Duft strömte ins Wohnzimmer.
Papa runzelte die Stirn und zog die Nase kraus, als wäre es ein übler Gestank. Neben ihm stand sein Radio, vor ihm lag ein Stapel Zeitungen.
Am Morgen hatte er Radio gehört und die Lautstärke bis zum Anschlag aufgedreht, als wäre er schwerhörig. Konzentriert lauschte er den aus dem Lautsprecher schallenden Stimmen von Radio Biafra. Selbst als Mama zu ihm ging und ihn bat, das Radio leiser zu stellen, weil der Lärm unerträglich sei und nicht jeder ständig daran erinnert werden wolle, dass das Land vor die Hunde ging, hatte er sie ignoriert.
Jetzt aber lief das Radio so leise, dass nur ein schwaches Knistern zu hören war, es klang ein wenig so, als kratze sich jemand am Arm.
Vor dem Krieg hatte Papa sein Grammophon geliebt. Er liebte es so, wie man Dinge liebt, die einem wichtig sind: Bibeln und alte Fotos, Wasser und Luft. Er hatte das Grammophon von seinem Vater geerbt, der im Jahr meiner Geburt gestorben war. Meine anderen Großeltern waren ihm bald gefolgt – im Jahr danach verstarb Papas Mutter, und in den zwei Jahren darauf verlor Mama beide Eltern. Papa und Mama waren Einzelkinder, und sie sagten immer, dass das einer der Gründe war, warum sie sich so sehr liebten: Ihre Familie bestand nur noch aus ihnen beiden, abgesehen von mir natürlich.
Aber die Tage, in denen Papa seinem Grammophon zärtliche Blicke zugeworfen hatte, waren vorbei. An diesem Nachmittag saß er da und starrte finster auf das klotzige Ding.
Dann wandte er sich den Zeitungen zu, die auf seinem Zeichenpapier lagen: die Ausgaben der Daily Times von einem ganzen Monat, zerknittert und mit Eselsohren. Er nahm eine und begann sie mit sorgenvoller Miene durchzublättern.
Ich ging zum Schreibtisch und stellte mich so dicht neben ihn, dass ich seine Pomade aus dem gelb-rotem Glas mit der Aufschrift Morgan’s riechen konnte, das aussah wie ein Medizinfläschchen. Wäre der Krieg doch nur eine Krankheit, gegen die man Medizin schlucken könnte.
Papa legte die Zeitung zurück auf den Stapel. Auf der Titelseite prangte in großen Buchstaben: HELFT UNS! Darunter war ein Foto von einem Kind mit aufgedunsenem Bauch und Beinen so dürr wie Stecken zu sehen, ein unterernährtes Mädchen, etwa so alt wie ich. Es war nur irgendein Igbo-Mädchen, aber es hätte genauso gut ich sein können.
Papa trug eine seiner weit geschnittenen Kombinationen aus Buba und Sokoto, deren Grün vom vielen Waschen ganz bleich war. Er hob den Blick und schenkte mir ein schwaches Lächeln, aber es wirkte falsch, weil kein Gefühl darin lag. Aber immerhin lächelte er.
»Kedu?«, fragte er.
Er zog mich in seine Arme, und ich schmiegte mich an ihn, sagte aber nichts, weil ich nicht wusste, was ich antworten sollte. Wie ging es mir?
Ich hätte ihm die Standardantwort geben und einfach »gut« sagen können, aber wie konnte es einem in diesen Tagen gut gehen? Nur wer blind, taub und stumm oder völlig abgestumpft war, dem konnte es angesichts des Krieges und der Bombenangriffe gut gehen.
Oder wer schon tot war.
Wir schwiegen und bewegten uns nicht, und mir fiel auf, dass er stocksteif dasaß, ohne dass sein Rücken die Stuhllehne berührte. Seine Füße schienen am Boden festzukleben. Er verzog die Lippen, aber nicht zu einem Lächeln, sondern wie ein Kind, das gleich weint. Er öffnete den Mund, aber es kam kein Wort heraus.
Am Abend vorher, es war schon spät und ich hätte längst schlafen sollen, hatte ich lange wach gelegen und mich dann hinunter ins Wohnzimmer geschlichen. Als ich mein Zimmer verließ, sah ich, dass im Wohnzimmer noch Licht brannte. Auf Zehenspitzen schlich ich auf die leisen Geräusche zu, die aus derselben Richtung kamen. An der dünnen Wand zwischen Esszimmer und Wohnzimmer blieb ich stehen und spähte um die Ecke. Papa saß in derselben Haltung wie jetzt da, auf seinem Stuhl, den Kopf über den Schreibtisch gebeugt, und hörte konzentriert Radio. Es war schon sehr spät, und trotzdem saß er noch im Wohnzimmer.
Ich rührte mich nicht und lauschte, und da hörte ich die Geschichte. Ein gewisser Mr. Njoku, ein Igbo, war gefesselt, mit Benzin übergossen und angezündet worden. Hier bei uns im Süden, sagte der Radiosprecher. Im Norden passierte so was ständig, aber jetzt ging es auch bei uns im Süden los. Die Hausas zündeten uns an, sie wollten uns töten, unsere Häuser zerstören und unser Land stehlen.
»Papa, ist irgendwas passiert?«, fragte ich jetzt. Damit meinte ich, ob etwas Schlimmes passiert war, so was wie in den Radionachrichten am Abend zuvor, ob zum Beispiel wieder jemand lebendig verbrannt worden war.
Papa schüttelte den Kopf, so als hätte er etwas sagen wollen, es sich dann aber anders überlegt. »Was können wir schon tun?«, murmelte er. »Ein einzelner Mensch ist machtlos. Aber es bringt nichts, sich ständig Sorgen zu machen. Das ist, als ob man Wasser auf einen Stein gießt. Der Stein wird nass. Er trocknet wieder. Aber es ändert sich nichts.«
Einen Moment lang war das einzige Geräusch das Klappern von Mamas Töpfen aus der Küche. Bald würden die Akara fertig sein, und Mama würde uns zum Essen rufen, so wie immer, wie vor dem Krieg.
Papa fasste mich an den Armen und sah mir in die Augen. Dann sagte er sehr sanft: »Ich muss dir etwas sagen. Du weißt es zwar schon, aber ich möchte es dir noch einmal sagen. Damit du es nie vergisst.«
»Was denn?« Ich fragte mich, was das sein konnte, etwas, was ich schon wusste, aber vergessen könnte.
»Ich möchte, dass du weißt, dass dein Papa dich sehr lieb hat. Ich möchte, dass du dir das gut merkst, damit du es nie vergisst.«
Ich seufzte, weil ich ein bisschen enttäuscht war, dass es etwas so Offensichtliches war. »Ach, Papa, das weiß ich doch.«
Im nächsten Moment sah Papa aus, als trüge er das Gewicht, den Schmerz und die Sinnlosigkeit der ganzen Welt in sich. Sein Gesichtsausdruck war distanziert, als hätte er sich von allem, was er kannte, entfernt, wäre gleichzeitig aber tiefer damit verbunden als je zuvor.
Er begann vor sich hinzumurmeln. Irgendetwas darüber, dass Nigeria dabei sei, Biafra die Glieder auszureißen. Nsukka und Enugu seien gefallen, Onitsha auch. Und letzten Monat Port Harcourt.
Er redete immer weiter. Seine Stimme klang monoton. Wie in Trance.
Nicht mehr lange, und es ist nichts mehr von Biafra übrig, sagte er. »Wird Ojukwu sich den Nigerianern ergeben? Oder wird er weiterkämpfen, bis auch der Letzte von uns tot ist?« Er starrte mit glasigem Blick aus dem Fenster.
Vielleicht hatte sein Zustand doch nichts mit dem Gewicht und dem Schmerz und der Sinnlosigkeit der Welt zu tun. Vielleicht hatte es eher etwas mit seinem Platz in der Welt zu tun. Vielleicht konnte er sich nicht vorstellen, in Nigeria zu leben, wenn Biafra besiegt worden war. Vielleicht fand er den Gedanken unerträglich, in einem neuen Regime weiterzuleben und ohne all das auskommen zu müssen, wofür er so hart gekämpft hatte – viele Jahre gekämpft hatte –, in einem Regime, in dem wir Biafraner Bürger zweiter Klasse wären, Sklaven, jedenfalls ging so das Gerücht.
Wie auch immer, er hatte alle Hoffnung verloren. Mama sagt, der Krieg verändert die Menschen und selbst ein mutiger Mann verliert manchmal jede Hoffnung, und da kann man ihn noch so sehr anflehen, sich zusammenzureißen, es nützt alles nichts.
23. Juni 1968. Der Krieg dauerte bereits ein Jahr, und wieder einmal stiegen Kampfbomber auf wie Lastwagen, die von der Straße abhoben und über den Himmel donnerten. Papa muss die Flugzeuge schon von Weitem gehört haben – im selben Moment wie ich –, denn er stand von seinem Schreibtisch auf und nahm meine Hand. Es kam mir vor, als wäre die Sonne, die eben noch hell durchs Fenster geschienen hatte, verschwunden. Als hätte sich der Himmel verdunkelt.
Erst zog Papa mich mit sich, so wie immer, wenn wir zum Bunker laufen mussten. Doch dann tat er etwas Ungewöhnliches: Zwischen Esszimmer und Küche blieb er abrupt stehen. Er war leichenblass und sah aus wie jemand, der sich nichts mehr vom Leben versprach. Ein bisschen wie ein Zombie.
Er ließ meine Hand los und stieß mich in Richtung Hintertür. Doch ich rührte mich nicht. Ich stand da und sah zu, wie er zurück ins Wohnzimmer ging, sich auf das Sofa setzte und zum Fenster starrte.
Mama kam schreiend ins Wohnzimmer gerannt und brüllte uns an: »Unu abuo, bia ka’yi je!« Schnell, ihr zwei! »Die Flugzeuge kommen! Binie! Los! Steh auf!«
Sie rannte zu Papa und zog ihn am Arm, und ich zerrte an dem anderen Arm, aber Papa blieb einfach sitzen. Er hätte genauso gut ein Zementblock sein können, eine Eisstatue oder eine Salzsäule, so wie Lots Frau. »Unu abua, gawa. Geht«, sagte er. »Ist schon gut. Lasst mich.«
Seine Stimme klang rau, wie Schleifpapier auf Holz oder wie ein geflochtener Korb, den jemand über einen Betonboden zieht.
Als wir aus dem Wohnzimmer liefen, saß er immer noch auf dem Sofa und starrte aus dem Fenster.
Der Bunker befand sich hinter dem Haus, nur wenige Meter von dem Zaun entfernt, der unser Grundstück vom Brachland trennte. Mama und ich liefen ohne Papa durch die Hintertür nach draußen und sprangen über die Palmblätter hinweg, die Papa vor Monaten zur Tarnung überall auf unserem Grundstück verteilt hatte.
Am Tor blieb Mama ein letztes Mal stehen und rief nach Papa: »Uzo! Uzo! Uzo!«
Das Sprichwort sagt, dass Hitze das, was bei Kälte erstarrt, wieder erweichen kann. Doch trotz der Hitze in ihrer Stimme wurde Papa nicht weich.
»Uzo! Uzo! Uzo!«, rief Mama noch einmal.
Keine Ahnung, ob er sie hörte. Jedenfalls kam er nicht.
2
Von unserem Haus bis zur Kirche war es nicht weit, nur ein Stück die Straße runter. Die Kirche stand dort, wo die Häuser aufhörten und der Markt anfing.
Ungefähr ein Jahr vor diesem 23. Juni betete ich zum ersten Mal, es möge keinen Krieg geben. Das war Anfang März. Ich weiß das so genau, weil es die Zeit war, in der die Guaven, Annonen und Tamarinden reif sind, der Übergang zwischen Trocken- und Regenzeit. Noch wehte der Nordwind aus der Wüste, aber unser Haar und unsere Haut waren nicht mehr so trocken und spröde wie mitten im Harmattan. Die Schnupfenzeit war vorbei. Es war wärmer geworden und die Luft war nicht mehr ganz so staubig.
In all den Jahren in Ojoto gingen wir jeden Sonntag in die Kirche, in die Holy Sabbath Church of God. Dort saßen wir auf den Holzbänken, die in langen Reihen aufgestellt waren, und lauschten der Predigt. Zwischendurch gab es Gebete, und zwischen den Gebeten wurde geklatscht und gesungen. Gegen Mittag waren wir müde vom Singen und Beten. Unsere Arme hingen schlaff herab, ausgelaugt vom vielen Klatschen und Bitten, Gott möge uns erhören.
Nach dem Gottesdienst saß ich oft draußen auf den Betonstufen und sah Chibundu Ejiofor und den andere Jungen beim Spielen zu. Es waren dumme Spiele, zum Beispiel Räuber und Gendarm: Einer war Polizist und verhaftete die anderen. Chibundu, der kluge, spitzbübisch funkelnde Augen hatte, wollte immer Polizist sein. Er benutzte seine Finger als Pistole, drückte sie einem anderen Jungen auf die Brust und rief: »Du bist verhaftet!«
Manchmal kamen ein paar andere Mädchen nach draußen und setzten sich zu mir. Aber meistens blieben sie drinnen bei ihren Eltern, weil sie Angst hatten, die Jungs könnten ihre Sonntagskleider dreckig machen.
Gegen Ende des Harmattans betete ich in dieser Kirche zum ersten Mal, es möge keinen Krieg geben, weil Chibundu vor dem Gottesdienst gesagt hatte, der Himmel wäre bald voller Kampfflugzeuge. Das war kurz vor Kriegsausbruch, noch bevor die Flugzeuge tatsächlich nach Ojoto kamen. Chibundu machte ein brummendes Geräusch mit den Lippen, wie ein Flugzeugmotor, und ich lachte, weil er sein Gesicht aufblies wie ein Kugelfisch. Aber eigentlich war das gar nicht lustig, also riss ich mich zusammen und sagte: »So ein Quatsch!«, niemals würden wir Kampfflugzeuge am Himmel sehen. Davon war ich fest überzeugt, denn Papa sagte damals immer, der Krieg wäre nur ein Hirngespinst, der kranken Fantasie der Erwachsenen entsprungen. Niemals würden Kampfflugzeuge in Nigeria Bomben abwerfen, und schon gar nicht in Ojoto. Und weil Papa sich sicher war, war ich mir auch sicher.
Chibundus Mutter hatte unser Gespräch mitangehört. Sie kam zu uns und schlug ihn ohne Vorwarnung mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. »Ishi-gi o mebiri e mebi?«, fragte sie. Ist dein Kopf kaputt? Wie kannst du es wagen, den Mund aufzumachen und so was Furchtbares zu sagen!
Für den Rest des Tages lief Chibundu herum wie ein geprügelter Hund. Später, während des Gottesdienstes, als der Pfarrer uns bat, ein stilles Gebet zu sprechen, flehte ich Gott an, all das Gerede vom Krieg und jeden Gedanken daran verschwinden zu lassen, sie einfach wegzuzaubern. Chibundu durfte auf keinen Fall Recht haben. Damit die Kampfbomber nie über uns hinwegflogen. Damit wir nicht ständig um unser Leben bangen mussten. Damit wir den Krieg nicht eines Tages mit uns herumtragen mussten wie eine zweite Haut.
Lieber Gott, betete ich, bitte hilf uns.
Seitdem ist viel Zeit vergangen, und leider hat Chibundu Recht gehabt. Gott hatte wohl etwas Besseres zu tun, als meine Gebete zu erhören.
23. Juni 1968. Wir kämpften uns durch das Gestrüpp und rannten keuchend zum Bunker, die in die Erde geschlagenen Stufen hinunter. Dann hockten wir stumm in dem Erdloch, das kaum größer war als ein Doppelbett. Ich konnte aufrecht stehen, aber Mama und jeder andere durchschnittlich große Erwachsene stieß mit dem Kopf an die Decke.
Wir kauerten an einer Wand. Manchmal schauten wir zum Eingang, der mit einem Brett verschlossen war, getarnt mit Palmblättern, unserem einzigen Schutz.
Papa hatte nicht nur überall auf dem Grundstück Palmblätter verteilt, sondern auch auf unserem Dach. Vielleicht funktionierte die Tarnung für das Haus ja genauso gut wie für den Bunker, dachte ich. Vielleicht würden die feindlichen Piloten nur Palmwedel sehen und das Haus nicht bombardieren.
Im Bunker betete ich wieder zu Gott: Lieber Gott, bitte beschütze Papa. Mach, dass die Flugzeuge keine Bomben auf ihn werfen.
Mama kauerte schweigend neben mir und machte ein Gesicht, als würde sie jeden Moment aufspringen und nach draußen rennen, um Papa zu holen. Ich rutschte näher an sie ran, biss mir auf die Lippen und kaute an meinen Fingernägeln. Ich hielt den Atem an und wiederholte immer wieder stumm: Lieber Gott, bitte beschütze Papa. Mach, dass die Flugzeuge keine Bomben auf ihn werfen.
Was mir an diesem Tag durch den Kopf ging, hätte auch jedes andere Kind in meinem Alter denken können: Vielleicht hatte Gott ja zur Abwechslung nichts Besseres zu tun – vielleicht musste er grad keinen ungezogenen Engel bestrafen, keine Naturkatastrophe heraufbeschwören, keine neuen Menschen erschaffen, sich nicht um die Seelen der Toten kümmern und auch nicht sein Himmelreich aufräumen (die Wolken wegfegen?). Was hielt ihn da oben im Himmel eigentlich so sehr auf Trab, dass er keine Zeit für unsere Gebete hatte? Schlafen und essen musste er ja wahrscheinlich nicht, womit verbrachte er also seine Zeit? Was konnte ihm wichtiger sein als wir, seine Kinder?
Vielleicht würde er mich ja diesmal hören, überlegte ich, vielleicht würde er auf mich herabsehen und mein Gebet aufsaugen wie ein Schwamm Wasser aufsog, ein Betrunkener Alkohol, ein Hemd den Regen und Löschpapier Tinte. Vielleicht würde er mein Gebet aufsaugen und so voll von ihm sein, dass er gar nicht anders könnte, als etwas zu tun.
Vielleicht würde er mein Gebet ja diesmal erhören.
Das Grollen der Flugzeuge wurde immer lauter, Menschen schrien und rannten davon, wir hörten ihre dumpfen Schritte. Oder waren das herunterstürzende Trümmer? Oder Menschen, die zu Boden stürzten? Wir hockten da und zitterten. Der Erdboden des Bunkers, der mich an ein Grab erinnerte, bebte. Dieser Angriff schien länger zu dauern als alle anderen davor.
3
Die Mauer um unser Grundstück war halb zerstört. Betonbrocken blockierten das Tor und versperrten uns den Weg zurück ins Haus, weshalb wir außen herum zur Straße liefen, um zur Vordertür zu gelangen.
Auf der Straße erschallten von allen Seiten laute Stimmen, fragende Rufe, wie nach jedem Luftangriff. Als könnte das Geschrei alles wieder gut machen.
»Habt ihr meinen Verandastuhl gesehen?«, rief eine Frau mit schriller Stimme, die klang, als wäre sie den Tränen nahe. Mit etwas Glück würde sie den Stuhl finden – wahrscheinlich lag er zersplittert auf der Straße, und sie würde seine Einzelteile einsammeln müssen. Aber mit etwas Glück würde sie ihn finden und könnte ihn wieder reparieren.
»Habt ihr meinen Sohn gesehen?«, rief eine andere Frau. Immer wieder rief sie seinen Namen. »Amanze, wo bist du? Die Flugzeuge sind weg. Du kannst rauskommen! Amanze, hörst du mich?«
Man hörte weitere Rufe, ein einziges Stimmengewirr. Ein Chor, ein Durcheinander, eine Ansammlung von Hoffnungen und Wünschen.
»Ich suche meine Mama«, sagte eine dünne Stimme, die viel jünger klang als alle anderen. Sie gehörte zu einem weinenden Mädchen, vier oder fünf Jahre. Mama sagte früher oft: Wenn du etwas suchst, ist es meistens da, wo du es am wenigsten vermutest. Ich fragte mich, ob das Mädchen seine Mutter auf dem Friedhof finden würde.
Während wir über Betonbrocken, heruntergefallene Äste, Wellblechplatten und Teile eines Dachs hinwegsprangen, bellte ein Hund.
Das vordere Tor zu unserem Grundstück war unbeschädigt, wir liefen hindurch, und es schlug hinter uns zu. Das Quietschen seiner Angeln klang wie ein Wimmern.
Anders als sonst blieben wir nicht auf der Veranda stehen, um uns den Staub von unseren Wickelkleidern und Oberteilen zu klopfen, wir rannten direkt durch die Tür ins Haus, Mama vorneweg, ich hinterher.
Mama sagte später, sie habe es schon auf der Veranda gerochen. Sie sagte, sie habe es gespürt, so wie man spürt, wie sich einem eine Mücke auf den Arm setzt, noch bevor sie zusticht.
Wenn sie in dem Moment jemand gefragt hätte, sagte sie, hätte sie den Geruch als schwer und metallisch beschrieben, wie verrostetes Eisen.
Im Wohnzimmer fiel ein Sonnenstrahl durchs Fenster. Vorsichtig wich sie den Glasscherben überall auf dem Boden aus und ging auf das Licht zu. Ich blieb dicht hinter ihr.
Nur eine einzige Fensterscheibe war im Rahmen geblieben, und auch die war zersprungen. Die Risse ergaben mehrere Kreise, als hätte eine Spinne dort ihr Netz gewoben. Mama ging zu der Scheibe, strich sacht mit dem Finger darüber und starrte vorwurfsvoll auf das gesprungene Glas.
Kurz nach Kriegsausbruch hatte unsere Lehrerin für Sozialkunde uns eines Nachmittags eine Geschichtsstunde erteilt, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde.
Wir saßen wie immer zu zweit an einem Tisch. Es war kurz vor Unterrichtsschluss, einer dieser furchtbar schwülen Tage, ein Wetter, bei dem alle noch mieser drauf sind als sonst. Mrs. Enwere war schon den ganzen Tag schlecht gelaunt, sie machte ein Gesicht, als wäre ihre Mutter gestorben. Oder ihr Kind. Jetzt hielt sie uns einen Vortrag und warf nicht einen einzigen Blick auf das Buch, das aufgeschlagen vor ihr lag. Sie sprach frei, als wüsste sie alles auswendig.
»Erst gab es einen Putsch, dann einen Gegenputsch. Einen Staatsstreich.« Sie wiederholte das Wort: »Einen Staatsstreich.« Dann fragte sie: »Wer weiß, was das ist?«
Mrs. Enwere hatte das Wort bestimmt korrekt ausgesprochen, aber der Schultag war lang gewesen und ich war müde, und so hörte ich nur den zweiten Teil des Worts: »Streich«. Das kannte ich auf jeden Fall. Kinder spielten anderen gern Streiche.
Was wollte sie uns damit sagen? Warum ging es in Sozialkunde plötzlich um spielende Kinder? Und was hatte das mit der Geschichtslektion zu tun, die sie uns offensichtlich erteilen wollte? Weil ich zu sehr damit beschäftigt war, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, merkte ich gar nicht, dass ich das Wort eigentlich kannte.
Mrs. Enwere wartete auf eine Antwort, und als keine kam, fuhr sie fort: »Dann will ich es euch erklären.« Sie ließ den Blick durch die Klasse schweifen und sagte dann laut: »Ein Staatsstreich ist eine Revolte oder ein Aufstand gegen die staatliche Autorität.«
Unser Klassenzimmer bestand aus rohem grauem Beton – Boden, Decke, alles – und die Wände waren nicht gestrichen. Auf dem Grundstück standen weitere Gebäude, in denen die drei anderen Klassenzimmer untergebracht waren, rings um einen Hof mit tiefgrünem Rasen, Blumenbeeten und einem sandigen Platz, auf dem wir zum Morgenappel antraten. Dabei nahmen uns die Direktorin und die Lehrerinnen unter die Lupe – überprüften, ob unsere Fingernägel geschnitten, unsere Schuluniformen gebügelt und unsere Haare gekämmt waren. Erst sangen wir die Schulhymne, dann die Nationalhymne, und dann führten uns die Lehrerinnen in die Klassenräume.
Unsere Fenster gingen alle zum Hof. Das war bei allen Klassenzimmern so, als wollte man uns davon abhalten, in die Welt hinauszublicken.
Ich starrte aus einem der Fenster raus auf den Hof und dachte an den Unterrichtsschluss. Welchen Weg würde ich zurück nach Hause nehmen? Den über das verwilderte Feld? Oder den an der Straße lang, wo mich Fahrräder überholten und hin und wieder ein Auto?
»Und jetzt alle zusammen«, befahl Mrs. Enwere. »Ein Staatsstreich ist eine Revolte oder ein Aufstand gegen die staatliche Autorität.« Ich schaute wieder nach vorn und merkte, wie sie mich fixierte. »Wiederhol, was ich gerade gesagt habe«, sagte sie scharf.
Ich wiederholte: »Ein Staatsstreich ist eine Revolte oder ein Aufstand gegen die staatliche Autorität.«
»Gut. Du musst im Unterricht aufpassen. Ich möchte dich nicht noch einmal beim Träumen erwischen«, sagte sie und tippte mit dem Zeigestock auf meine Tischhälfte.
»Ihr wisst ja, was in der Residenz des Gouverneurs in Ibadan passiert ist«, fuhr sie fort. Mrs. Enwere stellte ihre Fragen immer so, dass sie wie Aussagen klangen. Fragen, die viel zu schwer für uns waren und auf die wir keine Antworten wussten.
Die Klasse schwieg.
»Wer kann mir was über den Premierminister und den Sardauna von Sokoto erzählen?«
Wieder Schweigen.
Und dann begann Mrs. Enwere sehr schnell zu sprechen, die Worte wehten aus ihrem Mund wie ein Sturm: Ahmadu Bello, tot. Tafawa Balewa, tot. Akintola, tot. Tot, tot, tot.
Wir hörten beunruhigt zu, zumindest ich, und ich versuchte, ihren Ausführungen zu folgen. Soldaten. Gewehrkugeln. Präsident. Militär.
So ging es immer weiter, bis Mrs. Enwere auf Ironsi zu sprechen kam.
»Ironsi«, sagte sie. Sie wiederholte den Namen: »Johnson Aguiyi-Ironsi.«
Präsident. Ironsi, die Leiche im Wald, noch in Uniform. Einschusslöcher, aus denen Blut sprudelte wie Wasser aus einem Springbrunnen, alles rot.
Ironsi, von Kugeln durchsiebt, seine Leiche einfach im Wald liegengelassen.
»Was in diesem Land passiert, ist eine Schande«, sagte Mrs. Enwere. Jedenfalls sei das der Grund, warum Gowon jetzt Präsident war. Vor Ironsi: Azikiwe. Nach Ironsi: Gowon.
Wir saßen da wie versteinert. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören.
Die Stille in unserem Haus war genauso schwer wie an jenem Tag in der Schule. Mama rief Papas Namen, und ich atmete die tote, leere Luft ein, die uns nach jedem ihrer Rufe entgegenschlug.
Als wir ihn fanden, lag er mit dem Gesicht nach unten auf dem schwarzweiß gekachelten Esszimmerboden. Mama rannte zu ihm, fiel auf die Knie und rief immer wieder seinen Namen.
Seine Arme und Beine waren seltsam verdreht, wie tote Äste an einem abgestorbenen Baum. Um ihn herum lagen Teile des zersplitterten Esstischs. Unter seinem Körper hatte sich eine dunkelrote Lache gebildet.
Mama beugte sich über ihn, und ihr Wickelkleid saugte sich voll mit seinem Blut. »Uzo, biko, mepe anya gi! Ana m ayo gi!« Ich flehe dich an, Uzo. Mach die Augen auf!
Immer wieder rief sie seinen Namen, ihre Stimme wurde lauter und lauter. »Mach die Augen auf! Mepe, i nu go? Mach die Augen auf, hörst du nicht?!«
Ihre Rufe wurden zu Geschrei, und ihr Geschrei zu einem Wimmern.
Ich stand da wie erstarrt, nur wenige Schritte hinter ihr. Mein Vater lag im Sterben oder war schon tot, und obwohl ich ihm so gern geholfen hätte, konnte ich nichts tun.
Wieder sagte Mama Papas Namen, diesmal aber ganz leise. Minutenlang ging es so weiter, sie flüsterte verzweifelt seinen Namen. »Uzo, mein geliebter Uzo, bitte. Bitte steh auf.«
Aber natürlich rührte er sich nicht.
An dem Abend kamen ein paar Gemeindemitglieder, wischten das Blut auf und trugen Papas Leiche weg. Ich wusste nicht, wohin sie ihn brachten, aber ich sah, wie Mama einem der Männer einen Kleiderbügel mit Papas Isi-Agu gab, seinem Festgewand mit dem goldenen Muster. Die Männer müssen es Papa übergezogen haben, denn als sie ihn zurückbrachten und seine Leiche im Wohnzimmer aufbahrten, war er gewaschen und trug den Isi-Agu, als hätte er sich für einen feierlichen Anlass zurechtgemacht und wäre dann plötzlich eingeschlafen.
4
Papas Name, Uzo, bedeutete »Tor« oder »Weg«. Es war ein kräftiger Name, einer, der Stärke und Selbstvertrauen ausstrahlt, anders als meiner, Ijeomo (der nur ein Wunsch ist: »Mögest du sicher reisen«), oder Mamas, Adaora (der bedeutet, dass sie die Tochter der Gemeinschaft ist, die Tochter aller, was aber, wenn man es recht bedenkt, für alle Frauen gilt).
Uzo. Das war ein Name, den ich gern wie einen Zettel zusammengefaltet und immer in der Hand gehalten hätte, wenn man Namen zusammenfalten und in der Hand halten könnte. Damit ich, wenn ich mich im Leben verirrte, nur die Hand zu öffnen bräuchte und mir der Name wie eine Taschenlampe den Weg weisen würde.
In den Wochen nach Papas Tod war es, als hätten Mama und ich uns im Dunkeln verirrt. Wir wussten nicht mehr, wo oben und unten war, wo links und rechts. Wir waren völlig durcheinander, aber zum Glück schafften wir es trotzdem, zum Bunker zu laufen, wenn wir die Flugzeuge hörten. Zum Glück schaffte Mama es trotzdem, eine angemessene Totenfeier für Papa abzuhalten, damit er einen Platz unter seinen Ahnen einnehmen konnte.
Die Totenwache dauerte lange, weil viele Leute vorbeikamen, um uns ihr Beileid auszusprechen. Über eine Woche war Papa im Wohnzimmer aufgebahrt, auf einem Himmelbett, das wir von einem Gemeindemitglied ausgeliehen hatten. Daneben saß Mama auf einem Stuhl, ganz in weiß gekleidet, umgeben von lauter Frauen aus der Gemeinde. Mama weinte und beklagte den Tod ihres Mannes, während die Frauen Totenlieder sangen.
Nachdem die Männer Papa davongetragen und hinten in unserem Garten beerdigt hatten, begann die Ikwa-Ozu-Zeremonie, die sich über mehrere Tage hinzog: Es gab Körbe voller Kolanüsse und Kanister mit Palmwein, Opfergaben, Gebete, und die Dorfältesten riefen die Geister von Papas Ahnen an und baten sie, ihn in die Welt der Toten zu geleiten.
Eines Morgens, als die Ikwa Ozu vorbei war, rief Mama mich zum Frühstück.
Ich ging zu ihr ins Esszimmer und setzte mich an den Tisch, auf dem zwei Schüsseln mit Gari-Brei standen. Vor dem Krieg hatte es immer Tee gegeben und Brot und ein gekochtes Ei für jeden, und manchmal auch noch Cornflakes, Kellog’s Cornflakes aus der Pappschachtel mit dem Hahn mit dem roten Kamm und dem gelben Schnabel drauf. Die Cornflakes waren aus dem Ausland importiert, und wir aßen sie mit Kondensmilch von Peak oder Carnation, auch aus dem Ausland. Doch jetzt kamen schon seit einiger Zeit kein Tee, kein Brot, keine Kellog’s Cornflakes und keine Kondensmilch mehr auf den Tisch. Und mit den Eiern verhielt es sich so wie mit friedlichen Momenten und glücklichen Menschen. Die gab es nur noch selten.
Mama streute ein paar Erdnüsse über unseren Gari und sagte: »Erdnüsse enthalten fast genauso viel Protein wie Eier. Sie sind ein hervorragender Eiweißlieferant. Dein Gehirn braucht Protein, um sich zu entwickeln, damit du gut denken kannst.«
Kurz nach meiner Geburt – als frischgebackene Mutter – hatte Mama angefangen, sich mit den verschiedenen Lebensmitteln zu beschäftigen, denn ich war einen Monat zu früh auf die Welt gekommen und eine der Hebammen hatte gesagt, sie solle mich proteinreich ernähren. Damals wusste Mama nicht, was das Wort Protein bedeutete, es war ein abstraktes, geisterhaftes und geheimnisvolles Wort. Nicht wie Orange oder Banane oder Tisch oder Stuhl, Dinge, die man sehen und anfassen konnte. Proteine waren unsichtbar.
Sie hatte überall herumgefragt und alle Informationen gesammelt, die sie in Büchern und Zeitschriften über Gesundheit finden konnte. Sie wollte, dass ich überlebte, also musste sie unbedingt herausfinden, was diese Proteine waren, und mich damit füttern.
Später, als sie überlegte, was sie arbeiten könnte, um etwas Geld zu verdienen, beschloss sie, nicht Ernährungsberaterin zu werden, sondern Lebensmittel zu verkaufen. Sie hatte sehr viel über Proteine gelesen, und das war harte Arbeit gewesen. Sie las sehr langsam, jedes Wort strengte sie an. (Und die vielen komplizierten Begriffe, die sie nicht verstand, machten die Sache nicht besser.) Wenn sie einen Nachmittag lang gelesen hatte, hatte sie den ganzen Abend Kopfschmerzen.
Früher habe ich manchmal zu ihr gesagt, sie hätte damals vielleicht selbst mehr Proteine essen sollen. Vielleicht hätte ihr das beim Lesen geholfen und dabei, die vielen komplizierten Begriffe zu verstehen.
Jedenfalls saß ich mit ihr am Esstisch und fragte mich, wozu ich überhaupt ein funktionierendes Gehirn brauchte, wenn ich wegen dem Krieg sowieso bald nicht mehr zur Schule gehen konnte. Nur für die Schule las ich, übte das Einmaleins, paukte Geschichte und Erdkunde und studierte die Bibel. Die Schule sollte für die Entwicklung meines Gehirns sorgen. Wie könnte das Protein diese Aufgabe übernehmen?
Aber Mama behauptete, das ginge.
»Sobald der Krieg vorbei ist«, sagte sie, »wirst du wieder regelmäßig zur Schule gehen, und dein Gehirn wird so gut funktionieren wie vorher, vielleicht sogar noch besser.«
Ich warf ihr einen skeptischen Blick zu, was sie natürlich bemerkte.
Sie lächelte leicht und sagte, dass ich ein gutes Gehirn brauchen würde, wenn ich Lehrerin oder Ärztin oder Geschäftsfrau werden wollte. Es tue ihr leid, mir meine Illusionen zu nehmen, aber allmählich sei ich alt genug, über diese Dinge nachzudenken. Natürlich würde ich, so Gott wolle, eines Tages heiraten, aber was, wenn ich eines Tages wie sie ohne Ehemann dastünde? »Was dann?«, fragte sie und starrte mit leerem Blick auf einen Punkt hinter mir.
Nach einer Weile gab sie sich einen Ruck. Sie sah mich an und sagte: »Ich will nur sagen, dass du ein gutes Gehirn brauchst, wenn du Arbeit finden willst. Das ist nun mal so. Also musst du viel Protein essen.«
Wir saßen am Tisch, aßen Gari-Brei mit Erdnüssen, und Mama hielt mir Vorträge darüber, wie gut Protein für mein Gehirn sei, statt darüber zu sprechen, was uns wirklich beschäftigte, nämlich, dass Papa tot war und kein Protein der Welt ihn zurückbringen konnte.
5
Ende Juli war Papa schon einen Monat tot, und Mama hatte ihn noch kein einziges Mal erwähnt.
Also machte ich es genauso. Ich redete nicht von ihm, sondern dachte nur an ihn. Allerdings so, wie ein hungerndes Kind an Essen denkt: Meine Gedanken waren ständig bei ihm. Jedes Mal, wenn ich eine Männerstimme hörte, jedes Mal, wenn ich jemanden Zeitung lesen sah, musste ich an ihn denken. Mama schaltete das Radio nicht mehr ein. Vielleicht wollte sie mich schonen, aber das war sinnlos. Jedes Mal, wenn mein Blick auf das Radio fiel, musste ich an Papa denken.
An einem Tag fehlte er mir so sehr, dass ich dachte, schlimmer könnte es nicht werden – wenn ich ihn noch mehr vermissen würde, würde ich sterben –, und da platzte es aus mir heraus. »Fehlt dir Papa auch so sehr?«, fragte ich Mama.
Wir saßen gerade beim Abendessen, es gab Yam-Eintopf.
Sie hob abrupt den Kopf und funkelte mich wütend an. Mit drohendem Unterton fragte sie zurück: »Warum sollte er mir fehlen? Ist er nicht daran schuld, dass ich jetzt eine Witwe bin und du eine Halbwaise? Warum sollte er mir also fehlen, kannst du mir das sagen?«
Ich schob mir hastig einen Löffel Yam in den Mund.
Nach minutenlangem Schweigen sagte sie betont ruhig: »Ich bin wütend auf ihn. Da ist eine Riesenwut in mir. Manchmal habe ich das Gefühl, im nächsten Moment zu explodieren.«
Ich hörte schweigend zu.
Mama ließ alles raus, die Worte sprudelten nur so aus ihrem Mund: »Wie kann ein Mann sein Stück Land und sein Haus nur so besudeln? Wie kann er in seinem eigenen Haus sterben? Er hat Glück, dass Krieg ist, so kann man ihm nicht vorwerfen, Selbstmord begangen zu haben. Er hat Glück, dass er als Kriegsopfer gilt. Wie konnte er uns das nur antun!«
Die Schlafzimmer im oberen Stock waren von den Bomben, die Papa getötet hatten, zerstört, und Mama hatte beschlossen, die Wände nicht wieder aufzubauen, weil sie ja doch nur wieder zerstört würden.
Also hatten wir die Matratze aus Mamas und Papas Bett ins Wohnzimmer getragen und auf den Boden gelegt. Darauf schliefen wir jetzt.
In der Nacht nach Mamas Wutausbruch, gegen ein oder zwei Uhr morgens, wurde ich von einem Schrei wach, der ein Loch in die Dunkelheit riss, ein so großes und tiefes Loch, dass es mich hineinzog.
»Uzo!«, brüllte Mama. Noch nie zuvor hatte ich sie im Schlaf schreien hören.
Ich packte sie an den Schultern. »Mama, wach auf! Mama, ich bin’s, Ijeoma. Hörst du mich? Das war nur ein Traum.«
Da öffnete sie die Augen.
Mama hatte immer gesagt, wir würden unsere Probleme im Traum verarbeiten und könnten jedes Problem lösen, wenn wir unseren Träumen nur mehr Aufmerksamkeit schenken würden. Damals träumte ich oft, ich wäre gelähmt und könnte mich nicht mehr bewegen. Ich wusste genau, dass es nur ein Traum war, aber da ich gelähmt war, konnte ich nicht daraus aufwachen. Manchmal waren die Wände um mich herum hellgrün, manchmal hellgrau, aber nie rosa wie die Wände in unserem Haus in Ojoto. Ich versuchte zu schreien und nach Mama oder Papa zu rufen, damit sie mich weckten. Aber ich bekam keinen Laut heraus. Der Traum ging weiter. Erst wenn ich beschloss, nicht mehr gegen die Lähmung anzukämpfen, konnte ich aufwachen.
Aber nachdem Mama in dieser Nacht die Augen geöffnet hatte, hörte sie nicht auf zu schreien. »Uzo!« Sie schaute mich an. »Wo ist Papa?«
Sie sah sich wild in der Dunkelheit um. »Uzo!«, rief sie. »Uzo, hörst du mich?«
War sie verrückt geworden? Hatte sie vergessen, dass Papa nicht mehr da war?
Ich schmiegte mich an sie und sagte leise: »Papa ist tot. Hast du das vergessen?« Ich flüsterte es immer wieder:
Papa ist tot. Hast du das vergessen?
Papa ist tot. Hast du das vergessen?
Papa ist tot. Hast du das vergessen?
Sie weinte, als wäre die Nachricht völlig neu für sie. Ihre Schultern bebten. Ihr Atem ging stoßweise.
Ich schlang die Arme um sie und wiegte sie hin und her.
Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich beruhigte. Schließlich hob sie den Blick und sah mich an. »Dein Papa ist tot«, flüsterte sie.
»Ich weiß, Mama«, sagte ich. »Mein Papa ist tot.«
6
Ich stieß die Fensterläden auf. Der Morgen war schön und wolkenlos. Als die Läden aufschwangen, flutete Licht in den Raum.
Ich ging in die Küche. Der Vorratsschrank war fast leer.
Ich nahm eine Dose Sardinen und die letzte Yam vom Regal.
Mittlerweile erledigte ich die meiste Hausarbeit. Mama interessierte sich immer weniger für alltägliche Verrichtungen. Ihr war offensichtlich egal, ob sie lebte oder starb. In ihrer Trauer schien sie den Gedanken an ein Leben ohne Papa unerträglich zu finden. Also blieb mir nichts anderes übrig, als für sie einzuspringen.
Essen zu kochen, war gar nicht mal so schwer. Am Mühsamsten waren das Holzsammeln und das Feuermachen. Danach musste man eigentlich nur aufpassen, dass nichts anbrannte. Ich suchte nach dem kleinen Sack, in dem noch ein Rest Reis gewesen war, leider keine ganze Portion, geschweige denn zwei. Er hatte auf einem Regal im Vorratsschrank gelegen, und als ich ihn nicht finden konnte, fiel mir ein, dass wir den Reis längst aufgegessen hatten – hauptsächlich ich, Mama nahm ja kaum etwas zu sich.
Ich starrte auf die Sardinen und die Yam.
Ich schnitt die Yam in Würfel, hob die Herdplatte an, füllte den Ofen mit Brennholz und legte die Herdplatte zurück an ihren Platz. Während die Yamswürfel vor sich hinköchelten, verteilte ich die Sardinen auf zwei Schüsseln, eine für mich, eine für Mama. Draußen quietschte ein Tor.
Dann hörte ich einen dumpfen Knall, als wäre etwas Schweres zu Boden gefallen, aber es war nur die Haustür, die gegen die Wand schlug.
Mama kam in die Küche. Sie war blass und machte ein verwirrtes Gesicht.
»Mama, odimma? Alles gut?«, fragte ich.
»Geht so«, antwortete sie.
Sie kam zum Ofen und hob den Topfdeckel an.
»Der Lastwagen mit Hilfsgütern ist nicht gekommen«, sagte ich. »Ich koche uns Yam.«
Sie nickte.
»Isst du heute was?«, fragte ich.
Mama schwieg eine Weile, als müsste sie überlegen, ob ihr der Inhalt des Topfes gefiel.
»Etwas anderes haben wir nicht«, sagte ich. »Du musst was essen, auch wenn es dir nicht schmeckt.«
»Ich habe keinen Hunger«, murmelte sie.
Obwohl ich damals noch keine zwölf Jahre alt war, wusste ich längst, dass Traurigkeit einem den Appetit rauben kann und das leckerste Essen bei Angst oder Anspannung wie Papier oder Sand schmecken kann. Andererseits konnte Essen auch trösten. Damals sagten die Leute in Ojoto oft: »Iss lieber alles auf. Vielleicht gibt es bald nichts mehr.« Erst am Tag zuvor hatte ich das jemand sagen hören, vielleicht hatte ich deshalb solchen Hunger. Mein Magen hatte gut zugehört. Ich wünschte nur, Mamas Magen hätte auch zugehört.
»Nur ein paar Löffel«, sagte ich.
Sie starrte mich ausdruckslos an, schüttelte den Kopf, wandte sich ab und verließ die Küche.
7
Ich lungerte neben unserem Tor herum und hielt nach dem Lastwagen des Roten Kreuzes Ausschau. Es ging ein lauer Morgenwind, und ein schwerer Geruch nach Erde hing in der Luft. Ein kleines Stück entfernt standen drei Soldaten mit umgehängten Gewehren neben einem Panzerwagen, einem von diesen Militärfahrzeugen mit sechs Rädern auf jeder Seite, die aussahen wie von einem Fahrrad, und einem viereckigen Aufbau aus Metall. Einer der Soldaten trug seinen Patronengürtel auf dem Kopf wie einen Turban. Die Patronen waren so miteinander verbunden, dass sie wie eine Kette über seine Stirn verliefen.
Auf der anderen Straßenseite schob ein Mann mit nacktem Oberkörper ein Fahrrad vorbei. Auf dem Gepäckträger transportierte er einen Sarg, der zu klein war für die Leiche – vielleicht sein Kind oder ein anderes Familienmitglied –, weshalb die Füße aus dem Sarg heraushingen.
Ein Stück die Straße hinab lehnte ein vielleicht zwei- oder dreijähriger Junge neben einem Tor an der Betonmauer, als müsse er sich ausruhen.
Mehrere ein wenig ältere Kinder standen in seiner Nähe herum. Ihre Bäuche waren von der Unterernährung aufgedunsen wie prall aufgeblasene Bälle, und sie hielten kleine Bettelschüsseln aus Plastik in den Händen. Wenn jemand ein Foto von ihnen gemacht hätte, hätte es auf der Titelseite von einer von Papas Zeitungen erscheinen können.
Der Soldat mit dem Patronengürtel auf dem Kopf kam auf mich zu, sein eingefallenes Gesicht war müde und mit Dreckspritzern übersät. »Sista«, sagte er. »Abeg, make I get wata.« Kann ich bitte etwas Wasser haben?
Ich starrte ihn ausdruckslos an. Ich war abgelenkt, ich hörte gar nicht richtig zu.
»Make I get wata, abeg, obere mmiri«, wiederholte er flehend.
Jetzt kamen auch die anderen Soldaten näher. Der kleinere von beiden trug einen schmutzigen weißen Kanister. Er schraubte den Deckel ab und hielt ihn mir hin.
Ein Motorrad knatterte vorbei, Staub wirbelte von der trockenen Erde auf wie Flammen.
»Abeg, sista«, sagte der zweite Soldat. »Small wata.«
Jetzt hatten sie meine Aufmerksamkeit.
Im diesem Moment kam Mama aus unserem Tor geschossen. Sie trug ihr Wickelkleid vor der Brust verknotet und starrte die Männer mit zusammengekniffenen Augen an.
Ihr Blick wanderte von dem Kanister zu den Gesichtern der Männer.
Dann zeterte sie los: »Das ist ein Privatgrundstück! Ihr könnt nicht einfach herkommen und betteln!« Sie fuchtelte mit ihrem Zeigefinger herum wie eine Lehrerin, die ein ungezogenes Kind ausschimpft, sog Luft durch die Zähne ein und rollte mit den Augen, um ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Bevor sie sich abwandte, sagte sie in Pidgin: »Na who even tell you say I get wata?« Woher wollt ihr überhaupt wissen, dass ich Wasser habe?
Sie marschierte durchs Tor und blieb nur kurz stehen, um mir zuzurufen, ich solle ihr folgen.
Ich wollte Mama ja gern gehorchen, aber der Soldat mit dem leeren Kanister sah mich flehend an und schien gleichzeitig längst aufgegeben zu haben.
»Abeg, sista«, sagte er. Seine Stimme war schwach, so als kostete es ihn die letzte Kraft, mich um diesen Gefallen zu bitten.
Ich dachte: Was, wenn die Männer kurz vor dem Verdursten waren? Was, wenn sie vor meinen Augen zusammenbrachen und starben? Was, wenn sie nur ein wenig Wasser bräuchten, um weiterleben zu können? Und kämpfte dieser Soldat nicht für uns, für Biafra? Aber vor allem hatte ich Angst, er könnte vor meinen Augen sterben.
Hinter dem Haus gab es einen Grundwasserbrunnen, der mit unserem Wassertank verbunden war. Ich wusste, dass der Tank gut gefüllt war. Mama war zwar dagegen, aber ich könnte den Männern trotzdem etwas Wasser geben. Nicht viel, gerade mal einen halben Kanister.
Ich nahm dem Mann den Kanister ab.
Hinter dem Haus, auf dem Weg zum Wassertank, sah ich Mama. Sie saß auf den Stufen, die von der Küche in den Garten führten. Ganz in ihrer Nähe trippelte eine Schwalbe über den Boden.
Der Vogel flatterte auf und ließ sich auf einem der Betonpfeiler nieder.
Mama hatte der Schwalbe nachgesehen, aber jetzt fiel ihr Blick auf mich.
Sie schürzte die Lippen, zog die Mundwinkel auseinander und presste die Ober- und Unterlippe aufeinander, bis sie dünne Striche waren. Diesen Gesichtsausdruck kannte ich gut. »Was machst du da?«, fragte sie.
Sie atmete durch die Nase aus, ein leises, pfeifendes Geräusch. Dann schüttelte sie leicht den Kopf und schloss die Augen. Sie war müde, dachte ich. Natürlich war sie müde, sie aß ja auch kaum noch was.
Im nächsten Moment riss sie die Augen auf und funkelte mich an.
»Du dummes Kind«, schrie sie. Als wollte sie sagen: »Wie kannst du es nur wagen, so ungehorsam zu sein?« Oder: »Hast du nicht gehört? Wir haben kein Wasser zu verschenken!«
Sie sprang auf und schlug mir den Kanister aus der Hand, sodass er vor meinen Füßen landete. Dann packte sie mich am Ohr und verdrehte es. »Du böses Kind!«
Sie war außer sich. Sie war nicht mehr die Mama, die ich kannte. Sie hob den Kanister auf und stürmte zurück zum Tor. Ich folgte ihr unter Schock, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte.
Die Soldaten lehnten an der Betonmauer neben dem Tor. Mama warf ihnen den leeren Kanister zu. Er war so leicht, dass er vom Boden abprallte und die Straße entlangrollte.
»Habt ihr nicht gehört? Wir haben kein Wasser«, keifte sie. Dann schlug sie das Tor zu und schob den Riegel vor.
Ich folgte ihr zurück hinters Haus, ging neben dem Wassertank in die Hocke und wartete. Worauf, das wusste ich selbst nicht.
»Was hockst du da? Steh auf und mach dich nützlich«, sagte Mama. Sie hatte sich wieder beruhigt, die Heftigkeit war aus ihrer Stimme gewichen. Doch ihre Worte klangen, als wollte sie sagen, ich solle doch bitte einfach verschwinden (»Biko, comot from here!«). Nach der Szene mit dem Wasserkanister wusste ich, dass Mama begonnen hatte, mich als Last zu sehen, genauso wie sie die Soldaten als Last sah, genauso wie wir alle den Krieg als Last sahen. Sie war erschöpft. Eine andere Erklärung gab es nicht.
Kurz nach dem Vorfall muss sie angefangen haben, darüber nachzudenken, wie sie mich loswerden konnte. Der Krieg hat sie offenbar auf den verqueren Gedanken gebracht, sie müsse sich von allen Lasten befreien: den Soldaten, dem Haus und mir. Am liebsten wäre sie wohl auch alle Erinnerungen an den Krieg losgeworden. Weg damit, weg, weg, weg. Sie war wie ein Tier, das seine Haut oder sein altes Fell abwirft. Eine Echse. Eine Schlange. Ein Hund, eine Katze. Sogar Hühner mausern sich.
Sie wollte mich und alles andere loswerden wie eine schlechte Gewohnheit. So, wie man schmutzige Kleidung, in der sich zu viele Dornen verfangen haben, wegwirft.
8
Der August war gekommen und gegangen, und es war wieder Hilfsgütertag, aber auch der Vormittag war gekommen und gegangen und die Leute vom Roten Kreuz hatten sich nicht blicken lassen.
Normalerweise hörte man um diese Uhrzeit immer schon einen Aufruhr in der Nähe unseres Hauses. Dort gab es ein paar notdürftig errichtete Unterstände, in denen Freiwillige aus dem Dorf die Hilfspakete auspackten, Mahlzeiten zusammenstellten und diese an die Leute verteilten, die Schlange standen.
Es ging das Gerücht, Gowon und die nigerianische Armee hätten eine Blockade über Biafra verhängt und ließen die Konvois des Roten Kreuzes nicht durch. Ein anderes Gerücht besagte, die Hilfsorganisationen arbeiteten an einer Strategie, wie sie die Blockade durchbrechen konnten. Offenbar gab es noch Hoffnung.
Eigentlich war es ein Schultag, aber zu diesem Zeitpunkt waren sämtliche Schulen längst geschlossen.
Ich lungerte vor unserem Tor herum und hielt nach dem Lastwagen Ausschau. Zwei ältere Mädchen aus meiner Schule liefen vorbei. Ihr Haar war ungepflegt, einzelne Strähnen standen in alle Richtungen ab. Bei ihren müden Schritten musste ich unwillkürlich an verschlissene Putzlappen denken. Trotzdem waren die Mädchen schön, was vor allem daran lag, wie sie beim Laufen die Hüften schwangen.
Ihre Haut war dunkel wie Kakaobohnen, und ich musste an meine eigene hellere Haut denken, die Art von Haut, auf der man jeden Kratzer, jeden blauen Fleck und jede Narbe sieht, die Art von Haut, von der die Leute immer sagen, sie sei schön, nur hatten sie keine Ahnung, dass es überhaupt nicht schön ist, wenn der ganze Körper von kleinen Flecken übersät ist, die aussehen wie Windpockennarben.
Auf der dunklen, weichen Haut dieser Mädchen war kein Fleck zu sehen.
Papas Haut war wie meine gewesen, nur nicht ganz so hell. »Das liegt am Alter und der Sonne«, hatte er gesagt. Während ich den Mädchen nachsah, dachte ich, dass meine Haut mit dem Alter und der Sonne vielleicht auch noch dunkler werden würde und ich den Mädchen ein wenig ähnlicher sehen würde.