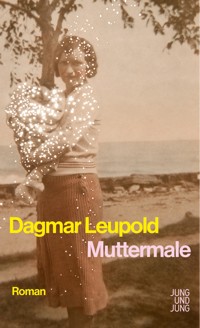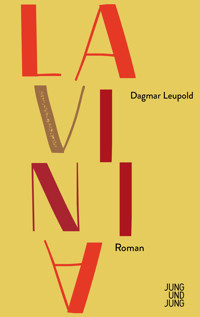Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2013Das ferne Ostpreußen und das heutige München mischen sich in diesem bewegend erzählten Roman ebenso wie die Generationen und deren Wünsche an das Leben, das seine Schwere unter der sicheren Hand Dagmar Leupolds zu verlieren scheint. Eine Geschichte vom schönen Glück erzählt Dagmar Leupold in ihrem neue Roman. Er handelt von den hellen und den dunklen Seiten des Menschlichen und von einer seltsamen "Schwarzarbeit": Ein italienischer Mäzen ermöglicht es einer Frau namens Minna, zu schreiben. Allerdings ist an seinen Auftrag eine ungewöhnliche Bedingung gebunden: Sie soll den Menschen Freude bringen.Ist es ein Märchen, das hier erzählt wird, ist es die reine Wahrheit, ist es beides? Der Roman ist Literatur auf der Höhe ihrer Möglichkeiten: raffiniert und doppelbödig werden hier Wirklichkeit und Erfindung ineinander gewoben. Als Minna einer alten, aus Ostpreußen stammenden Dame begegnet, beginnt sich ein Beziehungskarussell zu drehen, bei dem Vergangenheit und Gegenwart durcheinandergewirbelt scheinen und der Glanz früherer und ferner Zeiten sich ins heutige München mischt. Einmal mehr zeigt sich, dass das Leben ein kreislauf aus Geburt und tod ist. Als Frühchen ist Minna auf die Welt gekommen, und auch ihr Ende, ob wahr oder erfunden, lässt nicht allzu lange auf sich warten. In aller Abgründigkeit führt "Unter der Hand" nach Utopia und wieder zurück. An ein Ziel, das es wirklich gibt: Schwarzort."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unter der Hand
© 2013 Jung und Jung, Salzburg und Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung nach einem Foto von
Ralph Eugene Meatyard
ISBN E-Book 978-3-99027-106-3
ISBN print 978-3-99027-044-8
DAGMAR LEUPOLD
Unter der Hand
Roman
O ich zittere, wenn ich daran denke, wie hier und jetzt die Grundlage gelegt wurde für tausend Schwächen des Körpers und des Geistes, die keine Geschicklichkeit des Arztes oder kein Verstand des Philosophen später würde wieder gänzlich in Ordnung bringen können.
Laurence Sterne, Tristram Shandy
dem Mitarbeiter
Stillleben
Minna liegt auf ihrem mit Überdecke versehenen Bett, sie trägt ein weißes Männeroberhemd und enge schwarze Hosen. Es sieht aus, als wartete sie auf den erweckenden Kuss und schliefe seit hundert Jahren. Die Beine angewinkelt, im anfänglichsten Schlaf, das Leben noch vor sich.
Ihr Gesicht ist unbekümmert, glatt – glatt, wie der Stein, den sie in der halb geöffneten Faust ihrer rechten Hand hält. Ein schneeig schimmernder, nahezu durchsichtiger Stein, in der Mitte von einer schwarzen Linie umfasst.
Minna ist meine Wohnungsnachbarin, will ich zu meinem Gaszähler, dann muss ich in ihr Vorzimmer. Auch wenn ich im Besitz des Wohnungsschlüssels bin, schien es mir stets angemessen, ihre Wohnung nur in ihrem Beisein und auf ihre Einladung hin zu betreten.
Ein einziges Mal – kurz nach ihrem Einzug – habe ich eine Nacht mit ihr verbracht. Aus der Einladung zu einem Glas Wein waren zwei Flaschen geworden, aus mildem, beinahe mechanischem Interesse eine kurze Leidenschaft. Ihr Körper drahtig und tierhaft wendig, die ganze Person erstaunlich unerschrocken. Witzige Erzählerin, scharfe Beobachterin. Neigung zu altklugen Bemerkungen. Am Ende Tränen. Das versetzte mich in Unruhe, nichts für mich, zu intensiv, paradoxe Frauen machen mir Angst. Möglicherweise ist dies dem Naturwissenschaftler in mir zuzuschreiben, dem auch ihr Leben aus dem Stegreif Unbehagen bereitete.
Zum Glück brauche ich ein festes Einkommen.
Fortan trafen wir uns zum Ablesen des Zählerstands auf einen Kaffee. Drei, vier Mal im Jahr. Kein Alkohol. Und grüßten einander anständig im Treppenhaus.
Für heute hatte eine solche Verabredung bestanden – nach mehrmaligem, vergeblichem Läuten habe ich die Tür aufgeschlossen.
Und sitze nun am Fuß ihres Bettes, im Schoß das Manuskript, das ich, eingeschlagen in eine altertümliche Ledermappe, aus welcher Sand rieselte, neben ihrem Kissen fand.
Der Arzt ist gerufen. Ich beginne zu lesen.
SCHWARZARBEIT: EIN MÄRCHEN
Eins
Ab ovo: Frühgeburt. 1955, ein kleiner Ort am Rhein. Anstelle der Mutterbrust Rheinkiesel. Die Steine werden mit Rotlicht bestrahlt und sollen wärmen, ein Inkubator wie aus Vorkriegszeiten. Zwei Monate lang – bis zum Geburtstag unseren Herrn, dem 24. Dezember, an dem ich eigentlich hätte zur Welt kommen sollen, folglich gezeugt während des gutgelaunten rheinischen Karnevals – werden darin anderthalb Kilo zur Reife gebrütet. Der Schauplatz meiner Geburt war ein zweigeschossiges, graustichiges Gebäude, es wurde von Nonnen geführt. Ich sehe sie vor mir, wie sie in ihren fledermausigen Gewändern durch Gänge und Säle huschen; vor dem Frühgeborenen, das eher einem Grottenmolch ähnlich sieht als einem Menschen, bekreuzigen sie sich flüchtig. Der Herr hat’s gegeben, wenn er es wieder nimmt – kein Schaden. Korrektur: höhere Gewalt. Besser als niedere. Auf ihren Wangen ein rötliches Geflecht aus geplatzten Äderchen; zu oft besagten Herrn gelobt.
Ich stelle mir vor, wie das Frühgeborene hohe, fiepende Laute ausstößt, ähnlich dem Pfeifen der Murmeltiere, vermutlich in der falschen Frequenz, die guten Geister dieses Krankenhauses empfangen sie nicht. Das Krankenhaus, ein ausrangiertes Kloster, liegt in den Flussniederungen, aus denen es immer ein wenig verkommen riecht. Wie bald darauf die ganze Kindheit nach etwas Liegengebliebenem, Vermodertem oder vielleicht auch nur nach nasser Wolle riecht.
Die Nonnen tragen Schuhe mit klobigen Absätzen, ihre Ankunft ist nicht zu überhören und doch jedes Mal ein Schreck: Sie könnten gekommen sein, um sich abzuwenden. Grausamkeit hat noch keinem geschadet. Die hohe Schule der Resilienz: Steh auf Menschchen! Für den Übertritt an diese Schule braucht man einen guten Schnitt in schlechten Erfahrungen. Das Rotlicht gehört dabei zu den besseren der schlechten Erfahrungen; immer wenn irgendeines Liebhabers Wohnung – oder eine anderweitig zufällig betretene – im Badezimmer einen Heizstrahler aufwies, kam die Erinnerung daran zurück. Nein, Erinnerung kann man das nicht nennen, eher ein archaisches Gefühl, einen phylogenetischen Rest (ich lese nicht nur die Bibel, sondern auch Scientific American), der mit der eigentümlichen Wärme der rot glühenden Röhren aktiviert wurde.
Da lag ich also damals brach, eine kleine Witzfigur. Mit Lungenentzündung. Ohne Haare. Hätte es ein Wettbüro gegeben mit Einsätzen auf eine Zukunft des Wurms, die Optimisten hätten viel Geld daran verdient, denn das Überleben war höchst unwahrscheinlich. Vermutlich habe ich bereits damals gelernt, dass es helfen kann, sich totzustellen.
Ich bin nicht undankbar, dass die Möglichkeiten der Dokumentation anno 1955 eher spärlich waren; niemand hat sich jedenfalls die Mühe gemacht, die lederbezogene Agfa-Kamera der Mutter in das Krankenhaus einzuschleusen – denn so anstaltsmäßig, wie das Gebäude aussah, geduckt, verwittert und streng, musste man grundsätzlich das Gefühl haben, man schmuggle Kassiber ein anstelle von frohen Gaben oder rechtmäßig erworbenen Fotoapparaten –, sodass es heute der Einbildungskraft überlassen ist, sich das puppengroße Wesen vorzustellen, das wimpernlos im Steinbettchen irgendwem und irgendetwas trotzte, indem es nicht starb.
Ich würde gern einmal eine der Nonnen treffen und befragen. Diejenigen, die damals Anfang zwanzig waren, sind jetzt in ihren Siebzigern. Ich würde sie fragen: Was lag da, beschreib es mir! Ein Geschöpfchen oder ein abgeschafftes Satzzeichen? Nein, natürlich nicht, so würde ich nicht mit ihr sprechen, das wäre zu schnoddrig und zu exzentrisch. Also: Was lag da? Und sie würde irgendetwas mit aller Anfang ist schwer sagen, oder so winzig, dass es in die Hand gepasst hätte. – Hand Gottes? – Nein, mein Kind, die ist zu groß, sie ist für alle da. – Dachte ich es mir doch, in welche dann? – In die von Schwester Hilde, stolze einsfünfundsiebzig, Schuhgröße 42, wenn sie durch die Gänge lief, grüßten selbst die Wände. – Lebt sie noch? – Nein, mein Kind, sie wurde schon gerufen. – Ich will auch gerufen werden, aber nur von einer echten Stimme.
Während der zwei Monate, die ich hinter Kloster-, vielmehr Krankenhausmauern lag, kam zwei Mal ein katholischer Priester. Die Nonnen hatten ihn alarmiert, weil sie dachten, es ginge zu Ende. Zu der Zeit war ich ungetauft, vorgesehen war mir allerdings ein protestantisches Heranwachsen. Wer weiß, welche Saat die letzten Ölungen legten, Weihrauch jedenfalls machte mich auch später ganz zahm. Ich stelle mir den Priester bärtig vor, er beugt sich über das rot angestrahlte Etwas, murmelt Gebete, schwenkt Kännchen und schielt nach der jüngsten Nonne. Die hat wenigstens Zukunft.
Übrigens ist mein linker kleiner Finger zurückgeblieben, ich meine, im Wachstum zurückgeblieben. Äußerlich ist er der einzige Hinweis auf die viel zu frühe Geburt. Er könnte einer Fünfjährigen gehören, alle Versuche, Klavier zu spielen, scheiterten an ihm. Zu kurz für eine Oktave. Das finde ich bemerkenswert, weil im Regelfall die Gründe für ein Scheitern entweder im Dunkeln liegen oder so vielfältig sind, dass sie unverstanden bleiben. Ich habe den Schuldigen immer zur Hand. Gab es nicht einmal einen Film, in dem der Held keinen Lebenslauf vorlegte, sondern eine Summe seiner Pannen und gescheiterten Anläufe? Dieses Curriculum war beträchtlich länger als die Erfolgslisten, die Bewerbungen beiliegen. Bei mir wäre eine solche Einschätzung von Geburt an schwierig: Sollte ich sie als Erfolg oder Misserfolg verbuchen? Leicht hätte ich in späteren Jahren das Krankenhaus aufsuchen können, ich habe es nie getan. Ich halte nichts von Ortsterminen. Außer von denen auf Papier, denen, die schwarz auf weiß stattfinden so wie hier.
Ich schreibe das auf, während ich mich auf einem Liegestuhl sonne, das gleichmäßige Plätschern des Massagestrudels im Schwimmbecken begleitet den Gesang der Zikaden. Der Agroturismo, den die Italiener sich für ihre schönsten Landstriche haben einfallen lassen, ist eine wunderbare Idee: Man hat die Illusion von Landleben – Pfirsiche reifen an den Bäumen, Traktoren fahren in einiger Ferne, Wein rankt – und ist so vom reinen Touristendasein mit Zwang zum Pauschalen erlöst, schließlich lebt man mitten in einer Arbeitswelt. Was nichts daran ändert, dass es eine Rezeption gibt, Badetücher und Rechnungen. Hier, unter den schattenspendenden, geradezu segnenden handtellergroßen Blättern des Feigenbaums ist nur Sanftmut möglich. Unter einem solchen Baum hatte Augustinus sein Bekehrungserlebnis; dergleichen wissen wir aus anspruchsvollen Kreuzworträtseln (unter der Krone dieses Baums – 10 Buchstaben – wandte sich der Kirchenvater vom Heidentum ab). Nun, bekehrt bin ich nicht, wozu auch, aber dankbar. Ich werde ab nun für meine schwarzen Seiten entlohnt. Ein simples Geschäftsmodell, vom Mäzen, den ich gleich vorstellen werde, erdacht: Wenn ich dieses paradiesähnliche, von zarten Hügeln durchzogene Anwesen in der Toskana verlasse, werde ich Glücksmissionarin. Wäre es nicht so missverständlich, würde ich sagen: Freudenmädchen. Das ist die Abmachung. Ich bin die Schwester von Hans im Glück. Kein Naturtalent, aber lernwillig.
Durch meine geschlossenen Lider scheint die Sonne: Auf dieser Leinwand laufen Filme mit gutem Ausgang, nichts entzweit sich, alles versöhnt sich. Ginsterduft in der Nase, raschelndes Pappellaub über mir, zwischen den Fingern zerreibe ich eine Lavendelknospe. Die Schwalben üben den Absturz. Natürlich vergeblich. Immerhin sind wir in Italien. Wer traurig ist, soll scherzen. Hat mein Mäzen gesagt, der mich für diese Anstrengung bezahlt. Genauer gesagt: Aushalten wird. Nur im guten Sinn des Worts. Nach meiner Rückkehr aus diesem paradiesischen Ort, in dem ich mich zur Rehabilitation aufhalte, eine Seelen-Invalidin mit Aussicht auf Besserung. Denn das Frühchen plante einen frühen Abgang, aber der Hang zur Panne setzte sich durch. Es überlebte ein weiteres Mal, diesmal ohne Rotlicht.
Bei der Niederschrift dieser traurigen Zeilen ruft in der Ferne, dort, wo sich die Mauern des etruskischen Städtchens vom zarten Graublau des Maihimmels kaum abheben, ein Kuckuck. Immer wieder rührt es mich, wie wortwörtlich sein Ruf dem in Kinderbüchern nachzulesenden entspricht: Kuckuck. Bei allen anderen Tieren sind es Annäherungen, kein Hund macht wauwau, keine Katze miau, nur Kinder, die Hunde oder Katzen spielen, tun das. Diese schöne Übereinstimmung macht mich zufrieden. Die Muskeln, die man zum Lächeln braucht, treten in Aktion, ich spüre es unter der Wärme der Sonnenstrahlen. Wenn ich die Augen spaltbreit öffne, sehe ich meine Füße, leicht gebräunt. Mir scheint, sie wippen im Takt der Brise, die uns – mich, das Wasser, den Ginster, die kaum stecknadelgroßen Oliven – streift. Das, denke ich, wird irgendwann die letzte Aussicht sein. Es begann mit vierzig Zentimetern und wird mit einhundertsiebzig enden. Soviel steht immerhin fest.
Schluss jetzt! (Ausruf meiner Mutter, die ohne anzuklopfen in mein Zimmer trat, wo ich damit beschäftigt war, schöne Zitate von Selbstmördern der Weltliteratur in mein Tagebuch zu übertragen): Mein Auftraggeber fördert mich schließlich nicht für dunkle Gedanken.
Ein Sprung in das Schwimmbecken hat mich abgekühlt, jetzt perlen die Wassertropfen an meiner Haut ab und glitzern in der Sonne wie etwas Kostbares. Ich vertreibe mir die Zeit, die ich zum Trocknen brauche, mit Gedanken an das noch weit entfernte Abendessen, auch das spendiert mir mein Mäzen. Vier Gänge, die vom Koch mit liturgischer Feierlichkeit vorgetragen werden, ich, also die Gemeinde, falle nach jeder Ankündigung lobpreisend ein. Wir sind ein schönes Gespann. Seine große Kochmütze wackelt, so leidenschaftlich ist seine Predigt. Er hat Kinderaugen, sanft und unerfahren. Das Dessert materialisiert sich förmlich in seinem Mund, noch während er spricht. Wenn das keine religiöse Erfahrung ist!
Gelegentlich, auch wenn ich mich nicht auf Liegestühlen sonne, denke ich darüber nach, was wohl aus den Rheinkieseln geworden ist, die damals die Säcke füllten. Sind sie wieder am Ufer des Flusses ausgebettet, sonnen sich folglich auch? Oder auf seinem Grund, von der Strömung geschliffen und poliert? Ich bilde mir ein, es hätte geholfen, einen von ihnen als Handschmeichler und Fetisch ins erwachsene Leben mitzunehmen, als eine Art Gedenkstein. Beziehungsweise als das Herz aus Stein, das er dem Wurm, Molch, Kreatürchen war. Auch wenn es nicht schlug. Schläge kamen später.
Vielleicht sind die Kiesel auch auf einem Gartenweg gelandet oder als Grabschmuck verwendet worden: Hic iacet – in schöner hellgrauer Schrift mit weißer Maserung: eine Seele. Der See entsprungen, in der Erde bewahrt. Im Lateinischen hört man wenigstens, dass humanitas mit dem Humus verwandt ist, zu dem wir alle werden, nachdem wir unserer wässrigen Existenz entkommen sind. Das ist mit Menschheit anders, da denkt man nur an Männer. Und hoffentlich nicht gleich an Beerdigung.
Ich sehe, Vico runzelt die Stirn – Vico ist der Name meines Mäzens –, er hat nicht viel Bedingungen gestellt, aber die eine schon: Nicht zu viele Sperenzchen, nicht zu viele Wortspiele! Er weiß, ich liebe das. Er versteht einfach nicht, wie verlockend die Zungenfertigkeit der Worte ist. Ein Schmelz, ein Schmecken und Schlürfen! Wer keine Religion hat, muss sich andere Rettungen erfinden.
Mein Liegestuhl ist nun im Schatten, die Haut ist bereits ein wenig dunkler als gestern. Ich werde mich in ein mediterranes Geschöpf verwandeln, mit Lebensfreude, gesundem Appetit und italienischen Schuhen. Die Schwalbe fällt mir ein, die sich heute früh in mein Zimmer verirrt hat. Sie segelte durch das weit geöffnete Fenster, noch ganz unbeirrt, prallte gegen die Wand, taumelte – auch das elegant – und kollidierte mit dem Fliegengitter der Terrassentür. Sie krallte sich darin fest, ich näherte mich auf Zehenspitzen, sah schon aus einiger Entfernung ihr rasend pochendes Herz unter dem glänzend schwarzen Brustgefieder. Die blanken Augen drehten durch. Mit größter Vorsicht drückte ich das Gitter nach außen, sie entwich. Und ließ mich mit rasend pochendem Herz zurück. Ich hatte ein Leben gerettet. Der Himmel blähte sich gleichgültig, Tragödien interessieren ihn nicht.
Der Schatten vertieft sich, ich öffne die Augen. Der Koch steht am Fuß meiner Liege und schirmt mit seinem mächtigen Oberkörper die wenigen Sonnenstrahlen ab, die durch das Laub hindurchgefunden haben. Er wünscht mir eine buona giornata, ohne Mütze sieht er unbekleidet aus, nein, unbehütet, und man möchte aufspringen und ihm anbieten, ihn zur Mutter zurückzubringen. Seine großen Hände sind ihm offenbar fremd; er hält sie eigenartig abgespreizt. Nur in der Küche gehören sie ihm.
Ihnen auch!, erwidere ich enthusiastisch und überrasche mich selbst damit, Ihnen auch einen schönen Tag! Ich spanne die Bauchmuskeln an; ob aus Vorfreude auf das Essen, das er zubereiten wird, oder aus alter Gewohnheit – Tauglichkeitsmusterung –, zu heiß, um es zu entscheiden. In einem Buch, das ich kürzlich las, gab es eine Liebesszene, in welcher der männliche Erzähler von der Hingabe der Frau berichtete, die so groß war, dass sie vergaß, die Bauchmuskeln anzuspannen. Ich fühlte mich ertappt. Das fühle ich mich fünf Mal täglich.
Der Koch geht ab, mit einer halben Drehung wie ein Diskuswerfer, auf dem Absatz, so, als käme der Antrieb von außen. Es wird wieder heller. Vielleicht fiel mir bei seinem Anblick die Mutter ein, weil er mich ernährt. Der Versorgungsrückstand, den ich dadurch habe, dass ich nie gestillt wurde, ist nicht aufzuholen, ich kenne alle Erkrankungen und Misslichkeiten, die als Spätfolgen auftreten können. Die unmittelbaren Folgen auch: Ich bleibe ein ungestilltes Kind. Das erzeugt chronischen Liebeshunger. Voilà, jetzt ist es raus. Der ist ungefähr so schwer zu verbergen oder zu tarnen wie ein Bauchladen oder ein Feuermal mitten im Gesicht. Apropos Mal: Bei der Geburt hatte ich ein riesiges, schwarzes an der linken Wade, die nur so groß war wie eine kleine Möhre, und dieses schwarze Mal beraunten die Nonnen, so wurde berichtet, als Fingerabdruck des Teufels. Und das Herz war ungewöhnlich groß, im Unterschied zu allen anderen Organen, die sich richtigerweise im unreifen, unausgewachsenen Zustand von lediglich sieben, statt neun Höhlenmonaten befanden. Meine Vermutung ist, dass es sich dem genannten übermäßigen Liebeswunsch, der sich übrigens auf das Empfangen ebenso wie auf das Geben bezieht, einfach räumlich angepasst hat, indem es sich über Gebühr ausdehnte. Nein, jetzt geht der Hunger mit mir durch, nicht der Liebeshunger, aber sein Verwandter, der Erzählhunger, auch er chronisch, aber weniger peinlich. Er nimmt den Faden auf, der andernorts verlorenging. Der lose blieb. Poetisch gesagt. Prosaisch gesagt: nach Strich und Faden verratzt. Los-Pech.
Mit dem Frieden und dem Nachdenken über die Anfänge und ihre Folgen ist es nun vorerst vorbei. Die Gruppe Schweizer Mountainbiker aus dem Berner Oberland – die Einzigen, die neben mir diesen Garten noch bewohnen – fällt ein; erst höre ich nur das Surren der Reifen, dann, auf dem letzten Stück vor dem Schwimmbad, das Knirschen der wegspringenden Steinchen, schließlich, in unmittelbarer Nähe, die Stimmen selbst. Was für ein unbarmherziger Dialekt!, ruft es in mir aus, als käme er nicht aus einer Kehle, sondern aus einem Schacht! Mit den spitz zulaufenden Helmen, die ihren Gestalten etwas Extraterrestrisches geben, könnten sie durchaus die neuen Barbaren sein. Mit einer gewissen Befriedigung leiste ich mir auch dieses Klischee, zu Trainingszwecken: Den inneren Zensor zwangsbeurlauben, schließlich bin ich hier zur Erholung. Ich öffne die Augen ganz, als ich angesprochen werde.
– Bitte?
Ich höre Kratzendes, viel i, eine Stimme, die gegen Satzende wie auf einer Schaukel hochfliegt. Schwyzerdütsch. Verstehe ein Wort, Wasser. Vermutlich das im Schwimmbad.
– Ziemlich warm, angenehm.
– Merci.
Die Barbarin zieht einen Stuhl heran, den Helm aus, schüttelt überraschend lange, blonde Locken und seufzt tief auf. Streckt energisch kräftige Beine gerade in die Luft, taxiert sie, als müsse sie eine Kaufentscheidung treffen. Und ich erfahre – sie gibt sich beim Sprechen Mühe, ich gebe mir Mühe –, dass sie zu der Cappuccino-Gruppe gehört, den blutigen Anfängern, die bergauf schieben dürfen, und dass sie den abgesprungenen Liebhaber ihrer Freundin ersetzt, der wiederum von ihr behauptet habe, ihr ginge es doch alleweil nur ums Essen. Statt ums Fahrradfahren. Lacht kehlig. Menschenkenner, der abwesende Liebhaber. Ich gestehe unter dem milden Blick ihrer hellblauen Augen, dass es auch mir alleweil nur ums Essen geht. Wir lachen nun beide. Der Koch, ja, der Koch! Das große Kind, das in der Küche den hölzernen Löffel schwingt wie ein Unsterblicher.
Claudia – wir haben einander die Namen verraten und, sonnenträge, die Hände gereicht –, Claudia also pellt sich aus den eng anliegenden, knielangen Hosen und einem böse gemusterten Trikot, dann steht sie im Badeanzug am Beckenrand, dehnt und streckt sich, als hätte das gekrümmte Sitzen auf dem Sattel sie gestaucht. Bevor sie mit einem Sprung ins Wasser verschwindet, kommt sie noch einmal zu mir zurück und zeigt mir ein Tattoo am Oberschenkel:
Your efforts will pay, steht da in verschnörkelter Schrift.
Sie hebt den Daumen, lacht, wendet sich zum Becken; eine Erfolgsgeschichte geht nun baden.
Ich schließe meine Augen erneut. Zufrieden. Hat sie mir auf ihrer Haut gerade mein Orakel offenbart?
Rechtzeitig, denn morgen bin ich mit meinem Arbeitgeber zum Dinner (Vico sagt nie Abendessen) verabredet, da ist eine Stärkung des Selbstwertgefühls direkt proportional zur Steigerung des Profits, auch wenn dieser nur ideell ist. Ich müsste mir lediglich noch einige Redewendungen im Italienischen zurechtlegen, die Beine rasieren und eine Allergie gegen Meeresfrüchte erfinden (denn über Grottenmolche und ähnliches Getier soll geschwiegen werden), dann wäre ich einsatzbereit.
Einen heißen Saharawind hat die Wetterfee am gestrigen Abend im italienischen Staatsfernsehen angekündigt, mit nasaler Stimme, die vermutlich von einer Nasenbegradigungsoperation kommt, und mit verheißungsvollem Unterton, heiße Ware, dieses Wetter, heiße Nächte, beziehungsreiches Zwinkern, Sand nur in der Luft, nicht im Getriebe, ach ja, wo wir schon bei Trieben sind! Das Fernsehen scheint von Zuhältern betrieben zu werden, die ihre Lockvögelchen mit geputztem Gefieder aussenden, auf dass sie über Wetter, Politik, Ehebrecher, Papst und Kochrezepte so lange im Sopran des Gleichklangs zwitschern, bis die Freier vor dem Schirm ganz unfrei erliegen. So stellt man sich den idealen Wähler vor: Mit verschlucktem Souffleur. Embedded prompter.
Jedenfalls, der heiße Wind weht nun und schickt tatsächlich einige Sandkörnchen, die im aufgeschlagenen Notizbuch die Ritzen füllen. Die sonst so blassen Seiten erröten. Und ich sollte nicht so herumposaunen. Wer weiß, welche Einflüsterer in meinen Gehörgängen ihr Unwesen treiben!
Im Grunde ist mir rätselhaft, was Vico bewegt, ausgerechnet mich als Glücksmissionarin und Freudenbringerin auszusenden und zu verlangen, dass ich von meinen Einsätzen Zeugnis ablege. Gewissermaßen eine Mitschrift anfertige. Ich glaube, der wahre Missionar ist er, er erträgt nicht, dass jemand ein Scheitern nicht nur einräumt, sondern sogar zur Maxime erhebt. Vermutlich hat er einschlägige Erfahrungen und wünscht nun Dementi. Er unterstützt mich, damit er recht behält: Seiner Meinung nach beruht Scheitern auf Missverständnissen, auf fehlender Synchronisation; wenn es einem gelingt, erstere auszuschließen und letztere zu erreichen, folgt daraus – Erfolg! Er formuliert Kalendersprüche wie Niederlagen machen Männer stark und Frauen schön oder Siehst du ein Hindernis – dann begehre es!, aber zur Stunde kann er mich kaum als Beleg für seine forschen Annahmen führen: Mein Profil ist schaurig, meine Arme und Beine zu kurz, mein Kopf zu groß, mein Ehrgeiz zu klein. Ich war zwei Jahre lang stolze Besitzerin einer Moto Guzzi, mit der ich Schräglagen zu bewältigen lernte, und als ich mir einmal einen Motorradhelm kaufen wollte, musste ich in die Männerabteilung. Wenn ich Hindernisse begehren statt meiden wollte, dann müsste ich vierundzwanzig Stunden am Tag begehren. Bei den Hindernissen, die mir begegneten und begegnen, wäre das ein echtes Kunststück. Aber nun gibt es Vico. Kein Prinz, nein, eher ein Politiker und Menschenfreund, Menschensohn, wie er in leichter Überhöhung seiner Person einmal meinte, ein Kaufmann, zuhause auf allen Schwarzmärkten dieser Welt, ein bester Freund der besten Freundin und darum im Auftrag um mich besorgt: Ich soll genesen oder besser gesagt, gefeit in mein Leben zurückkehren, aus dem ich, vorübergehend, in die schwarze Grube gefahren war, in der es keine Schätze zu heben gibt. Wie seinerzeit der junge Joseph in den Brunnen. Ich brauchte keine missgünstigen Brüder dafür – meine eigenen Gespenster reichten aus. Nach dieser Schwarzfahrt steht mir, wie jedem anderen Delinquenten auch, eine Rehabilitationsmaßnahme zu, schließlich lässt sich Schwarzgalligkeit kurieren, so die feste Überzeugung all derer, die den Mohren in mir zu waschen versucht haben. Pardon, Vico, das war mit Sicherheit zu viel Wortspielerei gerade? Musste aber sein.
Das Ende dieses therapeutischen Toskana-Aufenthalts ist abzusehen, ein, zwei Überlegungen zur Strategie des Danach sollte ich wohl anstellen. Während ich mich anschicke, dies zu tun, schmilzt mir noch auf der Zunge die warme Mascarponetorte, die der unvergleichliche Koch gestern Vico und mir als Dessert kredenzte. Sie schmeckte (und schmolz dahin) wie ein Versprechen, eine Zusage, ein unschuldiges Ejakulat. Ein sahniges Ja zum Leben, ein halbflüssiges Gebet. Himmlisch.
Wahrscheinlich werde ich den Vergleich mit dem Ejakulat streichen müssen, wenn ich dies Vico vorlege; vorerst lasse ich ihn stehen. Hat nicht Vico gesagt, schreibe, was du willst, aber werde gesund? Das und munter hat er mich innerlich ergänzen lassen; er weiß als gelernter Katholik, worauf er sich bei einer Protestantin verlassen kann. Nicht aus psychologisch oder soziologisch geschulter Erkenntnis, sondern aus kaufmännischer Praxis.
Und so ging es weiter:
Auftritt Vico und ich, Minna (die Schwärmerei meines Vaters für die Sängerin Minna Planer, Richard Wagners erste Frau, trug mir diesen Namen ein. Leider nicht eine Liebe zu Lessing. Vermutlich protestierte meine Mutter nicht, weil auch sie, nach der Geburt, nicht mit meinem Überleben rechnete).
Vico: Sei bella –
Minna: Meine Beine sind zu kurz, mein Kopf zu groß, mein –
Vico: Ganz schön braun geworden in den letzten Tagen.
Minna (hebt das Glas, lächelt den Koch an, der vor der Schwingtür zur Küche steht, dann Vico): Salute!
Vico: Prrost!
Die Vorspeise unterbrach den erheblichen Gedankenaustausch, wir aßen frittierte Zucchiniblüten. Vico mahlte furchterregend mit den Kiefern, dabei waren die Blüten zart wie Blätterteig. Vielleicht eine politische Angewohnheit? Vico verfügt übrigens über einen zusätzlichen Zahn, den er Löwenzahn nennt und der recht spitz und bedrohlich unter der Oberlippe hervorfletschen kann. Das gibt seinem insgesamt gutartigen Gesicht gelegentlich etwas Tückisches.
Vico: Iss! Lass es dir schmecken! (Er winkt den Koch heran.) Den guten Correggio von neulich und für mich niente primo (er fasst sich an den Bauch). In unserem Alter muss man aufpassen.
Er lachte, sein Lachen ist gewinnend trotz des eigenartigen Zahns, es zeigt, dass er sich an diesen Plänkeleien erfreut, ohne sie ernst zu nehmen. Sie unterlaufen ihm so unwillkürlich wie Atmen und sorgen für frische Luft zwischen den Geschlechtern. Findet er. Um die esseri umani, die Menschenkinder, drehte sich das Gespräch bis zu meinem ersten Gang und seiner Pause. Vicos Sätze haben immer die Kraft Luther´scher Thesen, in Ermangelung eines wittenbergischen Kirchentors hämmert er sie auf die Tischplatte. Kann ich mir Vico im Bett vorstellen? Ich meine, mich zusammen mit Vico im Bett. Nur schwer, er ist ein solcher Verkäufer, vermutlich würde er auch noch seine Potenz als Sonderangebot bewerben. Jeder zweite Satz von Vico beginnt mit um bei der Wahrheit zu bleiben. Das gibt zu denken. Würde er mir zwischen zwei Küssen oder Stößen die Wahrheit sagen: Wann ist endlich Feierabend? Wie müde macht mich dieses Gerammel. Aber Karriere ist nun einmal die schnellste Gangart.
Vico: Es freut mich, dass es Dir schmeckt. Du hast einen gesegneten Appetit (er hebt noch einmal das Glas). Auf uns Veteranen!
Ich zuckte ein wenig zusammen, woher wusste Vico das? War mir bei anderer Gelegenheit etwas entschlüpft? Nämlich, dass Frühchen von Geburt an Veteranen sind oder Ähnliches?
Dann kam die Mascarpone-Torte (ich lasse unser Gespräch während des Hauptgangs aus, es drehte sich um Solartechnik und moderne Abwasserverarbeitungstechnologien – Vicos Spezialgebiete. Vielleicht sieht er in mir eine weitere Art von Energienutzung und Unratbekämpfung), und wir aßen die Torte harmonisch schweigend. Nur gelegentlich ein schwelgerischer Blick von Vico, dessen Adressat nicht ganz klar war: Gott, der Koch oder ich.
Bei Vico konnte man aber auch nicht ausschließen, dass er der Kuh dankbar war, die die Milch zum Mascarpone geliefert hatte.
Womit wir wieder beim Liebeshunger wären, der mich in viele Arme sinken ließ, die nicht immer zu angenehmen Menschen gehörten. Gut, dass ich dafür die schlüssige Erklärung der Frühgeburt habe. Die Nonnenarme waren vermutlich wohlmeinend; ihre Inhaberinnen hatten eine Kindheit im Krieg verbracht und streckten sich nun immerhin alle vier Stunden dem Säugling entgegen, um ihm das Fläschchen zu geben und die Windel zu wechseln. So viel Zuwendung hatten sie selbst nicht erfahren, das Wenige erschien ihnen ausreichend, wenn nicht sogar verschwenderisch. Kam nicht die Gottesumarmung ganz ohne Berührung aus?
Heute würde ich allerdings behaupten, dass die frühe Lektion nach hinten losging: Ich wurde nämlich ein Berührungsjunkie. Jemand, der nur nach Kontakt zündet.
In den Augen des Kochs liegt eine Ahnung des Trostes, den er spendet. Deswegen senke ich bei unseren Begegnungen über dem gedeckten Tisch rasch den Blick, und sein Ton wird noch ein wenig höflicher. Übrigens heißt er Oreste. Auch bei Cesare, Achille und Ercole kennen die Italiener keine Scheu. Selbst ein Fiat-Modell heißt Ulisse. Die Tochter Kleopatra, der Sohn Cäsar! Ach, Minna, wo soll’s hin? Eine Helden-Vita hat mir mit diesem Namen niemand zugedacht. Die Kleine findet nie einen Mann muss ein Ausspruch gewesen sein, der im Krankenhaus oft fiel, so wurde mir hinterher berichtet. Nicht dass Nonnen für derlei Fragen die kompetentesten Auskunftsgeber wären, aber recht behalten haben sie im Großen und Ganzen doch. Und wenn in diesem Orakel eine gewisse Geringschätzung für das Geschöpf durchscheint, dem die Prognose galt, dann täuscht dieser Eindruck keineswegs. Der Mann – als solcher – war auch für die Nonnen die Elle, an der Erfolg gemessen wurde.
Ich erhebe mich vom Liegestuhl, tauche die Zehen ins Wasser und studiere den makellosen Himmel nach Hinweisen: Er spannt sich, mehr nicht.
Geschrei aus Richtung der Rezeption, die Berner kehren zurück. Es ist früher Nachmittag, das kann keine lange Tour gewesen sein. Es muss sich folglich um die Cappuccino-Gruppe handeln, die die Hintern ihrer unerfahrenen Mitglieder schont und nur halbtägigen Einsatz verordnet. Beinahe wünsche ich mir, Claudia möge auftauchen, ihre blonden Locken schütteln und meine Schatten vertreiben mit ihrem liebenswürdigen Berner Gesang. Nach unserem Duett am Pool hatte ich sie noch einmal beim Frühstück getroffen. Da schrieb sie Postkarten an Berner Skeptiker; ein großer Teller dampfender Spaghetti war auf der Vorderseite der Karte zu sehen, darunter der Schriftzug Kunstschätze Italiens. Eigentlich missfallen mir Menschen, die witzige Postkarten kaufen und sich über den zu erwartenden Gesichtsausdruck der Adressaten im Voraus freuen. Mit der freien Hand balancierte Claudia ein Stück Kuchen, von dem sie sinnend – mit den Gedanken war sie in Bern – abbiss. Zwei, drei Krümel oder Pinienkerne (ich glaube es handelte sich um eine crostata ai pini) taumelten in ihr Dekolleté und mischten sich unter die Sommersprossen. Nun, in einem solchen Versteck wäre ich selbst gern blinder Passagier gewesen, auch wenn meine sexuelle Orientierung eindeutig Männern gilt; es muss sich mal wieder um mein Mutterbrust-Defizit handeln.
Claudias Füße steckten in geblümten Badelatschen und wippten im Takt ihrer Einfälle. Sie teilte den Frühstückstisch mit einer Freundin, vielmehr Gefährtin, die – der athletischen Figur nach zu urteilen – zur Gruppe der Fortgeschrittensten gehören musste und deren Teller nur halb so beladen war wie der Claudias. Sie musterte mich ein wenig streng, ihr Blick hellte sich erst auf, als er auf meine Laufschuhe fiel.
Sie schlug diesen konfektionierten Coach-Tonfall an, nach dem Motto: Auch die Nieten muss man ermutigen, und nippte an ihrem Tee. Ich dachte, wie schön die Welt wäre, wenn es nur Cappuccino-Gruppen gäbe, deren Mitglieder lachend bergauf bummelten und Your efforts will pay auf ihre Oberschenkel tätowieren ließen. Wenn es lauter Claudia-Klone gäbe. Vielleicht gehören Güte und Korpulenz zusammen, das Rationieren und Haushalten verträgt sich nicht mit Üppigkeit. Und wenn ich das als einen Dreisatz betrachte – der Mathematik war ich trotz durchgehend schlechter Noten immer zugewandt – dann ergibt das: hagere Nonnen. Und meine Schlafprobleme? Sind sie ein Wunder, so wie ich gebettet wurde? Und die Allergien? Sind sie eins? Nein! Ich lag inmitten von Fremdeinwirkungen. Welche alle weibliche Vornamen trugen wie Hilde und Cordula und ein Brustbein hatten anstelle der Brust. Auf welchem das Kruzifix wachte wie eine Festung.
Jetzt bewegt sich die bunte Truppe auf den Pool zu; ich strecke mich schnell auf dem Liegestuhl aus und halte das aufgeschlagene Buch in die Höhe, um Claudias Wege ungesehen zu beobachten. Sie geht neben der mageren Freundin und reibt sich den Hintern. Das Tattoo bewegt sich im Takt ihrer Schritte.
Im Lack des Kinderbetts, das auf die Steinsäcke folgte, gab es Kratzer, die sich an einer Stelle zu etwas zusammenfügten, von dem ich mit etwa drei, vier Jahren beschloss, es müsse der Umriss Afrikas sein (ja, Frühgeburten sind auch frühreif!). Nachts floh ich mit dem Finger südwärts, also herzwärts. Ich könnte auch sagen, mein Herz schlug in Afrika. Daran muss ich denken, als ich Claudia zuschaue, wie sie schnaubend und prustend das Becken durchquert. Das Wasser teilt sich zuvorkommend, scheint mir, kein Wunder, bei soviel Einverständnis und Harmonie mit dem eigenen Körper. Claudia, möchte ich rufen, wie machst du das? Wo lässt du deinen Gram?
Natürlich halte ich den Mund. Und beschließe, in den letzten Tagen so viel wie möglich von ihr zu lernen: von einer Glückstrainerin, die nichts von ihrem Glück weiß.
Der nächste Tag beginnt gewittrig. Das Licht ist verschleiert, die Schwalben rasen tief, die Wolken haben schmutzige Ränder. Das bedeutet, dass ich mich nicht am Schwimmbad auf die Lauer legen kann, und es bedeutet vermutlich, dass die Cappuccino-Gruppe ihrem Namen alle Ehre macht und den Vormittag nicht mit Radfahren bei Blitz und Donner verbringt, sondern bei Cappuccino. Meine strategische Wahl fällt auf die Bar, in der das Frühstücksbuffet aufgetischt wird. Ich setze mich in den überdachten Terrassenbereich; die weißen Plastikstühle Made in Taiwan phosphoreszieren gegen den dunklen Himmel. Höllenmöbel, so wie sie an der Haut kleben und sich mit unanständigem Schmatzen wieder von ihr lösen, wenn man aufsteht. Windböen stöbern in den Oleanderbüschen, die aufgescheuchten Blüten wirbeln in den Luftstrudeln. Ich bin die einzige. Und, wenn Claudia nicht sofort kommt, mutterseelenallein. Das Wort soll uns Deutschen erst einmal jemand nachmachen.
Oreste erscheint im Türrahmen zum Innenbereich. Ich sehe ihn das erste Mal ganz ohne seine Koch-Kluft; er trägt ein schlammfarbenes Polohemd und dunkle Leinenhosen, die reine Weiß-Vermeidung, denke ich, vermutlich ziehen auch Krankenschwestern und Pfleger in ihrer Freizeit nichts Weißes an. Mich verwirrt es. Er grüßt, seine Augen legen sich so sanft auf mich wie ein heilender Salbenverband, die Lippen tragen das ciao kaum hörbar nach. Jetzt verstehe ich, warum er so jung und kindlich aussieht: Man sieht nicht einmal einen Anflug von Bart, die Haut ist glatt und frisch, als verjüngten die Dampfbäder über den brodelnden Kochtöpfen sie täglich. Oreste trägt keine Spuren des Gebrauchs. Ich fühle mich in den Stuhl gedrückt von der Wucht schlagartigen Alterns.
Oreste geht, wieder mit dieser eigentümlichen Drehung auf dem Absatz, und ich kann erkennen, dass er die weißen Kochschlappen trägt, deren Oberfläche ziemlich bekleckert ist. Zum Abschied in den Augen eine Art Aufblenden, ähnlich dem Fernlicht bei Autos. Ich hebe die Hand, bin wieder mit dem Gewitter allein. Der Schaum des Cappuccino hat sich an den Seitenrändern der Tasse abgelagert wie Seifenreste um den Abfluss in der Dusche.
Ich bestehe auf Claudia. Oder ich gehe.
Nach zwei weiteren Blitzen und einem krachenden Donnern erhebe ich mich und schlage den Weg in die Rezeption ein, mit keinem anderen Beweggrund als der Überzeugung, dass man auch Drohungen wahr machen muss. Widerwillig schreite ich aus, dicke Tropfen zerplatzen vor meinen Füßen, irgendwie höhnisch, als hätte der liebe Gott sie geschickt, mich ins Off zu eskortieren.
Auf den letzten Metern schüttet es so heftig, dass ich bis auf die Haut durchnässt die Tür zur Rezeption aufstoße. In der Mitte des großen, hallenartigen Raums verläuft halbrund eine Theke, zwei Frauen, gekleidet wie Flugbegleiterinnen, tippen energisch in die Tastaturen vor zwei Bildschirmen, ein Telefon zwischen Ohr und Schulter geklemmt. Ebenfalls synchron lächeln sie mich an, si accomodi, mit dem Kinn weisen sie auf eine Schachtel mit Papiertaschentüchern. Ich wische mein Gesicht ab, Hals und Arme, aber meine Bewegungen fügen sich nicht ein in die fließende Choreographie dieses harmonischen Schwestern-Duos.
Die Telefonate sind beendet, das Tippen auch, und ich werde von beiden nach meinen Wünschen gefragt. Dafür sind sie eigens aufgesprungen, das setzt mich unter Druck, ich brauche einen echten Grund für mein nasses Auftreten. Ob sie außer Fahrrädern auch anderes vermieteten? Die freundliche Rezeptionistin zu meiner Linken fragt nach: Zum Beispiel? Und ich sage tatsächlich: Pferde.
In den wenigen Augenblicken, die mir bleiben, weil die beiden Schwestern sich ratlos anschauen und synchron die Achseln zucken, bevor sie sich mit zurechtgerückter Empfangsdamenmiene wieder mir zuwenden, läuft folgender Film in meinem Kopf ab:
Die Insel Nonnenau (Nonnen – schon wieder!!) im Rhein, mückenverseucht, Dickicht, Unterholz, Gestank nach Vergorenem. Mangrovensumpf ohne Mangroven. Von der Fähre ein halber Kilometer Fußweg, dann erreicht man einen heruntergekommenen Ponyhof, drei, vier Fjordpferde mit fahlem Fell, das gebürstet werden muss, bevor wir, die Freundin und ich, uns in den Sattel schwingen dürfen. Der Ausflug findet heimlich statt, Reiten ist verboten, die Angst klebt am ganzen Körper. Vor den Tieren, die die Augen rollen und versuchen zu beißen, vor der Mutter und ihren guten Gründen, so etwas zu verbieten.
Wenn man Pferde sattelt, blähen sie sich auf, damit der vermeintlich fest sitzende Sattel sich später lockert und der haltlose Reiter herabstürzt. Die Mädchen fühlen sich mit diesem Wissen im Rücken ziemlich erfahren und straffen den Gurt nach einigen Minuten noch einmal. Im Gesicht den Ausdruck von Erziehern, die recht behalten werden.
Der Ausritt beginnt, die Freundin voran, ein Kampf, das Pferd vom Fressen abzuhalten: Es reißt an den Zügeln und nähert sich jedem Grasbüschel, statt auf dem ausgetrampelten Reitweg zu bleiben. Mückenstiche an Armen, in Gesicht und Nacken, Schweiß in den Augen. Endlich Rückweg!
Und dann geht das Pferd durch, dasselbe Pferd, das nur eine einzige Gangart zu kennen schien, nämlich Schritt, verfällt aus dem Stand in einen rasenden Galopp, die Zügel gleiten aus der Hand, mit gestrecktem Hals beschleunigt das Tier noch einmal. Ein Lärm wie von tausend Hufen – als würde eine ganze Kohorte auf Angriff reiten. Direkt auf einen Baum zu, Absprung im letzten Moment.
Bei der Bestrafung zu Hause wird gerecht darauf geachtet, dass die aufgeschürfte linke Seite geschont wird. Im eigenen Zimmer bleiben die Blicke der Trakehnerstute und des Araberhengstes auf den Postern rings ums Bett sanft und solidarisch auf die Verwundete gerichtet, das Fell spannt sich leuchtend über ihre Kruppen, als hätte Gott persönlich sie gestriegelt.
Die beiden Damen an der Rezeption verhindern ein weiteres Nachdenken über diese Frage, indem sie ihr Bedauern ausdrücken, keine Pferde anbieten zu können. Da höre ich: Nass geworden? Ich wende mich um, Claudia steht vor mir, im weißen Rüschenkleid. Ihr Blick wandert an mir auf und ab wie der Strahl einer Taschenlampe, mit kaum unterdrückter Belustigung in ihrer Stimme stellt sie die Diagnose: Precipitazioni atmosferiche.
Glockenhell das Berner Gelächter, in das sie ausbricht, Dur, Dur, Dur das ganze Geschöpf. Die Rüschen am Ausschnitt beben mit. Precipitazioni atmosferiche. Ich weiß, wovon sie spricht, auf dem Weg hierher sind sie auch mir aufgefallen, die Schilder am Straßenrand mit dem schleudernden Auto und der Warnung darunter: In caso di precipitazioni atmosferiche, also im Falle von atmosphärischen Niederschlägen, wobei precipitare ziemlich dramatisch ist, abstürzen, herunterstürzen bedeutet, verzeih, Vico, aber das muss ich ausführen, es ist zu schön, aus Claudias Mund solcher Scharfsinn! Wortwitz! Sie hat doch recht! Ich war atmosphärisch abgestürzt, ich war ins Schleudern geraten, das hatten Orestes milde Augen so wenig verhindern können wie mein innerer kleiner General, der immerzu strammstehen! kommandiert. Claudias Zunge stolpert nicht im Geringsten bei dem schwierigen Wort precipitazioni, sie frohlockt geradezu in Wiederholungen, mit wunderbar gerolltem r, gezischtem ci, und erst als ich sage: Heute in Zivil? Schönes Kleid!, beruhigt sie sich und nimmt das Kompliment zustimmend entgegen. Die Radfahrerkluft mag sie auch nicht.
Claudia legt mir den Arm um die Schultern, bis zu den ersten Pfirsichbäumen fällt kein weiteres Wort, nur ihre Schlappen sind auf dem Teer zu hören, ein sommerlicher, argloser Rhythmus. Zu meiner Erleichterung macht sie den Vorschlag, einen Kaffee zu trinken, Cappuccino vielmehr, sie lächelt wie die beste Freundin und rafft ihr Kleid zusammen, als müsse sie einen Endspurt hinlegen. Wir fallen auf die Plastikstühle, die Sonne bricht hervor, unter gleißendem Licht verdampft die Nässe. Claudia schiebt die Sonnenbrille aus den Haaren zurück auf die Nase, nun sehe ich nur mein Spiegelbild in ihren Gläsern, grotesk verkrümmt.
Sie nuckelt an ihrer Tasse herum, wippt mit dem Fuß, schaukelt den Stuhl, das ganze Programm, genüsslich.
Und unversehens kann ich es gar nicht mehr erwarten, von hier wegzukommen, weg von diesem harmlosen Blondschopf, den operettenhaften Duetten mit Vico, dem Diktat der Mahlzeiten: Ich habe genug.
Unter den geballten Wolken wird das Licht immer fieser; ich springe auf und lasse die verdutzte Claudia zurück – wollten wir nicht die Adressen tauschen, höre ich, falls du mal in Bern bist oder.
Falls!, rufe ich über die Schulter zurück, falls!