
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das Eis wird dünner Yutu lebt mit seiner Großmutter in einem entlegenen Dorf in der kanadischen Arktis. Als er allein auf Seehundjagd geht, bricht er im Eis ein und kann sich mit letzter Kraft aus dem eisigen Wasser in eine alte Jagdhütte retten. Bee begleitet ihren Vater, der für eine Ölgesellschaft arbeitet, auf einem Trip zu einem Ölfeld in seinem Privatflugzeug. Doch direkt nach der Landung wird ihr Vater von bewaffneten Männern festgenommen. Bee kann gerade noch fliehen und findet sich in einer alten Jagdhütte wieder. Dort trifft sie auf Yutu. Ein Überlebenstrip beginnt. Und eine Jagd nach der Wahrheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Das Eis wird dünner
Yutu lebt mit seiner Großmutter in einem entlegenen Dorf in der Arktis. Als er allein auf Robbenjagd geht, bricht er im Eis ein und kann sich mit letzter Kraft aus dem eisigen Wasser in eine alte Jagdhütte retten.
Bee hat gerade wieder einmal die Schule gewechselt. Ihr Vater arbeitet für eine große Ölfirma als Geologe. Er verspricht ihr, dass sie nun nicht mehr umziehen müssen, aber bald verhält er sich sehr seltsam und geheimnisvoll. Als Bee ihn auf einem Flug in die Arktis begleitet, nimmt ihr Schicksal eine dramatische Wendung und ihre Welt kollidiert mit der von Yutu.
Ein Überlebenstrip beginnt. Und eine Jagd nach der Wahrheit.
Ele Fountain
UNTERNULLGRAD
COUNTDOWN IM EIS
Aus dem Englischenvon Beate Schäfer
Für Mum und Dad
Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.
CHIEF SI’AHL
STURM
Ein schwaches Dröhnen erfüllt die eisige Luft. In der Ferne gleiten vier dunkle Gestalten durch das Weiß, wie schwarze Gespenster. Ihre Scheinwerfer verbreiten ein gelbliches Licht. Der einzige Hauch von Farbe in einem Land, in dem sonst alles weiß und grau ist. Wo der Schnee tief ist, klingt das Dröhnen dunkel. Wenn Anhöhen zu erklimmen sind, verändert sich das Geräusch, es wirkt dann mehr wie das Sirren einer wütenden Wespe. Auf jedem Schneemobil sitzt eine Person, gehüllt in etliche Lagen Leder und Fell. Ein Mann führt die Gruppe an, gefolgt von einer Frau, dann kommt noch eine Frau, am Schluss fährt ein weiterer Mann.
Die vier sind seit Tagesanbruch unterwegs. Bald müssen sie einen geschützten Ort finden, an dem sie die Nacht verbringen können. So hoch im Norden steigt die Sonne nur kurz über den Horizont, um dann wieder unterzugehen. Die vier Menschen wissen, wohin sie wollen. Schon ihre Eltern haben diese Wege genutzt, genau wie ihre Großeltern und viele Generationen davor.
Wind pfeift über die Tundra. Alles in seinem Weg muss sich ducken oder wird davongeweht. Nichts hier ist so töricht, sich dem Wind entgegenzustellen, nicht so weit oben im Norden. Die vier wollen zu einem Ort, der Schutz bietet vor seiner erbarmungslosen Macht. Zu einer kleinen Holzhütte, die sich in eine Senke schmiegt. Normalerweise wären sie jetzt schon dort. Hätten die Tranlampe entzündet, um ihre Robbenfellhandschuhe zu trocknen. Doch das Wetter hat sie überrascht. Sonst ist es um diese Jahreszeit zwar klirrend kalt, aber windstill. Eine gute Zeit für die Karibujagd. Als sie aufgebrochen sind, war alles ruhig und friedlich, jetzt ist es das genaue Gegenteil. Vom Meer her tost ein Sturm.
Die beiden hinteren Gestalten fallen immer weiter zurück. Das Schneemobil des Mannes läuft nicht mehr richtig. Die Frau macht langsamer und wartet auf ihn. Er müsste nach den Zylindern schauen, aber hier geht das nicht. Sobald sie bei der Hütte angekommen sind, wird er den Motor überprüfen. Jetzt müssen sie einfach weiterfahren, egal wie langsam.
Der Wind wird von Minute zu Minute stärker. Schneeflocken peitschen durch die Luft. Immer heftiger schneit es, im Sturm wirken die wirbelnden Flocken wie rauchige Schwaden. Bald verblassen die vorderen Fahrzeuge zu grauen Schemen, Sekunden später sind sie nicht mehr zu sehen. Die Vorausfahrenden werden als Erste bei der schützenden Hütte ankommen und dort alles vorbereiten.
Das Schneemobil des Mannes wird immer langsamer und bleibt schließlich stehen. Er versucht, wieder zu starten, doch der Motor reagiert nicht. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als das Fahrzeug zurückzulassen. Eine schwere Entscheidung. Auf dem Rückweg werden sie es wieder in Gang setzen oder aber nach Hause schleppen. Die Frau gibt dem Mann ein Zeichen. Der klettert hinter ihr auf ihr Schneemobil. Im Fellrand ihrer Kapuzen sammeln sich für einen kurzen Moment Schneeflocken, bevor ein mächtiger Windstoß sie wegstieben lässt. Die beiden setzen sich in Bewegung, doch der Schneesturm ist jetzt so stark, dass vor lauter Weiß um sie herum nichts mehr zu erkennen ist.
Nach fünf Minuten müssen sie wieder anhalten, ihnen fehlt jede Orientierung. Von der Sonne ist nichts mehr zu sehen, kein noch so schwacher Schein zeigt ihnen, wohin sie fahren müssen. Alle Kennzeichen in der Landschaft, die sich ihre Vorfahren tief eingeprägt haben, sind verschluckt. Auch Absteigen ist unmöglich, denn in dem starken Wind könnten sie sich nicht aufrecht halten. Der Mann beugt sich vor und umarmt die Frau. Er kann sie kaum umfassen wegen der vielen Lagen Kleidung, die sie trägt.
Dunkelheit senkt sich herab. Die beiden können nicht hierbleiben, sonst werden sie mit Sicherheit erfrieren. Sie müssen weiter. Dieses Land ist ein Teil von ihnen, sie atmen in seinem Rhythmus. Doch dieser Rhythmus ist immer schwerer vorherzusehen. Es dürfte um diese Jahreszeit keinen Sturm geben. Schon gar nicht einen so heftigen, der wie aus dem Nichts losbricht. Das Wetter ändert sich, ihr Jahrhunderte altes Wissen kommt nicht mehr mit. Das Band zwischen Mensch und Natur ist beschädigt. Etwas unvorstellbar Kostbares löst sich auf.
YUTU
Jemand stößt mich fest in den Rücken. Ich falle auf die Knie, meine Schultasche fliegt ein paar Meter nach rechts. Eine starke Hand packt mich an der Schulter und versucht mich umzudrehen. Ich schaue auf. Sami starrt auf mich herunter. Ich packe ihn an der Jacke und zerre ihn zu mir in den Schnee. Wir rollen uns wie Robben auf dem Boden. Vier oder fünf Jungs stehen um uns herum und sehen zu, feuern Sami an, er soll es mir zeigen und mich unten halten. Mit einer letzten Drehung zwinge ich ihn auf den Rücken und setze mich auf ihn. Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Der Schnee in meinen Ohren schmilzt, läuft mir in die Kapuze und den Hals hinunter. Ich stehe auf und streife mir den Schnee von den Armen und Beinen, dann strecke ich Sami die Hand hin.
»War einen Versuch wert, was?«, sage ich.
»Fast hätt ich’s geschafft«, entgegnet er grinsend. »Hat nicht viel gefehlt.«
Ich klaube meine Tasche aus dem Schnee am Wegrand und schüttele sie.
»Kommst du morgen? Zum Zocken?«, fragt er.
»Mal sehen. Vielleicht gibt’s was, das ich für Großmutter erledigen muss.«
»Du willst schon mit den Aufgaben anfangen, stimmt’s?«, sagt Sami. »Du bist so ein Nerd, echt.«
Ich grinse. Er hat recht, das wissen wir beide.
Sami und die anderen machen sich auf den Weg zu der Ansammlung kleiner Häuser. »Bis dann!«, rufen sie, ohne sich noch mal umzudrehen. Sami hebt die Hand und winkt.
Langsam stapfe ich in die entgegengesetzte Richtung, auf einen niedrigen Hügel zu, den die untergehende Sonne in ein orangefarbenes Licht taucht. Am Fuß des Hügels steht ein kleines Wohngebäude, das sich von allen anderen im Dorf unterscheidet. Die übrigen Häuser haben glatte dunkelrote Außenwände und scheinen zu schweben. Sie stehen nämlich auf Pfeilern, sonst würde die Wärme im Inneren das solide Fundament des Permafrostbodens auftauen und alles würde in sich zusammensacken. Unser kleines Haus dagegen sieht aus, als ob es schon im Boden versunken und nur zum Luftholen wieder aufgetaucht wäre, wie eine Art felsiger Wal. Die Wände sind aus grob behauenen Steinen, jeder etwa so groß wie ein Kopf. Die Steine reichen hoch bis zum Holzdach, das aus Schwemmholz gemacht zu sein scheint. Und das ist es wirklich.
Das ist mein Zuhause. Ich wohne hier mit meiner anaanatsiaq – meiner Großmutter. Sie hat ihr ganzes Leben in diesem Haus verbracht. Immer wieder versucht irgendwer, sie zum Umziehen in eins von den Häusern zu überreden, die sie selbst modern nennt, obwohl schon seit weit vor meiner Geburt Familien in solchen modernen Häuser wohnen. Die Leute fürchten, das Haus könnte wegen der fehlenden Pfeiler in den Boden einsinken. Doch bei uns ist es nie so warm wie in den Wohnungen der anderen, da taut nichts auf, schon gar kein Permafrost. Oft kann ich sogar im Haus meinen Atem sehen. Aber das macht nichts, ich bin an Kälte gewöhnt. Und zumindest auf dem erhöhten Schlafplatz hinten ist es immer angenehm kuschlig, das hilft.
Ich beuge mich vor, um die Haustür zu öffnen – auch sie ist aus Schwemmholz. Der Eingang ist so niedrig, dass er gerade mal für einen Hobbit reichen würde, was bis vor einer Weile vollkommen in Ordnung für mich war. Aber inzwischen bin ich offiziell der Größte in meiner Klasse, vielleicht sogar in der ganzen Schule, daher stoße ich mir beim Eingang mindestens einmal am Tag den Kopf.
Drinnen sitzt Großmutter auf ihrem Stuhl und näht. Auf ihren Knien liegt eine Lage Robbenfell, an deren Rand bunte Stickereien leuchten. Sie hebt den Kopf und schaut mich lächelnd an.
»Willkommen daheim«, sagt sie, als wäre ich tagelang weg gewesen.
Ich werfe meine Tasche auf den Boden und setze mich auf den Stuhl ihr gegenüber. Mir ist unbegreiflich, wie sie für diese Arbeit überhaupt genug sehen kann. Durch das Fenster hinter ihr dringen nur schwache Sonnenstrahlen. Als ich das Licht anschalte, seufzt sie leise. Sie mag kein elektrisches Licht. Sie hat erst vor wenigen Jahren aufgehört, ihre Robbentranlampe zu benutzen. Ich hatte damals einen hartnäckigen Husten, der einfach nicht besser werden wollte, und am Ende hat der Arzt dann gesagt, die Lampe müsste weg. Das Ding hat sowieso nur die Wände verrußt.
»Wie war die Schule?« Sie redet in der Sprache unserer Vorfahren mit mir. Sie kann sehr wohl Englisch, aber es strengt sie zu sehr an, die seltsamen Geräusche zu machen, aus denen das Englische besteht. Die alte Sprache wird hinten in der Kehle gebildet, und die Laute sind kürzer und präziser, ganz anders als die englischen. Ich liebe den Rhythmus ihres Redens, er ist so stetig und ruhig.
»Ganz okay. Ich hab ziemlich viel auf über die Ferien, und die Naturwissenschaftsarbeit soll eigentlich auch fertigwerden. Keine Ahnung, ob sich außer mir noch irgendwer darum schert.«
Großmutter schweigt. Sie legt die Hände auf das Robbenfell und sieht mich an. Sie redet immer erst, wenn sie alles durchdacht hat. Nie würde sie direkt mit etwas herausplatzen, aus Wut oder warum auch immer. Gespräche mit ihr gehen daher oft schleppend voran. Es ist schon vorgekommen, dass ich mich gefragt habe, ob sie eingeschlafen ist, doch sie hat dann jedes Mal wieder ruhig und sorgfältig zu reden begonnen.
»Was willst du zum Spaß in den Ferien machen?«, fragt sie schließlich.
»Weiß ich nicht. Ich denk drüber nach, wenn die Arbeit fertig ist. Vielleicht kann ich mit Sami Tischtennis spielen. Oder ein bisschen Hockey.«
Sie betrachtet mich. Schaut hinter das, was ich gesagt habe, mustert mein Gesicht. Sie kann mir direkt in den Kopf gucken, das schwöre ich.
Vielleicht ist es an der Zeit, ihr zu sagen, was ich wirklich will. Ich habe das Gefühl, sie weiß es sowieso. Die Idee schwirrt mir schon seit Monaten im Kopf herum. Und je mehr ich an etwas denke, desto stürmischer wollen die Worte aus mir heraus. Da bin ich ganz das Gegenteil von Großmutter.
»Wenn das Wetter gut ist, könnte ich vielleicht hoch in den Norden zur Hütte.«
Wieder seufzt Großmutter leise.
Aber ich kann mich nicht mehr bremsen.
»Ich will den Schlitten nehmen. Petur meint, ich kann mir zwei Hunde von ihm leihen. Du findest es doch so wichtig, die alten Traditionen am Leben zu erhalten.«
»Die Traditionen lernen ist eine Sache. Den Schlitten nehmen, weil wir kein Schneemobil haben, ist eine andere. Du bist zu jung, du kannst nicht alleine losziehen. Erst recht nicht mit Hunden, die dir nicht gehören.«
Meine Schultern sacken zusammen. Großmutters Art, Dinge zu formulieren, macht es schwer, ihr zu widersprechen. Ich versuche es anders.
»Ich will ein bisschen Robbenfleisch mitbringen. Für den Gemeinschaftsladen. Die haben da unten nicht mehr viel, das weiß ich.«
Nach einer Weile sagt sie: »In meiner Jugend gingen die Jungen mit auf die Robbenjagd, sobald sie auf dem Meereis laufen konnten. Durch Zuschauen haben sie gelernt, wie man eine Kolonie aufspürt und das Atemloch findet. Wie man die Harpune wirft. Es hat Jahre gedauert, bis sie alles beherrscht haben. Dann erst waren sie bereit, alleine zu jagen.«
»Aber ich bin doch schon so oft mit Petur draußen gewesen. Er hat mir jahrelang alles beigebracht. Und er findet, ich bin ein begabter Jäger.«
Großmutter starrt mich lange an. »Du kannst nicht alleine gehen«, verkündet sie. Das ist ihr letztes Wort. Das sagt sie nicht ausdrücklich, aber es ist auch so klar genug.
Ich nehme meine Schultasche und ziehe mich nach hinten zurück. »Ich les dann mal ein bisschen«, rufe ich.
Ich lege mich aufs Bett und starre an die Decke aus dicht an dicht zusammengefügten Holzstücken. Auch die Wände sind mit diesem honigfarbenen Holz verkleidet. Jedes ist anders gemasert. Manche haben knorrige Wirbel oder sanft geschwungene Linien. Ich kenne sie alle. Die Bettdecke unter mir ist aus Karibufell, Großmutter hat sie genäht. Leute kommen aus weit entfernten Dörfern hierher, um ihre Sachen zu kaufen. Alle achten Großmutter, nicht nur weil sie eine der Ältesten im Dorf ist, sondern auch weil sie so schöne Dinge macht, mit den alten Handwerkstechniken, die sonst immer mehr in Vergessenheit geraten. Auch dafür, dass sie mich großzieht, wird sie von allen geachtet.
Großmutter sorgt jetzt schon seit sieben Jahren für mich, obwohl sie kaum genug einnimmt, um das Öl für den Herd zu bezahlen. Vielleicht macht es mir deshalb so viel aus, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben. Aber sie scheint einfach nicht zu begreifen, dass ich kein kleiner Junge mehr bin. Ich bin vierzehn. Ich kann nicht bis in alle Ewigkeit in diesem eisigen Dorf bleiben. Einerseits will sie, dass ich die alten Traditionen lerne, andererseits lässt sie mich nicht alleine losziehen und dieses Leben wirklich ausprobieren. Ihr missfällt, dass wir auf den Gemeinschaftsladen angewiesen sind, aber sie lässt mich auch nicht jagen gehen. Es zieht uns mehr und mehr in unterschiedliche Richtungen, und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann.
Verlassen kann ich mich nur auf eines. Es ist Freitag, also gibt es Lachsforelle zum Abendessen. Schon wieder.
BEE
Ich gehe durch das Schultor. Mir ist flau im Magen. Dabei dachte ich wirklich, ich hätte dieses Gefühl hinter mir, noch eine neue Schule mehr könnte mir nichts anhaben. Das hier ist die Fünfte in fünf Jahren: neue Schule, neue Stadt, neues Land. Nur ich bin gleich. Mit gesenktem Kopf gehe ich zum Haupteingang. Mum wollte mich begleiten, aber dann wüsste nicht nur meine Klasse, sondern gleich die ganze Schule, dass ich die Neue bin und heute mein erster Tag ist. Ich drücke die Tür auf und steuere den Empfang an. Eine Frau mit Brille und glatten braunen Haaren schaut von den Unterlagen auf, mit denen sie beschäftigt ist. Erst gleitet ein Hauch von Verwunderung über ihr Gesicht, dann nimmt sie meine nagelneue Schuluniform und meine wohl ziemlich angespannte Miene wahr und fragt: »Ist heute dein erster Tag?«
Das hat sie aber schnell kapiert.
»Ja. Ich soll in die Klasse von Miss Stewart. Jahrgang 9.«
Sie schenkt mir ein strahlendes Lächeln. »Du weißt gut Bescheid.« Dann meint sie, ich soll einen Augenblick warten.
An der Wand stehen drei graue Stühle. Ich setze mich auf den, der am weitesten von der Tür weg ist. Der mittlere Platz taugt nichts, da kann es zu leicht passieren, dass du zwischen Leuten eingeklemmt wirst, mit denen du nicht reden willst. Am Rand hast du höchstens eine Person neben dir.
Die Schulglocke läutet. Sekunden später wird die Tür aufgerissen und ein Haufen junger Leute platzt herein, alle lachen und reden durcheinander. Ein paar starren mich an, vor allem die Mädchen. Niemand lächelt.
Fünf Minuten später holt mich jemand ab. Mein »Buddy«, wie die das hier nennen: ein Mädchen mit einem Pixie-Schnitt. Solche Haare sehen nur gut aus, wenn du hohe Wangenknochen hast, aber die hat sie. Erst redet sie mit der Frau am Empfang, dann dreht sie sich zu mir um. Eins ist auf den ersten Blick klar: Sie will nicht mein Buddy sein.
»Ich heiße Stella«, erklärt sie, während sie in einem solchen Tempo durch die Schulkorridore läuft, dass ich keine Chance habe, mir den Weg zu merken. »Das ist Italienisch und bedeutet Stern.«
»Da quale galassia sei?«
»Was?«, faucht sie.
»Ich hab bloß gesagt, das ist schön. Auf Italienisch.«
Sie schießt einen Blick auf mich ab, der mir klarmacht, dass ich besser den Mund halte, solange sie mich nicht anspricht. Und auf gar keinen Fall soll ich Italienisch reden.
»Ich heiße Beatrice«, sage ich. »Das ist Lateinisch und bedeutet Glücksbringerin. Meistens werde ich Bee genannt.«
»Ich bin Schulpräfektin und Klassensprecherin«, verkündet sie, als wäre damit alles gesagt. »Falls dir in deiner ersten Woche irgendwas unklar ist, bin ich deine Ansprechpartnerin.«
Auf halber Höhe des Korridors bleibt sie auf einmal stehen, klopft an eine Klassenzimmertür und schiebt mich vor sich nach drinnen, sodass alle Blicke auf mir landen. Dreißig Augenpaare mustern mich, neugierig und laserscharf.
»Willkommen, Beatrice«, sagt die Lehrerin mit einem warmen Lächeln. »Ich bin Miss Stewart. Setz dich schon mal auf einen freien Platz, ich bin gleich bei dir und gebe dir deinen Stundenplan.«
Ich schaue mich nach einem freien Stuhl um. Es gibt einen hinten an der Wand und einen ganz vorne. Ich nehme den in der ersten Reihe, neben einem Mädchen mit langen braunen Haaren.
Kaum dass ich mich hingesetzt habe, flüstert sie: »Da sitzt Jessica.« Ich drehe den Kopf und schaue sie verwirrt an. »Die ist heute krank. Morgen musst du dir einen anderen Platz suchen.«
»Ich bin Bee«, sage ich. »Ist mit dir alles okay? Du siehst ein bisschen blass aus. Vielleicht hast du das Gleiche erwischt wie Jessica.«
Das Mädchen mit den langen braunen Haaren betrachtet mich stirnrunzelnd. Dann öffnet sie ihr Mäppchen und dreht es vorsichtig hin und her. Ein kleiner Spiegel fängt Licht ein, während sie so tut, als ob sie bloß nach einem Stift sucht.
Kurz darauf folge ich Stella, dem Stern, zu den ersten beiden echten Unterrichtsstunden. Unterwegs zeigt sie mir die Toiletten und Schließfächer.
In der Mittagspause führt sie mich widerwillig zur Cafeteria. Ich habe einen Riesenhunger. Mein Magen muss sich erst noch an die neue Zeitzone gewöhnen. Normalerweise hätte ich schon vor sechs Stunden zu Mittag gegessen. Also wähle ich das Gericht, bei dem mir die Portion am größten vorkommt, und scanne die Cafeteria auf der Suche nach einem Tisch, an dem niemand sitzt. Freie Stühle und Tische finden ist meine Spezialität. Ganz hinten entdecke ich einen.
Aber bevor ich mich verdrücken kann, bestimmt Stella: »Da lang«, und führt mich an einen Tisch, an dem schon das Mädchen mit den braunen Haaren sitzt – sie heißt Becky, wie ich inzwischen weiß. Drei andere Mädchen kommen dazu. Abwechselnd flüstern sie miteinander oder starren mich an. Ich fange an zu essen. Eine kichert und hört dann abrupt auf, wie um zu zeigen, dass sie sich im Griff hat, auch wenn es ihr wirklich schwerfällt.
Die große Blonde mir gegenüber räuspert sich demonstrativ und sagt: »Du bist also Bee, stimmt’s?«
»Ja«, antworte ich mit vollem Mund. Gut, dass es erst mal um die einfachen Fragen geht.
»Und Bee, das bedeutet … na ja, Bee heißt halt Biene, so wie das Insekt, was?« Wieder dieses unterdrückte Kichern. Der Stern schweigt.
»Das steht für Beatrice. Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Glücksbringerin.« Ich fixiere die Blonde und schaufele mir weiter Essen in den Mund. Je schneller ich fertig bin, desto besser. Das hier sollte nicht länger dauern als unbedingt nötig.
»Aha«, sagt sie und tut so, als fände sie das interessant. »Und wo kommst du her, dass du Lateinisch sprichst?«
»Latein ist eine tote Sprache«, erkläre ich. »Die spricht überhaupt keiner.«
Das haut die Blonde um.
»Wie traurig«, sagt sie und guckt künstlich betrübt. »Aber egal, jetzt hast du ja uns. Du kannst mit jemandem reden und bist nicht mehr allein.«
Ich schlucke den letzten Bissen runter. »Danke«, sage ich und schiebe meinen Stuhl zurück. »Dann sollte ich mich wohl revanchieren und dir sagen, dass vorhin jemand genau auf den Salat geniest hat.«
Die Blonde schaut auf ihren Salatteller, den sie eben zu essen begonnen hat.
Als ich aufstehe und weggehe, kommt vom Tisch hinter mir ein leises Summen. Es wird schnell so laut, dass sich andere Leute umdrehen. Wieder wird gekichert.
Nach der vierten Stunde bin ich vollkommen erledigt. Die Aussicht, mich immer weiter höflich darüber zu unterhalten, warum ich mitten im Jahr die Schule wechsele, macht mich fertig. Also treffe ich die kühne Entscheidung, vor Stella, dem Stern, zu flüchten und mich unbemerkt abzusetzen. Ich finde sogar alleine den Weg zu den Schließfächern. Meins ist ganz unten, was nervig ist, denn wenn man am Boden kauert und es öffnen will, rennen einen die Leute halb um. Ich fummele am Schloss herum, kriege in dem Gewimmel aber den Schlüssel nicht rein, also gebe ich mich geschlagen. Ich schiebe ihn zurück in die Tasche und reihe ich mich in den Strom von Schülerinnen und Schülern ein, die alle auf dem Weg zum Ausgang sind.
Als ich durch die offene Eingangstür nach draußen trete, fröstele ich. Trotz des Frühlings ist es furchtbar kalt. Genau als ich denke, der Tag könnte nicht schlimmer werden, sehe ich Mum. Sie wartet im Auto auf mich, fast direkt vor dem Schultor. Sie lässt das Fenster runter und winkt mir zu, mit knallrot lackierten Fingernägeln. Egal in welches Land wir ziehen – bevor Mum rausfindet, wo es Lebensmittel gibt, sucht sie erst mal ein Nagelstudio.
»Hallo, Bee, Liebling«, ruft sie durchs offene Fenster.
Zum Glück ist keiner aus meiner Klasse nah genug, um das Spektakel mitzukriegen. Ich sinke auf den Beifahrersitz und lasse meine Tasche in den Fußraum fallen.
»War der erste Tag okay?«, fragt Mum beim Losfahren.
»Ganz in Ordnung«, lüge ich.
»Ich wusste, dass dir diese Schule gefallen wird. Sie hat einen erstklassigen Ruf«, sagt sie. Als ich nicht reagiere, fügt sie hinzu: »Hast du dich denn mit irgendwem angefreundet?«
»Nicht wirklich.«
»Dir ist schon klar, dass du dich bemühen musst, wenn du neue Freundinnen finden willst. Ohne Einsatz geht das nicht.«
Am liebsten würde ich antworten: Sobald ich neue Freundinnen gefunden habe, ziehen wir doch sowieso wieder weg. Aber mir fehlt die Energie.
»Kann schon sein, Mum.«
»Stimm mir nicht einfach zu, Beatrice. Ich will wissen, ob du wirklich hörst, was ich sage. Es geht doch nicht um mich. Ich will eben, dass es für dich ein bisschen leichter wird.«
»Ich muss was für die Schule lesen«, gebe ich zurück und ziehe ein Buch aus der Tasche.
»Hier in der Stadt gibt es ein paar nette Läden. Vielleicht können wir die am Wochenende mal zusammen auskundschaften. Ich hab auch ein total süßes kleines Café entdeckt.«
»Klingt gut«, sage ich, während ich mein Spanischbuch aufschlage. »Tut mir leid, Mum, aber ich hab eine Menge Stoff nachzuholen.«
»Okay, Liebling.« Schularbeiten sind so ziemlich der einzige Grund für Stille, den Mum akzeptiert.
Ich höre den Schlüssel in der Tür und schubse Hester von meinem Schoß. Sie stößt ein schrilles, ärgerliches Miauen aus.
»Hallo«, ruft Dad. »Irgendwer zu Hause?«
Ich renne die Treppen runter und falle ihm um den Hals.
»Wie war dein Tag?«, fragt er.
Ich schaue auf den Boden und merke entsetzt, dass ich Tränen in den Augen habe. »Halbwegs okay«, antworte ich und wische mir mit dem Ärmel über die Augen, während er seinen Mantel aufhängt.
»Na ja«, sagt er. »Bei so viel Begeisterung kann ich schwer mithalten.«
Ich lache, muss gleich darauf aber schniefen. In der Küche klappert Mum mit dem Geschirr fürs Abendessen.
Dad lässt sich auf der Treppe nieder und zieht sich die Schuhe aus. »Mein Erkundungsflugzeug steht bereit, haben die in der Firma gesagt. Ich kann jederzeit zum Flugplatz und einen Testflug machen.« Er schaut mich an. »Sollen wir das am Wochenende tun? Du und ich, wir könnten ein bisschen Zeit in den Wolken gut gebrauchen, wie es aussieht.«
»Ja!« Zum ersten Mal an diesem Tag lächle ich. »Was ist mit Mum?«
»Die will bestimmt nicht, dass ich meinen ersten Flug in einem neuen Flugzeug alleine mache«, sagt er. Ihm ist klar, was ich meine: Die Frage ist nicht, ob Mum auch mitkommen will, sondern ob sie mich lässt.
Dad ist Mum gegenüber die Ruhe und Logik in Person. Logik wäre schon mein Ding, aber das mit der Ruhe nicht. Schon gar nicht, wenn Mum mal wieder anfängt mit dem Gerede, Fliegen sei unnötig riskant und es gebe passendere Beschäftigungen für mich.
Er schlüpft aus dem zweiten Schuh und setzt sich aufrecht hin. »Weißt du, wenn dieser Job vorbei ist, müssen wir nicht mehr umziehen. Die bezahlen mir so viel Geld, dass ich für den Rest meines Lebens auf dem Sofa rumlümmeln und Krimis lesen kann. Und du entscheidest, wo wir uns niederlassen und was wir machen.«
»Jeden Tag Fish and Chips, wie wär’s damit?«
»Wenn du willst. Ich weiß doch, wie schwer dieses ewige Umziehen für dich ist. Das ist jetzt das letzte Mal, versprochen.« Er streckt mir seinen kleinen Finger entgegen.
»So ein Pinky-Promise ist doch albern«, erkläre ich lachend, halte ihm aber trotzdem meinen kleinen Finger hin.
Was man sich auf die Art verspricht, darf man nicht brechen.
YUTU
Am nächsten Morgen stehe ich früh auf. Großmutter werkelt am Herd herum, sie bereitet ihren Lieblingstee zu. Der bittersüße Duft von Moltebeeren erfüllt den Raum. Die Küche ist bei uns nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Wohnen da. Wie fast überall im Haus sind die Wände auch hier mit Holz oder Karibuhäuten ausgekleidet.
»Frühstück«, verkündet Großmutter mit einem Lächeln. Sie reicht mir einen Teller mit einem großen Stück Bannockbrot und in Fett gedünsteten Beeren – süß und cremig.
»Heute will ich zum Lebensmittelladen. Schauen, was die dort haben«, sagt sie.
»Soll ich mitkommen?«, frage ich mit vollem Mund.
Großmutter schmunzelt. »Du bist ein guter Junge, immer hilfsbereit. Aber heute muss das nicht sein. Heute ist dein erster Ferientag.«
Mir ist klar, was sie damit sagen will: Lern heute nichts.
»Petur wartet auf dich, er will endlich anfangen, dir das Knochenschnitzen beizubringen. Damit lässt sich gutes Geld verdienen«, sagt sie. Großmutter bearbeitet mich schon die ganze Zeit, ich soll Knochenschnitzen lernen. Knochenschnitzen oder Trommeln. Trommeln interessiert mich schon, aber ich weiß, das wäre nur der Anfang. Als Nächstes würde Großmutter wollen, dass ich traditionelle Kleidung trage und bei jedem Ritual mittrommele. Da wäre dann sogar Knochenschnitzen noch besser.
»Ich hab heute schon was vor«, erkläre ich.
Großmutter lässt wieder ihr leises Seufzen hören.
Ich gehe zurück in mein Zimmer, schnappe mir meine Schulsachen und nehme mir noch ein Stück Bannockbrot vom Herd.
»Bis später, Großmutter«, sage ich und denke gerade noch rechtzeitig daran, mich zu bücken, bevor ich durch die Tür nach draußen schlüpfe. Dass Großmutter so langsam ist, kommt mir manchmal ganz gelegen.
Ich gehe den Hügel hinunter, vorbei an ein paar vereinzelten Häusern, die oben auf dem Schnee thronen. Der Himmel ist blau, nur ein paar schmale Wolkenstreifen stehen am Horizont. Das Licht der Sonne lässt das Meereis glitzern. Ich steuere auf das große graue Gebäude im Dorfzentrum zu. Die Gemeindebücherei. Dort ist es immer warm und ich kann meinen Laptop mit Gemeinschaftsstrom laden. Bis irgendwer aus meinem Freundeskreis aufsteht, wird es noch Stunden dauern. Ich öffne den Laptop, für den Großmutter ein ganzes Jahr lang gespart hat, und rufe mir in Erinnerung, warum ich das hier überhaupt mache, statt wie die anderen noch in meinem warmen Bett zu liegen. Wenn ich an die Uni will, brauche ich gute Noten. Mehr als das, ich brauche ausgezeichnete Noten. Nur dann kann ich in einer Stadt studieren, irgendwo weit weg, wo man alles Mögliche tun kann und wo es andere Jobs gibt als Knochenschnitzerei. Ich wünsche mir nämlich eine andere Zukunft als die, die Großmutter für mich im Sinn hat.
Drei Stunden später habe ich das mitgenommene Brot aufgegessen und starre gerade aus dem Fenster, als ein Schneeball gegen das Glas knallt, gleich darauf noch einer. Ich stehe auf und spähe nach unten in den Hof. Da draußen ist Sami, mit Jack und Adam im Schlepptau. Er hebt die Hände und zuckt mit den Schultern – geradezu angewidert, kommt mir vor. Anscheinend gibt es an diesem Ort niemanden, der es gut findet, wenn ich lerne. Aber für heute reicht es mir sowieso. Ich stopfe meine Sachen in die Tasche und gehe raus zu meinen Freunden.
»Jetzt mach schon, du Streber. Zeit für was anderes«, ruft Sami, als ich die Treppe runterkomme.
»Wohin gehen wir?«, rufe ich zurück.
»Zu mir«, erklärt Jack. »Ich hab ein neues Spiel. Ist gestern erst gekommen, aber ich bin schon auf dem dritten Level. Weiter kommt keiner.«
»Wetten, Adam schafft das«, sagt Sami.
»Wenn Adam weiß, was gut für ihn ist, kommt er nicht schneller aufs vierte Level als ich«, verkündet Jack, als ginge Adam nicht direkt neben ihm.
Erst nach Sonnenuntergang komme ich zurück nach Hause.
Großmutter blickt von den Fäustlingen auf, an denen sie näht. Während ich meine Stiefel ausziehe, betrachtet sie mich, um zu festzustellen, wie mein Tag gewesen sein mag.
»Gab nur Fisch im Laden«, sagt sie. »Kein Karibu. Und kaum noch Robbenfleisch.« Kurz schließt sie die Augen. Als sie sie wieder aufschlägt, wirkt sie traurig. »Jedes Jahr gibt es weniger Karibus für die Jagd. Dabei hatten wir immer genug.«
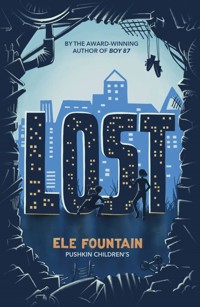
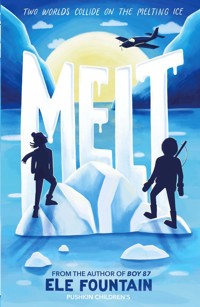
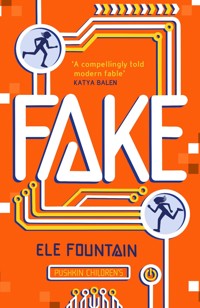


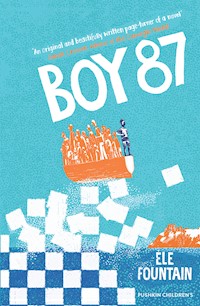













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









