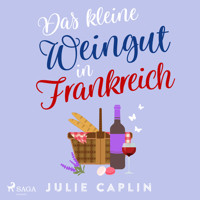36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Multimedia, Internet, neue Technologien, Note: 1,5, Universität Siegen (Fachbereich 3 - Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Vor dem Hintergrund von sich stetig verändernden medialen Bedingungen, wird in dieser Arbeit das Unterhaltungserleben bei aktuellen Computerspielen untersucht. Ausgegangen wird von der Annahme, dass Computerspielen, und hier in erster Linie den immer populärer werdenden Online-Spielen, Auswirkungen auf das Verhältnis von unterhaltsamer Mediennutzung und der Identitätsentwicklung der Mitglieder einer Kultur zugesprochen werden können. Jenseits des öffentlichen Diskurses soll deshalb ein Beitrag für die Wahrnehmung von Computerspielen als Kulturtechnik geleistet werden, die sich nicht mit Dichotomien von gut oder schlecht, nützlich oder schädlich beschreiben lässt. Um das Feld des Interessengebietes abzustecken, wird in der vorliegenden Arbeit nicht eine Unterteilung in bestimmte Genres vorgenommen, sondern der Fokus wird zunächst auf die Unterschiede zwischen Offline-Spielen und den Massively-Multiplayer-Online-Role-Playing-Games (MMORPGs) gelegt, aus denen sich vermutlich jeweils eigene Erlebnisstrukturen ergeben. Es werden demnach unterschiedliche Gratifikationen durch Offline- und Online-Spiele angenommen, die mit Hilfe von medienpsychologischen Erkenntnissen und Theorien identifiziert werden sollen. Eine Einteilung der Spiele, die sich insbesondere an der Eigenschaft Online oder Offline-Spiel orientiert, ist für die Zwecke dieser Arbeit auch insofern dienlich, als dass für Online-Spiele die Annahme einer Art institutionellen Funktion besteht. In diesem Zusammenhang wird am Beispiel von World of Warcraft gezeigt, dass durch eine unterhaltsame Mediennutzung in Kombination mit computervermittelter Kommunikation das Verhältnis von Unterhaltungssituation und Alltagswirklichkeit verschwimmen kann. Es geht hier also um Erfahrungsräume, die über die Spielsituation hinaus für die Nutzer von Bedeutung sind. Um zu dieser vermuteten Verflüchtigung von Grenzen fundierte Aussagen treffen zu können, bedarf es in einem ersten Schritt sowohl einer Erläuterung der Perspektive, aus der der Gegenstand Computerspiel betrachtet wird, als auch einer theoretischen Aufarbeitung der verwendeten Begriffe Spiel und Unterhaltungserleben. In einem zweiten Schritt werden diese Begriffe auf aktuelle Computerspiele bezogen. Hieran schließt sich in einem dritten Schritt eine detaillierte Betrachtung des MMORPG World of Warcraft an aus der seine kulturelle Funktion abgeleitet wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Unterhaltungserleben und kulturelle Funktion virtueller Spielwelten am Beispiel von „World of Warcraft“
Abschlussarbeit zur Erlangung des akademischen Grades eines Diplom-Medienwirtes. Vorgelegt dem Fachbereich 3 Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften im Diplomstudiengang
Student:
Page 1
„Computerspiele als bloße Unterhaltung oder kulturelles
Verfallssymptom abzutun, unterschlägt ihre Position in einem
größeren Gefüge der Genese und Geltung informatisierter
Gesellschaften.“ (Pias 2008a, 2)
1. Einleitung
In der Geschichte des Mediensystems kommt es immer dann zu nicht wertneutralen Diskussionen, wenn ein neues Medium in die Gruppe jeweils herrschender Medien eintritt (vgl. Leschke 2003, 145). Kritiker und Befürworter eines neuen Mediums stehen sich oft unversöhnlich gegenüber und der öffentliche Diskurs entfaltet sich überwiegend an den Annahmen von schädlichen Auswirkungen, die das neue Medium jeweils mit sich bringen könnte. Eine Kontinuität, die sich von der Entstehung von Schriftlichkeit, über den Buchdruck, die Fotografie, den Film bis hin zur Einführung des relativ neuen Mediums Computer beobachten lässt und sich hauptsächlich aus mangelnden Erkenntnissen über Formen und Potenziale des jeweils neuen Mediums speist. Der Computer, betrachtet als die „universelle Maschine“ (Schröter, 2002), die in der Lage ist prinzipiell alle anderen Medien und deren Inhalte zu simulieren, nimmt seit seinem Heraustreten aus militärischen Kontexten (vgl. Pias 2002) auch das Spiel als eine Grundkonstante menschlichen Daseins in Beschlag. Die „universelle Maschine“ etabliert sich zunehmend auch als neues Unterhaltungsmedium einer mediatisierten Gesellschaft. Der stetig wachsende ökonomische Erfolg
von Computerspielen1seit ihrer ersten kommerziellen Verwertung in den 1970er Jahren, ist in diesem Zusammenhang ein direkt beobachtbarer Beweis für ihre Etablierung als massenattraktives Unterhaltungsangebot. Vor dem Hintergrund von sich stetig verändernden medialen Bedingungen, wird in dieser Arbeit das Unterhaltungserleben bei aktuellen
1Eine historisch präzise Differenzierung zwischen Videospielen, Telespielen und
Computerspielen wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen. Prinzipiell haben all diese
Spiele einen Computer (eine Rechenmaschine) als Basis und unterscheiden sich lediglich in
der äußeren Erscheinungsform des Apparates mit dessen Hilfe sie gespielt werden. Dieser
Umstand legitimiert die generelle Bezeichnung als „Computerspiele“ (vgl.
Mertens/Meißner 2002, 7f).
Page 2
Computerspielen untersucht. Ausgegangen wird von der Annahme, dass Computerspielen, und hier in erster Linie den immer populärer werdenden Online-Spielen, Auswirkungen auf das Verhältnis von unterhaltsamer Mediennutzung und der Identitätsentwicklung der Mitglieder einer Kultur zugesprochen werden können2. Diese Annahme wird im Folgenden theoretisch präzisiert und auf ihren Gehalt hin überprüft werden. Die Berechtigung für eine solche Betrachtungsweise ergibt sich zum einen aus dem wissenschaftlichen Konsens, dass „Medienals Instrumente der Wirklichkeitserzeugungund damit als Mittel der menschlichen Selbsterfahrung“ fungieren (Hartmann 2003, 54). Desweiteren lässt sich beobachten, dass sich Computerspiele in ihrer relativ kurzen Geschichte zunehmend ausdifferenzieren und infolgedessen vermutlich unterschiedliche Funktionen für ihre Nutzer, für Kultur und Gesellschaft erfüllen. Spiele für
und das Spielen mit dem Computer zunächstauf universitärer, später auch auf privater Ebene könnenzum Beispiel als eine der Triebfedern der massenhaften Verbreitung von Personalcomputern seit den 1970er Jahren gesehen werden, weshalb Spiel, Technik und Kultur in einer engen Beziehung zueinander stehen (vgl. z.B. Pias 2002, Poser 2003, Krotz 2007, Mertens et al. 2008).
Jenseits des aktuellen öffentlichen Diskurses, der sich primär mit den
Gefahren der neuen Unterhaltungsangebote auseinandersetzt3, soll deshalb ein Beitrag für die Wahrnehmung von Computerspielen als Kulturtechnik geleistet werden, die sich nicht mit Dichotomien von gut oder schlecht, nützlich oder schädlich beschreiben lässt. Computerspiele sind aufgrund ihrer Präsenz im Mediensystem ein Phänomen, dem nicht mit
2Ähnliche Vermutungen äußert zum Beispiel Kiefer (2007), indem er unter
Berücksichtigung der Individualisierungsthese Auswirkungen von Computerspielen auf die
Bildung menschlicher Identität postuliert. Er zitiert Luhmann: „Die Kunstform des Romans
und daraus abgeleitete Formen der spannenden Unterhaltung rechnen mit Individuen, die
ihre Identität nicht mehr aus ihrer Herkunft beziehen sondern sie selber gestalten müssen.
[…] Es liegt dann verführerisch nahe, virtuelle Realitäten an sich selbst auszuprobieren -zumindest in einer Imagination die man jederzeit abbrechen kann.“ (Luhmann 1996 zit.
nach Kiefer 2007, 209) Online-Computerspiele integrieren laut Kiefer somit
Selbstbeobachtung und die Gestaltung der eigenen Individualität ins Spiel (vgl. ebd. 2007,
211).
3Zur Diskussion bezüglich der negativen Auswirkungen von Computerspielen vgl. z.B.
http://www.planet-interview.de/jeffrey-wimmer-03072008.html, verifiziert am 30.7.2009.
Page 3
bewahrpädagogischen und kulturpessimistischen Argumenten begegnet werden kann. Es müssen daher Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche Bedeutung Computerspielen in ihren unterschiedlichen Kontexten in unserer Medien-Kultur mittlerweile beizumessen ist und wie sich unterhaltsame Mediennutzung durch persistente virtuelle Welten und virtuelle Gemeinschaften verändert.
Um das Feld des Interessengebietes abzustecken, wird in der vorliegenden Arbeit nicht eine Unterteilung in bestimmte Genres vorgenommen, sondern der Fokus wird zunächst auf die Unterschiede zwischen Offline-Spielen und den Massively-Multiplayer-Online-Role-Playing-Games (MMORPGs) gelegt, aus denen sich vermutlich jeweils eigene Erlebnisstrukturen ergeben. Es werden demnach unterschiedliche Gratifikationen durch Offline- und Online-Spiele angenommen, die mit Hilfe von medienpsychologischen Erkenntnissen und Theorien identifiziert werden sollen. Allerdings zeichnen sich die hier behandelten Computerspiele durch mehrere gemeinsame
formale Eigenschaften aus, die ihre Massenattraktivität ausmachen4: Es sind aktuelle Computerspiele der letzten Dekade mit avatar-basierter Handlungsführung, einem semi-subjektiven Point of View (vgl. Neitzel 2007, 8ff) und fiktionalen narrativen Elementen, welche sich aus kulturellen Wissensbeständen5der westlichen Welt bedienen6, um eine Rahmenhandlung zu konstruieren.
Eine Einteilung der Spiele, die sich insbesondere an der Eigenschaft Online oder Offline-Spiel orientiert, ist für die Zwecke dieser Arbeit auch insofern dienlich, als dass für Online-Spiele die Annahme einer Art institutionellen Funktion besteht. In diesem Zusammenhang wird am Beispiel vonWorld of
4Die Spiele die in den aktuellen Charts die oberen Plätze belegen, entsprechen den im Text
genannten Kriterien. Vgl. http://www.gamestar.de/index.cfm?pid=945. Stand: 30.07.2009
(Hier vor allem die Charts der Spiele, die aktuell tatsächlich gespielt werden).
5Zu den Wechselbeziehungen zwischen Spielfilmen und Computerspielen vgl. z.B. Nohr
2008. King/Krzywinska 2002.
6In Anlehnung an Rolf F. Nohr werden in dieser Arbeit abstrakte Spielvarianten (z.B.
Tetris, 2D Jump’n’Run, Sportspiele etc.) explizit ausgeklammert. Es geht um
Computerspiele, die sich „eng ans filmische Gestaltungspotenzial anlehnen“ (Nohr 2008,
158).
Page 4
Warcraft7gezeigt, dass durch eine unterhaltsame Mediennutzung in Kombination mit computervermittelter Kommunikation das Verhältnis von Unterhaltungssituation und Alltagswirklichkeit verschwimmen kann. Es geht hier also um Erfahrungsräume, die über die Spielsituation hinaus für die Nutzer von Bedeutung sind. Sybille Krämer bemerkt in diesem Zusammenhang:
Um zu dieser vermuteten Verflüchtigung von Grenzen fundierte Aussagen treffen zu können, bedarf es in einem ersten Schritt sowohl einer Erläuterung der Perspektive, aus der der Gegenstand Computerspiel betrachtet wird, als auch einer theoretischen Aufarbeitung der verwendeten BegriffeSpielundUnterhaltungserleben.In einem zweiten Schritt werden diese Begriffe auf aktuelle Computerspiele bezogen. Der formale Begriff des Spiels wird über die kulturanthropologischen Definitionen von Johan Huizinga und Roger Caillois erarbeitet, um Gemeinsamkeiten zwischen Spiel und Unterhaltung durch Medien identifizieren zu können. Der Begriff des Unterhaltungserlebens wird unter Zuhilfenahme dertriadischdynamischen Unterhaltungstheorievon Früh (2002, 2003) erörtert und auf Computerspiele bezogen. Es ist hier also zunächst die Frage zu klären, warum Computerspiele in der aktuellen Medienlandschaft eine besonders attraktive Form der Unterhaltung sind, deren Erforschung hinsichtlich ihrer Funktion als Kulturtechnik eine lohnenswerte Aufgabe darstellt. Hieran schließt sich in einem dritten Schritt eine detaillierte Betrachtung des MMORPGWorld of Warcraftan aus der seine kulturelle Funktion abgeleitet werden soll.
7Das Spiel der Firma Blizzard Entertainment gilt momentan als die Referenz im Bereich
der MMORPGs und hat auch in der Forschung über diesen Bereich der
Computerspielkultur bereits Beachtung gefunden (vgl. z.B. Cypra 2005, Ducheneaut et al.
2006, Chen 2009). Zudem ist es aufgrund seiner komplexen Welt und einer durch
Medienberichterstattung entstandenen Öffentlichkeit besonders geeignet, das
Unterhaltungsangebot MMORPG zu untersuchen.
Page 5
2. Computerspiele aus kulturwissenschaftlicher PerspektiveMedien und ihre Produkte befinden sich in einem stetigen Wandel hinsichtlich ihrer technologischen Entwicklung, ihrer Darstellungsformen und ihrer Funktionen für die Menschen, die sie benutzen. Massenmedien wie das Fernsehen werden als Kulturtechniken verstanden, da es sich hier um Medien handelt, durch deren Nutzung Menschen subjektive
Wirklichkeit konstruieren, durch die Öffentlichkeit hergestellt wird und mit deren Hilfe gesellschaftliche Normen und Werte ausgehandelt werden (vgl. Schmidt 1996, Leschke 2003). Medien erfüllen demnach mehrere Funktionen für und innerhalb von Kulturen. Dabei ist der Einfluss einzelner Medien in unterschiedlichen Kulturkreisen auch unterschiedlich zu bewerten, was sich mit ordnungspolitischen Einflüssen, wie etwa staatliche Beschränkungen zum Zugang zu Medien oder Medienangeboten, als auch historisch gewachsenen Konventionen im Umgang mit Medien erklären lässt. Kulturübergreifend ist jedoch zu beobachten, dass durch die Digitalisierung und die Ausbreitung des Integrationsmediums Internet der Einfluss medial vermittelter Kommunikation auf die Konstitution von Kulturen stark zugenommen hat (vgl. z.B. Castells 2003). Folglich kann davon ausgegangen werden, dass kulturelle Praktiken und
Lebenswirklichkeiten mittlerweile umfassend in mediale Bedingungen eingebettet sind (vgl. Karpenstein-Eßbach 2004, 7ff). Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Frage nach neuen kulturellen Praktiken, die durch digitale Medien und Medienangebote entstehen und Einfluss auf die Wirklichkeitskonstruktionen der Menschen nehmen. Für eine Betrachtung der kulturellen Funktion von relativ neuen massenattraktiven Medienangeboten, wie sie in Form von Computerspielen zur Zeit große Beachtung finden, macht es daher auch Sinn, eine interdisziplinäre Perspektive einzunehmen. Desweiteren gibt die für das Vorhaben dieser Arbeit relevante Verknüpfung von digitaler Technik und einer kulturanthropologischen Konstante in Form des Spiels einen Hinweis darauf, dass Technologie zwar nicht alsdieDeterminante der Entwicklung
Page 6
menschlicher Kultur zu verstehen ist, dass aber Technologie maßgeblich an den aktuellen Veränderungen von Kultur beteiligt ist. Computerspiele als Medien aus einer kultur-wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten ist demnach notwendig, um sie als „Ermöglichungen und Bestimmungs-faktoren kultureller Praxen“ zu identifizieren und „ihre Relevanz für die Formierung von Kulturen“ zu erkennen (Karpenstein-Eßbach 2004, 8). Hierzu bietet sich ein Zugang an, der Erkenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen zu integrieren versucht und von einem weit gefassten Kulturbegriff ausgeht (vgl. z.B. Hejl 1998, 297ff). Kultur ist hiernach als ein Orientierungssystem einer Gesellschaft aufzufassen, welches aus spezifischen Symbolen gebildet und tradiert wird. Die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft definiert sich über dieses Orientierungssystem, welches das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller ihrer Mitglieder beeinflusst (vgl. Thomas 2003, 436). Kultur lässt sich nach dieser Vorstellung „nicht als ModellvonVerhalten, sondern als ModellfürVerhalten sehen“ (Schmidt 1992, 427).
Aus einer historischen Perspektive bildet die „Technologisierung des Wortes“ (Ong 1987) in Form der Schrift eine entscheidende Symbolisierungsleistung im Zusammenhang mit zwischenmenschlicher Kommunikation und damit einen Grundpfeiler des Orientierungssystems ‚Kultur‘. Die Technologie des Schreibens bezeichnet Ong als eine Erfindung, die das menschliche Bewusstsein mehr als jede andere Erfindung verändert hat (vgl. ebd., 83ff). Der Übergang von der oralen Gesellschaft zu einer durch schriftliche Kommunikation geprägten Gesellschaft, ist somit als ein historischer Schub im Prozess der Mediatisierung von Kommunikation zu konzeptualisieren und Schrift ist auch integraler Bestandteil der Technologie, auf der computervermittelte Kommunikation heute basiert (vgl. Krotz 2007. Castells 2003, 375). Für die Erzeugung und Speicherung kultureller Wissensbestände auf der Basis von Schriftlichkeit, ist ferner die technische Reproduzierbarkeit von schriftlicher Information durch den Buchdruck verantwortlich. Durch die Zusammenfassung verschiedener Umgangssprachen zu mechanisch reproduzierbaren und
Page 7
damit kapitalistisch verwertbaren Schriftsprachen, kommt dem Buchdruck seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert eine gemeinschaftsbildende Funktion zu (vgl. Anderson 1998, 50ff). Die Folge war eine Bildungsexplosion in Europa und die Loslösung von der Religion als Basis von Gesellschaft (vgl. Brooks 1984, 6ff). Die historische Bedeutung von Technologie für die dynamische Entwicklung einer Gesellschaft, in der auf den Konventionen schriftlicher Kommunikation basierende computervermittelte Kommunikation heute stattfindet, steht also vor allem im Zusammenhang mit einer wachsenden Selbstbestimmtheit der Mitglieder eines Kulturkreises. Für Helmut Schanze ist folglich die Druckerpresse auch das Werkzeug „an dem der geheime und freie Gedanke, die Kopfgeburt, jene Materialität gewinnt, die den modernen Begriff des freien Wortes, der freien öffentlichen Meinung, der Freiheit schlechthin zur Geltung kommen lässt“ (ebd. 2001, 400). Der Buchdruck kann somit als Basistechnologie verstanden werden, die „die Kopfgeburt(en)“, denen wir heute in Form der virtuellen Welten der Computerspiele begegnen, überhaupt erst denkbar macht. Auch wenn der narrative Rahmen von Computerspielen noch nicht an die Komplexität von Literatur und Film heranreicht, entwickeln aktuelle Computerspiele doch zunehmend komplexere Formen der Narration und bedienen sich dabei am Repertoire anderer massenattraktiver Medienangebote (vgl. Sorg/Eichhorn 2005). Als ein Beispiel für eine literarische Vorlage, auf deren Narration nahezu der gesamte Kosmos mythisch-fantastischer Rollenspiele basiert, müssen die Werke von J.R.R. Tolkien genannt werden (vgl. Weinreich 2007, 102ff). Vom ersten Pen-and-Paper-RollenspielDungeons&Dragons,über dieMulti User Domains(MUDs), bis hin zuWorld of Warcraft,bildet die von John Ronald Reuel Tolkien erdachte Welt eine der Grundlagen der kulturellen Wissensbestände der Fantasy-Rollenspieler (vgl. Grassmuck 1995, 50). Insofern bildet auch hier die Literatur, und so letztlich die Schrift, die Basis des Medienproduktes Computerspiel. Folgt man bei einer Betrachtung der Entwicklung von Medienkultur der Mediengeschichte von Gutenberg bis heute, so stellt man zusätzlich fest, dass die Abstände, in denen sich neue Medien etablieren, immer kürzer
Page 8
werden. Seit der Erfindung des Buchdruckes ist die Ausdifferenzierung des Mediensystems immer schneller vonstatten gegangen und hat ihren vorläufigen Höhepunkt in einem potenziell weltweit vernetzten, multifunktionalen Informationspool erreicht, der in wesentlichen Teilen auf der sich stetig fortentwickelnden Computertechnik basiert (vgl. Weischenberg/Hienzsch 1994, 470 ff). Diesen historischen
Entwicklungsprozess, bezeichnet Friedrich Krotz mit dem Oberbegriff „Mediatisierung kommunikativen Handelns“ (ebd. 2001). Ähnliche Begriffe finden sich zum Beispiel bei Castells (2003), der den Terminus der „Informationsgesellschaft“ im Zusammenhang mit der Globalisierung verwendet. Marshall McLuhan (1962) prägte den Begriff des „Global Village“, der sich prospektiv auf die raum-zeitliche Komprimierung der Welt durch untereinander vernetzte Medien bezieht und damit einhergehende gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen postuliert (vgl. de Kerckhove 2008, 9ff). Postmoderne Theoretiker wie Flusser, Virilio oder Lischka bemühen sich schließlich darum, neue Begrifflichkeiten zu entwickeln, die den Entwicklungen des Mediensystems und der angeschlossenen Gesellschaft gerecht werden sollen (vgl. Weber 2003, 32f). Gemein ist allen begrifflichen Konstrukten zum einen die Tatsache, dass in unserer westlichen Gesellschaft den Medien und den durch sie vermittelten Informationen eine immer stärkere Bedeutung zugewiesen wird (vgl. Jarren 1998, 74f) und zum anderen der übergeordnete Stellenwert einer Vernetzung, die sich mittlerweile als ein „kulturelles Paradigma“ (Koubek, 2008) etabliert hat. Eine umfassende technologische Vernetzung von Individuen über raum-zeitliche Grenzen hinweg, lässt aus dieser Perspektive die Annahme einer veränderten Identitätsbildung der Menschen angeschlossener Kulturkreise plausibel erscheinen (vgl. Turkle 1998). Unbeeindruckt, wenngleich aber nicht unbeeinflusst durch die technischen Entwicklungen, bildet das Spiel eine historische Konstante für die Bildung menschlicher Identität (vgl. Heidemann 1968, 3ff. Adamowsky 2000, 18ff. Poser/Zachmann 2003, 7ff). Unter dem Einfluss veränderter Kommunikationsbedingungen im Zuge der Digitalisierung, lassen sich
Page 9
Computerspiele daher auch als eine Anpassung des Spiels an die Anforderungen einer vernetzten Gesellschaft konzeptualisieren (vgl. Böhle 2007).
3. Das Spiel - Begriffliche Konturierung
Wenn im Folgenden von Computerspielen und deren kulturellen Funktion die Rede ist, so ist zunächst zu klären, was unter Spiel als einem der zentralen Begriffe dieser Arbeit zu verstehen ist. Dabei kann es nicht um eine Bestimmung eines objektiven und klar abgegrenzten Begriffes gehen, was in Anbetracht der Fülle der Definitionsversuche hier auch nicht zu leisten wäre (vgl. Adamowsky 2000, 22ff). Es werden formale Merkmale des Spiels identifiziert, um sie für die Betrachtung von Computerspielen nutzbar zu machen. Generell kann das Spiel als ein Phänomen verstanden werden, das als ein die menschliche Kultur bestimmendes und im Zeitablauf in seiner Erscheinungsform variierendes Muster menschlichen Handelns permanent in Erscheinung tritt. ÜberdieseFunktion des Spiels besteht weitgehend Einigkeit. So beschreibt Heidemann das Spiel als einen Teil des Lebens „ursprünglich und jedem zugänglich in der Lebenserfahrung, ein Ereignis in der Zeit, beliebig wiederholbar, weiterzugeben in der Tradition oder je neu zu erfinden“ (ebd. 1968, 3). Johan Huizinga sieht im Spiel sogar den Ursprung menschlicher Kultur (ebd. 1956, 7) und ebenso ist für Krotz das Spielen ein Fall sozialen Handelns, durch den sich Kultur und Gesellschaft, soziale Beziehungen und Identität konstituiert (vgl. ebd. 2007, 169).
3.1 Das Spiel bei Huizinga
In seinem kulturanthropologischen WerkHomo Ludensunternimmt Johan Huizinga den vielbeachteten Versuch einer Definition des Spiels, die es als
Page 10
„Kulturerscheinung“ auffasst und nicht als eine „biologische Funktion“ (ebd. 1956, 7). So lässt sich das Spiel auch nicht an bestimmten Tätigkeiten festmachen, sondern steht zunächst generell in Opposition zum zweckge-bundenen Handeln, das mit Begriffen der Rationalität zu beschreiben ist (vgl. ebd., 11ff). Für Huizinga ist Spiel in allererster Linie ein freies Handeln und für einen Menschen eine augenscheinlich nicht notwendige Tätigkeit.
Spiel unterbricht demnach den Prozess der notwendigen Bedürfnisbefriedigung und wird seiner selbst willen ausgeführt, wodurch es auf eine ihm eigene Art Funktionen für menschliches Zusammenleben erfüllt (vgl. ebd., 15f). Die Zweckfreiheit des Spiels betont auch Oerter und stellt das Spiel ebenfalls in Opposition zur rationalen Handlung, die er durch die Begriffskette „Situation - Handlung - Ergebnis - Folge“ kennzeichnet (ebd. 1993, 5). Der Wegfall der Folge einer Handlung ist für Oerter ein dem Spiel eigenes Merkmal, so dass der Zweck des Spiels in sich selbst besteht (vgl. ebd., 6). Aus diesen Befund der vermeintlichen Nutzlosigkeit des Spiels leitet sich das zweite entscheidende Merkmal von Spiel ab: Spiel ist nicht das normale, gewöhnliche Leben. Es ist das Heraustreten aus dem Alltagsleben in eine begrenzte Sphäre eigentümlicher Aktivität (vgl. Huizinga 1956, 15). Oerter beschreibt dies als einen „Wechsel des Realitätsbezuges“, durch den eine neue Realität durch die Spielenden konstruiert wird, die ihren aktuellen Bedürfnissen und Zielsetzungen entspricht. Dennoch tut man bloß so,als obund wird dabei mitunter ganz davon ergriffen, so dass die Grenze zwischen Spiel und Ernst im Spiel verschwimmt (vgl. ebd. 1993, 9).
Als drittes Kennzeichen des Spiels identifiziert Huizinga seine Abgeschlossenheit und Begrenztheit. Räumliche und zeitliche Grenzen
Page 11
bilden seinen Rahmen. „Das Spiel beginnt, und in einem bestimmten Augenblick ist es aus“ (ebd., 17). Seine Abgrenzung durch Spielfeld oder Spielplatz, verleiht dem Spiel auch räumlich den Status des außerhalb der gewöhnlichen Welt stehenden Erlebens. Innerhalb des Spielplatzes gelten besondere Regeln, aus denen sich die besonderen Handlungen ergeben. Ein Fußballfeld bildet genauso einen durch Ausdehnung und Markierungen abgegrenzten Raum, wie das Spielbrett auf dem das Schachspiel stattfindet oder der virtuelle Raum, in dem das Computerspiel situiert ist. Diese Grenzen machen das Spiel als regelgeleitete Handlung erinner- und wiederholbar. In seiner Wiederholbarkeit liegt auch für Oerter ein zentrales Merkmal des Spiels. Wiederholung ist laut Oerter eine Notwendigkeit, um Erfahrungen hinreichend zu festigen, also das Bewusstsein von Regelhaftigkeit und Sinn zu etablieren (vgl. ebd., 15ff). Seine Wiederholbarkeit macht es zudem möglich, Spiel als eine performative Handlung zu verstehen. Nach Krämer (1998) sei in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass alle Sinngebung auf Prozeduren des Wiederholens beruhe, die immer auch Wiederholungen der Form nach seien (ebd., 48). Die Regeln des Spiels basieren auf der vierten von Huizinga identifizierten Eigenschaft. Eine bestimmte Ordnung, die jedem Spiel immanent ist, verleiht ihm „zeitweilige begrenzte Vollkommenheit“. Weicht man von dieser Ordnung ab, verliert das Spiel seinen Wert als eine auf verbindlichen Regeln basierende Handlung. Mit seiner Ordnung begründet Huizinga auch den ästhetischen Charakter des Spiels (vgl. ebd. 17f). Begriffe der Ästhetik, wie Spannung, Gleichgewicht, Kontrast, Variation, Rhythmus und Harmonie, korrespondieren erfahrungsgemäß auch mit den Erlebnisstrukturen von Computerspielen8. Durch seine Struktur offeriert das Spiel Ungewissheit und Chancen und ist mit dem Streben nach Entspannung verbunden. Durch die Spannung des Spiels werden die Fähigkeiten des Spielers auf die Probe gestellt und Spannung ist zugleich die fünfte
8Diese Aussage spiegelt zumindest die subjektiven Erfahrungen des Autors beim Spielen
von Computerspielen wieder. Sie korrespondieren ferner mit den Begrifflichkeiten, die bei
der Beschreibung von Flow-Erlebnissen Verwendung finden (vgl. Csikszentmihalyi 2005,
206ff) und positionieren so das Spielerlebnis in den Bereich einer ästhetischen Erfahrung.