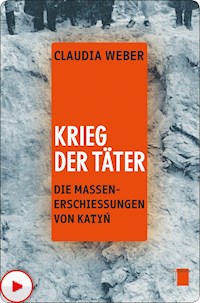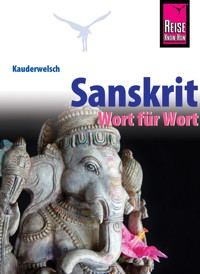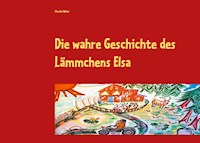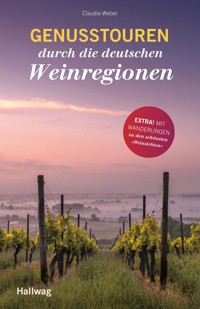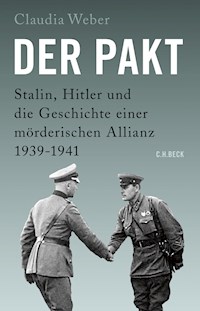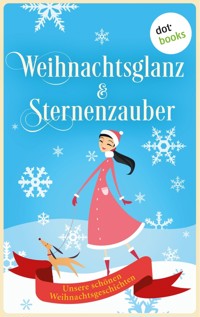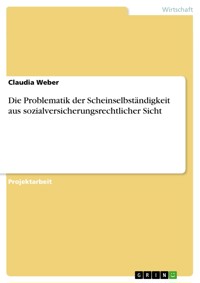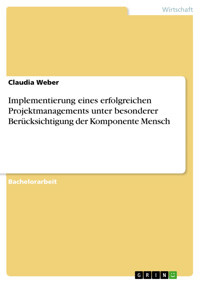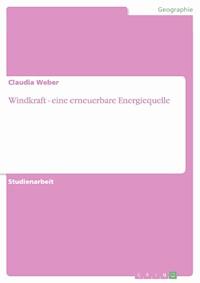39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Pädagogik - Schulpädagogik, Note: 1, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Viele Referendare und Referendarinnen beginnen ihren Beruf voller Enthusiasmus. Sie freuen sich mit Kindern arbeiten zu dürfen und ihnen Wissen vermitteln zu können, doch häufig werden sie auf den Boden der Realität zurückgeholt. Die meisten hoffen ein freundschaftliches Verhältnis mit der Klasse aufbauen können und möchten die Schüler und Schülerinnen vom Unterrichtsstoff begeistern. Wie man aber von vielen Erzählungen und Berichten hört, gelingt dies in den seltensten Fällen nur mit Liebe, Verständnis und Freiheit. Die Kinder brauchen Regeln und Vorbilder, an denen sie sich orientieren. Viele Referendare und Referendarinnen, wie auch Lehrer und Lehrerinnen haben Bedenken, dass sie bei ihrer Klasse nicht gut ankommen, wenn sie streng sind. Natürlich ist eine autoritäre Erziehung keine Lösung, da die Schüler und Schülerinnen sich nur anständig benehmen, weil sie Angst vor Konsequenzen haben aber nicht weil sie einsichtig sind. Die Klasse braucht jedoch eine Lehrkraft die sich durchsetzen kann und konsequent ist und konsequent eine Beeinträchtigung des Unterrichts nicht toleriert. Häufig stecken Lehrkräfte viel Arbeits- und Kraftaufwand in die Vorbereitung der Unterrichtsstunden hinein und trotz dieser Mühen sind die Resultate meist enttäuschend und demotivierend. Es gibt einige Handlungen, die den Unterricht unterbrechen können, wie Unkonzentriertheit, Ungenauigkeit, Faulheit, motorische Unruhe, mangelndes Interesse, verbale und physische Aggressionen, mangelndes Selbstvertrauen, Ungehorsamkeit, Kontaktprobleme, unterrichtsfremde Tätigkeiten, Überempfindlichkeit, Clownerien, Wutanfälle, übertriebener Ehrgeiz, Schulangst, psychosomatische Störungen, Beschädigung von Eigentum anderer Personen oder Gegenständen, starke Abhängigkeit, Depressivität, Druck auf Mitschüler und Mitschülerinnen, unregelmäßiger Schulbesuch, Provokation des Lehrers bzw. der Lehrerin, Stehlen, Alkoholmissbrauch, sexuelle Auffälligkeiten, Drohungen mit Selbstmord, Drogenmissbrauch, Selbstmordversuche. (vgl. Bach 2002, S.58) Unzufriedenheit, Enttäuschung, Frust und Resignation bei Lehrern und Lehrerinnen können die Folge sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1... Einleitung
1.1 Thematische Relevanz und Zielsetzungen
1.2 Aufbau der Arbeit
2... Theoretischer Teil
2.1 Theoretische Fundierung von Unterrichtsstörungen
2.1.1 Unterschiedliches Verständnis von U nterrichtsstörungen
2.1.2 Der Begriff „Unterrichtsstörung“
2.1.3 Die Schulgeschichte und der heutige Diskussionsstand
2.2 Formen von Unterrichtsstörungen
2.2.1 Durch Schüler verursachte Arten
2.2.1.1 Aktive Unterrichtsstörungen
2.2.1.2 Passive Unterrichtsstörungen
2.2.1.3 Interaktionen zwischen Schülern
2.2.2 Durch Lehrer verursachte Arten
2.2.2.1 Persönlichkeit
2.2.2.2 Unterrichtsgestaltung
2.2.3 Durch Umfeld verursachte Arten
2.2.3.1 Schulart
2.2.3.2 Gemeindegröße der Schulorte und Wohngebiete der Schüler
2.2.3.3 Schulische Bedingungen
2.3 Gründe von Unterrichtsstörungen
2.3.1 Schülerbezogene Ursachen
2.3.1.1 Der einzelne Schüler
2.3.1.2 Die Zusammensetzung der Klasse
2.3.1.3 Ermittlung von Ursachen durch Lehrer- und Schülerbefragungen
2.3.2 Lehrerbezogene Ursachen
2.3.2.1 Persönlichkeit
2.3.2.2 Unterrichtsgestaltung
2.3.2.3 Ermittlung von Ursachen durch Lehrer- und Schülerbefragungen
2.3.3 Äußere Bedingungen
2.3.3.1 Familie
2.3.3.2 Schule
2.3.3.3 Sozioökonomische Verhältnisse
2.3.3.4 Gesellschaftsstruktur
2.3.3.5 Lehrervariablen
2.4 Handlungsspektrum
2.4.1 Eine Umfrage unter Lehrkräften
2.4.2 Prävention bei Konflikten
2.4.2.1 Jacob Kounins Befunde
2.4.2.2 Regeln und Organisation
2.4.2.3 Breite Aktivierung
2.4.2.4 Unterrichtsfluss
2.4.2.5 Präsenz- und Stoppsignale
2.4.3 Intervention bei Konflikten
2.4.3.1 Lehrerzentrierte Strategien
2.4.3.2 Kooperative Strategien
2.5 Eigenes Verständnis zu Unterrichtsstörungen
3. Praktischer Teil
3.1 Trainingsraummethode
3.1.1 Ursprung
3.1.2 Ziel
3.1.3. Einführung
3.1.4 Verwirklichung des Programms
3.1.5 Umsetzung im Trainingsraum
3.2 Evaluationsergebnisse
3.2.1 Wirksamkeit in der Praxis
3.2.2 Befunde von Umfragen
3.3 Umsetzung in der Schule
3.3.1 Ziele der Dr.Albert-Liebmann-Schule und der
3.3.2 Methoden der Bekämpfung von Unterrichtsstörungen
3.3.3 Die Realisierung des Trainingsraumprogramms
3.4 Fazit
3.4.1 kritische Aspekte
3.4.2 Positive Effekte
3.5 Reflexion der Trainingsraummethode
4. Ausblick
4.1 Verbesserung des Lehramtstudiums
4.2 Weiterentwicklung von Schulen
5. Literaturverzeichnis
6. Abbildungsverzeichnis
7. Abbkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Thematische Relevanz und Zielsetzungen
Problematik des Lehrerberufs
Viele Referendare und Referendarinnen beginnen ihren Beruf voller Enthusiasmus. Sie freuen sich mit Kindern arbeiten zu dürfen und ihnen Wissen vermitteln zu können, doch häufig werden sie auf den Boden der Realität zurückgeholt. Die meisten hoffen ein freundschaftliches Verhältnis mit der Klasse aufbauen können und möchten die Schüler und Schülerinnen vom Unterrichtsstoff begeistern. Wie man aber von vielen Erzählungen und Berichten hört, gelingt dies in den seltensten Fällen nur mit Liebe, Verständnis und Freiheit. Die Kinder brauchen Regeln und Vorbilder, an denen sie sich orientieren. Viele Referendare und Referendarinnen, wie auch Lehrer und Lehrerinnen haben Bedenken, dass sie bei ihrer Klasse nicht gut ankommen, wenn sie streng sind. Natürlich ist eine autoritäre Erziehung keine Lösung, da die Schüler und Schülerinnen sich nur anständig benehmen, weil sie Angst vor Konsequenzen haben aber nicht weil sie einsichtig sind. Die Klasse braucht jedoch eine Lehrkraft die sich durchsetzen kann und konsequent ist und konsequent eine Beeinträchtigung des Unterrichts nicht toleriert. Häufig stecken Lehrkräfte viel Arbeits- und Kraftaufwand in die Vorbereitung der Unterrichtsstunden hinein und trotz dieser Mühen sind die Resultate meist enttäuschend und demotivierend. Es gibt einige Handlungen, die den Unterricht unterbrechen können, wie Unkonzentriertheit, Ungenauigkeit, Faulheit, motorische Unruhe, mangelndes Interesse, verbale und physische Aggressionen, mangelndes Selbstvertrauen, Ungehorsamkeit, Kontaktprobleme, unterrichtsfremde Tätigkeiten, Überempfindlichkeit, Clownerien, Wutanfälle, übertriebener Ehrgeiz, Schulangst, psychosomatische Störungen, Beschädigung von Eigentum anderer Personen oder Gegenständen, starke Abhängigkeit, Depressivität, Druck auf Mitschüler und Mitschülerinnen, unregelmäßiger Schulbesuch, Provokation des Lehrers bzw. der Lehrerin, Stehlen, Alokoholmissbrauch, sexuelle Auffälligkeiten, Drohungen mit Selbstmord, Drogenmissbrauch, Selbstmordversuche. (vgl. Bach 2002, S.58) Unzufriedenheit, Enttäuschung, Frust und Resignation bei Lehrern und Lehrerinnen können die Folge sein.
Meine Erfahrungen
Ich habe mir lange überlegt über welches Thema ich meine Zulassungsarbeit schreiben möchte und habe mich schließlich für das Thema „Unterrichtsstörungen“ entschieden. Meine Motivation, mich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen, war, dass ich Lehramt auf Hauptschule studiere und von Familie und Freunden immer wieder zu hören bekam, ob ich mir das antun möchte. Auch von den Medien werden die Schüler und Schülerinnen der Hauptschule häufig ins schlechte Bild gerückt. Einige Leute meinen, dass die Kinder schlicht dumm sind, kein Interesse für die Schule haben und kein Benehmen zeigen. Die äußeren Umstände werden aber meist nicht beachtet. Als ich meine Praktika in den Schulen absolviert habe, kamen öfters erfahrene Lehrer und Lehrerinnen zu mir und fragten mich ob ich mir sicher sei diesen Beruf ausüben zu wollen. Zum Glück gab es aber auch engagierte Lehrpersonen, die mir meine Bedenken nahmen. Sie mögen ihren Beruf, auch wenn er manchmal stressig und nervenaufreibend ist. Es stellt sich die Frage, was die Ursachen für solche verschiedene Meinungen sind. Liegt dies an der Persönlichkeit der Lehrkräfte, der Unterrichtsgestaltung oder den subjektiven Einstellungen?
Ein Großteil meines Bekanntenkreises hat selbst die Hauptschule besucht und mir immer wieder erzählt, wie sie Lehrkräfte geärgert und sogar zur Verzweiflung getrieben haben. Nach ihren Aussagen kam es öfters vor, dass Lehrkräfte, überwiegend Frauen, weinend aus den Klassenzimmern gerannt sind. Die Schüler und Schülerinnen bewarfen die Lehrkraft beispielsweise mit Papierkügelchen, liefen im Klassenzimmer umher oder beleidigten sie. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass manche Lehrkräfte in die Verzweiflung getrieben werden und die Motivation verlieren, die Klasse freundlich und mit Engagement zu unterrichten.
Als ich meine Bekannten fragte was die Ursache war, dass sie Lehrer und Lehrerinnen provoziert haben, bakam ich zur Antwort , dass ihnen langweilig war und sie die Lehrkräfte nicht ernst nahmen. Sie unterstellten den Lehrkräften, dass sie unfaire Methoden anwandten und die Schüler und Schülerinnen nicht gleich behandelten. Meine Bekannten räumtenjedoch ein, dass sie nicht alle Lehrer und Lehrerinnen ärgerten. Es gab in ihrer Schulzeit auch Lehrkräfte, die sie geachtet und geschätzt haben.
Meine Ziele
Mein Ziel dieser Zulassungsarbeit ist es herauszufinden, welche Eigenschaften eine Lehrkraft haben muss, um ein gutes Verhältnis zu den Schülern und Schülerinnen aufbauen zu können und einen motivierenden Unterricht zu ermöglichen. Auch ist mir wichtig welche äußeren Eigenschaften, wie Familie, Schule und Gesellschaft sich auf das Verhalten der Kinder auswirken kann. Gründe von Unterrichtsstörungen sindjedoch auch beim Schüler bzw. der Schülerin selbst zu finden. Es ist wichtig zu wissen, wodurch die Unterrichtsstörungen entstehen, um mit Präventions- und Interventionsmaßnahmen entgegen steuern zu können. Die Lehrkräfte sollten nicht gleich verzweifeln, wenn nicht alles so klappt wie sie es sich vorgestellt haben. Vor allem unerfahrene Lehrer und Lehrerinnen brauchen erst Übung in ihrem Beruf, um erfolgreich zu sein. Sie müssen jedoch bereit sein an dieser Situation etwas ändern zu wollen, denn nur dann sind sie in der Lage mit den hohen Anforderungen und der Vielseitigkeit des Berufes zurecht zu kommen. Die Lehrkräfte müssen lernen, wie sie mit Unterrichtsstörungen umgehen können. Es gibt zahlreiche pädagogische Maßnahmen, um mit den Problemen in der Klasse klar zu kommen. Das Trainingsraumprogramm ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Einbindung des Schülers und der Schülerin in den Klassenverband. Die Idee ist, dass Schüler und Schülerinnen welche stören, nach der zweiten Ermahnung in einen Trainingsraum geschickt werden, um dort über ihr Verhalten nachzudenken. Falls sie dort erneut auffallen, können sie sogar nach Hause geschickt werden. Ich habe mich entschieden dieses Projekt ausführlich vorzustellen, da ich mich interessiere, wie diese Idee in der Praxis umsetzbar ist. Es stellte sich bei mir die Frage, ob die Schüler und Schülerinnen nicht froh sind aus dem Klassenzimmer oder sogar nach Hause geschickt zu werden. Außerdem fand ich es aufschlussreich, wie man Kinder zu einem eigenverantwortlichen Denken und Handeln anregen kann.
Ich erhoffe mir durch diese Zulassungsarbeit Informationen zu gewinnen, die ich in meiner Referendariatszeit und im Lehrerberuf bei Unterrichtsstörungen selbst anwenden kann um Unterrichtsstörungen von vornherein zu verhindern bzw. wirksam entgegen treten zu können. Ich denke, dass viele Referendare und Referendarinnen Probleme haben, wenn sie das erste Mal vor der Klasse stehen. Wie sollen sie sich verhalten? Welche Konsequenzen sind effektiv? Sind sie verantwortlich für die Beeinträchtigungen im Unterricht? Wie können sie Unterrichtsstörungen bekämpfen?
Ich würde mich freuen, wenn diese Arbeit auch anderen Studenten und Studentinnen, Referendaren und Referendarinnen sowie Lehrern und Lehrerinnen eine Hilfestellung, bei der Bewältigung ihrer Probleme, sein kann. Ich denke, dass sie auf jeden Fall eine Hilfestellung sein kann, um das Problem von Beeinträchtigungen des Unterrichts erkennen und bekämpfen zu können.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Zulassungsarbeit gliedert sich in zwei Teile, und zwar dem theoretischen und dem praktischen Teil.
Im theoretischen Teil werde ich zunächst in „Kapitel 2.1“ auf theoretische Fundierungen von Unterrichtsstörungen eingehen. Mir ist wichtig, dass das Verständnis von Unterrichtsbeeinträchtigungen erkennbar wird, welches von Person zu Person verschieden sein kann. Vertieft werde ich auf die Wünsche, Vorstellungen und subjektive Empfindungen eingehen. Anschließend werde ich einige Definitionen von Unterrichtsstörungen wiedergeben und veranschaulichen, dass es keine einheitlichen Merkmale gibt, ab wann der Unterricht gestört wird. Außerdem werde ich berichten, wie sich Unterrichtsstörungen im Laufe der Zeit entwickelt und verändert haben.
Um über Unterrichtsstörungen sprechen zu können, muss klar sein welche Typen es gibt. Ich möchte in „Kapitel 2.2“ deutlich machen, dass Störungen sowohl vom Schüler und von den Schülerinnen, den Lehrkräften als auch den äußeren Bedingungen verursacht werden können.
Bevor man nach Möglichkeiten sucht, diese Störungen zu bekämpfen, muss klar sein, wodurch sie verursacht werden. Gründe dafür kann man hier ebenso bei den Schülern und Schülerinnen, den Lehrern und Lehrerinnen und den äußeren Bedingungen finden, diese Ursachen beschreibe ich in „Kapitel 2.3“
Die vorangegangenen Kapitel sind entscheidend um effektiv gegen die Unterrichtsbeeinträchtigungen ankämpfen zu können. Um Störungen erst gar nicht aufkommen zu lassen, sind Präventionen von Bedeutung. Fallsjedoch bereits Beeinträchtigungen des Unterrichts statt finden, ist eine Intervention wichtig. Diese Handlungsperspektiven habe ich in „Kapitel 2.4“ ausführlich dargestellt.
Schließlich möchte ich in „Kapitel 2.5“ über mein gewonnenes Verständnis von Unterrichtsstörungen berichten. Anhand dieser Erkenntnisse werde ich beurteilen, ob der Trainingsraum, welchen ich im praktischen Teil vorstelle, wirksam ist.
Im praktischen Teil werde ich, wie bereits erwähnt, den Trainingsraum konkretisieren. Es ist für mich bedeutungsvoll, dass man die Ziele und die Umsetzung dieses Projekts versteht, woraufich in „Kapitel 3.1“ eingehen werde.
Schließlich werde ich in „Kapitel 3.2“ Evaluationsergebnisse anführen, um in der Praxis die Wirksamkeit der Trainingsraummethode zu veranschaulichen.
Da ich mir ein eigenes Bild dieses Konzepts machen wollte, machte ich eine Woche lang ein Praktikum in der Dr.-Albert- Liebmann Schule in Kleinostheim, welche dieses Programm erfolgreich, wenn auch etwas abgeändert, umsetzt. In Kapitel „3.3“ werde ich zunächst allgemein auf die Schule eingehen, anschließend andere Methoden der Bekämpfung von Unterrichtsstörungen vorstellen und letztlich auf die Realisierung des Programms in der Dr.Albert-Liebmann-Schule eingehen.
In „Kapitel 3.4“ werde ich schließlich positive, wie auch negative Aspekte des Trainingsraumprogramms anführen. Mein Ziel ist es, dass der Leser oder die Leserin sich ein eigenes Urteil bilden kann und nicht wie in den Büchern das Thema verherrlicht wird.
In „Kapitel 3.5“ werde ich die Trainingsraummethode reflektieren und bewerten, wie effektiv ich diese in der Theorie und der Realisierung finde. Hierzu ziehe ich Informationen aus Büchern und aus Erfahrungen meines Praktikums heran.
2 Theoretischer Teil
2.1 Theoretische Fundierung von Unterrichtsstörungen
2.1.1 Unterschiedliches Verständnis vonU nterrichtsstörungen
Um die Problematik im Unterricht durch die Störungen zu verstehen, müssen zunächst die Wünsche und Vorstellungen der Lehrer und Lehrerinnen und der Schüler und Schülerinnen betrachtet werden sowohl die Lehrer und Lehrerinnen als auch die Schüler und Schülerinnen erleben einen Unterricht als angenehm, wenn dieser effektiv, befriedigend, eindrucksvoll und abwechslungsreich ist. Diese Vorstellungen werden meist durch methodische und didaktische Umsetzungen erreicht. Es ist wünschenswert, dass der Schulalltag gut strukturiert ist, offene und freundliche Umgangsformen sowohl unter den Schülern und Schülerinnen selbst als auch mit den Lehrkräften existieren und alle gemeinsam kooperieren. Es sollen klare Regeln, Grenzen und Rituale gelten, Minderheiten sollen beispielsweise geschützt werden.
Störungen sind auf subjektive Empfindungen zurückzuführen und stellen Interpretationen von Schülern und Schülerinnen und von Lehrern und Lehrerinnen dar, wobei sie sich inter- und intraindividuell unterscheiden können. Was der eine Lehrer als Störung wahrnimmt stört den Kollegen nicht, und was ein Lehrer an einem Tag als störend empfindet, nimmt er am nächsten Tag mit Humor auf oder erst gar nicht wahr. Dies hängt häufig von der Stimmung, der Tagesform, der Müdigkeit und der Gelassenheit ab. Die Störungsempfindlichkeit ist zudem durch die Arbeitsform bedingt, bei Gruppenarbeit und offenem Unterricht liegt die Toleranzgrenze deutlich höher als beim Frontalunterricht und bei Schülerreferaten. Darüber hinaus kann das Unterrichtsfach auch ausschlaggebend sein, in manchen Fächern ist die Klasse interessierter und konzentrierter und folgt dem Unterrichtsgeschehen aufmerksamer als in anderen Fächern. Die unterschiedliche Auffassung von Unterrichtstörungen gilt ebenso für die Schüler und die Schülerinnen. Wenn sie selbst involviert sind, empfinden sie die Störungen anderst als wenn sie nicht beteiligt sind. Wenn sie als Täter oder Mitläufer fungieren finden sie die Situation meist amüsant, im Gegensatz zu den Opfern, welche darunter leiden. Lehrer und Lehrerinnen haben oftmals den Eindruck, dass die Schüler und die Schülerinnen Störungen gleichgültig hinnehmen, es hat sichjedoch im Gegensatz heraus gestellt, dass sie sich dadurch belästigt fühlen und ein Durchgreifen der Lehrkräfte fordern. (vgl. Bründel, Simon 2007, S.13ff., 37ff.)
Abb 3 Offene Ursachenanahme
Müller-Fohrbrodt sieht dennoch einen negativen Interaktionskreislauf, ohne Beachtung dieser Toleranzunterschiede, als Ursache von Unterrichtsstörungen an. (siehe Abb.2) Der Lehrer oder die Lehrerin bewertet Störungen als nicht akzeptabel und reagiert daraufhin mit Ermahnungen und Bestrafungen. der Störer oder die Störerin ärgert sich darüber und ist nicht bereit das Verhalten zu ändern, woraufhin er/sie wieder stört und der Kreislauf von vorne beginnt. Müller-Fohrbrodtempfindet es als wichtig, dass die Lehrer und die Lehrerinnen diesen Kreislauf durchbrechen und sich einer offenen Ursachenannahme zuwenden. Sie sollen den Störer oder die Störerin nicht in seiner Persönlichkeit kränken, sondern akzeptieren, dass sein Benehmen einen Grund hat, auch wenn dieser zu diesem Zeitpunkt nicht nachvollziehbar ist. Der Schüler oder die Schülerin hat Wünsche und Ziele, die er/sie verwirklichen will.
Im Gegensatz zum negativem Interaktionskreislauf versucht die Lehrperson bei der offenen Ursachenannahme herauszufinden, welches Motiv der Schüler oder die Schülerin hatte, den Unterricht zu beeinträchtigen. (siehe Abb.3) Störungen sind offene und verdeckte Botschaften, welche der Lehrer oder die Lehrerin und der Störer oder die Störerin bestmöglichst gemeinsam aufklären und Wege zur Vermeidung der Störungen finden sollen. Der Schüler oder die Schülerin soll das Gefühl übermittelt bekommen, dass er bzw. sie verstanden und ernst genommen wird, wodurch er selbst bereit wird, seine Handlungen zu kontrollieren und die störendenVerhaltensweisen aufzugeben. (Müller-Fohrbrodt 1999, S.93 zit. n. Bründel, Simon 2003,S.28 ff.)
2.1.2 Der Begriff „Unterrichtsstörung“
In der heutigen Zeit hat der Begriff „Unterrichtsstörung“ an Bedeutung in der Schule gewonnen. Die Unterrichtsstörung stellt die größte Blockade dar, um guten Unterricht zu verwirklichen und respektvolles Verhalten bei den Schülern und Schülerinnen untereinander und gegenüber der Lehrkraft zu erzielen. Konflikte können bis zu 60 Prozent einer Unterrichtsstunde ausmachen, wobei nicht nur die Störungen der Schüler oder der Schülerinnen sondern auch die Reaktionen der Lehrpersonen inbegriffen sind. Die Maßnahmen sind von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich und vielfältig. Ab wann von einem störenden Verhalten gesprochen wird ist nicht eindeutig festgelegt, meist hängt es vom subjektiven Befinden ab. (vgl. Bründel, Simon 2007, S.13) Es lassen sich dennoch Kriterien für die Definition von Störungen nennen. Im folgendem werde ich einige Begriffserklärungen von verschiedenen Autoren wiedergeben.
Winkel (2005)
“Eine Unterrichtsstörung liegt dann vor, wenn der Unterricht gestört ist, d.h. wenn das Lehren und Lernen stockt, aufhört, pervertiert, unerträglich oder inhuman wird.” (Winkel 1996, S. 31)
Ortner (2000)
“Eine konkrete oder potentielle Unterrichtsstörung umfasst alles, was dazu führt oder führen kann, den Prozess oder die Beziehungsgefüge von Unterrichtssituationen zu unterbrechen (vgl. Biller 1981, S.28). Auf das Verhalten eines Schülers bezogen betrifft Stören des Unterrichts alle Aktionen und Reaktionen, mit denen dieser sich bewusst über schulische Normen und Regeln hinwegsetzt. Das Störverhalten richtet sich dabei gegen den Lehrer, die Mitschüler oder gegen den Unterrichtsverlauf.” (Ortner 2000, S.200)
Nolting (2007)
Normative Definition: „Unterrichtsstörungen sind Handlungen von Schülern, die gegen Regeln für das Verhalten im Unterricht verstoßen. Ob eine Störung vorliegt oder nicht, hängt hier letztlich von der Lehrkraft ab; sie bestimmt die Regeln und bewertet das Verhalten. Was Lehrer X als „unruhig“ bezeichnet, nennt seine Kollegin Y vielleicht „lebhaft“.“
Funktionale Definition: „Unterrichtsstörungen sind Handlungen, welche die von einer Lehrkraft beabsichtigte Unterrichtsdurchführung behindern, und zwar (a) indem sie andere Personen, nämlich die Lehrkraft oder die Mitschüler, in ihren aufgabenbezogenen Aktivitäten beeinträchtigen, und/oder (b) indem sie die eigene aufgabenbezogene Aufmerksamkeit und Mitarbeit beeinträchtigen.“ (vgl. Nolting 2007, S.13)
Lohmann (2007)
„Unterrichtsstörungen sind Ereignisse, die den Lehr-Lern-Prozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie die Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz außer Kraft setzen. Zu den Voraussetzungen zählen äußere und innere, das Lernen ermöglichende Bedingungen, wie z.B. physische und psychische Sicherheit, Ruhe, Aufmerksamkeit, Konzentration. Die Störungen können von Schülern und Lehrern verursacht oder von außen hereingetragen werden, z.B. laute Zwischenrufe, verbale oder physische Attacken, Herumlaufen von Schülern; Hektik, Herumbrüllen oder Sarkasmus von Lehrern; Durchsagen, Baustellenlärm, Tiefflieger, plötzlicher Schneefall usw.” (Lohmann 2007, S.12)
Bei den Definitionen, wobei hier nur ein kleiner Bruchteil aufgezählt ist, wird deutlich, dass die Autoren den Begriff„Unterrichtsstörung“ auf unterschiedliche Weise bestimmen.
Winkel bezieht sich nur auf die Beeinträchtigung des Unterrichts, seiner Meinung nach liegt dies vor, wenn das Lehren und Lernen unterbrochen wird. Er gibt keine Auskunft über den Auslöser der Geschehnisse.
Nolting und Ortner halten ebenso fest, dass der Unterricht unterbrochen wird, gehenjedoch in ihrer Definition weiter, und sehen die Ursache im Schülerverhalten. Ortner erklärt, dass die Störungen sich gegen Lehrer bzw. Lehrerinnen, Mitschüler bzw. Mitschülerinnen und gegen Unterrichtsverläufe richten. Nolting bekennt, dass die Unterbrechungen auch Folgen für den Störer selbst haben können. Nolting räumt des weiteren ein, dass der Begriff personenabhängig ist, manche Lehrkräfte sehen eine Handlung bereits als Unterrichtsstörung an, wo ein anderer Lehrer bzw. Lehrerin nur der Meinung ist, dass die Klasse lebhaft ist.
Lohmann definiert Unterrichtsstörungen als Beeinträchtigung des Lehr-Lern-Prozesses. Im Gegensatz zu den anderen genannten Autoren sieht er die Auslöser in mehreren Faktoren, sowohl im Schülerverhalten, als auch im Lehrerverhalten, als auch in den äußeren Bedingungen. Neben den Ursachen von Unterrichtsstörungen bezieht sich Lohmann auch auf Voraussetzungen, die für das Lehren und Lernen gegeben sein müssen.
Meiner Meinung nach ist die Definition von Lohmann am besten, da er verschiedene Gründe nennt, die Beeinträchtigungen des Unterrichts auslösen. Er erwähnt, dass sowohl Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, wie auch äußere Bedingungen sich störend auf das Lehren und Lernen auswirken können und gibt hierfür sogar Beispiele an, welche die Geschehnisse überzeugend darstellen. Bei dieser Definition fehlt allerdings der Aspekt, dass es Präventions- und Interventionsmaßnahmen gibt, diese sindjedoch nicht unbedingt notwendig, um den Begriff„Unterrichtsstörung“ lediglich zu beschreiben
2.1.3 Die Schulgeschichte und der heutige Diskussionsstand
Wer denkt, dass es früher keine Unterrichtsstörungen gab und diese ein Phänomen der heutigen Zeit sind, liegt falsch. Schon seit dem Schüler und Schülerinnen gelehrt werden, ist der Unterricht auf verschiedene Art und Weise Disziplinproblemen ausgesetzt. Früher gab es sogar manchmal so gravierende Erscheinungen, dass man sich diese heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Ein Beispiel hierfür ist das 16. und 17. Jahrhundert, in welcher Zeit Schülerstreik und Vandalismus herrschte. Im 16. Jahrhundert, welches man auch Grobeanismus nennt, spürte man die schwer schwerwiegendsten Beeinträchtigungen. Die Schüler und Schülerinnen verweigerten den Besuch der Schule, man hörte häufig auch den Vorwurf, dass sie die Schule nicht pflegten und verwüstet hinterlassen haben. Die Störungen des Unterrichts waren manchmal so drastisch, dass die Folge war, dass Tage lang kein Schulunterricht statt fand. Neben dem Ausfall von Unterricht muss auch noch erwähnt werden, dass die Ausbildung und Qualifikation der Lehrkräfte mangelhaft war und dies Gründe für die Störungen sein konnten. Man kann die Schule von damals keineswegs mit der Schule von heute vergleichen, die Standards waren viel tiefer und fast jeder Idiot konnte Lehrer werden. Vor allem der 30jährige Krieg von 1618 bis 1648 hatte extreme Formen der Unterrichtsstörung, viele Teile des Landes wurden vernichtet und und ca. ein Drittel der Bevölkerung starb. (vgl. Conrad, Ludwig 1999, S.16 f.)
Seit etwa 200 Jahren werden in der Schule mehrere Schüler und Schülerinnen gleichzeitig gelehrt, es wurden nicht mehr länger einzelne Schüler bzw. Schülerinnen unterrichtet. Es stellte sich am Anfang die Frage wie man dies durchsetzen könnte. Es wurden Unterrichtsmethoden entwickelt, die es möglich machten mehrere Schüler und Schülerinnen gemeinsam zu unterrichten. In dieser Zeit verstand man unter Disziplin einen Zustand, bei dem eine „Lehr-Lernsituation“ möglich war und sowohl die Mitschüler und Mitschülerinnen als auch die Lehrer und Lehrerinnen mit Respekt behandelt wurden. Die Erwartungen und die Durchsetzung von Disziplin haben sich im Laufe der Zeit in der Schule verändert. Disziplin ist somit nicht nur abhängig von den Lerninhalten und den
Lernumständen, sie wird ebenso historisch-gesellschaftlich bestimmt. Die Vorstellung und Umsetzung von Disziplin lässt einige Erkenntnisse derjeweiligen Zeit zu. Welche Struktur besteht zu dieser Zeit, welche Ziele werden verfolgt, welche Absichten haben die Schulen, welche fachliche und pädagogische Fähigkeiten sind vorhanden, welchen Stellenwert hat der Lehrer bzw. die Lehrerin in der Gesellschaft.(vgl. Sandfuchs 2002, S. 44 f.)