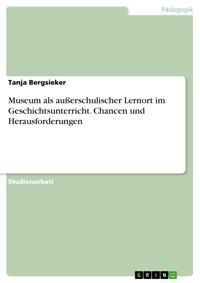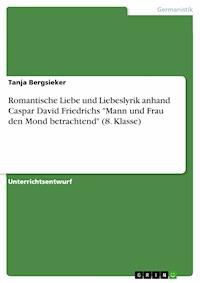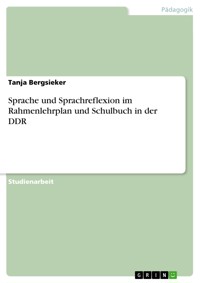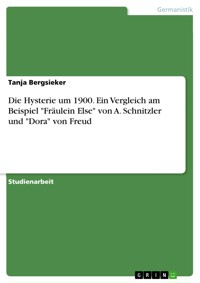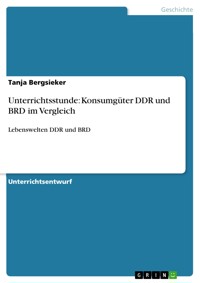
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Neuere Geschichte, Note: 1,0, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Historisches Institut), Veranstaltung: Schulpraktische Übung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Unterrichtsstunde wurde für eine 5. Klasse entwickelt. In dieser lernen gegenwärtig neun Mädchen und sechs Jungen. Die SuS waren vorher an einer herkömmlichen Schule und sind mit dem Konzept der Musterschule noch nicht lange vertraut. Dafür haben sie sich jedoch schon sehr gut einleben und arrangieren können. Im Unterricht kommen häufig szenische Gestaltungsmittel zum Einsatz, so sind die Klasse und der Raum mit modernen Technologien wie Beamer, Wlan, IPad, Apple TV und MacBook ausgestattet. Die SuS reagieren dabei immer motiviert, wenn die Geräte zum Einsatz kommen. Der Unterrichtsgegenstand „Lebenswelten DDR und BRD“ ist den SuS seit Beginn dieser Unterrichtseinheit bekannt. So wurde im Verlauf der vorigen Stunden zunächst grundlegendes Wissen um Begriffe wie Ost und West, Mauerbau und Mauerfall, Jugend der DDR und BRD erarbeitet. Die Aufteilung und Ausstattung des Klassenraums sind als besonders positiv anzuführen. So wirkt das Raumkonzept sehr durchdacht, ordentlich, strukturiert und keinesfalls überladen. Mit der für diese Stunde vorgesehenen Arbeitsform der Partner- beziehungsweise Gruppenarbeit eignet sich die Aufteilung der Sitzordnung sehr gut, da jeweils drei SuS an einem Tisch sind. Zur zeitlichen Orientierung der Stunde ist zu sagen, dass es kein Klingelzeichen gibt, wenn eine Pause von fünf Minuten ist. Die SuS sind es gewohnt, ihre Arbeitszeit selbst zu kontrollieren oder durch Vorgabe der Lehrkraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Bedingungsanalyse
2. Sachanalyse
3. Didaktische Überlegung
4. Methodische Überlegung
5. Lernziele
6. Verlaufsplan
7. Reflexion
8. Quellen- und Literaturverzeichnis
Anhang
1. Bedingungsanalyse
Die vorliegende Unterrichtsstunde wurde für die 5. Klasse der Montessori-Schule in Xxx entwickelt. In dieser lernen gegenwärtig neun Mädchen und sechs Jungen. Die SuS waren vorher an einer herkömmlichen Schule und sind dem Konzept der Montessori-Schule noch nicht lange vertraut. Dafür haben sie sich jedoch schon sehr gut einleben und arrangieren können. Im Unterricht kommen häufig szenische Gestaltungsmittel zum Einsatz, so sind die Klasse und der Raum mit modernen Technologien wie Beamer, Wlan, IPad, Apple TV und MacBook ausgestattet. Die SuS reagieren dabei immer motiviert, wenn die Geräte zum Einsatz kommen.
Der Unterrichtsgegenstand „Lebenswelten DDR und BRD“ ist den SuS seit Beginn dieser Unterrichtseinheit bekannt. So wurde im Verlauf der vorigen Stunden zunächst grundlegendes Wissen um Begriffe wie Ost und West, Mauerbau und Mauerfall, Jugend der DDR und BRD erarbeitet.
Die Aufteilung und Ausstattung des Klassenraums sind als besonders positiv anzuführen. So wirkt das Raumkonzept sehr durchdacht, ordentlich, strukturiert und keinesfalls überladen.
2. Sachanalyse
Der Lebensstandard der DDR war von dauerhaften Alltagsproblemen geprägt. So zählte das Beschaffen von Waren des täglichen Gebrauchs und von Konsumgütern dazu. Besonders knapp waren langlebige Konsumgüter, deren Verteilung streng geregelt war. Lange mussten die Bürger der DDR auf ein Auto warten. Zum Einkaufen ging es in den Konsum oder die HO (Handelsorganisation). Das Wort „Konsum“ kommt aus dem lateinischen cosumo und bedeutet „Verbrauch“. Weiterhin typisch für die DDR war ein Nebeneinander von hochsubventionierten Waren des Grundbedarfs einerseits und überteuerten „Luxusgütern“ andererseits. Eine einfache Grundversorgung war den Bürgern der DDR jedoch gesichert. Normal war es auch, dass vor den Lebensmittelgeschäften Menschenschlangen standen, um Südfrüchte wie Orangen und Kiwis zu bekommen, die es so nur selten gab. In den sechziger Jahren wurden Intershops errichtet, in denen erst einmal nur Westbürger und Transitreisende gegen Devisen – „harte“ Westmark[1] – spezielle Produkte erwerben konnten. Devisen bezeichnen Zahlungsansprüche – Forderungen – in fremder Währung im Ausland, die durch Ersparnisse bei ausländischer Bank ergeben. Damit gemeint sind: Schecks, Zahlungsanweisungen oder Wechsel (Buchgeld), die im Ausland fällig sind.[2] Ab 1974 durften auch DDR-Bürger, die Westmark oder Forum-Checks besaßen, dort einkaufen. Westgeld bekam man als DDR-Bürger von Westverwandten. Dies führte zur Zweiklassen-Gesellschaft und somit zum Unmut einiger Bürger, die keine gutsituierten Westverwandten hatten. Dadurch hatte der DDR-Bürger leider nur einen begrenzten Einblick in die Warenwelt der BRD. Im Sortiment waren Nahrungsmittel, Alkohol, Tabakwaren, Kleidung, Spielwaren, Schmuck, Kosmetika, technische Geräte, Tonträger und vieles mehr. Die DDR-Wirtschaft blieb aber deutlich hinter der der Bundesrepublik zurück.[3]