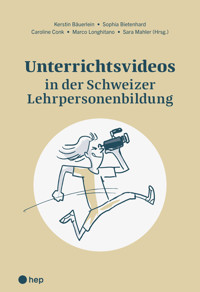
Unterrichtsvideos in der Schweizer Lehrpersonenbildung (E-Book) E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Dieses E-Book enthält Bildbeschreibungen zu allen Grafiken. Es wird empfohlen, einen E-Reader zu verwenden, auf dem die Bilder vergrössert werden können. Die Arbeit mit videografierten Unterrichtssequenzen ist zu einem bedeutsamen Instrument in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen geworden. Doch was heisst es, Videos für die Hochschullehre zu erstellen, Unterricht mit unterschiedlichen videografischen Technologien zu erfassen? Welche Chancen und Herausforderungen bietet der Einsatz von Videos für den Aufbau beruflicher Kompetenzen? Der vorliegende Sammelband vereinigt Beiträge, die diese Fragen im Kontext der schweizerischen Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen aller Schulstufen untersuchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Bäuerlein, Sophia Bietenhard, Caroline Conk,
Marco Longhitano, Sara Mahler (Hrsg.)
Unterrichtsvideos in der Schweizer Lehrpersonenbildung
ISBN Print: 978-3-0355-2662-2
ISBN E-Book: 978-3-0355-2663-9
Die Illustrationen dieses Buchs wurden von Jonas Raeber (jonasraeber.com) an der Tagung «Unterrichtsvideo – der Königsweg in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen?» vom 2.–3. Juni 2023 an der PHBern angefertigt und für die vorliegende Publikation leicht angepasst.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 hep Verlag AG, Bern
hep Verlag AG
Gutenbergstrasse 31 | Postfach | CH-3001 Bern
[email protected] | hep-verlag.ch
Inhalt
Einleitung
Lehr-Lern-Prozesse im Erwerb professioneller Kompetenzen bei Studierenden und Lehrpersonen dokumentieren und messen
Länderübergreifend inklusive Settings mit Videoclubs entwickeln
Alexandra Roggensinger, Robbert Smit, Petra Hecht, Marion Matic und Esther Moll
L’usage de la vidéo en formation continue : un espace de réflexion sur les gestes professionnels à développer au cycle I
Catherine Tobola Couchepin et Ismaïl Mili
Einsatz von Videos zur Förderung und Erfassung von professioneller Unterrichtswahrnehmung bei Lehrpersonen im Zyklus 1
Rahel Laubscher, Christine Streit und Christine Bänninger
Wer ist besser? Videobasiertes Adaptive Comparative Judgment in der Ausbildung Sport unterrichtender Lehrpersonen
Eric Jeisy
Videobasierte Fallarbeit zur formativen Beurteilung im Bildnerischen Gestalten
Caroline Conk
Unterrichtsvideos als Lernmaterial zur Förderung professioneller Handlungskompetenzen
Kompetenzorientierte fachspezifische Unterrichtsentwicklung: Das E-Portal KfUE und seine Nutzung
Caroline Conk, Sophia Bietenhard und Ursula Aebersold
Videografiertes professionelles Handeln interindividuell vergleichen – jenseits von Qualitätsrastern, Persönlichkeitsansatz und Typenbildung
Simone Kannengieser
Wissen und Können im Sportunterricht durch Video sichtbar machen?
Roland Messmer, Katja Schönfeld und Mario Steinberg
Adressierungen im Kunstunterricht: Alles eine Frage der Perspektive?
Annette Rhiner und Nadia Bader
Videobasierte Fallstudien in der Fremdsprachendidaktik an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis
Bettina Imgrund
Technologische Entwicklungen
Acquérir des compétences en conception de vidéo pédagogique pour former dans l’enseignement supérieur
Corinne Ramillon
Online oder im Klassenzimmer? Liedvermittlung peer-to-peer
Annamaria Savona, Patrik Bachmann und Armin Wyrsch
Unterschiedliche Videoperspektiven auf den Unterricht: Potenziale für die Lehrpersonenbildung
Sara Mahler und Kerstin Bäuerlein
Die 360-Grad-Videografie in der Ausbildung angehender Lehrpersonen
Philipp Peter und Marco Seeli
Lernförderliche Entscheidungen stärken – interaktive Videolernumgebungen mit Branching-Szenarien in der Lehrpersonenausbildung
Kerstin Bäuerlein, Loris Jeitziner, Sara Mahler, Livia Müller, Alessia Ruf und Anna-Lena Ullrich
Automatisierte Videoproduktion mithilfe künstlicher Intelligenz. Bericht über ein Innovationsprojekt in der sportbezogenen Lehrpersonenbildung
Eric Jeisy
Anhang I – Überblick der Beiträge
Anhang II – Autorinnen und Autoren
Einleitung
Die Arbeit mit videografierten Unterrichtssequenzen hat sich zu einem bedeutsamen Instrument der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen entwickelt. Die Zugänge zur videografischen Erfassung von Unterricht und die Auswertungs-, Einsatz- und Analysemethoden haben technologisch und inhaltsbezogen an Vielfältigkeit gewonnen. In der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen ermöglichen Videoaufnahmen die nachträgliche, wiederholte Betrachtung von Unterrichtssequenzen ohne Handlungsdruck, unter verschiedenen Fragestellungen und mit hochschuldidaktischen Mitteln. Dass diese Auseinandersetzung in unterschiedlichen Phasen der Lehrpersonenbildung die Entwicklung professioneller Kompetenz wirksam unterstützt und die Bedeutsamkeit theoretischer Konzepte und Modelle für die Reflexion über Unterricht sichtbar macht, ist mittlerweile gut belegt (z. B. Holodynski & Meschede, 2022; Kramer et al., 2017). Aktuelle Reformen der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen wie in der Schweiz das Projekt «Qualifizierung in der Unterrichtsbeurteilung» der Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft externe Evaluation von Schulen (argev.ch) oder in Deutschland die bundesweite «Qualitätsoffensive Lehrerbildung» (qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de) messen der Arbeit mit Unterrichtsvideos zentrale Bedeutung zu, da sie den Bezug zur Unterrichts- und Schulpraxis aufnimmt, den analytischen Diskurs über die Berufskompetenzen im Lehrberuf empirisch mitbegründet, für Anspruchsgruppen veranschaulicht und hochschuldidaktisch umsetzt. Damit ist die Unterrichtsvideografie ebenfalls zu einem eigenen Feld der Unterrichtsforschung und -entwicklung geworden. Im deutschsprachigen Raum entstanden in den letzten Jahren etliche über Registration zugängliche forschungsbasierte Videoportale, die mehrperspektivisch auf unterschiedliche Fragestellungen ausgerichtet, methodisch vielfältig und professionsorientiert eingesetzt werden können. Dazu kommen institutionsinterne Portale, Listen mit Videoportalen (z. B. fdz-bildung.de/videoportale) und aktuell das von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster koordinierte Metavideoportal zur Suche geeigneter Videos (unterrichtsvideos.net).
Blickpunkt Schweiz
Im schweizerischen Kontext ist die Entwicklung der Forschung und Arbeit mit Unterrichtsvideos in der Lehrpersonenbildung vor dem Hintergrund der tertiären Lehrpersonenbildung zu sehen, die für den Kindergarten und die Primarstufe im Jahr 2001 einsetzte. Damit wurde die wissenschaftlich-empirisch fundierte Unterrichtsentwicklung und -forschung auf breiter Ebene angeregt, in Verbindung mit den wachsenden technologischen Möglichkeiten für die Integration in die Lehrpersonenbildung. Als Pionierleistung ist das E-Portal der Universität Zürich und der Pädagogischen Hochschule Schwyz zu nennen, das ausgehend von der TIMMS-1999-Videostudie (Reusser & Pauli, 2003) eine Sammlung von Videos, hauptsächlich zu mathematischen, natur- und erziehungswissenschaftlichen Themen, aufbaute (unterrichtsvideos.ch; Moser et al., 2010). Die Zeitschrift «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» widmete in der Folge dieses Projekts ein ganzes Heft der videobasierten Fallarbeit/Kasuistik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Reusser et al., 2014). Zunehmend verfügen einzelne Ausbildungsbereiche an Pädagogischen Hochschulen über themen- und fachspezifische Videosammlungen, die intern für bestimmte Lehrmodule eingesetzt werden. Das Unterrichtsvideo-Portal des Instituts für Sekundarstufe I und II der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (fhnw.ch/plattformen/isek-unterrichtsvideo-portal) stellt seit 2021 für die eigenen Mitarbeitenden sowie für Interessierte anderer Hochschulen Unterrichtsvideos aus verschiedenen Perspektiven (inkl. Eye-Tracking-Videos) sowie darauf bezogene Lernaufgaben zur Verfügung. Die Pädagogische Hochschule Bern lancierte im Juni 2020 das E-Portal «Kompetenzorientierte fachspezifische Unterrichtsentwicklung. Fachdidaktische Fallarbeit in der Lehrpersonenaus- und weiterbildung» (phbern.ch/e-portal-kfue; Adamina et al., 2020; s. Conk et al. in diesem Band). Dieses Portal bietet Bildungs- und Forschungsbeauftragten pädagogischer Institutionen kommentierte Unterrichtsvideos mit Begleitmaterialien für die fachspezifische Fallarbeit an und ist seit 2023 auch an das Metaportal der Universität Münster angebunden.
Mehrheitlich initiieren einzelne Lehr- und Forschungsbeauftragte oder Teams an Pädagogischen Hochschulen oder erziehungswissenschaftlichen Instituten an Universitäten Entwicklungs- und Forschungsprojekte mit Unterrichtsvideos. Festzustellen ist, dass die Hochschulen zunehmend Unterrichtsvideos in der Grundausbildung und dort vor allem in den berufspraktischen Studien nutzen. Videoportale dienen der fachbereichs- und institutsübergreifenden Entwicklung der Lehrpersonenbildung (vgl. Beitrag Conk, Bietenhard & Aebersold in diesem Band). Öfters werden eigene Unterrichtseinsätze von Studierenden gefilmt und analysiert und Unterrichtspraktika mit Videoanalysen vorbereitet. Eher selten sind gesamtinstitutionelle Bestrebungen anzutreffen, die Qualitätskriterien der Aus- und Weiterbildung strategisch mit diesem Instrument verbinden. Eine Herausforderung bieten die in einigen Kantonen strengen Datenschutzbestimmungen betreffend Unterrichtsaufzeichnungen und deren Wiedergabe.
Insgesamt beginnt sich jedoch die Arbeit mit Unterrichtsvideos als wirksamer Beitrag zur professionalisierten Lehrpersonenbildung zu etablieren. Eine Tagung zum aktuellen Stand der Unterrichtsvideografie in der Schweiz am 2. und 3. Juni 2023 an der Pädagogischen Hochschule Bern bot die Möglichkeit zum Zwischenhalt, zum Austausch und zur Vernetzung. Über 40 Beiträge zeugten von der Vielfalt der Ansätze in der Aus- und Weiterbildung, im Unterricht selbst sowie der methodischen und thematischen Zugänge in Forschungsprojekten. Die Beiträge in diesem Band bilden Fortführungen von Studien ab, die dort vorgestellt und diskutiert wurden. In einer moderierten Diskussion zum Thema «Quo vadis, Unterrichtsvideo?» besprachen interessierte Tagungsteilnehmende zudem Zukunftsperspektiven und Herausforderungen der Arbeit mit Unterrichtsvideos, die in den folgenden Ausführungen ebenfalls aufgenommen werden.
Als Standortbestimmung will dieser Sammelband in der Unterrichtsvideografie Forschenden und Lehrenden einen Überblick über gegenwärtige Schwerpunkte, Horizonte und Desiderate geben. Dass sich die meisten Beiträge dieses Bandes mit Aspekten der Unterrichtsvideografie in der fachlichen Aus- und Weiterbildung beschäftigen, legt nahe, dieses Instrument als etabliertes hochschuldidaktisches Mittel zu verstehen und entsprechend in die Konzeptionen der fachbezogenen und der berufspraktischen Lehrpersonenbildung aufzunehmen. Die nachfolgenden Ausführungen dienen denn auch dazu, diese Bezugnahmen und ihr Potenzial aufzuzeigen. Um die Konturen des aktuellen Diskurses zu schärfen, stellen wir im Folgenden Themenbereiche und Kontroversen, Fragestellungen und Ausblicke für die künftige Forschung und Lehrpersonenbildung vor.
Verortung und Horizonte
Die im vorliegenden Band versammelten Beiträge zeigen für die Unterrichtsvideografie eine ausgeprägte Anwendungsorientierung sowohl bei Forschungs- als auch bei Entwicklungsprojekten. Eine Mehrheit thematisiert Fragen der fachlichfachdidaktischen Professionalisierung unterschiedlicher Zielgruppen und untersucht diese an Fachunterrichtsszenarien. Damit richten sich die Fragestellungen der Forschungsprojekte auf Ziele, die im Zusammenhang der Förderung professioneller Fähigkeiten angehender Lehrpersonen im Fachunterricht stehen. Dazu werden unterschiedliche Technologien eingesetzt und deren Einsatz kritisch reflektiert. Die damit verbundenen Einblicke und Fragen teilen wir in die folgenden drei Bereiche ein: 1) die verschiedenen Ziele, die mit dem Einsatz der Videoaufnahmen verfolgt werden; 2) die Technologien, die eingesetzt werden, sowie 3) die Fachbereiche und Zielgruppen. Die Namensverweise in Klammern benennen die Beiträge des Sammelbands, die den entsprechenden Punkt aufnehmen. Eine Übersicht über die einzelnen Beiträge, die neben einer Kurzbeschreibung, die Ziele, die genutzte Technologie sowie den Fachbereich und Zielgruppe benennt, findet sich im Anhang dieses Sammelbandes.
Ziele beim Einsatz von Videoaufnahmen
Unterrichtsvideos werden in der Forschung als Instrument zur Beantwortung von Forschungsfragen oder zum Zweck einer professionalisierten Lehrpersonenbildung eingesetzt. Fragestellungen und Ziele sind Voraussetzung, um Erkenntnisse oder Analyseergebnisse zu gewinnen beziehungsweise bei den Studierenden und Lehrpersonen in Weiterbildung einen erkennbaren Zuwachs an Kompetenzen zu erzielen (Seidel & Thiel, 2017, S. 2).
Ein Teil der Beiträge dieses Bandes nutzen Videoaufnahmen primär dazu, um Lehr-Lern-Prozesse im Erwerb professioneller Kompetenzen bei Studierenden und Lehrpersonen zu dokumentieren und zuverlässige und valide Messungen vorzunehmen (Conk; Jeisy: Wer ist besser?; Laubscher et al.; Mahler & Bäuerlein; Peter & Seeli; Roggensinger et al.; Tobola Couchepin & Mili).
Ein anderer Teil umfasst Studien, welche Unterrichtsvideos als Lernmaterial im Rahmen von Lehrveranstaltungen der Lehrerpersonenbildung verwendet, um den Aufbau professioneller Handlungskompetenzen zu unterstützen (Bäuerlein et al.; Conk et al.; Imgrund; Jeisy: Automatisierte Videoproduktion; Kannengieser; Messmer et al.; Ramillon; Rhiner & Bader; Savona et al.).
Die Trennlinie zwischen der Messung bestimmter Leistungen und der Förderung professioneller Kompetenzen bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten unter Einsatz von Unterrichtsvideos ist allerdings unscharf. Einerseits waren viele der hier vorgestellten Projekte, die Messungen vornahmen, auch als Aus- oder Weiterbildungsangebote konzipiert mit dem Ziel des Aufbaus professioneller Kompetenzen. Andererseits könnten einige der konzeptuell angelegten Beiträge dieses Bands durchaus als Vorstudie für Forschungsprojekte mit Leistungsmessungen dienen, oder ihr Material wurde dazu bereits genutzt (z. B. Conk; Conk et al.).
In Bezug auf die inhaltlichen Interessen lassen sich im Querschnitt der Beiträge Schwerpunkte feststellen. Besonders häufig werden der Aufbau der professionellen Unterrichtswahrnehmung (professional vision) und der Analyse- und Reflexionsfähigkeit als Ziel der Arbeit mit Unterrichtsvideos genannt (z. B. Conk; Conk et al.; Mahler & Bäuerlein; Roggensinger et al.; Laubscher et al.). Die Dimension der Unterrichtswahrnehmung kann dabei die fachlichen Implikationen eines Unterrichtsgeschehens fokussieren (Imgrund; Jeisy: Wer ist besser?; Laubscher et al.; Messmer et al.; Rhiner & Bader; Savona et al.; Tobola Couchepin & Mili), oder sie richtet sich auf lernrelevante, fach- oder allgemeindidaktische Merkmale, wie etwa die kognitive Aktivierung (Bäuerlein et al.; Peter & Seeli; Roggensinger et al.). Weiter werden Unterrichtsvideos eingesetzt, um die professionell begründete Entscheidungskompetenz in beruflichen Handlungssituationen zu unterstützen (Bäuerlein et al.; Jeisy: Wer ist besser?; Kannengieser; Roggensinger et al.). Zudem eignen sich Unterrichtsvideos für die Förderung der für den Lehrberuf notwendigen kriteriengeleiteten Verbindung von theoretischen Grundlagen mit der Unterrichtspraxis (Conk; Conk et al.; Imgrund). Kommunikative Aspekte wie Interaktionen zwischen Lehrpersonen (Kannengieser; Roggensinger et al.; Savona et al.) oder zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen, beispielsweise mit Blick auf deren Feedbackkompetenzen (Conk; Rhiner & Bader) bilden weitere wichtige Inhalte der Arbeit mit Unterrichtsvideos. Etliche Beiträge im vorliegenden Band verweisen auf die Bedeutsamkeit der videobasierten Analysen zur Interaktion zwischen den Akteur*innen eines Unterrichtsgeschehens, zu Sprechhandlungen oder zur Verbindung von nonverbalen, körperlichen Ausdrucksweisen mit sprachlich-reflexiven Tätigkeiten (Kannengieser; Messmer et al.; Rhiner & Bader). Spannend wären in diesem Kontext vertiefte sozial- oder erziehungswissenschaftliche Videoforschungen zu Rollen und Rollenverständnisse im Unterrichtsgeschehen (ausgehend von Conk et al.; Jeisy: Wer ist besser?; Kannengieser; Rhiner & Bader; Roggensinger et al.).
Um die beschriebenen Ziele des beruflichen Kompetenzaufbaus zu erreichen, können Videos des eigenen Unterrichts sowie Videos zum Unterricht anderer Lehrpersonen eingesetzt werden. Zunehmend gehört es zu den Standards einer reflexiven Praxis, den eigenen Unterricht aufzunehmen und Aufnahmen in den beruflichen Austausch zu integrieren. Neben selbstreflexiven Übungen kann dies mit Gewinn im Rahmen kollegialer Unterrichtsentwicklung mit Videoclubs oder bei vergleichenden Leistungsbeurteilungen in Fachteams geschehen (Jeisy: Wer ist besser?; Kannengieser; Laubscher et al.; Roggensinger et al.; Savona et al.). Zu fragen ist jedoch, wie die Entwicklung der professionellen Unterrichtswahrnehmung im Berufsverlauf mit und ohne Interventionen und Impulsen von Expert*innenseite gestützt und verstetigt werden könnten. Es wäre daher interessant, wenn Studien zur Wirksamkeit der Arbeit mit Unterrichtsvideos in der Ausund Weiterbildung vermehrt auch hochschuldidaktische Modelle und Methoden aus der beruflichen Weiterbildung in ihre Ansätze einbeziehen würden (Conk et al.).
Technologische Entwicklungen
Die raschen technologischen Entwicklungen der letzten Jahre erlauben immer vielfältigere und immersivere Unterrichtszugänge. Daher sind diejenigen Beiträge, die sich bewusst mit Videotechnologien befassen, in einem eigenen Abschnitt versammelt. Allerdings gehen die meisten Beiträge des vorliegenden Bandes wenig differenziert auf die technische Anlage ihrer Projekte ein. Von den Fachinhalten her nutzen sie die angewendete Videotechnologie als Mittel zum Zweck. Meistens werden dazu eine bis mehrere Stand- und Rollkameras eingesetzt. Es könnte aber kritisch gefragt werden, ob die Studien davon ausgehen, dass die Videoaufnahmen das tatsächliche Unterrichtsgeschehen abbilden (Messmer et al.). Doch beeinflusst die Kameraperspektive den Blick auf ein Unterrichtsgeschehen (Mahler & Bäuerlein), und die Aufnahme- und Wiedergabetechnik wirkt sich ebenfalls auf die Wahrnehmungs- und Analysearbeit mit Unterrichtsvideos aus. Neue Technologien erweitern den Blick auf Unterrichtsdimensionen, zum Beispiel, indem 360-Grad-Kameras Einblicke in die Komplexität von Unterrichtssituationen sichtbar machen (Peter & Seeli). Demgegenüber fokussieren Eyetracking-Brillen bestimmte Perspektiven oder Ausschnitte eines Unterrichtsgeschehens; sie können die Wahrnehmung also auch verengen und den Fokus lenken (Mahler & Bäuerlein). Fest installierte Kameras und der Einsatz künstlicher Intelligenz erlauben Unterrichtsaufnahmen und ihre weitgehende Bearbeitung unabhängig von kameraführenden Lehrpersonen (Jeisy: Automatisierte Videoproduktion). Über die Aufzeichnungstechnologien hinaus wird es möglich, interaktive Videolernumgebungen einzusetzen, um Aspekte der beruflichen Kompetenzförderung, wie zum Beispiel die Entscheidungsfähigkeit, durch Branching-Szenarien zu unterstützen (Bäuerlein et al.).
Der vergleichende Einsatz unterschiedlicher Technologien (Mahler & Bäuerlein; Peter & Seeli) und die Erkundung neuester Entwicklungen (Bäuerlein et al.; Jeisy: Automatisierte Videoproduktion) stehen hier für methodisch ausgewiesene Forschungsansätze. Weiter wirken sich die Möglichkeiten der digitalen Distanzlehre auf Ausbildungsformate aus (Savona et al.). Die technologische Kompetenzförderung von Lehrpersonen (Ramillon) und die Möglichkeit, dass Studierende, Lehrpersonen oder Schüler*innen über individualisierte Tools wie Eyetracking-Brillen oder eigene Smartphones Unterricht aufnehmen und auswerten können, richten den Blick auf die lernenden Subjekte und sind hochschuldidaktisch anregend und herausfordernd.
Im Anbetracht dieser Perspektiven und Potenzialen neuer Technologien stellt sich die Frage nach einer zunehmenden Technologiesteuerung in der Arbeit mit Unterrichtsvideos. Als Teil des forschungsmethodischen Instrumentariums beeinflussen die Technologien die Wahrnehmung, Analyse und Kriterien der Aufnahmen, und damit auch die Fragestellungen der Forschung und der Ergebnisanalyse. In der oben erwähnten Quo-vadis-Diskussion wurde daher die pointierte Frage gestellt, ob dies letztlich nicht auch die didaktischen Grundlegungen und Fragestellungen des schulischen Unterrichts beeinflussen könnte.
Fachbereiche und Zielgruppen
Die meisten der im vorliegenden Band abgebildeten Studien fokussieren mit fachdidaktischen Fragestellungen den Fachunterricht und führen ihre Erhebungen an ausgewählten Unterrichtssequenzen durch. Die Fachbereiche reichen vom Bildnerischen Gestalten/Kunst über Französisch, Sport und Musik bis zur Mathematik. Im Kindergarten wird auch das Aufräumen zum Lerninhalt (Kannengieser). Die dargelegten Methoden und Ergebnisse einiger Studien sind vermutlich auf andere Fächer anwendbar. Oder es wäre zu ergründen, weshalb ein spezifisches Fach als geeignetes Setting für die Studie angesehen wird (z. B. Jeisy: Automatisierte Videoproduktion; Roggensinger et al.; Tobola Couchepin & Mili). Einzelne Beiträge beziehen sich auf den Fachunterricht im Allgemeinen (Ramillon) beziehungsweise auf allgemeindidaktische oder erziehungswissenschaftliche Aspekte von Unterricht (Bäuerlein et al.; Mahler & Bäuerlein).
Die hier dargestellten Projekte beziehen sich auf die Lehrpersonenbildung für den Kindergarten, die Primarstufe und die Sekundarstufe I, oder sie verfolgen einen stufenübergreifenden beziehungsweise stufenunabhängigen Ansatz (Anhang I: Übersicht der Beiträge). Zielgruppen sind Dozierende, die bei ihrer Tätigkeit in der Lehrpersonenausbildung unterstützt werden sollen (z. B. Conk et al.; Jeisy: Wer ist besser?), Studierende der Grundausbildung (z. B. Bäuerlein et al.) sowie (Praxis-)Lehrpersonen und Heilpädagog*innen in Weiterbildung (z. B. Laubscher et al.). Der Fokus auf die Schüler*innen und deren Kompetenzaufbau schwingt bei vielen Beiträgen als Horizont zwar mit, wird jedoch nur selten näher beleuchtet (Messmer et al., Rhiner & Bader). Weitere Forschungsprojekte wäre sicherlich auf die Schüler*innen als lernende Subjekte auszuweiten, denn mit geeigneten technologischen Mitteln können sie ihre Lerntätigkeiten filmen (Messmer et al.), selbstständig wahrnehmen und reflektieren.
Ausblicke und offene Forschungsfragen
Die vorausgegangene Diskussion umriss Interessensschwerpunkte und Fragestellungen im Zusammenhang mit der vorliegenden Beitragssammlung. Neben den bereits genannten Lücken gibt das reichhaltige Material des Bandes Anlass, weitere offene Entwicklungs- und Forschungsfelder zu skizzieren.
Die Forschungsbeiträge in diesem Band wählen überwiegend deduktive Vorgehensweisen, gehen von der Theoriebildung aus und verbinden diese mit der Wahrnehmung und Analyse einer videografierten Unterrichtssequenz. Induktive Zugänge, die von den unmittelbaren, auch lebensweltlich-beruflichen Bezügen der Studierenden und von den (angehenden) Lehrpersonen als Subjekte des Lernens und Unterrichtens ausgehen, stellen hingegen ein Forschungsdesiderat dar. Hier bieten sich Methoden der Fallarbeit an, die erlauben, Anliegen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Ressourcen aufzugreifen (Conk et al.; Imgrund; Laubscher et al.).
Etliche hier vorgestellte Projekte setzen zusätzlich zu den Unterrichtsvideos Begleitmaterialien ein: Aufträge, Lernspuren, Perspektiven der Lehrpersonen, didaktische Hinweise zum Einsatz der Videos (z. B. Conk et al.). Obwohl in einigen Beträgen erwähnt, bilden sie jedoch nirgends den eigentlichen Forschungsfokus.
Weitere Aspekte, die dieser Band nicht beleuchtet, betreffen heuristische, juristische oder auch ethische Themen der Unterrichtsvideoforschung im schweizerischen Kontext. Es stellen sich Fragen in Bezug auf die Zugänglichkeit zu Videodaten und zu deren Nutzung und Aufbewahrung, zum Beispiel wenn Videosammlungen lange nicht betreut werden oder Aufnahmen veralten, wenn Schüler*innen ihre Lerntätigkeiten über ihre Smartphones aufnehmen oder wenn Unterricht über eine umfassende technologische KI-Ausrüstung aufgenommen und bearbeitet werden kann (Jeisy: Automatisierte Videoproduktion).
Darüber hinaus wäre es wünschenswert und dringend notwendig, die praxisorientierte Videoforschung in ihrer Zweckbestimmung auch kritisch zu befragen. Hier wären Bezüge zur Videoforschung in anderen Berufsbildungen sowie vermehrte Kooperationen mit anderen Hochschulen wichtig, um videobasierte Grundlagenforschung, zum Beispiel zu disziplinären Fragestellungen, zu Themen der berufsübergreifenden Professionalität oder zu Interaktionsfragen, anzugehen.
Dank
Auf unseren Aufruf hin, im Anschluss an die Tagung vom Juni 2023 ihre abgeschlossenen, laufenden und geplanten Forschungen und Entwicklungen im Bereichder Unterrichtsvideografie vorzustellen, haben erfreulich viele Kolleg*innen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten Beiträge eingereicht. Wir danken ihnen an dieser Stelle herzlich für die Bereitschaft, sich über ihre reich befrachteten Alltagspflichten hinaus auf das Vorhaben einzulassen und diesen zukunftsweisenden Bereich in der Entwicklung der Lehrpersonenbildung mit dem vorliegenden Sammelband mitzugestalten.
Den Verantwortlichen der Pädagogischen Hochschulen Bern, FHNW und Schwyz danken wir für Pensen und die grosszügige finanzielle Unterstützung, um die herausgeberische Arbeit, die Drucklegung und die Veröffentlichung im Open-Access-Format zu ermöglichen. Christian de Simoni, Projektleiter und Lektor beim hep Verlag Bern, danken wir für die sorgsame Betreuung aller verlegerischen Arbeiten seit Beginn dieses Unterfangens.
Literatur
Adamina, M., Aebersold, U., Bietenhard, S., Eichelberger, E., Huber Nievergelt, V., Junger, S., Molinari, V., Nydegger, A., Probst, M., Wälti, B. & Weidmann, L. (2020). Kompetenzorientierte, fachspezifische Unterrichtsentwicklung: Professionalisierung von Lehrpersonen durch fachdidaktische Fallarbeit. hep.
Holodynski, M. & Meschede, N. (2022). Videobasierte Lehre und Forschung in der Lehrkräftebildung – Quo vadis? In R. Junker, V. Zucker, M. Oellers, T. Rauterberg, S. Konjer, N. Meschede & M. Holodynski (Hrsg.), Lehren und Forschen mit Videos in der Lehrkräftebildung (S. 197–218). Waxmann.
Kramer, C., König, J., Kaiser, G., Ligtvoet, R. & Blömeke, S. (2017). Der Einsatz von Unterrichtsvideos in der universitären Ausbildung: Zur Wirksamkeit video- und transkriptgestützter Seminare zur Klassenführung auf pädagogisches Wissen und situationsspezifische Fähigkeiten angehender Lehrkräfte. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 20(1), 137–164.
Krammer, K., Hugener, I., Biaggi, S., Frommelt, M., Fürrer auf der Maur, G. & Stürmer, K. (2016). Videos in der Ausbildung von Lehrkräften. Förderung der professionellen Unterrichtswahrnehmung durch die Analyse von eigenen bzw. Fremden Videos. Unterrichtswissenschaft, 44(4), 357–372.
Moser, T., Petko, D. & Reusser, K. (2010). Unterrichtsvideos.ch: Eine digitale Bibliothek für videobasierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In S. Mandel, M. Rutishauser & E. Seiler Schiedt (Hrsg.), Handbook of Research on teacher education (S. 449–450). Macmillan.
Reusser, K. & Pauli, C. (2003). Mathematikunterricht in der Schweiz und in weiteren sechs Ländern. Bericht über die Ergebnisse einer internationalen und schweizerischen Video-Unterrichtsstudie [Schlussbericht mit Videodokumentation]. Pädagogisches Institut, Universität Zürich.
Reusser, K., Pauli, C., Brühwiler, C., Heitzmann, A., Niggli, A., Tettenborn, A. & Tremp, P. 17 (Hrsg.). (2014). Videobasierte Fallarbeit/Kasuistik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 32(2).
Seidel, T. & Thiel, F. (2017). Standards und Trends der videobasierten Lehr-Lernforschung. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 20(S1), 1–21. https://doi.org/10.1007/s11618– 017–0726–6





























