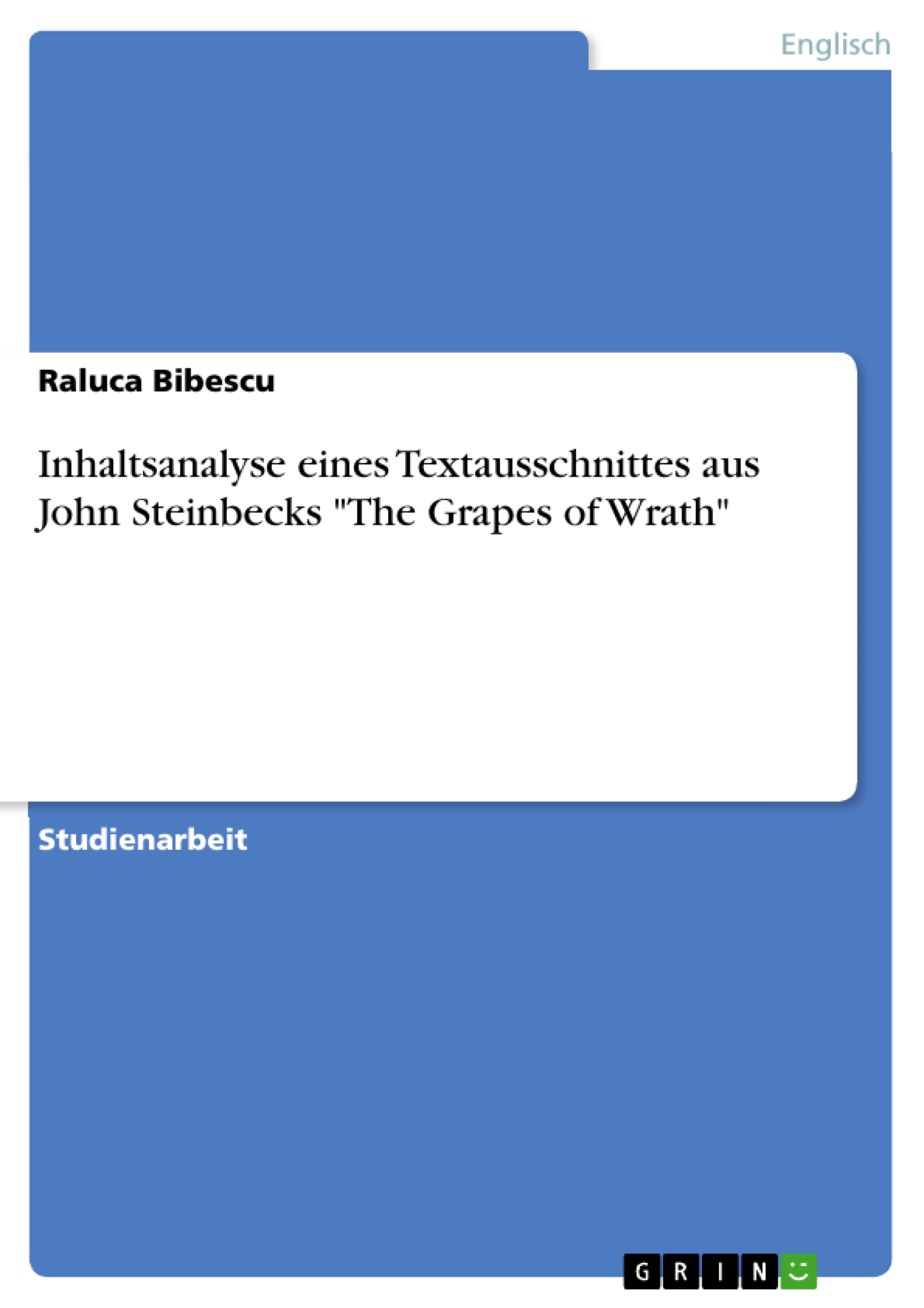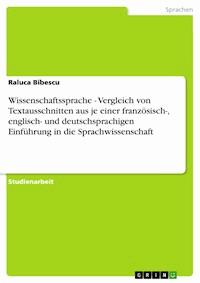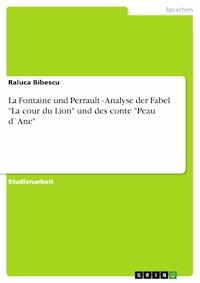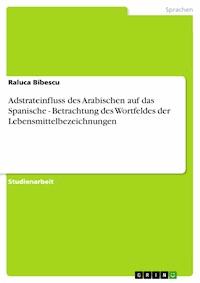36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Französische Philologie - Linguistik, Note: 1,7, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Romanisches Seminar), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Gebrauch der Sprache in der Wissenschaft kann nur dann sinnvoll analysiert werden, wenn man den Untersuchungsgegenstand präzisiert. In der vorliegenden Arbeit ist die Wissenschaft durch die geisteswissenschaftliche Disziplin Sprachwissenschaft repräsentiert. Den Gegenstand Sprache grenze ich ein, indem ich die Konstante meiner Untersuchung festlege, nämlich die Textsorte, welche in diesem Fall die Einführung in die Sprachwissenschaft darstellt. Die wissenschaftlichen Texte variieren in Abhängigkeit von Wissenschaftszweig und Disziplin sowie in Abhängigkeit von Verfasser- und Adressatengruppen. Sie weisen zwar einige allen Wissenschaftstexten gemeinsame Merkmale auf, haben aber auch spezielle Charakteristika und zum Teil einen jeweils eigenen „Jargon“. So unterscheiden sich z.B. der Stil geisteswissenschaftlicher Texte von dem naturwissenschaftlicher Texte und der Stil einführender Bücher für Studenten von dem Stil von Fachbüchern oder Fachartikeln, die für Wissenschaftler geschrieben wurden. Es ist daher schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, den Wissenschaftsstil zu beschreiben; vielmehr muss man bei einem Vergleich stets die Texttypenspezifik beachten, d.h. der Vergleich kann nur innerhalb einer Wissenschaftsgruppe, einer Autorengruppe und einer Adressatengruppe stattfinden. Die mir vorliegende Textsorte ist einführende Literatur in die Sprachwissenschaft mit jeweiliger Ausrichtung auf die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Diese Einführungen sind trotz der ähnlichen Thematik nicht gleich aufgebaut: Während eine Einführung zuerst ein Thema behandelt, behandelt eine andere Einführung ein anderes. Ich habe deshalb aus jeder Einführung die Kapitel ausgewählt, die sich mit der Phonetik beschäftigen, da dies ein Thema darstellt, das man in jeder beliebigen Einführung in die Sprachwissenschaft finden kann. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Unterschiede in Wissenschaftsstilen
Vergleich von deutsch-, französisch- und englischsprachigen
Page 3
1. Einleitung
Der Gebrauch der Sprache in der Wissenschaft kann nur dann sinnvoll analysiert werden, wenn man den Untersuchungsgegenstand präzisiert. In der vorliegenden Arbeit ist die Wissenschaft durch die geisteswissenschaftliche DisziplinSprachwissenschaftrepräsentiert. Den Gegenstand Sprache grenze ich ein, indem ich die Konstante meiner Untersuchung festlege, nämlich die Textsorte, welche in diesem Fall dieEinführung in die Sprachwissenschaftdarstellt. Die wissenschaftlichen Texte variieren in Abhängigkeit von Wissenschaftszweig und Disziplin sowie in Abhängigkeit von Verfasser- und Adressatengruppen. Sie weisen zwar einige allen Wissenschaftstexten gemeinsame Merkmale auf, haben aber auch spezielle Charakteristika und zum Teil einen jeweils eigenen „Jargon“. So unterscheiden sich z.B. der Stil geisteswissenschaftlicher Texte von dem naturwissenschaftlicher Texte und der Stil einführender Bücher für Studenten von dem Stil von Fachbüchern oder Fachartikeln, die für Wissenschaftler geschrieben wurden. Es ist daher schwierig, wenn nicht sogar unmöglich,denWissenschaftsstil zu beschreiben; vielmehr muss man bei einem Vergleich stets die Texttypenspezifik beachten, d.h. der Vergleich kann nur innerhalb einer Wissenschaftsgruppe, einer Autorengruppe und einer Adressatengruppe stattfinden. Die mir vorliegende Textsorte ist einführende Literatur in die Sprachwissenschaft mit jeweiliger Ausrichtung auf die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Diese Einführungen sind trotz der ähnlichen Thematik nicht gleich aufgebaut: Während eine Einführung zuerst ein Thema behandelt, behandelt eine andere Einführung ein anderes. Ich habe deshalb aus jeder Einführung die Kapitel ausgewählt, die sich mit der Phonetik beschäftigen, da dies ein Thema darstellt, das man in jeder beliebigen Einführung in die Sprachwissenschaft finden kann. Meines Erachtens ist es nicht sinnvoll, die Biographien der einzelnen Autoren auf ihre muttersprachliche Zugehörigkeit und die unterschiedlichen fremdsprachlichen Einflüsse hin untersuchen zu wollen, denn auch bei genauer Recherche ließen sich in keinem Fall die psychologischen Faktoren in ausreichendem Maße erfassen, die für die sprachlichen Fähigkeiten und Vorlieben mit ausschlaggebend sind. Hinzu kommt natürlich, dass es sich bei den Autoren um Linguisten handelt, die sich im Laufe ihres Lebens in verschiedene Sprachräume aufgehalten haben und die davon im gewissen Umfang beeinflusst wurden. Ich gehe
Page 4
bei meiner Untersuchung davon aus, dass die Autoren die Wahl zwischen verschiedenen Sprachen bei ihren Publikationen hatten und ihre Entscheidung kann man als Indiz dafür nehmen, dass die Autoren für die gewählte Sprache eine Präferenz, wenn nicht eine dominierende Kompetenz haben. Kompetente Benutzer einer bestimmten Sprache beherrschen auch die Verwendung der textuellen Konventionen der jeweiligen Sprache. Das bedeutet, dass ein Autor zu unterscheiden weiß, welche textuellen Konventionen er in welcher Sprache realisieren muss, damit sein Text nicht nur als ein Text z.B. in französischer Sprache, sondern als ein französischer Text rezipiert wird. Diese zumindest intuitive Kenntnis und Verwendung von Textkonventionen spielt eine große Rolle bei der Textproduktion und -rezeption.
Wenn ich in dieser Arbeit die wissenschaftlichen Stile der deutschen, englischen und französischen Tradition beschreibe, so ist das nicht ganz unproblematisch, da ich selbst auch in einer bestimmten Wissenschaftstradition stehe, von der meine Sichtweise und Wahrnehmung beeinflusst werden. Dennoch werde ich natürlich versuchen, so objektiv wie möglich zu beschreiben.
Page 5
2. Zum Verhältnis zwischen Kultur und Sprache
Meiner Arbeit liegt die Erfahrung zugrunde, dass trotz einer immer weiter fortschreitenden Internationalisierung und Anglisierung der Wissenschaften unterschiedliche Traditionen und Konventionen in den einzelsprachlichen Realisierungen wissenschaftlicher Texte zutage treten. Bevor ich im weiteren Verlauf dieser Arbeit den Vergleich von Texten vornehme, die zu verschiedenen Kulturen gehören, möchte ich zunächst kurz auf den Begriff der `Kultur` eingehen. Als Einstieg in die Thematik möchte ich die Erfahrungen eines mexikanischen Studenten beim Verfassen einer deutschen literaturwissenschaftlichen Seminararbeit anführen:
Während der letzten Wochen habe ich mich mit Hilfe von Wörterbüchern, Grammatik und Fragen an meine Freunde um das bestmögliche Verständnis einer romantischen Erzählung bemüht. Ich habe mir genaueste Notizen gemacht. … Ein deutscher Freund, der hervorragend Spanisch spricht, half mir mit sprachlichen Korrekturen, so daß das Deutsch fehlerfrei war. Eine Woche später bestellte mich der Dozent Sch. in seine Sprechstunde. „Ich kann Ihre Arbeit nicht beurteilen“, sagte er knapp. „Sie halten sich nicht an die deutschen Forschungsmethoden.“ Ich war erstaunt… .
„Ich sagte Ihnen, ich kann Ihre Arbeit einfach nicht beurteilen“, sagte er noch einmal und fügte hinzu: „ Und wie steht es mit der Bibliographie?“
Es stimmte, daß ich als Bibliographie lediglich das analysierte Buch angegeben hatte. Ich erklärte: „Die Bibliographie reicht doch nicht aus, um eine Arbeit zu beurteilen, ebensowenig wie Fußnoten. Zitate von anderen Autoren reichen doch nicht aus, um einem Text Qualität und Gültigkeit zu verleihen, ebensowenig wie eine Bibliografie zur besseren Erklärung beiträgt. Ein Freund von mir hat einen Katalog1verfasst und dafür eine gute Note bekommen. Das ist doch heute nicht mehr möglich. Kataloge sind schon genug geschrieben worden. Das, was normalerweise fehlt, ist doch die Kreation, der persönlichen Beitrag.“
Der Dozent Sch. rückte mit spitzen Fingern seine Brille zurecht… „Ich wiederhole noch einmal, daß ich Ihre Arbeit nicht beurteilen kann. Wie sind Sie vorgegangen?“
„Ich kann Ihnen all meine Aufzeichnungen zeigen“, antwortete ich, „den vollständigen Plan, den ich mir für meine Arbeit gemacht habe. Eine solche Arbeit entsteht doch nicht von selbst. Sie hat mich viele Stunden am Schreibtisch gekostet. Sie müssen doch auch bedenken, daß so eine Arbeit schon schwer für einen deutschen Studenten ist, um wieviel schwerer ist sie erst für einen ausländischen Studenten.“ …
1„Katalog“ ist hier zu verstehen als reine Aufzählung bzw. Auflistung von Sekundärliteratur.
Page 6
„Ihre Arbeit lässt sich leicht lesen, ist ansprechend geschrieben, aber Sie müssen einfach das Trockene akzeptieren, das Langweilige. Gehen Sie zu einem Seminar über literarische Theorie“, empfahl er mir lächelnd.
Ich entgegnete: „Wie viele Bücher muss ich denn gelesen haben, damit meine Arbeit gut ist? Wie trocken soll sie denn sein, damit sie ernst genommen wird? Wie langweilig muss sie sein, damit es sich lohnt, sie zu lesen?“ …
„Nein, nein. Es geht nicht darum“, sagte er ein bisschen verzweifelt, „es geht darum, daß Sie sich an uns anpassen.“
Auf einmal konnte ich kein Deutsch mehr sprechen oder verstehen… .
„Ihre Arbeit ist wirklich ansprechend. Könnte es sein, dass Sie einen Essay geschrieben haben?“ fragte der Dozent Sch. „Ja, es könnte ein Essay sein“, antwortete ich. „Also, hier sind wir gegen `Essayismus`“, sagte er entschieden. …
Traurig nahm ich meine Unterlagen, warf mir meinen Schal um und verließ das Germanistikgebäude. Ich schickte meine Arbeit zusammen mit einem Beschwerdebrief an akademische Prüfungskommissionen. Aus Bonn erhielt ich ein Antwortschreiben, indem man mir empfahl, ein Seminar für Anfänger zu besuchen.2
Was ist hier passiert? Der mexikanische Student scheint die Erwartungen des deutschen Dozenten mit seinem in der mexikanischen Wissenschaftstradition geschriebenen Text nicht erfüllt zu haben, trotz sprachlicher Korrektheit. Der Dozent beurteilt den fremden Text nach den Kriterien des eigenen (deutschen) Textwissens und empfindet diesen als abweichend und befremdlich. In diesem konkreten interkulturellen Kontakt stoßen zwei verschiedene Formen wissenschaftlicher Kommunikation aufeinander, welches auf beiden Seiten Unverständnis auslöst. Sowohl dem mexikanischen Studenten als auch Herrn Sch. ist „etwasgeheim geblieben“.3
Wenn wir über Kultur sprechen, müssen wir uns zunächst fragen, was der Terminus genau meint. Mit dem Kulturbegriff gehen allerdings große Definitionsschwierigkeiten einher. Die inhaltliche Bedeutung des Kulturbegriffs variiert von Gesellschaft zu Gesellschaft und auch in den Einzelwissenschaften wird
2Ojeda, Jorge Arturo:Cartas Alemanas,Mexico City, 1972:111f., (Übersetzung von Eßer).
Im mexikanischen Buch „CartasAlemanas“(„DeutscheBriefe“)verarbeitet ein Mexikaner
seine Erfahrungen in Deutschland.
3Der Ausdruck „etwasist mir geheim geblieben am deutschen Referat“habe ich von Esser
übernommen, die diesen wiederum von einer spanischen Studentin übernommen hatte, die
sich so in einem Fragebogen bezüglich ihrer Schwierigkeiten beim Verfassen deutscher
Referate geäußert hatte. (Eßer 1997:9f.)
Page 7
der Begriff unterschiedlich gebraucht. Wegen der definitorischen Schwierigkeiten und der Fülle von existierenden Kulturkonzepten und -definitionen möchte ich mich hier darauf beschränken, Rehbeins4Kulturkonzept wiederzugeben. Kultur ist ein mehrdimensionales Phänomen. Sie besitzt sowohl eine synchrone, systematische Dimension als auch eine diachrone, historische Dimension. In ihrer systematischen Dimension ist Kultur ein für eine gesellschaftliche Gruppe aktuell geltendes Ensemble von gleichen, selbstverständlichen und funktionalen Verhaltensweisen. In ihrer zeitlichen Dimension ist Kultur zu begreifen als das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, also als geschichtlich begründete, gemeinsame Vorstellungen, Denkweisen, Gefühle, Verhaltens- und Existenzformen. Kultur ist nicht identisch mit Nation. So gibt es verschiedene Subkulturen innerhalb einer Nation oder auch nationenübergreifende Kulturen. Kultur ist primär bedingt durch die gemeinsame Selbstverständlichkeit des Denkens, Fühlens und Handelns einer Gruppe und nicht durch den Besitz bestimmter Reisepässe. Schriftliche und mündliche Texte derselben Textsorte aus verschiedenen Kulturen weisen vielfach große Unterschiede in ihrem Textmuster auf. Diese Unterschiede können zu erheblichen Schwierigkeiten und Missverständnissen sowohl bei der Textproduktion in fremder Sprache als auch bei der Textrezeption führen.
Welches Verhältnis besteht nun zwischen Kultur und Sprache? In der Sprache manifestieren sich die Vorstellungen, Denkweisen, etc. einer gesellschaftlichen Gruppe, d.h. Sprache wird zum Medium, durch das sich Kultur ausdrückt. Mit anderen Worten: Kultur prägt die sprachlichen Ausdrucksformen.5Texte entstehen also nicht im luftleeren Raum - sie sind Produkte ihres kontextuellen Umfeldes und werden durch viele Faktoren beeinflusst. Anna Mauranen formuliert das Verhältnis von Kultur und Texten folgendermaßen:
4Redder, Angelika/Rehbein, Jochen 1987 „Zum Begriff der Kultur“, In: Redder, A./Rehbein,
J. (Hgg.)Arbeiten zur interkulturellen Kommunikation. Osnabrücker Beiträge zur
Sprachtheorie 38
5Eßer, Ruth 1997:„Etwas ist mir geheim geblieben am deutschen Referat“,München, S. 19
6Mauranen, Anna:Cultural Differences in Academic Rethoric. A Textlinguistic Study,
Frankfurt am Main, 1993
Page 8
Aber wie können wir bestimmte Faktoren im Umfeld des Autors auswählen und rechtfertigen, dass genau diese eine Wirkung auf seine akademische Verhaltensweise haben? Dabei kämen einfach zu viele Variablen ins Spiel und deswegen wäre dies eine unmögliche Aufgabe. Trotzdem können wir zumindest vermuten, dass die Muttersprache des Autors, die mit seiner sprachlichen Identität zusammenhängt, eine große Rolle spielt. Ein anderer wichtiger Einflussfaktor könnte die akademische Welt sein, die die akademische Identität des Autors erheblich beeinflusst. Der dritte Faktor wäre die vom Autor ausgewählte Disziplin und die disziplinäre Identität, die damit einhergeht. Als vierter Faktor führt Fløttum die Aspekte auf, die die Gattung und die akademische Gemeinschaft betreffen.7Das Kommunikationsverhalten ist also kulturell geprägt. So wie nonverbale Kommunikationselemente wie Gestik, Mimik, Körperhaltung und Blickkontakt variieren, so sind auch Redebeginn, Sprecherwechsel, Turntakingsignale, Art und Länge der Redebeiträge usw. von Kultur zu Kultur verschieden. Als es in den sechziger Jahren zu einem großer Zustrom von Studenten der verschiedensten Nationalitäten an amerikanische und westeuropäische Universitäten kam, stellte man fest, dass das was diese ausländischen Studenten schrieben, nicht zwangsläufig falsch war, sondern einfach anders. Kaplan, der beeinflusst wurde von der Sapir-Whorf-Hypothese, ging damals schon von einer gegenseitigen Beeinflussung von Sprache und Kultur aus.