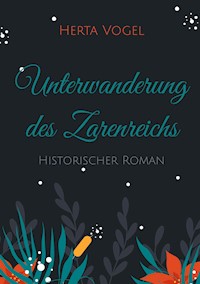
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Rußlanddeutsche "Helden" des Romans, ansässig in Großstädten und mehreren Kolonien Rußlands, werden in kriminelles "Leben, Lieben, Leiden" verwickelt und mit Lügen, Mord, Gewalt und Schrecken konfrontiert. Alles in diesem Buch ist Wahrheit, und nur Wahrheit. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit, denn Die läßt sich nicht zwischen zwei Buchdeckel klemmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Präambel
Kapitel 1 Petersburg, Tobolsk, Jekaterinburg, 1912 bis 1917
Kapitel 2 Petersburg, Samara, Brest-Litowsk, 1917 – 1918
Kapitel 3 Fürstenstein, Milchfluss, Juschanlee, 1917 – 1918
Kapitel 4 Milchfluss-Kolonie, 1918 – 1919
Kapitel 5 Halbstadt, Odessa, Omsk, Kronstadt, Krim, Gorki 1920 – 1924
Schluss / Dank / Quellen
Literatur- Verzeichnis:
Präambel
»Die Oktoberrevolutionund der Bürgerkrieg waren eine welthistorische Katastrophe, ausgelöst von der Machtbesessenheit einer Parteispitze. Und all die Schrecken und Gräuel, angefangen mit dem Meuchelmord an der Zarenfamilie, die nachfolgenden Hungersnöte, Massen-Erschießungen und Epidemien waren nicht vereinzelte Übergriffe und bedauerliche Betriebsunfälle. Das war Wahnsinn, der Methode hatte!«Johann Warkentin: »Russlanddeutsche – WOHER? WOHIN?« (Aus »Ins Gestern tauche ich ein« S. 47 – eine Dokumentation der Künstlergilde zur Tagung »Sowjetdeutsche Literatur heute« in Berlin am 18.-20. Oktober 1990. Esslingen, 1994). ISBN 3-925125-26-4
Die »Unterwanderung« besteht aus Kurz-Romanen, Doku-Berichten und Essays, die durch den roten Faden aus Erzählern, Orten, handelnden Personen eng miteinander zu einem Panorama verbunden sind. Hier geht es um Menschen, die alle Ereignisse und Widrigkeiten der russischen Geschichte um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert entweder als Täter aktiv herbeiführten, ihnen bewaffneten Widerstand leisteten oder als wehrlose Opfer erdulden mussten und zugrunde gingen. Der Erste Weltkrieg führte über die bolschewistische Revolution und den Bürgerkrieg zur Vorbereitung der »materiellen Basis der Weltrevolution«.Das Wirken, Leiden und Sterben der Zivilisten dieser Zeit wurde bisher von Historikern jeglicher Couleur zu wenig, zu allgemein, so zusagen »aus der Vogelperspektive« behandelt. Mit Erinnerungen von überlebenden Heimkehrern der 1980er/90er Jahre und mit Hilfe von Briefen und Tagebüchern, geschrieben zwischen den Jahren von 1900 bis 1980, werden hier einige Tatsachen präzisiert und zurechtgerückt, damit die Kirche immerhin im Dorfe bleibe.
KAPITEL 1
PETERSBURG, TOBOLSK, JEKATERINBURG, 1912 BIS 1917
1
Es ist das Privileg der Romandichter, Geschichte mit wallender Fantasie zu interpretieren, ohne Beweise liefern zu müssen. Um einen spannenden Roman zu erzählen, verdichten wir nun das Sein und Dasein und lassen die Kirche im Dorf.
Die Geschichte fängt wie ein schönes Märchen an: Es war einmal …
In einem großen reichen Land lebte einst ein Prinzenpaar, das sich innig liebte. Doch sie lebten nicht glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Weil ihr Geschlecht unter einem Fluch stand und das Land viele Feinde hatte, geriet das Prinzenpaar bald in große Not.
Hier blicken wir zurück, holen etwas weiter aus und beginnen ein neues Märchen.
Das letzte russische Zarenpaar Nikolaus und Alexandra hatten vier wunderschöne Töchter – Olga, Tatiana, Maria und Anastasia, bevor der ersehnte Thronfolger Alexej das Licht der Welt erblickte. Die Kinder wuchsen in Zarskoje Selo (30 km südlich von St. Petersburg) im kaiserlichen Palast auf. Diese Sommerresidenz der Zaren und die um sie herum gewachsene Stadt war seit 1837 mit St. Petersburg durch die erste russische Eisenbahn verbunden. Und als erster Ort auf dem Europäischen Kontinent hatte die Stadt schon 1887 elektrische Beleuchtung. Die Zarenfamilie lebte in zivilisierten Verhältnissen, umgeben von prunkvoller Architektur und zeitloser Kunst.
Die Zaren-Kinder besuchten keine Schulen, bekamen aber eine Ausbildung besonderer Art. Sie reisten mit ihren Eltern nach Europa zu ihren nahen Verwandten an den englischen, dänischen und deutschen Herrscher-Hof. Sie verbrachten die Sommermonate in Livadia auf der Krim, wo sie Natur- und Volksnähe erlebten. Sie wurden vom Schweizer Hauslehrer Pierre Gilliard und vom russischen Hauslehrer Piotr Wassiljewitsch Petrow in allen notwendigen Fächern unterrichtet. In russischer Geschichte, Naturkunde und Geographie unterwies sie ihr Vater – der Zar selbst. Von frühester Kindheit an wurden sie mehrsprachig erzogen: Deutsch und Englisch sprach mit ihnen ihre Mutter; Russisch sprachen sie mit ihrem Vater und ihren zahlreichen Verwandten; Französisch sprach am Hof der russische Adel.
Die Großfürstinnen kleideten sich elegant und geschmackvoll, aber auch schlicht, bequem und ohne Prunk. Sie waren erstaunlich modern, standen im Mittelpunkt des Medien-Interesses ihrer Zeit. Die Mädchen beschäftigten sich gerne mit Fotografie, Tennis, Reiten, sie machten weite Spaziergänge, mochten Schiffsfahrten und vergnügliche Nachmittage mit ihren zahlreichen gleichaltrigen Verwandten. Im Winter machten sie Schlittenfahrten mit Dreigespann und Glöckchen durch den verschneiten Wald. Auch am Schlittschuh- und Skilaufen hatten sie großen Spaß.
Die Zarentöchter waren das blühende Leben selbst, humorvoll und selbstbewusst. Ihr ganzer Charme bestand aus ihrer außerordentlichen Einfachheit, Offenheit, Frische und ihrer instinktiven Herzensgüte. – So erinnerten sich ihre Hauslehrer an sie.
Und weil die Großfürstinnen eben so intelligent, gebildet und weltoffen waren – nicht auf den Kopf und nicht auf den Mund gefallen – so machten sie es »dem Fluch des Schicksals« und den »drohenden dunklen Mächten« nicht ganz einfach. Sie wehrten sich …
Weil die Mädchen auch optisch eine Augenweide waren, ließen auch die »Edlen Prinzen und Tapferen Ritter« nicht lange auf sich warten: Sie waren zur Stelle, versuchten die Schönen aus der Macht der Bösen zu befreien, und teilweise gelang es ihnen auch.
Das ist nun das neue Märchen.
Bereits Ende Oktober zog in Petersburg der trockene Frost ein. Die Bäume und Sträucher der Alleen, Parks und Gärten hüllten sich in kuscheligen Reif. Sie glänzten entzückend in den gleißenden kalten Sonnenstrahlen. Die Teiche im Taurischen Garten froren zu. Nachdem ihr Eis getestet war, eröffnete die Hofverwaltung die Schlittschuhbahn.
Der Garten war von einem hohen vergoldeten Gusseisen-Gitter eingezäunt. Zum Eislaufen wurde man nur mit besonderen Erlaubniskarten zugelassen. Dort versammelten und trafen sich Jugendliche der Petersburger »Welt«. Da ließen sich Großfürstinnen, Zarentöchter und viele berühmte Schönheiten sehen. Hübsch gebaute und zart bestückte Prinzessinnen in kostbaren Pelzen und langen Stiefeln glitten leise und elegant über das Eis.
Manchmal kam auch Zar Nikolaus selbst in den Garten, setzte sich, in einen warmen Pelz gehüllt, in einen Sessel am Rande der Eisbahn, ließ sich eine große Tasse heißen Tees bringen und sah den jungen Leuten auf der Eisfläche zu. Dabei schwelgte er in Erinnerungen an seine eigene unbeschwerte Jugendzeit.
Da St. Petersburg in der Nähe des Nord-Polarkreises liegt, dunkelte es hier sehr früh und der Taurische Garten erstrahlte in hellem elektrischem Licht.
Wie üblich, spielte auch an diesem Donnerstag auf der Eisbahn das Militärorchester und die Musik war in der klirrenden Frostluft in allen Alleen des Parks zu hören. In weißen Hermelinpelzjacken und Kappen betraten Olga und Tatiana graziös und geschickt das blaue, von den Schlittschuhen noch nicht zerfahrene Eis des Teiches. Hand in Hand führten die Schwestern ihre erste Runde um den Teich aus.
Inzwischen tummelte sich schon viel fröhliches Jung-Volk auf der Eisbahn.
Die 17jährige Olga war in diesem Herbst sehr hübsch und fast erwachsen geworden. Ihre Figur wirkte anmutig und zerbrechlich wie aus Bleikristall gearbeitet. Dunkle, rot schimmernde Locken lugten unter der Pelzkappe hervor und umrahmten ihr zartes Gesicht.
Tatiana führte sehr elegant alle möglichen Figuren und Schritte aus. Sie fiel den Zuschauern durch ihren hohen Wuchs, die schlanke Taille und die scharf geschnittenen Züge ihres jugendlichen, aber ernsten Gesichtes auf. Zu ihrem Verdruss liefen Lyzeums-Schüler und Pagen ihr nach und umschwärmten sie.
Mehrere der hier anwesenden Offiziere liefen ruhig, mit langen Schritten und hatten ihre Hände auf dem Rücken verschränkt.
Unter ihnen fiel ein junger Rittmeister der Gardekavallerie völlig aus dem Rahmen: Er flog buchstäblich aus dem Pavillon, rief frech: »Hier kommt Andy Bode!« und schoss jauchzend durch die Menge.
Er trug seine Uniform ohne Mantel und hohe weiche Reitstiefel mit angeschraubten Schlittschuhen. Er machte Sprünge, beschrieb Schnörkel und Schleifen, wurde immer schneller und wirbelte direkt auf die Zarentöchter zu. Kurz vor ihnen machte er einen Luftsprung, bremste scharf und fuhr nach einer raschen Drehung mit langen ruhigen Schritten davon. Selbstbewußt, unbekümmert und mit Elan führte er seine Kunst vor. Man sah – er war auf dem Eis kein Anfänger. Alle sahen ihm nach: Von hohem Wuchs, mit schönem dunklem Lockenkopf, Backenbart und von der Kälte geröteten Wangen sah er bezaubernd aus.
Als Paarlaufen veranstaltet wurde, warteten die Damen gespannt, wen der junge »Gott der Eisbahn« zur Partnerin wählen würde. Er glitt schnurstracks an allen Schönheiten vorbei, blieb vor Großfürstin Olga stehen, verbeugte sich leicht und stellte sich vor: »Sie gestatten? Adrian Bode, Rittmeister des Zaren.« Das entsprach zwar nicht der Hofetikette, der nach Prinzessinnen und Zarentöchter sich ihre Partner selber wählten, aber Großfürstin Olga nahm diese Einladung an. »Olga Nikolajewna«, stellte sie sich schlicht vor, legte ihre Hand auf seinen leicht gebeugten Arm und ließ sich von ihm zur Mitte der Eisbahn führen, wo sich elegante Paare zum Tanz aufstellten.
Unter den Klängen herrlicher Musik schwebte Großfürstin Olga in den Armen dieses Unbekannten über das Eis … Sie drehten graziöse Kreise und Schleifen, tanzten Quadrille, Polka und Walzer. Als das Orchester schwieg, sah Olga die ganze Welt um sich herum nur noch in Rosa. »Sagen Sie bitte, Herr Bode, wo haben Sie so das Eislaufen gelernt?«, fragte sie ihren Tanzpartner mit lustigem übermütigem Feuer in ihren goldig glänzenden Augen.
»Zu Hause, auf dem Gut meines Vaters«, kam genau so fröhlich und spontan die Antwort. Adrian sah die geröteten Wangen und das entzückende Lächeln auf den elegant geschwungenen Lippen der jungen Dame. »Mit Ihnen möchte ich ewig tanzen, Olga Nikolajewna«. Lächelnd geleitete er sie zum Pavillon, wo Tatiana schon auf sie wartete.
Am darauffolgenden Sonntag spielte im Taurischen Garten wieder das Militärorchester.
Als Zar Nikolaus mit seinen Leibwächtern auf der Eisbahn erschien, spielte das Orchester die Nationalhymne: »Boshe, Zaria chrani/ Gott, schütze den Zaren.«
Rittmeister Adrian war wieder da und forderte Olga zum Tanz auf. Olga richtete ihm ihren Blick zu: »Sagen Sie mal, Rittmeister, wo sind Sie denn zuhause? Wo liegt das Gut Ihres Vaters?« – »O, weit weg von hier im Osten – an der Wolga, im Gebiet Samara«.
Am kalten Winterabend stand Tatjana am Fenster, fröstelnd zog sie ihr Jäckchen über der Brust zusammen und sah gelangweilt in den von Straßenlaternen beleuchteten Park hinaus. Dann wandte sie sich zu ihrer Schwester Olga um, die vor ihrem Frisiertisch saß und sich ihre prächtigen Locken kämmte. »Bist du vielleicht in den Rittmeister verliebt?«, neckte Tatiana ihre Schwester. »Habt ihr euch schon geküsst? – Gib es ruhig zu.« »Sei doch nicht albern!«, gab Olga zurück. »So schnell geht das doch nicht. Manchmal …« sie ließ den Satz unvollendet. »Er tanzt auf dem Eis einfach fabelhaft! Ich gebe zu, er gefällt mir. Aber ob es gleich Liebe ist? Jedenfalls kann ich den alten Vetter unseres Vaters nicht leiden. Was glaubt der eigentlich, wer ich bin? Ohne mich zu fragen, hält er bei den Eltern um meine Hand an! Sind wir hier im Mittelalter oder was?! Da ist mir der Rittmeister natürlich viel angenehmer«. Wenn sie ehrlich war, müsste Olga zugeben, dass sie sich ganz gern vom Rittmeister Adrian küssen ließe. Aber bis jetzt hatte es noch keine Gelegenheit dazu gegeben.
Noch einige Male gingen die Schwestern Olga und Tatiana auf die Eisbahn. Mit klopfendem Herzen, sehnsüchtig hielt Olga vergebens Ausschau nach dem Rittmeister. Er tauchte dort nicht mehr auf. Das machte sie traurig. Sie hätte ihn so gerne etwas näher kennengelernt, war er doch so erfrischend anders, als die jungen Herren aus ihrer Umgebung. War sie vielleicht wirklich verliebt? Olga lächelte nachdenklich, als Tatjana in ihr Gemach kam. Tatjana ahnte, dass sie ein vertrauliches Gespräch mit ihr möchte.
»Was das Leben für mich wohl bereithält?« Verträumt blickte Olga in die Ferne. »Ich will mein eigenes Leben führen und anderen Menschen nützlich sein. Ich möchte studieren … Geschichte, Kunst, Musik. Wie schön wäre es, Lehrerin, Erzieherin oder Kinderärztin zu sein. Auch wir Frauen haben Fähigkeiten und Talente. Warum sollen wir sie nicht pflegen, nutzen und einsetzen?« Mitleidig blickte Tatjana ihre Schwester an: »Das ist unmöglich – Papa wird das nie erlauben! Eine Zarentochter hat andere Aufgaben. Verstehst du? Noch nie hat eine Zarentochter …« – »Ich weiß, ich weiß! – Noch nie …« unterbrach sie Olga, warf den Kopf zurück und lachte bitter auf. »Die Zarentöchter mussten schon immer eine ‚gute Partie’ im Sinne der großen Politik machen. Es gibt aber auch andere Geschichten: Zarin Katharina zum Beispiel war eine kluge Politikerin, traf viele wichtige Entscheidungen für Russland und lebte selbstbestimmt«.
Eines Abends gab es einen Tumult auf der Eisbahn, als eine Granate im Garten explodierte und auf den Straßen Schüsse fielen. Olga begegnete hier ihren Lehrer Piotr W. Petrow und fragte ihn ganz verstört: »Wer macht denn so etwas? Wen stört es denn, wenn wir Schlittschuh laufen?« Der Lehrer war verlegen: Soll er? Darf er? Kann er es wagen, die Großfürstin über die wirtschaftliche Not des einfachen Volkes und die soziale Schieflage im Lande aufzuklären? Er versuchte es.
»Wissen Sie, Prinzessin, es gibt viele arme Leute, das Volk hungert und friert. Nur durch lautstarke Proteste kann es auf seine Notlage aufmerksam machen. Aber Granaten über den Zaun in den Park schleudern …«, sagte er nachdenklich »Nein, das tut nicht das Volk, das tun Terroristen, die auch immer wieder Anschläge auf bekannte Persönlichkeiten versuchen«.
Ab nun fanden im Taurischen Garten alle Veranstaltungen nur unter strengster Bewachung statt: Um den Garten patrouillierten Reiter, am Eingang und an allen Ausgängen standen Bewaffnete. Das bedrückte die Eisläufer und raubte ihnen die Freude.
»Es macht mir keinen Spaß mehr, Schlittschuh zu laufen«, beklagte sich Tatiana.
Ab nun gingen die Schwestern in diesem Winter immer seltener aufs Eis.
Als im Dezember die Sonne sich mit ihren langen Goldstrahlen im Gestrüpp verzappelte und auch zur Mittagszeit nicht über die Baumkronen des Gartens hinaufstieg, wurde es bedrückend düster im Zarenpalast. Olga weinte nun oft heimlich – vor Sehnsucht nach dem Rittmeister, der sich gar nicht mehr blicken ließ. Sie wusste natürlich, dass sie verschiedenen Gesellschafts-Schichten angehörten, dass sie sich keine großen Hoffnungen machen dürfte. Aber in den wenigen Minuten in seinen Armen hatte sie das Gefühl, eine verwandte Seele gefunden zu haben. Ist ihr denn auch das vergönnt?! Vielleicht hätten sie wenigstens gute Freunde werden können? Sie weiß nicht, ob, wo und wie sie ihn suchen soll und wen sie nach ihm fragen könnte?
Eines langen dunklen Winterabends, als Olga wieder einmal betrübt war, legte ihr Vater – der Zar seinen Arm um ihre Schultern und fragte sie teilnahmsvoll:
»Was ist denn los, mein großes Mädchen? Warum bist du so traurig?« Mit Tränen in den Augen vertraute sie ihrem Vater ihren Liebeskummer und die Sehnsucht an.
»Du musst dich doch nicht grämen, Prinzessin! Deine Mutter und ich kennen den Vater des Rittmeisters Adrian – den Baron August von Bode – schon lange. Wir sind mit ihm sogar befreundet. Sieh mal, meine Gemahlin – deine Mutter – stammt aus Darmstadt, wo auch die Familie Bode herkommt. Alle Söhne des Barons August sind Offiziere und Rittmeister der Garden. Leopold zum Beispiel, der ältere Bruder des Rittmeisters Adrian, ist Oberleutnant der Preobrashenski Garde – ein schneidiger junger Offizier; Johann – der älteste der Brüder – hat Veterinärmedizin studiert und ist Offizier unserer Kavallerie. Auf dem Gut seines Vaters betreibt er sehr erfolgreich eine eigene Pferdezucht. Die vielen anderen Geschwister leben auf dem Landgut der Familie in der Nähe von Samara. Ihr Petersburger Palast kann sich sehen lassen! Weißt du, wir werden sie mal auf ihrem Gut besuchen, damit du dir ein eigenes Bild von dieser rechtschaffenen Familie machen kannst.«
»Danke, Papa!« Olga strahlte ihrem Vater glücklich entgegen und küsste ihn auf die Wange.
2
Im Februar 1913 begannen in St. Petersburg, Moskau und allen anderen größeren Städten Russlands die Feierlichkeiten zum 300jährigen Regierungs-Jubiläum der Romanows. Aus diesem Anlass nahmen Olga und Tatiana an einer Militärparade teil. Die jungen Damen sahen in den Paradeuniformen ihrer Regimenter bezaubernd aus und wurden von den Zuschauern mit begeistertem Applaus begrüßt. Zu Beginn der Parade spielten mehrere Militär-Kapellen die Marseillaise und die Zarenhymne.
Dann ritten der Zar und seine Töchter in Begleitung der Garde-Generäle zu ihren Regimentern, die vor ihnen salutierten. Beim Vorbeimarsch sämtlicher angetretenen Kavallerie und Infanterie – insgesamt etwa sechzigtausend Mann – wurden vor Seiner Majestät die Fahnen gesenkt und die Zuschauer applaudierten im Takt der Musik.
Hier sah Olga ihren Rittmeister Adrian hoch zu Ross auf einem goldenen Falben und ihr Herz schlug höher: »Die Welt ist doch so schön!«
Kurz nach der Parade ging die Zarenfamilie auf Reisen: Seine Majestät besuchte Wladimir, Pskow und die Wolgastädte bis hinunter nach Zarizyn. Überall wurden der Zar und sein Gefolge mit Begeisterung empfangen.
Am Bahnhof von Samara wurden die Romanows von fünf Schlitten mit Dreigespann des Barons August von Bode abgeholt.
Es war ein frostiger sonniger Wintertag. Die Zarenfamilie mit Bediensteten und Hauslehrern, verpackt in lange Zobelpelze, fuhr mit klingenden Glöckchen in Begleitung einer Reitereskorte mehrere Stunden durch verschneite Wälder, Felder und Dörfer.
Der Wohnsitz des Barons August von Bode befand sich auf Gut Fürstenstein und sein Anwesen erstreckte sich über das Dorf Nikolajew und sieben kleinere Siedlungen und Güter.
Endlich fuhren die Schlitten durch einen hohen Torbogen auf ein Rondell. Sie hielten vor einem Herrenhaus und einem Schlösschen mit hohem Zinnen-Turm, die etwa im rechten Winkel zueinanderstehen. Die Romanows hatten den Wohnsitz des Barons erreicht.
Nach dem Mittagsmahl im Festsaal des Schlösschens begab sich Alexandra Fiodorowna in Begleitung ihrer Hofdame in ein Schlafgemach um sich nach der langen Reise auszuruhen.
Im herrlichen Park hinter dem Herrenhaus tummelte sich der zahlreiche Nachwuchs dieser Familie auf dem Eis eines großen Teiches. Auch alle Zarentöchter nahmen an diesem Spaß teil, sie scherzten und tobten mit ihren Altersgenossen ausgelassen herum. Dabei führte Rittmeister Adrian, der hier seinen Urlaub verbrachte, sein sämtliches Können im Eiskunstlauf vor. Es war ein unbeschwertes fröhliches Erlebnis für die Jugendlichen beider Familien, an das sie sich ihr Leben lang erinnern sollten.
Beim abendlichen Spaziergang durch den weitläufigen Park bot Adrian der Großfürstin Olga seinen Arm an: »Damit Sie nicht stolpern und ausrutschen in der Dunkelheit«. Sie legte dankbar ihre Hand auf seinen Unterarm. »Ich hatte gehofft, Sie im Taurischen Garten auf der Eisfläche wieder zu treffen. Ist was passiert? Warum kamen Sie nicht mehr?«
Verlegen stammelte er etwas. Sie blickte ihn an. »Gehen Sie mir … etwa … aus dem Weg? Weichen Sie mir vielleicht aus?« – Er betrachtete sie eine Weile.
»Das muss ich doch, Prinzessin, oder?« – »Bitte, Rittmeister, vergessen Sie die Großfürstin und auch die Prinzessin – sagen Sie mir einfach Du. Ich bitte Sie! Ich bin ein ganz normaler Mensch. Sagen Sie: Du Olga!«
Der Gedanke raubte ihm den Atem. Erstaunt wandte er ihr sein glühendes Gesicht zu.
»Du?! … Ja, gerne! Erinnerst Du dich an unsere erste Begegnung, auf dem Eis? Du warst wunderschön. Mir war, als ob wir Seelenverwandt wären … Es war aber ein Spiel mit dem Feuer. Mich hat es erwischt – ich muss mich vor dir in Acht nehmen.«
Olga zog gespielt einen Schmollmund: »Aber anschließend warst Du verschwunden.«
»Es fiel mir nicht leicht«, rechtfertigte er sich. »Aber Du – eine Zarentochter, Großfürstin … und ich – ein einfacher Bauernsohn. Was kann daraus werden? Wie sollte das gut gehen?«
Sie unterbrach ihn, indem sie ihren Zeigefinger leicht gegen seine Lippen drückte:
»Aber das hat doch nichts zu bedeuten«. Sie schlang ihre Arme um seinen Hals und im selben Augenblick trafen sich ihre Lippen so, dass ihr Atem stockte. Ihre Finger krallten sich in seine Locken und er küsste ihre Stirn, die Schläfen, die geschlossenen Augen, den Mund.
»Es macht nicht glücklich, Prinzessin und Großfürstin zu sein«, stammelte Olga. »Ganz im Gegenteil: Es macht einsam und … und unglücklich. Ich brauche Freunde, verstehst Du? Ich suche Freunde. Willst Du … kannst du … mein Freund sein?« Wie verzaubert küssten und berührten sie sich gegenseitig im winterlich verschneiten Schlosspark.
Am anderen Morgen besichtigten Nikolaus und seine Kinder den Wirtschaftshof und ließen sich von August und seinen Söhnen das Falben Gestüt zeigen. Der Zar war tief beeindruckt und seine Kinder waren entzückt von den vielen Fohlen, die gelb wie frisch geschlüpfte Küken aussahen.
August selbst hatte zwar nicht Landwirtschaft studiert, aber seine älteren drei Söhne hatten im deutschen Siedlungsgebiet am Schwarzen Meer höhere landwirtschaftliche Schulen besucht. Johann hatte Veterinärmedizin studiert und war Tierarzt. Leopold und Adrian haben Ackerbau, Pferde- und Viehzucht gelernt. Alle drei sind begeisterte, experimentierfreudige Landwirte und gleichzeitig Offiziere der Zarenarmee – »Kosaken«.
Der Titel Baron war vom Zaren Peter dem Großen ursprünglich für die russischen Bürger deutscher Nation eingeführt worden, die sich politisch und militärisch für ihre russische Heimat eingesetzt und verdient gemacht hatten. Dieser Erb-Titel wurde sehr selten vergeben und war mit großzügigem Landbesitz verbunden. Die meisten Barone waren keine Landwirte, sondern gingen anderen Berufen und Beschäftigungen nach. Den landwirtschaftlichen Betrieb, der im großen Stil aus Ackerbau, Vieh- und Pferdezucht oder auch Forstwirtschaft und Wildpflege bestand, überließen sie ihren Söhnen oder anderen tüchtigen Fachkräften.
Die Einwanderung der Deutschen nach Russland gemäß dem Erlass der Zarin Katharina II. war im Jahre 1862 eigentlich abgeschlossen: Es waren die Ansiedlungen an der Wolga, am Dnjepr und Milch-Fluss, am Schwarzen Meer, auf der Krim und im Kaukasus entstanden.
Die Deutschen und ihre zahlreichen Nachkommen waren inzwischen nicht nur in der Landwirtschaft erfolgreich, sondern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens anzutreffen. Sie waren präsent in der Wissenschaft, Bildung und Forschung, in der Industrie, im Handel, im Post- und Verkehrswesen.
Einige Vertreter des evangelischen städtischen Deutschtums bekleideten hohe Posten in den Regierungs-Ämtern und in der Armee. Sie machten sich Namen auch in Kunst, Kultur und Politik.
Und nun kamen 1863 unter besonderen Umständen Nachzügler aus Polen, unter denen auch die Familie Bode war. Mit der Einwanderung dieser Familie hatte es eine besondere Bewandtnis.
Das Königreich Polen wurde (nach dreifacher Teilung zwischen den Nachbarländern) 1815 durch den Wiener Kongress in Personalunion mit Russland verbunden und war bis 1918 ein Teil Russlands. August Bodes Vorfahren waren zunächst aus Darmstadt in Hessen als Hochschul-Lehrer an die Universität in Lodz gegangen und dann in den Dienst des russischen Zaren Alexander II. als Verwaltungs-Beamte berufen worden. Während des Aufstandes des polnischen Adels (Revolution 1863-64) war Professor Bode gezwungen, mit seiner Familie Polen zu verlassen und wanderte nach Petersburg aus. Gleichzeitig flüchteten zahlreiche deutsche Fabrikarbeiter und Handwerker aus polnischen Städten nach Russland.
Zar Alexander II., der von 1855 bis 1881 russischer »Alleinherrscher« war, zeigte sich erkenntlich, verlieh seinem treuen Beamten den Erb-titel eines Barons und übereignete ihm beträchtliche Ländereien. Da in der Ukraine und im Siedlungsgebiet der Deutschen an der Wolga kein Krohn-Land mehr frei war, wurde den Nachzüglern Land im Norden des Gouvernements Samara am Mittellauf der Wolga zugeteilt. So entstanden hier mehrere Ortschaften mit Kreiszentrum in Groß-Konstantin.
August von Bode war dreizehn Jahre alt als seine Eltern aus Lodz nach Petersburg kamen. Er studierte an der Universität in Riga, wurde 1885 Verwaltungsbeamter des Zaren Alexander III. Nach dessen Tod 1894 und der Thronbesteigung des Zaren Nikolaus II. wurde August dessen geheimer Regierungsrat. Offiziell war er Abgeordneter der Duma ohne bestimmte Aufgaben. Alles Weitere über diese seine Tätigkeit blieb im Dunklen. Sein Schwager – Baron Engelhardt, war ebenfalls Duma Abgeordneter und ein zweiter Schwager – Piotr W. Petrow war Hauslehrer und unterrichtete die Kinder von Nikolaus und Alexandra. Die große Familie Bode war bedingungslos dem Zaren-Hofe treu und gehörte zum Stabilitäts-Symbol Russlands.
Nach dem Besuch der Zaren-Familie auf Gut Fürstenstein folgte ein reger Briefwechsel zwischen Olga und Adrian. In ihren Briefen tauschten sie zahlreiche Zärtlichkeiten aus, teilten einander ihre Erlebnisse, Freuden und Sorgen mit. Sie verlobten sich heimlich und teilten später ihren Eltern ihre Heiratsabsichten mit. In jedem Brief fand Adrian für Olga neue Kosenamen und schickte ihr einige ihr gewidmete Verse.
»Du – meines Lebens größter Schatz!
Du – lieber, kleiner, zarter Spatz.
Ich fang dich ein mit einem Netz
und schließ für immer dich ins Herz.«
Olga war begeistert und beeindruckt von seiner Dichtkunst, seinen Deutsch-Kenntnissen und entdeckte so die Schönheit ihrer eigentlichen Muttersprache.
»Deutsch ist nicht schlechter als Russisch oder Englisch«, sagte sie eines Tages ihrer Mutter, die mehrsprachig aufgewachsen war. Olga sang der Mutter Adrians Verse leise vor:
»Du – meiner Seele Sonnenschein!
Ohne Dich mag ich nicht sein.
Du – meiner Sehnsucht Schmerzensschrei,
mein Durst nach dir geht nie vorbei.«
Auch Alexandra war beeindruckt und fragte schmunzelnd:
»Hat er auch gleich die Melodie komponiert und mitgeliefert?!« Olga schüttelte lachend den Kopf: »Nein, Mama, die Melodie … die quillt einfach aus meinem Herzen hervor … die summe ich immer vor mir hin, wenn ich an meinen Verlobten denke. Und das tue ich fast ununterbrochen.«
Kurz darauf begann der erste Weltkrieg und nichts war ab nun mehr so, wie es einmal war.
3
Am 28. Juni 1914 wurden in Sarajevo der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin von bosnischen Nationalisten ermordet.
Diese berühmt-berüchtigten »Schüsse von Sarajevo« lösten eine Kettenreaktion der europäischen Politik aus: Es begann der Erste Weltkrieg. Österreich-Ungarn erklärte am 28. Juli 1914 Serbien den Krieg; Russland machte am 30. Juli mobil, um zum Schutze seiner slawischen Brüder in den Krieg zu ziehen; Deutschland stellte sich Österreich zur Seite und erklärte am 01. August Russland den Krieg. So war der europäische Wahnsinn komplett!
Das bisher rebellierende russische Volk stand nun Schulter an Schulter hinter seinem Zaren und jubelte ihm begeistert zu. Nicht nur in Petersburg, sondern auch in Moskau wurde die Zarenfamilie vom Volk mit Liebe und Begeisterung empfangen. Sie genossen es, waren stolz und gerührt. Doch als die ersten Nachrichten von verheerenden russischen Niederlagen an der Front in der Hauptstadt eintrafen, schlug die Stimmung im Lande sehr schnell um.
Russland verlor insgesamt 110 000 junge Männer an Gefallenen, Verwundeten und Gefangenen und um jeden weinten die Familien. Russland versank in Hoffnungslosigkeit und Tränen. Nach dieser Niederlage nahm sich der verantwortliche General das Leben und tiefe Niedergeschlagenheit breitete sich von der Hauptstadt über das ganze Land aus.
Endlose Güterzüge brachten Tag für Tag Verwundete in die Hauptstadt und in alle großen Provinzstädte des Landes. Schlagartig wurde dem Volk bewusst: Die Armee sei schlecht ausgerüstet und unzureichend bewaffnet. Es fehlte am Notwendigsten: Nur jeder dritte Soldat bekam ein Gewehr. Der Nachschub von Soldaten, Munition und Verpflegung klappte nicht. Das Rote Kreuz war mit der Versorgung der Verwundeten heillos überfordert. Es fehlte an mobilen Lazaretten, an Verbandsmaterial, Medikamenten, Ärzten und Pflegern.
Die Lage war wirklich katastrophal!
Auf Betreiben der »Nationalistischen Russischen Partei« entwickelte sich nun eine böse Hetze gegen alles Deutsche im Inneren des Landes. Obwohl viele Brüder und Söhne der Russlanddeutschen an den Fronten kämpften und für ihre russische Heimat starben, andere ihren Dienst in Sanitätszügen verrichteten, Verwundete von der vordersten Front ins rettende Hinterland transportierten, betrachtete man sie als Feinde Russlands und diffamierte sie als Spione des deutschen Kaisers. Dabei wurde auch die Romanow-Dynastie nicht verschont.
Dem russischen Volk wurde von den »Nationalisten« bewusst gemacht: Auf ihrem Thron säßen ja eigentlich keine Russen, sondern Deutsche. Seit mehreren Generationen nahmen sich die russischen Zaren deutsche Prinzessinnen evangelischen Glaubens zu Ehefrauen. So habe auch Zar Nikolaus Romanow nicht nur eine deutsche Gemahlin, sondern auch eine deutsche Mutter und Großmutter. Auch schon in den Adern seines Vaters und Großvaters sei mehr deutsches Blut als russisches geflossen.
Die »Nationalistische Russische Partei« veröffentlichte in den Zeitungen regelmäßig Hetzartikel und hämmerte dem Volk ein, an allen Missständen im Lande, an allen Leiden der Menschen sei nur ein einziger Mann schuld – der Zar Nikolaus Romanow. Er habe versagt, er sei eine Niete, ein unfähiger Oberkommandierender des Heeres, ein herzloser Mensch, ein Despot, Tyrann, Blutsauger. Wie könne es auch anders sein – er sei ja ein Deutscher! Unter diesen Umständen distanzierte sich das Herrscherhaus von seinen Untertannen deutscher Abstammung und leugnete sogar, Deutsch jemals als seine zweite Muttersprache angesehen, beherrscht und gesprochen zu haben. Doch auch dieses Verhalten konnte die Autokratie nicht mehr retten: Innerhalb der Regierung wurde der Zar von seinen Ministern kaltgestellt und ignoriert. Vom Alleinherrscher und Autokraten des größten Landes der Welt wurde er zum Getriebenen und Gejagten.
Um die nationalistischen Kräfte im Lande zu besänftigen und so die Situation zu entspannen, beschlossen die Regierungs-Minister, den Besitz der »Fremdstämmigen« zu konfiszieren und ihre Sprache zu verbieten. Der Landbesitz der Russland-Deutschen war aber legal erworben und ihre Muttersprache vertraglich erlaubt worden. Um den Gelüsten der »Nationalistischen Russischen Partei« nach schneller müheloser Bereicherung auf Kosten der deutschen Bauern einen gesetzlichen Anschein zu geben, bereiteten die Minister entsprechende »Gesetzes-Entwürfe« vor. Dem Zaren blieb nun nichts anderes übrig, als diesen »Entwürfen« zuzustimmen und die deutschen Landbesitzer in den Ruin zu treiben.
Von diesen »Liquidationsgesetzen des Jahres 1915« waren als erste die Deutschen in Wolhynien – an der West-Grenze der Ukraine – betroffen. Sie wurden sämtlicher Habe beraubt und überstürzt nach Sibirien und Mittelasien verfrachtet. Dabei sollen mindestens 50 Tausend dieser unglücklichen Menschen ums Leben gekommen sein.
Die Deutschen in anderen Teilen des Landes konnten diesen mörderischen Vertrags-Bruch nicht gutheißen, zumal auch sie vom selben Schicksal bedroht waren.
Dabei verlor Zar Nikolaus die letzten Sympathien seiner Untertanen deutscher Abstammung. Auch Baron August von Bode war von den »Liquidationsgesetzen« der Regierung und vom Verhalten des Zaren nicht begeistert. Außerdem bangte er um das Leben seiner Söhne, drei von denen im Einsatz an der Front waren: Oberleutnant Leopold – jetzt Leonid genannt – kämpfte im Kaukasus, Rittmeister Adrian – nunmehr Andrej – war an der Westfront und Johann – den Nationalisten zuliebe zum Ivan mutiert – leitete an der West-Front einige Sanitäts-Züge des Rot-Kreuz Adels-Verbandes. Die deutschen Bauern konnten diese Gesetze, welche ihre Diskriminierung und Entrechtung legalisierten, nicht verstehen und dem Zaren nicht verzeihen.
Besonders seltsame Blüten trieb das amtliche Verbot des Deutsch als Umgangssprache. Familien- und Vornamen wurden geändert, was zu einem unheilvollen Durcheinander im Personal-Wesen und Post-Verkehr führte. Sogar der »Gottesdienst in den deutschen Kirchen sollte jetzt in russischer Sprache gehalten werden«. Dabei wurden deutsche Geistliche jeglicher Couleur ausnahmslos verhaftet, getötet oder nach Sibirien verbannt.
Und Rittmeister Adrian/ Andrej schrieb von der Front, er habe einen strengen Verweis und eine Geldstrafe auferlegt bekommen, weil er, nach einem schweren Kampfeinsatz, seinem Falben die goldene Mähne getätschelt und auf Deutsch für den treuen Dienst gedankt habe.
Er wurde bestraft, weil er mit seinem Pferd deutsch gesprochen hatte. Das war die letzte Nachricht, die August von seinem Sohn erhalten hatte.
Seit Kriegsbeginn befand sich im Katharinen-Palast von Zarskoje Selo ein Lazarett.
Die kostbaren Gemälde an den Wänden waren mit Leintüchern verhangen; die antiken Möbel wurden in Lagerräumen verwahrt; und in den prunkvollen Sälen des Palastes befanden sich zahlreiche Krankenbetten.
Zarin Alexandra Fiodorowna und ihre Töchter Olga und Tatiana hatten Kurse für Krankenschwestern belegt, um die Verwundeten pflegen zu können. Sie trugen schlichte Schwesterntracht und kamen täglich vor Sonnenaufgang zum Dienst. Sie wuschen die Kranken, wechselten Verbände, verabreichten Medikamente, teilten Essen aus, assistierten den Ärzten bei Operationen, führten Gespräche mit Genesenden und Sterbenden.
Auch die jüngeren Geschwister Maria, Anastasia und Alexej betreuten die Verwundeten, indem sie ihnen Getränke reichten, für sie Briefe schrieben, ihnen vorlasen oder vorsangen.
Die Großfürstinnen nahmen ihre Arbeit überraschend ernst und schonten sich nicht. Sie versorgten entzündete, oft auch eiternde Wunden; sie waren sich nicht zu fein, auch schmutzige Tätigkeiten zu verrichten; aber das Versorgen von Sterbenden ging beinahe über ihre Kräfte.
Als Großfürstin Olga ihren Lehrer Petrow traf, sprach sie mit ihm wie mit einem Seelsorger.
»Wie ist das alles neu für mich, Piotr Wassiljewitsch, was ich da im Lazarett erlebe. Ich bin in diesen Tagen gar nicht mehr ich selbst: Noch vor kurzem war ich fröhlich, gelassen und glücklich. Jetzt sind mein Frieden und die Lebensfreude dahin. Junge Männer in meinem Alter und sogar noch jünger sterben uns einfach weg und dagegen kann keiner was machen. – Entsetzlich, Herr Petrow, ist der Tod, einfach entsetzlich. Wissen Sie, es war ganz seltsam, als der erste Junge unter meinen Händen starb. Er hatte ganz zarten Flaum auf der Oberlippe – wahrscheinlich noch kein einziges Mal rasiert … so ganz jung war er. Ich sah den Tod zum ersten Mal und es war, als fielen mir Schuppen von den Augen. Wie können wir Menschen denn glücklich und fröhlich sein in diesem Leben, wenn es so schrecklich eingerichtet ist?! Ich habe bisher nie darüber nachgedacht, aber es hat mit mir auch niemand darüber gesprochen … weder meine Eltern, noch der Geistliche Pope unserer Kirche … auch Sie nicht, Piotr Wassiljewitsch. Warum nicht?! Sie waren doch mein Lehrer …
Und nun stellt sich heraus, dass es überhaupt kein wichtigeres Thema im Leben, ja in der ganzen Bildung und Erziehung gibt, als das Sterben und der Tod. Darauf muss der junge Mensch doch vorbereitet werden?! Auch über die Liebe will keiner mit mir reden. In letzter Zeit denke ich oft darüber nach: Liebe und Tod liegen ganz nahe beieinander … sie sind unzertrennlich, wie zwei Seiten einer Medaille«.
Der Lehrer hörte geduldig zu. Olga saß still da und schwieg, in Gedanken versunken.
»Ja, Olga Nikolajewna. Vor jedem Menschen steht der Tod. Und er ist das Einzige, was jeden von uns unausweichlich trifft. Sofern der Mensch geboren ist, ist er auch schon alt genug zu sterben. Der Alte muss … irgendwann und der Junge kann … zu jeder Zeit sterben. Das gilt für alle ausnahmslos. Um alles andere – um Liebe, Glück, Reichtum und Ruhm kann man beten und kämpfen, darauf kann jeder hoffen, das kann jeder anstreben.
Nur mit dem Tod kann man nicht verhandeln. Von ihm kann sich kein Mensch freikaufen. Arm oder reich, dem Tod sind alle gleich. Er ist jedem gewiss, da gibt es keine Ausnahmen und kein Rätselraten.«
»Wissen Sie vielleicht, Piotr Wassiljewitsch, wo Ihr Neffe Adrian ist … und wie es ihm geht?«, fragte Olga zaghaft, unvermittelt. »Mein Neffe?«, der Lehrer hob erstaunt die Augenbrauen: »Rittmeister Adrian Bode? Der ist mit seinem Regiment an der Front … An der West-Front, wohlgemerkt. Weiter kann ich Ihnen auch nichts sagen. Es gibt keine Nachricht von ihm. Was aber nichts heißen muss: Die Post, der Verkehr, die Versorgung – alles bricht zusammen. Unser Land, das Volk, die Armee sind auf diesen Krieg schlecht, sehr schlecht vorbereitet.«
»Ich habe Angst um ihn, Piotr Wassiljewitsch«, schluchzte Olga leise. »Ich habe entsetzliche Angst … um Adrian, nicht nur wegen der Gefahren der Front, sondern auch, weil er – ein Deutscher – in unserer russischen Armee dient!«
Mit der Zarin gingen erstaunliche Wandlungen vor. Während sie im Spital arbeitete war sie körperlich kräftig und stabil geworden. Ihre Herz-Beschwerden, Kreislauf-Störungen und sogar die Ödeme waren verschwunden. Das alles war psycho-somatischer Natur. Jetzt, da sie gebraucht wurde und etwas Sinnvolles für andere leistete, vergaß sie zeitweise ihren privaten Kummer; musste nicht ständig an die unheilbare Bluter-Krankheit ihres Sohnes – des Thronfolgers, denken. So gewann sie Lebensmut und Selbstvertrauen. Großfürstin Olga versorgte einen Verwundeten, während ihre Mutter nebenan am Bett eines Sterbenden verweilte.
»Der Zar hat Schuld«, murmelte der junge Soldat, an dessen Bett die Zarin wachte und ihm den Schweiß von der Stirn tupfte. Er hatte hohes Fieber und wusste nicht, wer die hagere Pflegerin mit dem müden und traurigen Blick war. »Der Zar hat an diesem Blutvergießen Schuld. Ohne Waffen und Munition, ja ohne Stiefel! … in Bastschuhen … schickt er uns Bauern-Jungs in den Krieg … Damit wir … alle verrecken … Der Krieg … ist nicht zu gewinnen.« Alexandra Fiodorowna wischte ihm die Tränen ab und sagte entschieden: »Gott wird das nicht zulassen.« Der Soldat lachte leise: »Gott? Bist du meschugge, Schwester? Der hat uns ja längst im Stich gelassen! Er hat diesen Krieg nicht gewollt … Er ist als erster von der Front getürmt … Desertiert … ist unser Gott, weil alles hoffnungslos ist.«
Großfürstin Olga hörte diesem Gespräch zu und hing ihren eigenen Gedanken nach.
»Bald werde ich schon 21 – Ich habe das Recht auf mein eigenes Leben. Ob Zarentochter oder nicht. In den letzten zwei Jahren hat sich so vieles geändert, aber es ist noch kein Tag vergangen, an dem ich nicht an Adrian gedacht hätte. Seltsam ist das, seltsam. Ich kenne ihn doch kaum. Aber ich werde ihn suchen und finden. Falls er noch lebt, werde ich ihn finden. Ich will für immer bei ihm bleiben. Ohne ihn hat mein Leben keinen Sinn.«
Mit ihrer Mutter und Geschwistern ging Olga zu den ankommenden Zügen mit den Verwundeten. Maria, Anastasia und Alexej gingen durch alle Waggons und sprachen mit den Soldaten und Offizieren, während Alexandra, Olga und Tatiana auch hier Verbände wechselten, Gesichter und Hände erfrischten und Getränke verabreichten.
Im kleinen Lazarett, wo nur schwerstens verwundete Offiziere behandelt wurden, denen der Thronfolger Alexej schöne Gedichte vortrug, fand Olga eines Tages den ihrem Herzen so teuren Rittmeister Adrian. Er war bewusstlos und bat auf Deutsch: »Trinken, bitte … trinken.« Er hatte hohes Fieber, sah und hörte nichts. »Lieber Gott, bitte, lass ihn nicht sterben!«, flehte Olga und kämpfte mit den Tränen. Tag und Nacht war sie um ihn herum. Nur für kurze Augenblicke erlangte er das Bewusstsein, suchte mit den Augen die Schwester und flüsterte: »Mein Engel … bitte zu trinken.« Er sah die Schwester in weißer Tracht, mit Kopfbedeckung und Mundschutz. Nur die Augen und die Stimme kamen ihm bekannt vor. Es waren die Augen und die Stimme aus seinen Träumen. Dann tauchte er wieder ab in die Welt der Bewusstlosigkeit.
Nachts hielt Olga Wache und schlief, auf einem Stuhl sitzend neben seinem Bett. Sie wachte auf, als sie eine leichte Berührung ihrer Hände spürte, und sah den klaren Blick seiner hellen Augen auf sie gerichtet.
»Du … bist da, Gott sei Dank!« flüsterte er. »Ich fürchtete schon, alles sei nur ein Traum.
Du – meine Lebensmelodie, verlassen werde ich Dich nie. Ich möchte immer bei Dir sein. O bitte, lass mich nicht allein. Ich wollte Dir so gerne schreiben, aber es ging nicht – unsere Briefe wurden kontrolliert: Deutsch – ist verboten und Russisch kann ich nicht dichten.«
Olga drückte ihren Zeigefinger sanft gegen seine Lippen: »Tss … bleib nur ganz ruhig. Ich bin doch so froh und glücklich, dass du wieder ganz da bist. Du musst gesund werden. «
In den darauffolgenden Tagen trafen sich die Großfürstinnen Olga und Tatiana mit ihrem Hauslehrer Piotr Wassiljewitsch und benachrichtigten über ihn die Familie Bode im Gebiet Samara. Schon wenige Tage später traf August von Bode mit seinen jüngeren Söhnen Wilhelm und Theodor, die jetzt auf Russisch Wassilij und Fiodor genannt wurden, in Zarskoje Selo ein, um den schwer verwundeten Adrian zu besuchen.
Hier sah August, mit welcher Hingabe und Selbstlosigkeit die Zarin und ihre Töchter im Lazarett arbeiteten und gewann großen Respekt für sie.
Der 20jährige Wilhelm blieb bei seinem Onkel Petrow in Petrograd, wie die Hauptstadt den Nationalisten zuliebe jetzt hieß. Hier wurde er im Lazarett zum Pfleger ausgebildet und versorgte anschließend gemeinsam mit den Großfürstinnen die Verwundeten. Wenn Not am Mann war, fuhr er mit dem Sanitätszug seines großen Bruders Johann mit an die Front, um Verwundete aus der Kampfzone hinaus zu tragen und sie als Pfleger zu betreuen. Feige war er nicht – er war schon in mehreren ernsthaften Einsätzen dabei.
4
Petrograd 1917: Revolution hängt in der Luft!
Die Unruhen steigerten sich und nahmen den Charakter einer spontanen Revolte an. Streikende Arbeiter legten die Rüstungs-Industrie lahm. Der Brotmangel in der Hauptstadt verschlimmerte sich von Tag zu Tag. Die Zivilisten hungerten und froren, plünderten und mordeten. Drohende Massen zogen durch die Straßen mit roten Bannern und Transparenten mit Aufschriften: »Nieder mit dem Krieg!« und »Gebt uns Frieden!«, »Gebt uns Freiheit!«, »Gebt uns Brot!« Die Armee meuterte. Soldaten erschossen in den Kasernen einige Offiziere und marschierten dann in voller Kampf-Ordnung in die Innenstadt. Die Nachricht von der Meuterei verbreitete sich wie Lauffeuer. Immer mehr Regimenter schlossen sich der Revolte an und bewegten sich durch die Straßen der Hauptstadt in Richtung Innen-Ministerium.
Die Regierungs-Minister putschten gegen den Zaren, führten eine »bürgerliche Revolution von oben« an und setzten eine Provisorische Regierung unter Fürst Lwow ein. – Das war die »fast blutlose Februar-Revolution« in Russland.
Anfang März 1917 dankte Zar Nikolaus II. ab, für sich und auch im Namen seines minderjährigen, unheilbar kranken Sohnes.
Als Zarin Alexandra während ihrer Arbeit im Spital von der Abdankung ihres Mannes hörte, ging ihr ein kalter Schauer über den Rücken und ihre Augen füllten sich mit Tränen.
»Was soll denn jetzt aus unserem Land werden? Steuert Russland in die Anarchie? Ist das der Dank für Nickis Dienst am Volk und Vaterland?«, gingen ihr bittere Gedanken durch den Kopf. »Lieber Gott, steh ihm bei und schenk ihm bitte die Kraft, das alles zu ertragen.«
General Kornilow, der Oberste Befehlshaber der Petrograder Garnison, besuchte in Zarskoje Selo den Palast des Zaren und informierte alle Anwesenden über den Befehl der Provisorischen Regierung, »den Zaren und seine Gemahlin unter Arrest zu nehmen«, was angeblich eine Schutz-Maßnahme gegen Übergriffe der Aufständischen sein sollte. Allen anderen Bewohnern des Palastes stünde es frei, zu bleiben oder zu gehen, denn von nun an würde niemand mehr das Gelände frei betreten oder verlassen dürfen.
Schon am anderen Morgen kehrte Zar Nikolaus II. aus Mogilöw vom Hauptquartier der Armee zu seiner Familie zurück und wurde sofort unter Hausarrest gestellt.
Die Romanow-Dynastie war eine sehr große Familie, die viele Anhänger und Befürworter im Lande hatte. Doch es gab auch viele Benachteiligte und Unzufriedene.
Das Land bedurfte grundsätzlicher politischer, wirtschaftlicher und sozialer Reformen. Doch die Russische Autokratie tat sich – nicht zuletzt wegen der Größe des Landes – mit den Reformen schwer. Nach der Aufhebung der Leibeigenschaft (1861) gab es Pläne der Regionalisierung und wirtschaftlichen Reformen: In einigen großen Regionen wurden tatkräftige Gouverneure mit weitgehenden Entscheidungs-Befugnissen eingesetzt. Doch innere Feinde der Autokratie gönnten Russland und ihren Zaren keine Erfolge: Eine ganze Reihe politischer Morde riss die Reformen für viele Jahre ab. Und je weiter sie verschoben wurden, desto brisanter wurde die Lage im Lande.
Dazu kam der Erste Weltkrieg, der Russland ins Chaos und an den Rand der Katastrophe führte, was von den Völkern Russlands nicht abgewehrt werden konnte. Somit beeinflusste eine ganze Kette ungünstiger Umstände die Ereignisse in Russland im Jahre 1917 und danach.
Die Anführer der Provisorischen Regierung im März 1917 waren liberale Abgeordnete der Duma. Der einzige Räte-Vertreter und Sozialist, der jetzt Justizminister wurde, war Alexander Kerensky. Unter seiner Regie wurde die Verwaltung, die Polizei und das Gericht reorganisiert und demokratisiert. Die neue Regierung führte die überfälligen politischen Reformen mit »allgemeinem Wahlrecht für alle« durch. Ohne Rücksicht auf Rasse, Klasse und Religion wurden nun Versammlungs-, Rede- und Meinungsfreiheit garantiert. Die politischen Gefangenen – Gegner des gestürzten Zaren – wurden begnadigt und kehrten aus Sibirien in die Städte Zentralrusslands zurück. Ja sogar die Heimkehr der revolutionären Avantgarde aus dem europäischen Exil wurde ermöglicht! Wobei diese Heimkehrer jubelnd feststellten, Russland sei über Nacht zum »freiesten Land der Welt« geworden.
Und wäre Russland so frei geblieben, wären seinen Völkern der Oktoberputsch mit seinen leidvollen Folgen, der Bürgerkrieg und die 70 Jahre der unheilvollsten Diktatur ersparrt geblieben. Ja »hätte«, »währe«, wenn … Wenn die Provisorische Regierung auch weiter so mutig gehandelt hätte, wie zu Beginn. Doch anstatt Wahlen durchzuführen, den Krieg zu beenden, die überfällige Bodenreform zu verwirklichen und die größten Konflikte unter den Nationalitäten und Konfessionen zu entschärfen – statt all das zu realisieren, führte die Regierung den Krieg fort. Das Sterben an der Front und das Elend im Lande hörten nicht auf. Zunächst versuchte der Justizminister der Provisorischen Regierung Alexander Kerensky der Familie des gestürzten Zaren die Ausreise aus Russland zu ermöglichen. Als dieses Vorhaben scheiterte, war der Zar nicht zu stolz, sich mit einer privaten Bitte an seine Feinde zu wenden. Er bat, ihn nicht des Landes zu verweisen, ihn nicht ins Exil zu schicken, sondern im eigenen Lande weiterhin leben zu lassen. Er sei doch Russe: Wo solle er denn hin? Er wolle sich im entferntesten Winkel Russlands als bescheidener Bauer seinen Lebens-Unterhalt verdienen.
Das Leben unter Arrest im eigenen Hause war für die Familie unangenehm. Erwachsene und Kinder langweilten sich in erzwungener Tatenlosigkeit und die Ungewissheit ihrer Zukunft machte allen zu schaffen. Sie arbeiteten alle gemeinsam im Garten: Legten Kräuter- und Gemüsebeete an, pflanzten Rosen, fällten und zerlegten trockene Bäume. Auch wurde in verschiedenen Fächern der Unterricht für die halbwüchsigen Kinder organisiert.
Bei all ihren Beschäftigungen wurden sie von Soldaten und Offizieren überwacht, die sich manchmal auch an der Arbeit beteiligten. So lernten einfache russische Soldaten die ganze Zarenfamilie aus nächster Nähe kennen und waren überrascht: »Es sind ganz normale Menschen mit ihren Freuden und ihrem Kummer. Es sind keine Monster oder Blutsauger«. Die jungen Männer der Wachmannschaften gewannen Respekt und Bewunderung für die Haltung der eingesperrten Hoheiten.
Anastasia – die jüngste Großfürstin, plauderte über den Zaun hinweg unbeschwert und ungeniert mit den jungen Soldaten. Sie vertraute ihnen an, wie prima sie es finde, dass ihr Papa nicht mehr Zar aller Reußen sei und sämtliche Verantwortung für alles im Lande trage. Er sei jetzt immer bei der Familie, sei öfter gut gelaunt und habe viel mehr Zeit für seine Kinder. Außerdem sei es mit ihm nie langweilig, da er sehr viel zu erzählen wisse und interessant und spannend Geschichte, Geographie und Naturkunde unterrichte.
Da passierte es, dass Olga und Tatjana von zwei Offizieren einen »Handkuss« bekamen, was ein Wach-Soldat sofort den Vorgesetzten meldete. Der Soldaten-Rat schlug Alarm: Unerhört! Die Offiziere seien »konter-revolutionär angehaucht« und eine Umerziehungs-Kampagne wurde gestartet: »Vor dem Feind katzbuckle man nicht! Man schlecke ihm nicht die Hände ab! Den Feind müsse man so richtig schikanieren, erniedrigen und hassen lernen«!
Den Erziehern schien entgangen zu sein, dass der Feind in diesem Fall vier sympathische und reizende junge Damen waren: Wie sollten die fast gleichaltrigen Offiziere diesen Feind denn erniedrigen und hassen? Außerdem war des Rätsels Lösung sehr einfach: Es handelte sich um Offiziere, die erst kürzlich von den Großfürstinnen im Lazarett gesund gepflegt und auf die Beine gestellt wurden. Da gab es Erlebnisse und entstanden Beziehungen. Bei diesem Handkuss bekam Großfürstin Olga unauffällig einen Zettel in die Hand gedrückt, den sie in ihrer Rocktasche verschwinden ließ. Dieser kleine Zettel war wohl Sinn und Zweck der riskanten »Kuss-Aktion«.
Bei passender Gelegenheit rollte Olga den Zettel auf, glättete ihn und versuchte, die feine Schrift zu enträtseln. Doch was sie da las, machte sie ratlos: »Wenn Sie verreisen, halten Sie Onkelchen auf dem Laufenden«. Unterschrift: Falbe. Damit konnte sie wenig anfangen.
Wie und wohin sollte sie denn verreisen, wenn sie unter Arrest steht, Tag und Nacht überwacht wird? Bei der Gartenarbeit sprach sie darüber mit ihrer Schwester.
»Falbe?«, sagte Tatiana »Ist das nicht die Farbe eines Pferdes?« »Stimmt«, bestätigte Olga »da fällt mir auch schon ein, wer einen Falben reitet. Und Onkel – das könnte unser lieber Piotr Wassiljewitsch sein. Aber was ist mit dem Verreisen? Eine Reise ist nicht in Sicht, soweit ich das beurteilen kann.«
»Was nicht ist, kann ja noch werden. Lassen wir uns überraschen!«, meinte ihre Schwester.
»Auf Überraschungen … möchte ich aber gut vorbereitet sein«, sagte Olga nachdenklich.
Und die Schwestern machten sich ans Werk: Tatiana nahm mit ihrem ehemaligen Hauslehrer Kontakt auf, schrieb ihm einen Brief und erkundigte sich nach dem Verbleib und Wohlergehen seines Neffen, ohne dabei Adrians Namen zu nennen.
Nach längerer Krankheit verloren die Großfürstinnen ihre Haare und ihre Köpfe wurden rasiert. Mit kurzem Haarschnitt wäre es leichter, sich als Männer zu verkleiden. Außerdem, seien kurze Haare auch leichter zu pflegen, wenn es denn sein müsste. So die Überlegungen der älteren Großfürstinnen. Damit es aber nicht gleich die ganze Wach-Mannschaft sehe, wickelten die Schwestern Schals um ihre Köpfe nach der Art eines kirgisischen Turbans. Darüber amüsierten sie sich köstlich.
Jetzt schrieb auch Olga an ihren Lehrer und erzählte ihm vom Tagesablauf der Familie unter Arrest. Zum Namenstag bekam sie von diesem alten und kranken Mann einen Brief, in dem er ihr etwas wünschte, was teurer sei, »als alle Reichtümer der Welt«: Sie solle ihre körperliche Gesundheit und seelische Ausgeglichenheit bewahren! Dann kämen unter jeglichen Umständen Glück und Lebensfreude von selbst. »S Milym Raj w Schalasche!« – »Platz ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar«, zitierte er zum Schluss auf Russisch Schillers Gedicht »der Jüngling am Bache«. – »Was will Onkelchen damit sagen?«, staunte Tatiana. »Er wünscht mir ein glückliches Liebesleben, wenn auch in Armut …«, meinte Olga ihn richtig verstanden zu haben.
5
Seit dem Frühjahr 1917 herrschten in Petrograd chaotische Zustände. Die extrem Linken mit Lenin & Heloten an der Spitze kehrten aus dem Exil zurück und stachelten mit der Losung »Raubt das Geraubte!« die Bevölkerung zu Gewalttaten an. Dadurch entfesselten sie Neid- und Hass- Instinkte des hungernden, frierenden und durch den Krieg leidenden Volkes, was zu weiteren Unruhen in der Hauptstadt führte.
Nach der »Kuss-Aktion« und während der anlaufenden »Erziehungs-Kampagne« wurden die jungen Soldaten und Offiziere der Wachmannschaft durch das Garde-Corps des 2. Artillerie-Regiments ersetzt. Die Soldaten und Offiziere dieses Corps rückten böswillig und obszön den Großfürstinnen zu Leibe. – Die Haft-Bedingungen verschlechterten sich zusehends.
Im Juli 1917 zerbrach die Provisorische Regierung und eine neue, mit Kerensky an der Spitze, wurde gebildet. Unerwartet besuchte der neue Regierungschef in Zarskoje Selo die Zarenfamilie und sprach lange mit dem Ex Zaren unter vier Augen. Er deutete an, die Lage im Lande sei schwierig. Er könne die Sicherheit der Zarenfamilie nicht mehr garantieren und schlage vor, ihren Wohnsitz weit weg von der Hauptstadt zu verlegen.
»Ja, eine gute Idee«, meinte Nikolaus Romanow. »Meine Gemahlin und die Kinder möchten gerne wie jeden Sommer nach Livadia – auf die Krim.« Er versuchte herauszufinden, wohin die Reise gehen sollte. Doch das schien ein gut gehütetes Geheimnis zu sein. Wohin genau es gehen solle, wisse nicht einmal er – der Premier der Regierung, beteuerte Kerensky. Ins »Landesinnere« dürfte es jedenfalls gehen und man sollte viel warme Kleidung und wetterfestes Schuhwerk einpacken.
Da ging dem Ex Zaren ein Licht auf: »Ja! Natürlich«, dachte er. »Nach Sibirien – in die Gegend, wohin meine Vorfahren schon seit Jahrhunderten unsere Gegner verbannten!« Er lächelte verlegen bei diesem Gedanken: »Wie könnte es auch anders sein! Sie handeln nach dem Prinzip: Wer dem anderen einer Grube gräbt, fällt selbst hinein! – Welch eine Ironie der Geschichte!« Vor zwei Jahren erst hatte er die russischen Bürger deutscher Abstammung aus dem 150 Kilometer breiten Grenzgebiet in Wolhynien mit Kind und Kegel nach Sibirien vertreiben lassen.
Vorher aber wurden sie ihres Eigentums beraubt und somit dem sicheren Verderben ausgesetzt. Jetzt sollten also auch seine Kinder in den »Genuss« all dessen kommen, was er anderen zugemutet hatte … Er seufzte tief und schwer.
Bei seinem nächsten und letzten Besuch in Zarskoje Selo wirkte Kerensky sehr nervös und vertraute dem Ex Zaren unter vier Augen bei einem Spaziergang im Garten an, er selber sei in Lebensgefahr und rate Oberst Romanow eindringlich, seine Töchter eine nach der anderen aus der Familie zu entfernen, sie einfach mit einer anderen Identität »hinaus ins russische Volk« zu entlassen. Diesen Vorschlag besprach Nikolaus mit jeder Tochter einzeln … bei der Gartenarbeit. Sie sollten es sich durch den Kopf gehen lassen und überlegen. Aber nicht in den Palast-Räumen miteinander darüber diskutieren. Er kannte schließlich die Methoden seines Geheimdienstes – der »Ochrana« – nur zu gut!
Auf Beschluss der provisorischen Regierung wurde Nikolaus II. mit seiner Familie in das sibirische Städtchen Tobolsk am Fluss Irtysch verfrachtet, angeblich, um sie aus der Schusslinie des revolutionären Sturms zu ziehen. Vom Dampfer »Rus« aus sahen sie schon aus der Ferne den hohen Zinnen-Turm der Festung. In Tobolsk verbrachten die Verbannten einige Tage auf dem Dampfer, während die für ihren Aufenthalt bestimmten Räume im »Holz Kreml« renoviert und gesäubert wurden. Da gelang es Olga in den ersten Augusttagen einen unzensierten Brief an Piotr Wassiljewitsch abzuschicken und den Lehrer von ihrem Zielort an der »Straße der Freiheit« in Tobolsk zu benachrichtigen.
Die Holzgebäude des Kremls waren in einem sehr schlechten baulichen Zustand, ihre Räume vernachlässigt, schmutzig und nur dürftig möbliert. Für die Bediensteten standen einige Zimmer im Anbau zur Verfügung. Das Gefolge, der Kommissar, der Wach-Kommandant und die Offiziere wurden im Gebäude gegenüber im so genannten Kornilow-Haus untergebracht.
Am Tag des Einzugs ins neue Heim hielt der Priester der orthodoxen Kirche in der geräumigen aber düsteren Eingangshalle für die Häftlinge eine Messe und versprühte anschließend Weihwasser in allen Räumen. Zur nächsten Messe brachte der Priester vier Nonnen aus dem nahegelegenen Kloster mit, die den Gottesdienst mit Gesang begleiteten.
Bei dieser Gelegenheit gelang ein Austausch: Anastasia verließ die Familie und ging in Nonnentracht verkleidet mit dem Priester hinaus ins Kloster. Die unter Arrest gebliebene Nonne war in etwa von Anastasias Größe, etwas fülliger, konnte aber Anastasias Kleider tragen und fiel nicht sonderlich auf.
In dieser Zeit schrieb Ex-Zarin Alexandra ihrer Freundin Anja Wyrubowa nach Zarskoje Selo einen Brief, der scheinbar mehr für die Zensur und die »Ochrana« bestimmt war als für die Freundin, die sich gerade in Petersburg unter Arrest in der Peter-und-Paul Festung befand.
Unter Anderem hieß es in diesem Brief, Anastasia sei »zu ihrer eigenen Verzweiflung ziemlich rund geworden, wie Maria es früher war: rund und dick bis zur Taille, mit kurzen Beinen«. Weiter äußerte Alexandra Fiodorowna die Hoffnung, Anastasia werde ja wohl noch wachsen. So versuchte die Ex-Zarin den Bewachern die Verwandlung ihrer Jüngsten zu erklären, falls es jemandem aufgefallen sein sollte. Doch zu dieser Zeit war ihre Sorge noch unbegründet, denn die Wachen wechselten täglich ab und keiner von der neuen Mannschaft hatte sich bisher das Äußere der Zarentöchter so richtig eingeprägt.
Der Englischlehrer Sidney Gibbes erinnerte sich später, Anastasia sei anscheinend in ihrer »geistigen Entwicklung plötzlich stehen geblieben«. Scharf beobachtet! Schöpfte er Verdacht? Oder wusste er vom Austausch?
Zunächst hatte Nikolaus die Idee, den Familienverband aufzulösen, entschieden abgelehnt: »Kommt gar nicht in Frage!« entrüstete er sich. »Wie sollen meine Kinder ohne mich im Leben bestehen?!« Kerensky aber war vom Gegenteil überzeugt. »Irrtum, Oberst Romanow! Sie sind kein Schutz mehr für Ihre Kinder, sondern die größte Gefahr! Ihre Töchter sind ja inzwischen keine Kinder mehr im üblichen Sinne, sondern anmutige junge Damen. Die müssen schleunigst aus Ihrer Nähe verschwinden. Jede einzelne von ihnen hat alleine noch eine Chance, unterzutauchen und zu überleben. Auch für Sie und Ihre Gemahlin wäre es einfacher, ohne die Töchter nur mit dem Thronfolger zu emigrieren.« – »Glauben Sie wirklich, Alexander Fiodorowitsch, meine Familie sei in Lebensgefahr? Hier, inmitten meines geliebten Volkes?! Glauben Sie, auch nur einer meiner Untertanen könnte es wagen, mich oder jemanden aus meiner Familie zu töten?!« – »Ja, wo leben Sie denn, Oberst Romanow?«, empörte sich Kerensky. »In einer Traumwelt?! Hat es nicht schon genug politische Morde bei der Dynastie Romanow gegeben? Seien Sie nicht so naiv! Denken Sie doch an Ihren Großvater!« Kerensky schüttelte entrüstet den Kopf und verabschiedete sich.
Dieses Gespräch fand anfangs August 1917 statt – kurz vor der Verbannung der Romanows nach Tobolsk. Damals wollten Nikolaus und Alexandra nichts von Kerenskys Vorschlag hören. Jetzt aber lagen die Dinge völlig anders.
Sie lebten nicht mehr in Zarskoje Selo, sondern im tiefen Sibirien; und nicht mehr im Palast, sondern im »Holzkreml« mit unzureichenden und defekten sanitären Einrichtungen. Sie lebten hier gemeinsam mit zahlreichen Küchenschaben, Wanzen und sonstigem Ungeziefer! Die Männer der sich ständig abwechselnden Wachmannschaft sahen vulgär aus und belästigten aufdringlich die jungen Mädchen.
Rebrow – ein neuer Kommissar der Provisorischen Regierung, der sämtliche Korrespondenz der Verbannten zensieren sollte, traf ein. – Die Haftbedingungen verschlechterten sich täglich. Jetzt sahen Nikolaus und Alexandra ein, dass ihre Töchter so schnell wie möglich aus dem streng bewachten, hinter hoher Holzpalisade liegendem Gebäude verschwinden müssten, und nutzten jede Gelegenheit. Nikolaus sprach mit seinen Töchtern über mögliche Flucht-Pläne draußen, während ihrer Spazier-Gänge und der Garten-Arbeit im Freien.





























