
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Dieser Roadtrip geht direkt ins Herz. Andrea lebt mit Kaninchen Maikel bei seinem Vater. Bei den dreien herrscht zwar gelegentlich Chaos, aber im Großen und Ganzen kommen sie klar. Bis Fidaa mit ihrer Mutter bei ihnen einzieht. Und Fidaa aus Versehen Maikel fallen lässt. Und Maikel eingeschläfert werden soll. Und Andrea deswegen in einer Nacht- und Nebelaktion nach Süddeutschland aufbricht. Zu seiner Mutter. Mit Maikel in einer Kühlbox. Und Fidaa auf den Fersen. "Unterwegs mit Kaninchen" von Benjamin Tienti ist eine warmherzige, lustige und authentische Geschichte für Kinder ab zehn Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Hallo Leute! Mein Name ist Maikel und ich erzähl euch jetzt von meinem besten Freund Andrea. Ja, ich bin ein Kaninchen. Top, oder? Nein, Andrea ist kein Kaninchen. Andrea ist ein Junge und gerade total sauer … Auf wen? Na, auf seinen Papa. Weil der Fidaa mitgebracht hat. Und auf Fidaa natürlich. Wegen der hab ich mir die Pfote gebrochen! Auf die bin ich auch sauer! Ihr fragt, warum ich dann jetzt ausgerechnet mit Andrea und Fidaa in einem Lkw sitze? Tja, Leute, spitzt die Löffel! Das ist eine lange Geschichte …
Rau, warm und unglaublich echt. Dieses Abenteuer geht direkt ins Herz.
On the road again
Goin’ places that I’ve never been
Willie Nelson – On the road again
In der Kühlbox
Tja, Leute. Los geht’s.
Ich darf mich vorstellen: Maikel, mein Name. Ich bin ein Kaninchen. Und jetzt gerade sitze ich in einer Kühlbox irgendwo in Süddeutschland. Aber dazu kommen wir noch.
»Was? Ein Kaniiinchen!? Und es spriiiicht?«, fragt ihr nun.
Ja, kann ich da nur sagen. Ich spreche. Mit euch. Na und?
Und ihr reißt die Augen auf. »Was ist das hier, ein Määäärchen?«
Nein. Das hier ist kein Märchen. Es ist eine Geschichte, die rein gar nichts mit einem Märchen zu tun hat, ja? Wir sind hier alle total real. Und eigentlich geht’s in dieser Geschichte auch gar nicht um mich, sondern um meinen besten Freund.
Aber fangen wir vorne an.
Mein bester Freund heißt Andrea. Oder Andi, wie ich ihn nenne, klingt irgendwie … besser, finde ich. Und nur, falls ihr wieder fragt, nein, Andi ist kein Kaninchen, sondern ein Mensch. Ist doch nicht so schwer zu kapieren, oder? Langsam macht’s klick, wa?
Jedenfalls: Andi kann einen Kumpel gut gebrauchen, darum bin ich auch bei ihm eingezogen. Ich kümmere mich um ihn und passe auf, dass er nicht durchdreht. Und hey, wenn der Junge mal jemanden zum Vollquatschen braucht, bin ich da. Ich kann nur leider nicht antworten.
Wie es das Schicksal nun mal will, kann ich mit Andi nicht einfach so locker sprechen wie mit euch jetzt. Ich kann mich ihm nur mitteilen, indem ich irgendwelche … Kaninchendinge tue. Oder sie lasse. Nicht ganz so einfach, auf diese Art ein echter Freund zu sein, das kann ich euch sagen. Nur gut, dass ich so süß aussehe. Zumindest jetzt noch, bin nicht mehr der Jüngste, leider.
Aber er ist auch nicht anspruchsvoll. Es reicht meistens, Andi einfach nur mit meinen Kaninchenaugen anzusehen und ein bisschen an ihm zu schnüffeln. Schon geht’s ihm besser.
Ja, er ist echt okay, der Kleine … werdet ihr ja sehen. Auch wenn er ein kleines bisschen spinnt. Aber wer tut das nicht, frage ich? Wer tut das nicht?
Hier kommt jedenfalls unsere Geschichte.
Und sie geht los bei uns zu Hause.
In einem Karton …
EINS
Im Karton
Herausgefunden, dass ich verrückt bin, habe ich, als Papas neue Gitarre kam. Es war ein Riesenkarton. Keine Ahnung, wieso, vielleicht hatten sie im Versandhaus gerade keinen kleineren zur Hand. Papa freute sich schon die ganze Woche auf seine Gitarre. Obwohl er gar nicht spielen konnte. Es war eine Fender Telecaster. Er packte sie aus und hielt sie hoch und kniff ein Auge zusammen, während er prüfte, ob der Hals auch gerade war. Er war richtig rot im Gesicht. Ganz aufgeregt.
Ich sah nur den Karton. Irgendwas zog mich zu ihm hin. Er hatte genau die richtige Größe für mich. Papa klimperte auf der Gitarre herum, zwei, drei Töne, immer wieder. Er hörte überhaupt nicht mehr auf.
»Gute Gitarre«, hörte ich ihn sagen. Und dann Pling Plang Plong. Pling Plang Plong. Plinnnnng Plannnnng Plooooonnnng. Da kann man beim Zuhören schon mal müde werden. Ich legte den Karton auf die Seite und ging auf die Knie. Streckte meinen Arm hinein. Es fühlte sich für mich warm an, wie ein Frühstücksbrötchen frisch aus dem Ofen. Als Nächstes steckte ich meinen Kopf in den Karton. Es roch gut. Muffig, ein bisschen nach feuchtem Papier, aber gut. Und schließlich kroch ich ganz in den Karton. Zog meine Knie an die Brust und schloss die Augen. Ich hatte mich noch nie so wohlgefühlt.
Da wusste ich, dass ich verrückt bin.
Pling Plang Plong, hörte ich Papa. Pling Plang Ploing. Und dann irgendwann, Tock, wurde die Gitarre abgestellt.
»Andrea?«, hörte ich Papa durch den Karton. »Was … machst du da drinnen?«
Aber ich antwortete nicht. Ich wollte überhaupt nie mehr sprechen. Alles, was ich wollte, war, so liegen zu bleiben. Für immer. Es war einfach zu perfekt.
Irgendwann bin ich natürlich doch wieder rausgekommen. Man hat ja noch ein Leben zu leben. Aber nur ungern. Und die Kiste wollte ich behalten. Papa sah mich komisch an. Sehr komisch. Aber er sagte: »Okay. Behalte die Kiste.« Jetzt steht sie in meinem Zimmer. Verrückt oder nicht, sie tut mir einfach gut.
* * *
Ich schließe unsere Wohnungstüre auf und rufe »Hallo!« in den Flur. Das mache ich jeden Tag, obwohl ich genau weiß, dass Papa nicht da ist. Aber erstens: Es könnte ein Einbrecher in der Wohnung sein, und ich will ihm genug Zeit geben, durchs Fenster abzuhauen, und zweitens: Maikel. Kaninchen erschrecken sich schnell mal. Und er wäre nicht das erste Kaninchen, das einen Herzinfarkt bekommt, einfach nur, weil jemand zu plötzlich in den Raum kommt.
Ich stelle meine Schultasche auf die Garderobenkommode. Sie muss genau gerade stehen, das überprüfe ich auch noch ein-, zweimal. Dann sehe ich in jedem Raum nach, ob ein Fenster offen ist. Nichts wäre schlimmer als ein Einbrecher, der erst nach einer Stunde plötzlich hinter irgendeinem Schrank hervorspringt und »Hahaaa!« schreit. Da würde nicht nur Maikel einen Herzinfarkt bekommen.
Dann endlich kann ich in mein Zimmer gehen. Ohne Hektik, jeder Schritt im gleichen Rhythmus. Nichts hassen Kaninchen mehr als aufplatzende Türen, reinstampfende Leute und laute Stimmen. Nur vielleicht einen Habicht, der sich von oben auf ihren Käfig fallen lässt und mit dem Schnabel über die Gitterstäbe rattert. Aber das ist ja wohl hier drinnen unrealistisch.
»Lebst du noch?«, sage ich in mein Zimmer hinein. Nur ein winziges Rascheln unter dem Heu in seinem Klorollenhaus ist zu erahnen. Das reicht. Ich weiß, dass er da drin ist und dass er nicht tot ist. Wenn er mag, kann er rauskommen, ich lasse die Käfigtür immer auf. Aber er kommt selten raus, wenn ich nicht da bin.
Direkt neben dem Käfig liegt mein Karton auf der Seite. Braun und ein bisschen verbeult. Schon ihn nur zu sehen, beruhigt mich irgendwie. Mein Herzschlag wird langsamer, ich muss gähnen, ich strecke mich noch mal und dann krieche ich hinein. Ich denke überhaupt nicht drüber nach. Sofort spüre ich die Wärme, die einfach irgendwie von selbst hier drin ist. Ich rolle mich zusammen und bleibe so. Das Gefühl, nichts machen zu müssen, in dieser Wärme zu liegen und die engen Wände zu ahnen, das ist das Tollste auf der Welt. Ich fühle mich nicht beengt. Wenn ich wollte, könnte ich mich einfach ausstrecken, und der Karton würde sich ausbeulen und irgendwann aufreißen. Das ist das Schöne an dieser Enge, ich kann sie genießen, aber wenn es zu viel wird, habe ich alles unter Kontrolle. Sollte jeder mal ausprobieren. Also jeder, der verrückt ist.
Ich bleibe einfach liegen. Und atme. Und atme. Und atme. Und mein Atem wird das Lauteste auf der Welt, er ist überall. Und irgendwann spüre ich ein kleines Kitzeln am Fuß, durch die Socke durch. Maikel kommt mich besuchen. Er zwängt sich durch bis zu meinem Gesicht und dort kuschelt er sich an mich. Ich spüre seinen Bauch wackeln, weil er so schnell atmet. Ich rieche ihn, er riecht nach Heu. Und wir beide verbringen die tollsten Minuten des Tages zusammen und müssen dafür nicht mal etwas tun.
Nach einer Weile spüre ich, dass es genug ist.
»Lass uns wieder rausgehen«, flüstere ich. Und Maikel zwängt sich hinaus, als ob er genau versteht, was ich sage. Und ich krieche auch raus und die Luft in meinem Zimmer ist auf einmal frisch und kühl an meinen Wangen. Ich atme durch und grinse. Mein Akku ist wieder voll.
Die Zwiebel
Papa ist ein Karnivore. Das heißt Fleischfresser. Also eigentlich heißt das bei Menschen Omnivore, Allesfresser. Er isst meistens im Krankenhaus, da kann er so viel Fleisch in sich reindrücken, wie er will, interessiert mich nicht. Nur wenn er Frühschicht hat, einmal die Woche, kochen wir abends zusammen. Und dann natürlich vegetarisch. Ich suche meistens raus, was es geben soll, das dauert oft den ganzen Vormittag. In der Schule denke ich an solchen Tagen die ganze Zeit über Essen nach. Ich kann gar nicht anders: Es ist Gruppenarbeit oder der Lehrer erzählt irgendwas und meine Gedanken wandern automatisch davon ins Nudelland. Oder in die Omelettehöhlen. Oder auf den Pestoberg. Ich liebe Essen. Wenn ich dann irgendwann weiß, was es am Abend geben soll, schicke ich Papa meinen Beschluss per WhatsApp, und er kauft noch schnell ein, bevor er nach Hause kommt. Papa ist nicht so ein guter Koch. Ich vermute, meistens muss er im Internet nachsehen, wie man zum Beispiel Tortellini macht, und er kauft dann einfach alles, was in der Rezeptliste steht. Also wirklich alles. Darum haben wir auch acht Packungen Salz zu Hause oder drei Packungen Hartweizengrieß und siebzehn Eier. Egal. Wenn ich in der Schule darüber nachdenke, was es zu essen geben soll, berücksichtige ich meistens auch, was schon in unserem Kühlschrank und in den Schränken ist. So gleicht es sich dann aus und wir müssen nichts wegwerfen. Heute gibt es jedenfalls Kartoffelsuppe mit Lauch. Die hatten wir schon ein paarmal und wir fanden sie beide immer gut.
Papa holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank, während ich den Einkaufskorb ausräume.
»Wir haben doch schon Öl hier«, sage ich.
Papa nickt nur und prostet mir zu.
»Und Zwiebeln auch«, sage ich.
Papa nickt noch mal, stellt die Flasche weg und bindet sich seine Schürze um. Ich mache das Radio an. Bei uns läuft immer Radio eins, wenn wir kochen. Manchmal, wenn wir beide gut gelaunt sind und die Musik passt, tanzen wir sogar. Und rühren und schnippeln im Rhythmus. Aber jetzt laufen gerade die Nachrichten.
»Was soll ich machen?«, fragt Papa. Ich drücke ihm den Schäler in die Hand und den Kartoffelsack. Papa muss immer die langweiligen Sachen machen. Den interessanten Kram verkackt er nämlich in der Regel und dann gibt es im schlimmsten Fall am Ende einfach nur Brot mit Käse.
Ich röste Sesamsamen in der Pfanne an. Unser Kartoffelsuppenrezept hat einen asiatischen Touch. Sesam und Currypulver und auch ein bisschen Sojasoße. Hat Papa alles brav noch mal eingekauft.
Ich liebe es, Nüsse oder Samen in der Pfanne zu rösten. Man muss genau den richtigen Moment erwischen, sonst bringt es gar nichts. Aber wenn man sie so weit hat, dass sie genau kurz vor dem Anbrennen sind, dann riecht die ganze Küche auf einmal einfach nur gut. Ich schwenke die Pfanne hin und her, und am meisten liebe ich das Geräusch, wenn die Samen dabei trocken über den Pfannenboden rollen.
»Bist du so weit?«, frage ich, während ich den Sesam in eine Schüssel fülle. Es kommt keine Antwort.
»Papa!«
»Was?«
Ich drehe mich um. Papa sitzt immer noch vor seiner ersten Kartoffel. Er schält bestimmt schon die dritte Schicht herunter, und er macht einen Buckel dabei, sodass er aussieht wie ein alter Opa. Als er meinen Blick sieht, legt er die Kartoffel weg und räuspert sich.
»Ich muss mit dir reden«, sagt er.
Okay, was kommt jetzt?
Papa streckt seinen Rücken und macht sich wieder groß.
»Wir haben hier so viel Platz!« Er macht mit dem Arm einen Bogen, als ob wir in einer Palasthalle wären und nicht in unserer Küche. »Wir haben mindestens zwei Zimmer zu viel.«
»Du meinst, Mamas Zimmer?«
»Mama wohnt hier nicht mehr«, sagt Papa knapp.
Ich hole mir ein Messer und eine Zwiebel und ziehe die Schale ab.
»Es ist so … ich hab im Krankenhaus eine Familie, die Hilfe braucht.«
Ich sage nichts.
»Eine Frau und ihre Tochter. Sie ist so alt wie du, also die Tochter.« Ich höre, dass er lächelt, auch wenn ich nicht hinsehe. »Es geht ihnen wirklich nicht gut. Sie wissen nicht, wo sie im Moment wohnen können.«
Es macht Tack, als ich die Zwiebel in der Mitte durchschneide. Und dann Tack tack tack, als ich sie in Scheiben schneide, und tacktacktacktack, als ich sie in Würfel hacke.
»Andrea, kannst du bitte kurz aufhören?«
Ich lege das Messer weg.
»Ich habe den beiden angeboten, für eine Weile bei uns einzuziehen«, sagt Papa. »Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.«
Mein Gesicht hängt genau über der Zwiebel und Tränen steigen mir in die Augen. Todeszwiebel, ey.
»Klar«, sage ich.
Papa atmet aus. Pfffffffh. Wie ein Roboter, dem man den Stecker gezogen hat.
»Wann?«, frage ich.
»Die Frau muss sich noch ein, zwei Tage im Krankenhaus erholen. Vielleicht übermorgen. Äh, sag mal, weinst du?«
Ich zeige nur auf die Zwiebel.
»Ach so!« Papa lacht.
»Ist sie deine Freundin?«, frage ich.
»Was? Nein! Ich kenne sie ja gar nicht richtig. Die beiden tun mir einfach leid.«
»Was haben sie denn für Probleme?«
»Ich weiß es auch nicht so genau. Die Frau … Farah, sie spricht Arabisch. Ich weiß nur, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat und … dass das nicht so einfach war. Sie wissen nicht, wohin, und es kommt mir einfach nicht richtig vor, dass hier bei uns mindestens zwei Zimmer ungenutzt sind.«
Ich nicke.
»Die Tochter kann aber sehr gut Deutsch. Sie wird sicher froh sein, jemanden zum Quatschen zu haben.«
Ich nicke wieder.
»Kann ich jetzt weitermachen?«
Papa lacht wieder. »Ich bin froh, dass du einverstanden bist«, sagt er. Er schiebt seine Hand über den Tisch auf meine und drückt sie kurz. »Ich bin ganz sicher, dass ihr euch super verstehen werdet.«
Ich ziehe meine Hand aus seiner und schnappe mir mein Messer und schiebe damit die Zwiebelwürfel auf dem Brett hin und her.
Papa steht auf. Er kommt um den Tisch und stößt mich mit der Hüfte an, sodass ich einen Schritt zur Seite stolpere.
»Heeee!«, sage ich.
»Jetzt …«, sagt Papa und schnappt sich seinen Schäler, wirft ihn in die Luft, sodass er sich einmal überschlägt, und fängt ihn wieder auf, »jetzt können wir anfangen zu kochen!«
Also nee, ey!
Es war nicht so, dass ich unbedingt ein Kaninchen haben wollte. Aber als ich Maikel zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass wir zusammengehören. Papa und ich waren im Streichelzoo, so ein ganz kleiner am Stadtrand. Ich hatte Sommerferien, und Papa war der Meinung, wir müssten auch mal was zusammen unternehmen.
Papa hat nur selten frei. Er ist Arzt im Krankenhaus. Eigentlich ist er kein richtiger Arzt, sondern ein Anästhesist. Das sind die, die sich um die Betäubung kümmern, wenn man operiert wird. Im Krankenhaus gibt es immer zu wenig Anästhesisten und Papa könnte praktisch immer arbeiten, er ist sehr gefragt. Darum fahren wir auch so gut wie nie in den Urlaub oder so, schon gar nicht, seit Mama nicht mehr bei uns wohnt.
Letzte Sommerferien lag ich eigentlich die ganze Zeit nur mit meiner Nintendo Switch im Bett. Einmal habe ich nicht mal gemerkt, wie es schon wieder dunkel wurde, ich war nur einmal morgens aufgestanden und hatte Pipi gemacht und was getrunken. Irgendwann kam dann Papa nach Hause und machte das Licht in meinem Zimmer an und meckerte ein bisschen herum.
»Morgen habe ich frei«, sagte er. »Und wir müssen, glaube ich, mal was zusammen unternehmen.«
Und da standen wir im Streichelzoo, zwischen lauter Kinderwagen und schreienden Muttis, die ihren Kindern hinterherschrien, ob sie Durst hätten oder ein Eis wollten. Und die Kinder liefen den Ziegen und Schafen hinterher und schrien ihnen hinterher, ob sie Körner wollten. Und die Schafe und Ziegen liefen einfach nur weg und suchten sich einen Ort zum Verstecken. Aber den gab es nicht. Ich fühlte mich auch wie ein Schaf. Und Papa, glaube ich, auch.
»Lass uns mal nach da drüben gehen«, sagte Papa und zeigte auf einen kleinen Stall mit Freigehege etwas abseits. Dort waren kaum Kinder, also ging ich mit. In dem Stall hoppelten lauter Kaninchen herum, ganz kleine. Sie waren überall, draußen und drinnen, sie hüpften übereinander und mümmelten und machten Männchen, und alles raschelte und lebte, und man wusste gar nicht, wo man hinsehen sollte.
»Süß«, sagte Papa.
Ganz am Rand, halb unter etwas Stroh versteckt, sah ich ein einzelnes Kaninchen, das nicht so gut gelaunt aussah. Und das ist noch untertrieben. Es saß einfach nur da und glotzte die anderen Kaninchen an und regte sich nicht. Nur sein Kopf wiegte ganz leicht hin und her, als würde es die ganze Zeit »Also nee, ey! Neeee, ey!« sagen. Es war genau wie ich.
Papa stupste mich irgendwann an. Also nach ungefähr einer Stunde oder so.
»Bist du eingeschlafen?«, fragte er.
»Ich will ein Kaninchen«, sagte ich.
Papa legte den Arm um mich.
»Meinst du das ernst?«
»Ich will dieses da«, sagte ich und zeigte auf Maikel.
»Andrea … wir wissen doch überhaupt nichts über Kaninchen. Wie man sie hält und so weiter«, wandte Papa ein und guckte etwas zerknirscht.
»Dann lerne ich es halt.«
Papa sagte nichts mehr. Er stand neben mir und gemeinsam sahen wir dem kleinen Kaninchen ein bisschen beim »Also neee, ey!«-Sagen zu. Und irgendwann ging Papa weg und kam mit einem Tierpfleger wieder.
»Das können Sie gern mitnehmen«, sagte der. »Aber es ist sicher nichts für Anfänger. Es ist schon sehr alt. Kein einfaches Tier. Sie kennen sich doch mit Kaninchen aus?«
Papa wollte antworten, aber ich kniff ihm in die Hand.
»Klar«, log ich.
»Das hier geben wir nur einmal am Tag kurz zur Gruppe. Es ist aggressiv und nicht sehr beliebt. Sicher keine einfache Aufgabe, das Tier mit Ihren anderen Kaninchen zu vergesellschaften.«
»Aber wir haben ja gar keine …«, sagte Papa.
»Das kriegen wir schon hin«, sagte ich schnell.
Der Tierpfleger kratzte sich am Bart.
»Soll ich ehrlich sein? Ich bin froh, wenn das kleine Ding noch einen schönen Lebensabend bekommt. Bei Leuten, die es gernhaben und die die Mühe auf sich nehmen.«
Und so standen wir am Ende mit einer Tüte voller Kaninchensachen und einem Käfig vor dem Streichelzoo und in dem Käfig saß Maikel.
»Maikel?«, fragte Papa. »Ernsthaft? Mit ai und e?«
»Maikel«, sagte ich. »Ist doch schön.«
* * *
Heute bin ich es, der »Also neee, ey!« sagt. Wie kann so ein kleines Tier nur so viel Kacke fabrizieren? Die Wohnungstür steht noch offen und vom Hausflur zieht die warme Luft an mir vorbei in die Wohnung. Ich stelle meine Schultasche ab, ganz genau gerade auf die Garderobenkommode. So viel Zeit muss sein.
Die Fladen bilden eine Spur über den Flurboden, durchs Wohnzimmer direkt in mein Zimmer. Alle paar Zentimeter ein Kackfladen. Ja, man denkt vielleicht, ein Kaninchen macht Kötel. So kleine Kügelchen, die man problemlos aufsammeln oder herumschnipsen kann, ohne dabei schmutzig zu werden.
Aber nicht Maikel. Wenn er mal wieder einen schlechten Tag hat, macht er Fladen. Weich und braun und klebrig. Er kommt heraus, wenn keiner in der Wohnung ist, macht alles voll und verkriecht sich zurück in seinen Käfig. Als wollte er sagen: »Viel Spaß damit. Ich bin dann weg.«
Danke auch.
»Nee, ey!«, sage ich noch mal. In der Küche lasse ich Spülwasser einlaufen und reiße ein paar Küchentücher ab. Dann fällt mir ein, dass ich noch gar nicht nach ihm gesehen habe. Ich gehe an den Kackfladen entlang in mein Zimmer und sage leise: »Maikel?«
Es rührt sich nichts im Käfig.
»Maikel!?«, sage ich etwas lauter. Nichts. Mein Herz schlägt ein bisschen schneller. Was, wenn er tot ist?
Das denke ich ständig.
Ich nehme das Käfigdach ab und sehe hinein. Alles still. Da bemerke ich ein kleines Haarbüschel aus seinem Häuschen herauswachsen. Ich berühre es, streichle ganz leicht darüber. Es regt sich nicht. Jetzt bekomme ich richtig Angst, ich nehme das Häuschen hoch und da liegt er. Ich beuge mich noch tiefer und halte die Luft an. Doch, er bewegt sich. Ich sehe seinen Bauch beim Atmen auf und ab gehen, ganz leicht nur, aber richtig schnell.
»’tschuldigung«, sage ich leise und setze das Häuschen wieder über Maikel drüber.
Ich mache das Radio an und fange an zu putzen. Im Flur und im Wohnzimmer ist das noch einfach, da haben wir Parkettboden. Aber in meinem Zimmer muss ich mich richtig hinknien und den Teppich schrubben und es bleiben trotzdem noch Flecken. Es sind nicht die einzigen. Dann kommt der spaßigste Teil. Ich muss Maikel herausholen und ihm den Po putzen. So ist das nun mal. Er lässt es über sich ergehen, es scheint ihn nicht mal zu stören, er hält ganz still. Niemand sonst darf ihn anfassen, nur ich. Ich nehme ihn mit in die Küche und schmeiße mit der freien Hand die ganzen Küchentücher in den Müll.
Jetzt ab in meinen Karton, denke ich.
Da höre ich den Schlüssel im Schloss, die Wohnungstür geht auf und Papa kommt herein.
»Huhu!«, sagt er. »Wir sind da!«
Er trägt zwei riesige Koffer. Und hinter ihm steht eine Frau auf der Türschwelle. Sie hat einen Arm in Gips, er hängt in einem Verband vor ihrer Brust.
»Hallo!«, sagt sie.
»Kommt doch rein«, sagt Papa und macht den Weg frei. »Das ist Farah.« Papa zeigt auf die Frau. »Mein Sohn, Andrea.«
Die Frau kommt zu mir und lächelt und gibt mir die nicht eingegipste Hand. Die linke. Sie trägt ein Kopftuch und ist geschminkt. Unter der Schminke um ihr linkes Auge ist, glaube ich, ein blauer Fleck.
»Hallo«, sagt sie noch einmal und drückt meine Hand.
Hinter ihr steht noch jemand. Ein Mädchen. Sie steht immer noch auf der Türschwelle und sieht in den Raum und sagt gar nichts. Sie trägt einen roten Adidas-Trainingsanzug.
»Und das ist Fidaa«, sagt Papa. Er stellt die Koffer ab, geht zu ihr und schiebt sie in den Flur. Sie steht vor mir und Papa und Farah daneben, und die beiden sehen uns beide an, als ob sie erwarten, dass wir uns jetzt um den Hals fallen oder so.
Stattdessen zeigt Fidaa auf Maikel.
»Was ist das, eine Ratte?«, fragt sie. Sie lacht nicht dabei. Sie meint es komplett ernst. Sie sieht mich an, mit einem Todesgesicht und nicht dem kleinsten Lächeln.
»Haha«, macht Papa. »Hahaha.«
Aber niemand sonst lacht. Im Radio läuft irgendein Popsong, es passt überhaupt nicht.
»Jedenfalls, herzlich willkommen bei uns!«, sagt Papa viel zu laut. »Kommt mit, ich zeige euch eure Zimmer.« Er schnappt sich wieder die Koffer und zieht sie durch den Flur nach hinten. Farah lächelt mich noch mal an und geht hinterher. Fidaa bleibt stehen.
»Wie heißt du? Andrea!?«, fragt sie. Ich nicke.
»Wie ein Mädchen?«
»Das ist Italienisch«, sage ich.
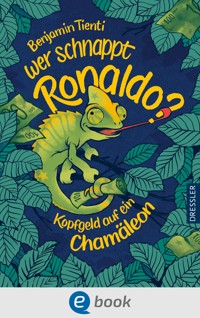
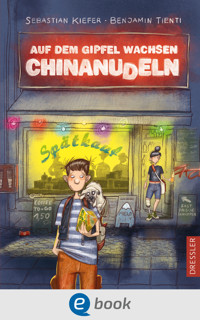
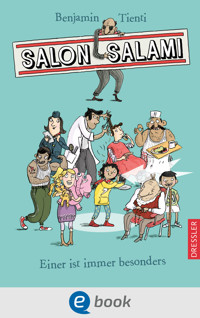













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












