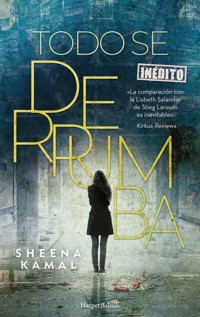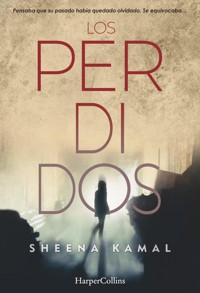8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Eine mutige, unbeirrbare Heldin und eine mutige, unbeirrbare Schreibweise ergänzen sich zu einem außergewöhnlichen Debüt – höchst empfehlenswert.« Lee Child Nora Watts ist die perfekte Jägerin - als ehemaliges Mitglied der Canadian Forces hat sie ein untrügliches Gespür für Lügen. Sie ist die beste Privatdetektivin Kanadas. Doch ihr Leben ist hart, immer wieder verfällt sie dem Alkohol. Sie vertraut niemandem, lebt heimlich in einer Abstellkammer unter dem Detektivbüro in Vancouver und spricht nur mit ihrer Hündin Whisper. Bis ein Paar sie um ihre Hilfe bittet. Ihre Tochter Bonnie ist verschwunden. Nora stellt entsetzt fest, dass es sich um ihre eigene, vor fünfzehn Jahren zur Adoption freigegebene Tochter handelt. Nur wenn sie sich jetzt zum ersten Mal wieder den Menschen öffnet, kann sie sie retten. Aber Bonnies Entführer sind auch hinter ihr her, und bald wird die Jägerin zur Gejagten ... »Extrem spannend, mit ganz eigener Stimme, psychologischer Tiefe und herzzerreißend lebensnahen Figuren. Untiefen bleibt im Gedächtnis, noch lange nachdem man die letzte Seite gelesen hat. Vielleicht für immer.« Jeffery Deaver »Kamals Debüt ist anders als die üblichen Vermissten-Thriller – rau, brutal und provozierend. Eine Autorin, die man im Blick behalten sollte!« Library Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Nora Watts ist eine Frau mit einer dunklen Vergangenheit, einer komplizierten Identität und der Seele einer Künstlerin. Eine ehemalige Blues-Sängerin, die von Problemen verfolgt wird wie von dem streunenden Hund, den sie auf ihrem Weg aufgesammelt hat. Sie ist das Kind eines oft missverstandenen Landes, ein Flickenteppich gebrochener Identitäten und Einflüsse. Bei Nora gibt es keine einfachen Antworten.
Extrem spannend, mit ganz eigener Stimme, psychologischer Tiefe und herzzerreißend lebensnahen Figuren. Untiefen bleibt im Gedächtnis, noch lange nachdem man die letzte Seite gelesen hat. Vielleicht für immer.
Die Autorin
Die Kanadierin Sheena Kamal studierte Politikwissenschaften an der University of Toronto. Sie ist in der Film- und Fernsehbranche tätig, zuletzt war sie bei der Entwicklung einer Crime-Drama-Serie für Recherchen zuständig. Ihre Nachforschungen inspirierten sie dazu, ihr Debüt Untiefen zu schreiben.
SHEENA KAMAL
Untiefen
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Sybille Uplegger
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1655-0
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017© Sheena Kamal 2017Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, LLCTitel der amerikanischen Originalausgabe: The Lost Ones (William Morrow, 2017)Umschlaggestaltung: semper smile, MünchenTitelabbildung: plainpicture / Millennium / © Ilona Wellmann (Frau von hinten);Shutterstock / © Bipsun (Schrift); Shutterstock / © Toluk (Struktur)
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
ErsterTeil
1
Der Anruf kommt um kurz nach fünf Uhr morgens.
Ich bin sofort in Alarmbereitschaft, denn zu so früher Stunde bedeutet ein klingelndes Telefon nichts Gutes. Vor neun Uhr erhält man garantiert nicht die Nachricht vom Ableben eines wohlhabenden Verwandten, der einem sein gesamtes Hab und Gut vermacht hat. Ein Glück also, dass ich bereits wach bin und gerade meine zweite Tasse Kaffee trinke; so bin ich wenigstens halbwegs gerüstet.
Davor war ich spazieren. Ich habe mich über das Geländer der Ufermauer gelehnt und ins Wasser geschaut, das genauso ruhig und grau war wie die Stadt um diese Jahreszeit. Wie üblich habe ich versucht, in der Tiefe die warme Schwarze Strömung auszumachen, die, von Japan kommend, in den Nordpazifik fließt, wo sie ihre lauen Finger bis zur Küste hin ausstreckt. Und wie üblich war sie nirgends zu entdecken.
Vancouver. Manche Menschen behaupten, es sei wunderschön hier, aber diese Menschen waren noch nie in den Gegenden der Stadt, die ich mein Zuhause nenne. Sie waren noch nie unten in der Hastings Street mit ihren Spritzen und Junkies. Sie haben nie monatelang auf grauen Himmel und graues Wasser gestarrt, während der Regen, wie in einem vergeblichen Versuch, die Stadt reinzuwaschen, ohne Pause vom Himmel rauscht. Und wenn dann der Sommer kommt, wird es so heiß, dass man in den Feuern, die in den Wäldern der Provinz wüten, Marshmallows rösten kann. An der Küste ist der Sommer ganz erträglich, allerdings lässt er zum jetzigen Zeitpunkt noch mehrere Monate auf sich warten.
Ich betrachte die unbekannte Nummer auf dem Display meines Handys und drücke sie nach kurzem Zögern weg. Bereits wenige Sekunden später klingelt es erneut. Neugierig geworden, nehme ich nun doch ab. Beharrlichkeit ist eine Eigenschaft, die ich bei Anrufern seit jeher bewundere.
»Hallo?«
Nachdem der Mann am anderen Ende mir mit heiserer Stimme den Grund seines Anrufs geschildert hat, tritt erst einmal eine lange Pause ein. Mit der Zeit wird diese Pause beklemmend. Ich spüre, wie der Anrufer mit sich ringt; er möchte noch mehr sagen, weiß aber, dass das nicht klug wäre. Niemand will einen Schwafler in der Leitung haben. Schon gar nicht, wenn es sich um einen Unbekannten handelt. Ich stelle mir vor, wie er schwitzt. Vielleicht sind seine Hände feucht geworden, denn plötzlich fällt ihm das Telefon herunter. Ich höre das Poltern, als es auf dem Boden aufschlägt. Er flucht geschlagene dreißig Sekunden lang, während er es aufhebt und um Fassung ringt.
»Sind Sie noch da? Haben Sie gehört, was ich gesagt habe?«, fragt er.
»Ja, ich hab’s gehört«, antworte ich, als die Stille zur Qual wird. »Ich komme.« Dann lege ich auf.
Ich habe den Namen Everett Walsh noch nie zuvor gehört. Trotzdem behauptet er, ich könnte möglicherweise etwas über ein verschwundenes Mädchen wissen. Allerdings hat er mir nicht verraten, was. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, das Treffen abzulehnen, aber er klang so verzweifelt, und wenn es etwas gibt, womit man mich noch leichter herumkriegt als mit Hartnäckigkeit, dann ist es Verzweiflung.
Zugegeben, es ist gewissermaßen mein Beruf, Menschen aufzuspüren – aber was um alles in der Welt kann ich über ein vermisstes Mädchen wissen, das einen Anruf um diese Uhrzeit rechtfertigen würde?
Seine Verzweiflung ist so frisch und nackt, dass ich sie beinahe schmecken kann.
2
Es ist kühl an diesem Wintermorgen in Vancouver. Ich hätte auch »nass« sagen können, aber das ist an der Westküste zu dieser Jahreszeit gewissermaßen mitgedacht. Hier muss man immer mit Niederschlag rechnen. Es dauert noch eine Stunde bis zur vereinbarten Zeit. Ich sitze auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Wartehäuschen einer Bushaltestelle – ungeachtet dessen, dass mein uralter, verbeulter Corolla auf dem Parkplatz steht. Menschen, die an Bushaltestellen warten, werden von Autofahrern für gewöhnlich nicht wahrgenommen, es sei denn, die Ampel ist gerade rot und sie wissen vor lauter Langeweile nicht, wo sie hinschauen sollen. Da es hier keine Ampel gibt, fühle ich mich sicher. Von meinem Platz aus habe ich sowohl das Café als auch den dazugehörigen Parkplatz gut im Blick. Der Tresen ist hell erleuchtet, der Rest des Cafés jedoch liegt im Halbdunkel. Es soll also ein geheimes Treffen werden. Kein Problem. Ich bin Expertin für Heimlichtuerei. Kann dieser Everett Walsh dasselbe von sich sagen?
Ein Bus hält vor mir. Ich gebe dem Fahrer ein Handzeichen, dass er weiterfahren soll. Mit einem missmutigen Brummen gibt er Gas, und der Bus bläst mir beim Losfahren eine Abgaswolke ins Gesicht.
Das Café liegt, umgeben von Autowerkstätten und Fast-Food-Läden, an der Grenze zum belebten Bezirk Kingsway. Es ist ein Zwischending aus Coffeeshop und Diner. Innerhalb des breiten Spektrums von Lokalen, die es zwischen Everett Walshs Haus in Kerrisdale und meinem eigenen, ungleich schäbigeren Wohnviertel gibt, hat er sich eins mit hübscher roter Markise und verblichenem gelbem Anstrich ausgesucht. Etwas, das genau in der Mitte liegt. Wahrscheinlich hofft er, dass wir beide uns hier einigermaßen wohl fühlen können.
Selbst aus der Entfernung erkenne ich recht schnell, dass der Kaffee in dem Laden scheußlich schmeckt. Die Muffins allerdings scheinen nicht übel zu sein. Die Leute, die mit einem Pappbecher in der Hand aus der Tür kommen, fummeln draußen den Deckel ab, trinken einen Schluck und verziehen das Gesicht, wohingegen diejenigen, die von ihrem Muffin abbeißen, einfach achselzuckend weitergehen. Sie haben an ihrem Kauf nichts zu beanstanden.
Zwanzig Minuten vor der Zeit biegt ein sportlicher dunkler Audi auf den Parkplatz ein. Darin sitzt ein gepflegtes Paar, beide mit Sonnenbrille. Im Vorbeifahren werfen sie aus dem Auto einen Blick ins Café. Als sie denjenigen, nach dem sie Ausschau halten, nicht sehen, beginnen sie zu streiten. Der Audi fährt davon, kommt aber bereits fünf Minuten später wieder zurück.
Sie parken unweit des Eingangs. Der Mann, der inzwischen die Sonnenbrille abgenommen hat, steigt aus und nimmt Kurs auf das Café. Er ist klein und untersetzt mit dickem Hals. Eine Baseballkappe bedeckt sein schütteres braunes Haar, und selbst unter der dunklen Jacke erkennt man gebeugte Schultern. Er wirkt niedergeschlagen. Kurze Zeit später taucht dann auch die Frau auf. Sie wirft ihre langen roten Haare nach hinten und folgt dem Mann hinein. Ihr ist egal, ob jemand sie sieht. Sie ist wunderschön und daran gewöhnt, alle Blicke auf sich zu ziehen. Allerdings behält sie ihre Sonnenbrille auf, weil das ihre Aura des Geheimnisvollen und Sinnlichen verstärkt. Es ist ein äußerst wirkungsvolles Mittel. Der Mann mittleren Alters, der hinter dem Tresen des Cafés die Gäste bedient, taxiert sie unauffällig, während er ihr Kaffee einschenkt. Ihrem Ehemann schenkt er keine Beachtung, außer um sein Geld zu nehmen.
Der Mann und die Frau warten. Beide sind etwa Mitte vierzig und gut gekleidet. Sie unterhalten sich nicht, aber ihr Schweigen ist auch nicht freundschaftlich. Falls es zwischen diesen beiden jemals etwas wie Chemie gegeben hat, ist nach vielen Jahren Ehe nichts mehr davon übrig. Der Mann zeigt nach wie vor Interesse, doch die Frau ignoriert all seine Bemühungen um Aufmerksamkeit und starrt aus dem Fenster zur Einfahrt des Parkplatzes. Sie nippen an ihrem Kaffee, lassen dabei aber nicht die kleinste Regung erkennen. Entweder sie achten gar nicht auf das Aroma, oder ihre Geschmacksknospen stehen unter Schock.
Ich studiere sie für die restliche Zeit, die mir noch bleibt. Ganz offensichtlich sind sie kein Paar, das gewohnheitsmäßig zum gemeinsamen Kaffeetrinken ausgeht. Von sich aus wären sie niemals hergekommen, die Lage muss also ernst sein. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, kann aber nicht verhehlen, dass ich zugleich auch neugierig bin. Bei einer Internetrecherche heute Morgen habe ich herausgefunden, dass sie beide als Architekten arbeiten, allerdings für unterschiedliche Firmen. Da sie mir im Großen und Ganzen harmlos erscheinen, stehe ich auf, überquere die Straße und gehe um das Gebäude herum zum Seiteneingang des Cafés. Damit rechnen sie nicht, und dementsprechend überrascht sind sie, als ich plötzlich, einen Muffin in der Hand, an ihrem Tisch auftauche.
Die Frau mustert meine abgetragene Jeans und den ausgeleierten Pullover mit den gezogenen Fäden. Im Gegensatz zu ihr konzentriert sich der Mann allein auf mein Gesicht. Meine Haut, die weder hell noch dunkel ist, sondern irgendwas dazwischen. Die ausgeprägten Wangenknochen. Das trotzige Kinn. Ganz besonders scheinen ihn meine Augen zu faszinieren. Das ist oft so – jedenfalls bei denen, die sich die Mühe machen, genauer hinzusehen. Ohne meine Augen wäre ich vollkommen unscheinbar. Sie sind so dunkel, dass Pupille und Iris kaum voneinander zu unterscheiden sind, und werden von langen Wimpern umrahmt. Man könnte sie beinahe als hübsch bezeichnen – aber nur im ersten Moment, bis man merkt, dass sie das Licht schlucken und undurchdringlich sind wie eine Wand. Wer mir in die Augen schaut, dem fällt plötzlich siedend heiß ein, dass er gerade jetzt einen wichtigen Termin hat oder unbedingt irgendwelche anderen Dinge erledigen muss, die keinen Aufschub dulden.
»Everett Walsh?« Ich hole mir einen Stuhl und setze mich. Ich wende mich ausschließlich an den Mann. Die Frau braucht noch etwas Zeit, um sich von meinem Überraschungsauftritt zu erholen.
»Was? Ach so. Ja. Das wäre … äh, das bin wohl ich.« Er wischt sich unter dem Schirm seiner Kappe eine Schweißperle von der Stirn, dann nimmt er die Kappe ganz ab. Die Frau wirft ihm einen angeekelten Blick zu. »Und das ist meine Frau Lynn.«
»Ist mir ein Vergnügen«, sagt sie, wobei ihr schneidender, kühler Ton verrät, dass es ihr ganz und gar kein Vergnügen ist. Sie erkennen mich nicht als die Frau von der Bushaltestelle wieder. Wahrscheinlich haben sie gar nicht registriert, dass es überhaupt eine Bushaltestelle gibt. Die beiden gehören nicht zu der Sorte Mensch, die im Alltag auf öffentliche Transportmittel angewiesen ist. Die Glücklichen. Der öffentliche Personennahverkehr in Vancouver lässt sich am treffendsten als totales Desaster beschreiben. Es gilt, ihn unter allen Umständen zu meiden, es sei denn, man ist arm, oder die Luxuskarosse steht gerade in der Werkstatt.
Da Everett erkennt, dass Lynn ihm vorerst keine Hilfe sein wird, übernimmt er die Gesprächsführung. »Danke, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, der Anruf kam ziemlich unerwartet, und Sie kennen uns nicht, aber …«
»Wer hat mich Ihnen empfohlen?« Denn irgendjemand muss mich empfohlen haben. Woher hätten sie sonst meine Nummer?
Everett blinzelt verwirrt. »Was? Niemand. Wir haben jemanden damit beauftragt, Sie zu finden.«
Jetzt ist die Verwirrung auf meiner Seite. Normalerweise bin ich diejenige, die Leute findet. »Wovon reden Sie?«
»Unsere Tochter ist verschwunden«, klinkt Lynn sich ein.
Everett sieht seine Frau an. »Das habe ich ihr schon am Telefon gesagt, Schatz.«
Lynn dreht sich zu ihm um. Sie tauschen einen Blick, in dem ihre ganze gemeinsame Geschichte zu liegen scheint. »Ihre Tochter ist verschwunden. Hast du ihr das gesagt?«
Mit offenem Mund starre ich sie an. Der Satz schlägt bei mir ein wie eine Bombe – und zweifellos hat Lynn genau das beabsichtigt. Einen Moment lang habe ich das Gefühl, als wäre der Sauerstoff aus dem Raum gesaugt worden. Eine seltsame Spannung entsteht. Jetzt endlich widmet Lynn mir ihre volle Aufmerksamkeit, und obwohl sie weder lächelt noch ihre Sonnenbrille abgenommen hat, erkenne ich, dass sie äußerst zufrieden mit sich ist.
Everett räuspert sich. Er öffnet den Mund, um etwas zu sagen, schließt ihn dann aber wieder. Wir starren einander an, er und ich, bis er den Mut für einen zweiten Versuch aufbringt. »Sie meint das Baby, das Sie vor fünfzehn Jahren zur Adoption freigegeben haben.« Meine Reaktion beunruhigt ihn. Bislang habe ich alles mit vollkommen ausdrucksloser Miene zur Kenntnis genommen. Jetzt allerdings verspüre ich das Bedürfnis, nachzusehen, ob ich noch festen Boden unter den Füßen habe, statt, wie ich glaube, in einen alptraumhaften Kaninchenbau gestürzt zu sein.
Er zieht ein Foto aus seiner Brieftasche und legt es vor mich hin.
Ein leicht molliges junges Mädchen mit goldenem Teint blickt mir entgegen. Obwohl ihre Augen tiefer liegen und ein wenig schräg stehen, lässt sich nicht leugnen, dass es meine Augen sind. Nahezu schwarz und undurchdringlich. Sie hat dunkle Haare, dunkler als meine, die ihr bis über die Schultern reichen, und ein niedliches Grübchen am Kinn. Doch dann höre ich auf, ihre einzelnen Merkmale zu katalogisieren. Ich will ein Gespür fürs Ganze bekommen. Für das, was sich hinter der äußeren Erscheinung verbirgt. Was dieses Mädchen ausmacht. Nach einer Weile sehe ich, dass ihre Lippen zwar lächeln, ihre Augen jedoch nicht. Sie belügt die Kamera, indem sie vortäuscht, glücklich zu sein.
»Das ist Bonnie. Bronwyn, um genau zu sein, aber wir nennen sie meistens Bonnie.« In Everetts Stimme schwingt Stolz mit. Und Liebe.
Ich werfe einen Blick zu Lynn hinüber. Sie vermeidet es, das Foto anzuschauen. Ich beiße von meinem Muffin ab. Das gibt mir Zeit, meine Gedanken zu sammeln, die durch die Ritzen im Holztisch gerutscht sind und jetzt überall verstreut auf dem Fußboden herumliegen.
Everett weiß meine Miene nicht recht zu deuten, aber er hat angefangen, und jetzt gibt es kein Zurück mehr. »Sie ist vor zwei Wochen verschwunden. Wir dachten, sie wäre mit Freunden zelten gefahren, aber …«
»… das war gelogen. Sie hat alles an Bargeld mitgenommen, was wir im Haus hatten. Außerdem hat sie noch meine Scheckkarte gestohlen und damit tausend Dollar abgehoben, ehe ich etwas gemerkt habe und die Karte sperren lassen konnte.« Lynn nimmt ihre Sonnenbrille ab, und ich sehe die Schatten unter ihren blutunterlaufenen Augen. Allmählich bekomme ich ein klareres Bild von dem, was hier vor sich geht. Lynn ist mit ihrem Latein am Ende. Das Kind, das sie unbedingt haben wollte und für dessen Adoption sie große Mühen in Kauf genommen hat, ist zu einem pubertierenden Teenager herangewachsen, und jetzt sucht sie den Kassenzettel, weil sie es zurückgeben will. »Das ist früher auch schon vorgekommen, schon zweimal. Aber so lange wie jetzt ist sie noch nie weggeblieben.«
»Die Polizei war kein bisschen hilfsbereit«, wirft Everett ein. »Sie haben zwar eine Vermisstenmeldung rausgegeben, aber weil sie das Geld gestohlen hat, gehen sie davon aus, dass sie aus freien Stücken weggelaufen ist und nicht zurückkommen will. Sie haben aufgehört, nach ihr zu suchen – falls sie überhaupt je wirklich nach ihr gesucht haben. Sie sind zu uns nach Hause gekommen und haben den Vorfall aufgenommen, und ich glaube, einer von ihnen hat auch mit ein paar Lehrern von Bonnies Schule gesprochen, aber mehr ist nicht passiert. Sie ist ein gutes Mädchen …«
Lynn schnaubt verächtlich. »Die haben sie als ›chronische Ausreißerin‹ bezeichnet, Everett. Sie hat uns beklaut.«
»Sie ist ein gutes Mädchen!«, beharrt Everett. »Aber in letzter Zeit war sie ziemlich schwierig«, räumt er ein. »Neue Freunde. Sie kam abends immer später nach Hause. Wir vermuten, dass sie Alkohol trinkt und Drogen nimmt. Wie gesagt, sie ist früher auch schon von zu Hause weggelaufen, aber sie ist immer wiedergekommen! Nur diesmal … diesmal nicht. Warum? Warum ist sie nicht zurückgekommen?« Von seinen Gefühlen überwältigt, schlägt er die Hände vors Gesicht. Es ist bedrückend, einen erwachsenen Mann weinen zu sehen, trotzdem widerstehe ich dem Drang, den Blick abzuwenden. Dies sind die Momente, in denen man sieht, ob jemand aufrichtig ist oder nicht. Falsche Tränen sind leicht zu erkennen, wenn man also weint, sollte man ehrlich dabei sein. Und das ist er. Dieser Mann leidet.
Lynn starrt Everett eine Zeitlang an, dann richtet sie das Wort wieder an mich. Keine tröstende Hand auf seiner Schulter, kein »Ist ja gut, Liebling«. »Wir haben auf ihrem Computer ihren Suchverlauf gefunden. Obwohl sie wusste, dass wir dagegen sind, hat sie im Netz nach ihren leiblichen Eltern gesucht. Über eine dieser … wie nennt man die noch gleich?«
Sie sieht mich an, als müsste ich die Antwort wissen. Ich zucke mit den Schultern.
Lynn verzieht keine Miene. »Eine dieser Seiten, auf denen adoptierte Kinder mit ihren leiblichen Eltern zusammengeführt werden. Wir hoffen für Bonnie, dass sie keinen Kontakt zu Ihnen aufgenommen hat, aber falls sie es getan haben sollte …«
Everett hat lange gebraucht, um sich zu fangen. Nun maßregelt er Lynn mit einem verärgerten Blick. »Bitte entschuldigen Sie meine Frau. Wir wollen einfach nur wissen, wo unsere Tochter ist.«
Es fällt nicht weiter schwer, hier zwischen den Zeilen zu lesen. Was sie eigentlich sagen wollen, ist, dass ich einen schlechten Einfluss auf ihr Kind ausübe – und das, obwohl ich es nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen habe und es sich unmöglich daran erinnern kann, meine Bekanntschaft gemacht zu haben. In ihren Augen bin ich daran schuld, dass Bonnie mit Alkohol und Drogen experimentiert. Sie haben Angst, ihre Tochter könnte die ganze gute Erziehung in den Wind geschossen und sich auf die Seite ihrer fragwürdigen Erbanlagen geschlagen haben. Angst, sie könnte in die Arme ihrer wahren Familie geflohen sein, um fortan mit mir zusammen faul und versoffen in den Tag hinein zu leben. Wahrscheinlich stellen sie sich vor, wie wir beide über unserem Bier sitzen und sie auslachen.
Nichts ist erniedrigender, als wenn anständige Menschen auf einen herabsehen. Aber ich lasse mir nichts anmerken, sondern ziehe einen schwachen Trost aus der Erkenntnis, dass diese beiden ihr Leben wesentlich schlechter im Griff haben als ich meines. Jetzt verstehe ich auch, warum Everett sich unbedingt mit mir treffen wollte.
Ich bin seine letzte Hoffnung.
»Vor ein paar Jahren war sie regelrecht besessen von der Idee, ihre leiblichen Eltern ausfindig zu machen. Damals hat sie auch oft mit ihren Freunden darüber gesprochen. Irgendwann kam dann nichts mehr, und wir dachten, das Thema wäre vom Tisch.«
»Aber dann haben wir gemerkt, dass sie die Adoptionsunterlagen gefunden hatte, die Sie damals unterschrieben haben. Ihre Geburtsurkunde. Es war schwer, Sie zu finden, wir mussten extra einen Privatdetektiv anheuern. Trotzdem dachten wir, dass es Bonnie vielleicht irgendwie geschafft haben könnte, mit Ihnen in Kontakt zu treten.«
Ich runzle die Stirn. »Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das Gesetz schreibt vor, dass Sie eine abgeänderte Geburtsurkunde bekommen. Mein Name hätte gar nicht draufstehen dürfen.«
»Das wissen wir«, antwortet Everett. »Nur gab es da eine Verwechslung. Man hat uns zuerst irrtümlicherweise die Originalurkunde ausgehändigt. Danach haben wir dann die abgeänderte Urkunde bekommen und wurden gebeten, das Original zu vernichten.«
Lynn sieht Everett nicht an, obwohl ihre nächsten Worte an ihn gerichtet sind. »Aber Everett hat sie behalten.«
»Es tut mir leid«, sagt er. »Okay? Wie oft soll ich es noch sagen? Es tut mir wahnsinnig leid.«
»Ich hab nichts von ihr gehört«, sage ich nach einem kurzen Schweigen. Mein Muffin ist fast aufgegessen, und sowohl der Haupt- als auch der Seiteneingang des Cafés üben in diesem Moment eine fast unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich aus. Am Ende jedoch siegt meine Neugierde. »Was ist an dem Tag passiert, als sie verschwunden ist?«
Lynn zuckt mit den Schultern. »Sie hat uns gesagt, sie will zelten fahren.«
»Ja, das habe ich schon gehört. Wo waren Sie?«
Ein Blickwechsel. Es ist ihnen unangenehm, dass ihre Fähigkeiten als Eltern auf dem Prüfstand stehen. »Wir haben beide gearbeitet«, teilt Lynn mir mit. Ihre Augen verengen sich zu schmalen Schlitzen, und ihre Stimme ist unbeabsichtigt um mehrere Dezibel lauter geworden. Ein paar Gäste heben die Köpfe und schauen in unsere Richtung, bevor sie sich wieder ihrem ungenießbaren Kaffee zuwenden.
»Vielleicht hat sie Kontakt zu ihrem leiblichen Vater aufgenommen?«, mutmaßt Everett in dem Versuch, das Gespräch wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Er lächelt, um sich für Lynn zu entschuldigen – etwas, woran er gewöhnt zu sein scheint.
Herzlich unwahrscheinlich. Ich schüttle den Kopf. »Ich kann Ihnen da nicht helfen.« Mit diesen Worten stehe ich auf und verlasse den Tisch. Mein Abgang erfolgt genauso abrupt wie mein Auftritt. Ich überlege kurz, ob ich mich entschuldigen soll. Andererseits habe ich diesen typisch kanadischen Drang, »Es tut mir leid« zu sagen, obwohl man nichts falsch gemacht hat, nie nachvollziehen können.
Auf dem Weg zur Tür bekomme ich mit, wie Lynn hinter mir zischelt: »Grandiose Idee, Ev. Wirklich genial.«
Als ich über den Parkplatz gehe, höre ich Schritte hinter mir, und ich spanne mich unwillkürlich an. Es ist Everett. Er drückt mir das Foto in die Hand. »Nora? Das eben lief nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Lynn … sie steht auf der Arbeit gerade unter sehr großem Druck, und zwischen ihr und Bonnie gab es schon seit längerer Zeit immer wieder Konflikte.«
Auch diesmal ist seine Miene entschuldigend. Er möchte, dass ich ihm sage, dass alles gut ist, doch genau wie Lynn ignoriere ich sein aufdringliches Buhlen um Trost und Verständnis. Er versteift sich, und Röte kriecht ihm den speckigen Hals hinauf bis ins Gesicht. Ich versuche, ihm das Foto wiederzugeben, doch er hebt die Hände und weicht vor mir zurück.
»Behalten Sie es. Und, bitte, wenn Sie von ihr hören, rufen Sie uns an. Ich habe unsere Kontaktdaten auf die Rückseite geschrieben. Sie ist … sie ist trotz allem ein gutes Kind. Ich möchte einfach nur, dass sie nach Hause kommt.«
Das sagt er jetzt schon zum zweiten Mal. Er klammert sich beinahe verzweifelt an diesen Glauben. Ein gutes Kind. Ich frage mich, was damit eigentlich gemeint sein soll. Für mich hat es den Anschein, als wäre sie zutiefst unglücklich.
»Warum haben Sie den Privatdetektiv damit beauftragt, mich zu finden und nicht sie?«, frage ich. Gleich darauf kommt mir die Antwort von allein. »Weil Sie dachten, sie wäre zu mir gekommen. Ich bin Ihr Ausgangspunkt.«
»Und unser Endpunkt«, sagt er und wendet sich ab. »Sie hat mittlerweile ziemlich viel Übung im Weglaufen. Sie hat uns nicht den kleinsten Hinweis hinterlassen.«
Auf dem Weg zu meinem rostigen Corolla versuche ich die aufsteigende Panik zu unterdrücken. Everett Walsh hat keine Mühen gescheut, um die leibliche Mutter seiner verschwundenen Tochter ausfindig zu machen – und das, obwohl es keinen einzigen konkreten Anhaltspunkt gab, dass ich mit dem Kind, das ich vor all den Jahren weggegeben habe, in Kontakt stehe. Sicher, sie hat nach mir gesucht, aber was heißt das schon? Viele Kinder suchen nach ihren leiblichen Eltern, ohne sie jemals zu finden. Das ist wohl kaum ungewöhnlich. Er gibt mir ein Foto, obwohl ich nicht darum gebeten habe. Er versucht mich damit zu beeindrucken, was für ein liebes Mädchen sie angeblich ist. Er lügt nicht, aber seine Manipulationsversuche sind allzu durchschaubar. Sie ist in der Vergangenheit bereits mehrfach von zu Hause ausgerissen, das hat die Polizei dazu veranlasst, nur halbherzig zu ermitteln, und jetzt klammert sich Everett an jeden Strohhalm.
Mich zu finden ist nicht schwierig, steht doch mein Name schwarz auf weiß auf dem Original der Geburtsurkunde. Aber woher um alles in der Welt weiß er, dass es mein Beruf ist, nach vermissten Personen zu suchen?
Und weiß er auch, dass seine Frau gelogen hat, als ich sie fragte, wo sie am Tag von Bonnies Verschwinden war?
3
Das Mädchen sitzt auf den Felsen und überlegt, was sie jetzt tun soll. Sie vermutet, dass sie eine Gehirnerschütterung hat, weiß es aber nicht genau. Sie blutet an Kopf, Armen und Handgelenken. Hinten an der Hüfte verspürt sie einen dumpfen Schmerz, kann sich jedoch nicht erinnern, dort geschlagen worden zu sein. Ihre Ohren sind erfüllt vom Getöse der Wellen, die sich an den Felsen brechen und sie ins Meer zu reißen drohen. So schwindlig, wie ihr ist, könnte sie nicht dagegen ankämpfen, das weiß sie. Das Wasser hat seine ganz eigene Kraft. Eine Kraft, die ihr Angst macht.
Sie muss hier weg.
Bald werden sie denken, sie sei tot, und die Suche nach ihr einstellen. An diesen Gedanken klammert sie sich, während sie sich ganz klein zusammenkauert. Das Salz der Luft brennt in ihren Augen. Mit ausgestreckter Zunge leckt sie sich einen Tropfen Meerwasser vom Gesicht und stellt fest, dass es eine Träne ist.
4
Die Kreuzung der Hastings Street mit der Columbia Street liegt in Downtown Eastside, dem schlimmsten Viertel von Vancouver. Es gibt städtebauliche Pläne zu seiner Aufwertung, aber bis sie umgesetzt werden, bleibt die Gegend das, was sie die meiste Zeit ihres Bestehens gewesen ist: ein Dreckloch. Allerdings ist sie bei den momentanen Immobilienpreisen auch der einzige Ort, wo man halbwegs erschwingliche Geschäftsräume mieten kann, wenn man, so wie mein Chef, eingefleischter Downtowner ist. Er führt eine Privatdetektei und teilt sein Büro mit der Liebe seines Lebens, einem mehrfach ausgezeichneten Journalisten, der an seinem nächsten Buch schreibt, Artikel verfasst und seinen Nachrichten-Blog pflegt.
Ich bin für die zwei als Sekretärin und wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Allein könnte keiner der beiden mein Gehalt finanzieren, aber Kostenteilung macht vieles möglich. Ähnliches gilt auch für mich selbst: Seit nunmehr drei Jahren wohne ich mietfrei im Keller des Bürogebäudes, um Geld zu sparen, damit ich irgendwann einmal die Anzahlung für ein eigenes Apartment leisten kann. Meine Chefs wissen nichts davon. Sie glauben, das Untergeschoss beherberge lediglich ein Gelass voll mit alten Akten und eine Besenkammer. Bislang haben sie sich noch nicht die Mühe gemacht, in mein Reich vorzudringen und sich vom Gegenteil zu überzeugen.
Gelegentlich stellen sie Spekulationen über meinen Corolla an, der Tag und Nacht auf dem Parkplatz hinter dem Haus steht und von dem sie ebenfalls nicht wissen, dass er mir gehört. Sie denken, er gehöre dem Mann von der Marketingagentur, die sich auf demselben Stockwerk befindet wie unser Büro. Ich habe es nie für nötig gehalten, sie über ihren Irrtum aufzuklären.
Wenn man die von Junkies, Dealern, Zuhältern und Huren bevölkerte Hastings Street ein Stück weitergeht, gelangt man ins Hipster-Viertel Gastown. Gastown ist gewissermaßen der Puffer zwischen den Reichen und den Armen; zwischen denen, die es sich leisten können, in den schönen Gegenden der Stadt zu wohnen, und Leuten wie mir, die in Kellern hausen und nehmen müssen, was sie kriegen können. Meine Arbeitgeber wiederum wohnen in Kitsilano, unweit des Strandes und in gebührender Entfernung zum Gestank der Hastings Street.
Meine Arbeitgeber, das ist zum einen Sebastian Crow, seines Zeichens Scheidungsopfer mit gebeugten Schultern, zum anderen Leo Krushnik, ein Schwuler, wie man ihn sich flamboyanter nicht vorstellen kann. Die beiden sind absolut verrückt nacheinander, wobei die Verrücktheit bei Sebastian nicht ganz so stark zum Ausdruck kommt – er ist einfach nur verliebt. Seb, ein begnadeter Auslandskorrespondent, hat sich erst relativ spät im Leben zu seiner Homosexualität bekannt – genauer gesagt, im Alter von dreiundvierzig Jahren, nach zwei Magengeschwüren infolge einer aus dem Kosovokrieg mitgebrachten posttraumatischen Belastungsstörung sowie seiner unglücklichen Ehe mit einer Anwältin. Doch auf Dauer vermochte er seine Leidenschaft für den wesentlich jüngeren Privatdetektiv und Rechnungsprüfer der Kanzlei seiner Frau nicht zu unterdrücken, und so gab er sein bisheriges Leben auf, um Leo dabei zu helfen, seine eigene Detektei zu gründen, in deren Räumlichkeiten Seb nun für sein Buch recherchiert und nebenbei Auftragsartikel schreibt. Hin und wieder kann er dank seiner journalistischen Fähigkeiten auch einen Beitrag zur Arbeit der Detektei leisten, aber größtenteils sind die Ermittlungen Leos Sache.
Womit wir zu einer wichtigen Lektion kämen, die ich mir definitiv zu Herzen nehme: Gründe niemals eine Firma mit deinem Lebensgefährten. Arbeit und Privatleben sind nicht mehr voneinander zu trennen. Seb hat jetzt nur noch seine Ruhe, wenn er gegenüber in die Bar geht oder Leo gerade unterwegs ist, so dass er das Büro für sich allein hat.
»Ah, da ist ja unser hauseigener Lügendetektor«, grüßt mich Leo, als ich hereinkomme.
Ich bin spät dran heute. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich bin sonst immer pünktlich – im Keller zu wohnen hat seine Vorteile –, aber das Treffen mit den Walshs hat mich aus der Bahn geworfen. Es ist halb zehn, und statt mit einem neuen Klienten komme ich mit einer dreißigminütigen Verspätung nebst sichtlichem Unwillen, mich dafür zu rechtfertigen. Leo blickt mich von seinem Schreibtisch aus an. Mit seiner Designerbrille und der maßgeschneiderten, wenngleich legeren Kleidung passt er nicht recht in das Bild, das man für gewöhnlich von einem Privatdetektiv hat. Genau das ist, wenigstens zum Teil, das Geheimnis seines Erfolges. Die Menschen unterschätzen ihn. Ein grober Fehler.
Auch Seb steckt nun den Kopf aus seinem Büro und mustert mich vom Türrahmen aus. Seine Lesebrille stammt aus der Drogerie. Sie ist auf der einen Seite mit Tesafilm geklebt und rutscht ihm fast von der Nase. »Alles in Ordnung, Nora?«, fragt er leise. Mein Zuspätkommen hat seinen üblichen Tagesablauf durcheinandergebracht. Er musste heute Morgen selbst seinen Kaffee aufsetzen und fragt sich jetzt natürlich, wieso.
»M-hm.« Ich setze mich an meinen Schreibtisch. Das rote Lämpchen am Telefon blinkt nicht, seit gestern sind also keine neuen Anrufe eingegangen. »Tut mir leid, dass ich spät dran bin.«
»Du kannst ruhig öfter zu spät kommen«, wirft Leo ein. »Ernsthaft, Nora. Genieß das Leben. Geh ein bisschen unter Leute. Investier was in eine neue Garderobe.«
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch nur einen dieser Vorschläge beherzigen werde, tendiert gegen null, und Leo weiß das auch. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, mich immer wieder darauf anzusprechen. Dass ich keine aufregenden Geschichten aus meinem Leben zu erzählen habe und meine Büro-Outfits sich aus zwei abgewetzten Jeans und drei uralten, ausgeleierten Pullis zusammensetzen – wobei ich Letztere nur trage, damit man die Löcher in meinen T-Shirts nicht sieht –, sind ewige Aufreger für ihn.
Gerade als er zu einem weiteren Vortrag darüber ansetzen will, wie wichtig es ist, qualitativ hochwertige Basics sowie einige ausgefallenere Teile zum Kombinieren zu haben, wird die Eingangstür zur Detektei so schwungvoll aufgestoßen, dass sie mit einem lauten Knall gegen die Wand schlägt. Wir alle zucken gleichzeitig zusammen. Eine schlanke, blonde Frau tritt ein und sieht sich im Büro um, als gehöre es ihr. Seb und mir schenkt sie keinerlei Beachtung. Sie wendet sich ausschließlich an Leo. Es ist unsere Stammkundin. »Ich habe Arbeit für euch.«
»Melissa …«, setzt Leo an.
Ihre Augen werden schmal. »Du unterstützt den Vater meines Kindes. Wie soll er den Unterhalt für Jonas zahlen, wenn er pleite ist? Von seinem Buchhonorar hat er ja nichts mehr übrig, und die Deadline für sein nächstes Buch ist längst verstrichen, weil er die ganze Zeit an diesem albernen Blog herumbastelt. Wer verdient heutzutage noch Geld mit Blogs?« Diese kleine Ansprache ist an uns alle gerichtet und soll einmal mehr demonstrieren, wie gut informiert Melissa ist. Sebs Exfrau weiß, dass sie mit Forderungen nach Ehegattinnen-Unterhalt keine Chance hätte, weil sie mehr verdient als er. Also benutzt sie den gemeinsamen Sohn, gezeugt in einem letzten verzweifelten Versuch, die Ehe zu kitten, als Vorwand hierherzukommen. Sie will ergründen, ob Seb wirklich mit einem anderen Mann glücklicher ist als mit ihr.
Sie wirft eine Akte auf meinen Tisch. »Den Mann müssen wir bis spätestens nächste Woche gefunden haben.«
Seb seufzt aus seinem Türrahmen heraus. »Ich brauche wirklich keine Almosen von dir. Das haben wir doch alles besprochen.«
»Also, ich brauche schon welche«, widerspricht Leo. Sein Lächeln hat etwas Aufgesetztes. »Wenn deine Firma mich anheuern will, Melissa – immer gern. Ich bin der beste Privatermittler der Stadt. Hier, nimm eine Broschüre mit.« Er hält ihr einen der schicken Flyer hin, für die er letztes Jahr in einem Versuch, seiner Firma ein neues Image zu verpassen, zweihundert Dollar ausgegeben hat. »Sag es gerne auch deinen Freunden weiter.«
Wir alle wissen, dass Melissa, eine erfolgreiche Strafverteidigerin, keine Freunde hat. Sie registriert die Spitze und bedankt sich dafür bei Leo mit einem harten Blick, halb feindselig und halb irritiert. Es geht über ihren Verstand, dass ihr Mann sie für diesen heiteren, korpulenten Polen hat sitzenlassen. Sie kann sich nicht erklären, wie es dazu kommen konnte, dass der Privatermittler, dessen Dienste ihre Kanzlei hin und wieder in Anspruch nahm und den sie anheuerte, als ihr Ehemann sich immer mehr von ihr zurückzog, am Ende selbigen Ehemann verführte, anstatt gegen ihn zu ermitteln, wie es seine Aufgabe gewesen wäre. Sie begreift nicht, wie ihr eigener Mann einfach so, ohne ihr Wissen schwul werden konnte. Als ihr das alles zu viel wird, wendet sie sich zum Gehen. »Nächste Woche«, wirft sie uns noch einmal zu.
Dann ist sie weg. Die Tür fällt genauso heftig ins Schloss, wie sie zuvor geöffnet worden war, und alle atmen auf.
Seb funkelt Leo verärgert an, bevor er ebenfalls seine Tür zuknallt. Leo vertieft sich in irgendwelche Unterlagen auf seinem Schreibtisch. Wir alle tun so, als wäre es nicht beschämend, dass wir jeden Fall annehmen müssen, der uns angeboten wird, weil seit Sebs mäßig erfolgreichem Buch über den Völkermord im Kosovo inzwischen zwei Jahre vergangen sind und das Honorar größtenteils für ihr gemeinsames Townhouse und Sebs Scheidung draufgegangen ist.
Trotzdem: Ein Fall ist ein Fall. Rosinenpickerei können wir uns nicht leisten.
Die Akte ist natürlich für mich bestimmt.
Ich mache gesuchte Zeugen ausfindig und nehme auch an den Vernehmungen teil, um festzustellen, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Ich durchschaue ihre Täuschungsmanöver und erkenne, was sie zu verbergen haben. Das ist meine besondere Fähigkeit. Leo hat angeboten, mich zu einer speziellen Schulung zu schicken, um meiner Tätigkeit einen offiziellen Anstrich zu geben, aber ich weiß, dass er nicht das nötige Geld dafür hat. Außerdem habe ich noch nie viel Wert darauf gelegt, mit meinem Können hausieren zu gehen. Manchmal ist es klüger, seine größte Stärke für sich zu behalten. Diese Lehre habe ich aus eigener schmerzvoller Erfahrung ziehen müssen.
Ich schlage die Akte auf und studiere das Hochglanzfoto von Harrison Baichwal, der konzentriert in die Kamera lächelt. Als Erstes stechen mir die dicken Brauen und der säuberlich gestutzte Vollbart ins Auge, der den Großteil seines faltigen Gesichts bedeckt. Hinter ihm sieht man die Ufermauer, der Himmel über ihm ist strahlend blau und wolkenlos. Der Mann auf dem Foto hat noch keine Ahnung, was die Zukunft für ihn bereithält. Er weiß nicht, dass sich jederzeit, ohne Vorwarnung ein dunkler Schatten vor die Sonne schieben kann. Harrison Baichwal wurde Zeuge eines Mordes und hat bei der Polizei eine wenig glaubhafte Aussage gemacht, in der er behauptete, im Vorfeld der schrecklichen Tat nichts Ungewöhnliches gesehen zu haben. Seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt.
Ich schiebe alle Gedanken an das verschwundene Mädchen beiseite und mache mich an die Arbeit. Trotzdem. Trotzdem nagt es an mir, und mein Kopf spinnt sich allerhand grauenhafte Bilder zusammen, was jungen Mädchen, die nicht nach Hause kommen, zugestoßen sein könnte. Ich kenne Bonnie nicht, aber ich kann mir auch nicht länger etwas vormachen. Sie hat einen Platz in meinem Bewusstsein. Nur habe ich mir in all den Jahren nie erlaubt, darüber nachzudenken, wie groß er wirklich ist.
5
Die Menschen lügen immer und in jeder Lebenslage. Viele lügen sogar auf gezieltes Nachfragen hin. Wenn man einen Lügner, erst recht einen erfahrenen, überführen will, ist es daher von elementarer Wichtigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Seien Sie präzise. »Schatz, wo warst du gestern Abend?« ist viel zu ungenau. Selbst ein Amateur kann solche Fragen jahrelang abblocken. Es ist immer besser zu sagen: »Hast du gestern Abend zwischen einundzwanzig Uhr siebenunddreißig und zweiundzwanzig Uhr achtzehn die Kassiererin von der Tankstelle gevögelt?«
Mit einer solchen Frage konfrontiert, wird ein Amateur fast immer die Wahrheit sagen. Ein Routinier wird zu dem Schluss kommen, dass seine Sache vielleicht noch nicht ganz verloren ist. Vielleicht hat Ihre beste Freundin Nancy ja nur jemanden gesehen, der ihm ähnlich sah, der mit jemandem, der der Kassiererin von der Tankstelle ähnlich sah, in einem Motelzimmer verschwand. Es war Abend, und abends ist es dunkel. Es stand kein Mond am Himmel, außerdem hat er sich bewusst für das Zimmer entschieden, das am weitesten von den Straßenlaternen entfernt war. Kann sein, dass es Fotobeweise gibt, kann aber auch nicht sein. Der gute Lügner wird immer nach einem Ausweg suchen und mit Gegenfragen kontern, um zu ergründen, wie viel Sie wirklich über die fraglichen Ereignisse wissen. Außerdem wichtig: Würden die Beweise vor Gericht standhalten, falls es darum geht, einen Ehevertrag für null und nichtig zu erklären? Ein sehr guter Lügner wird den Spieß umdrehen und Ihnen ein schlechtes Gewissen machen, weil Sie ihm nicht vertrauen und eine bedrückend negative Weltsicht haben.
Es gilt, eine Vielzahl von Möglichkeiten zu berücksichtigen, wenn es ums Lügen geht, aber während der Lügner all diese Möglichkeiten im Kopf durchspielt, wird sein Körper sich unweigerlich verraten. Ein Flattern des Augenlids. Ein kurzes Zucken der Lippen. Trommelnde Finger oder ein unwillkürliches Anspannen des Kiefers. Eine kaum wahrnehmbare Veränderung im Tonfall. Daran erkennen Sie, dass er nicht die Wahrheit sagt.
Natürlich kann der Er ebenso gut eine Sie sein, jung oder alt oder irgendetwas dazwischen. Lügen ist ein vollkommen normaler Bestandteil des menschlichen Lebens. Alle tun es, und die meisten sind gut genug darin, um diejenigen, die ihnen am nächsten stehen, hinters Licht zu führen.
Alle tun es – nur ich nicht. Mir fällt das Lügen schwer. Selbst harmlose Schwindeleien sind für mich ein Ding der Unmöglichkeit. In der Regel ziehe ich es daher vor, die Wahrheit zu umschiffen, statt sie zu beugen.
Ich starre das Foto von Harrison Baichwal an und frage mich, was an seiner Aussage ihm so unangenehm ist, dass er es nicht vor Gericht wiederholen möchte.
Leo ist nicht dumm. Er weiß, dass ich für solche Aufgaben eigentlich nicht qualifiziert bin. Deshalb gehen unsere wichtigsten Überwachungsaufträge auch an Stevie Warsame, einen jungen Expolizisten aus Alberta mit somalischen Wurzeln. Stevie ist Freiberufler und sehr engagiert. Er nimmt nie mehr als einen Fall gleichzeitig an, verlangt dafür allerdings auch einen erklecklichen Anteil des Honorars. Seine Gründlichkeit ist bewundernswert, sein Tempo schon weniger. »Gut Ding will Weile haben«, sagt er immer zu mir, wenn er sich dazu herablässt, bei uns im Büro vorbeizuschauen – normalerweise, um sich seinen Scheck abzuholen. »Man sieht hin, man hört zu, und erst wenn man das große Ganze kennt, handelt man.«
Leo musste schnell einsehen, dass es für seine neugegründete Firma nicht profitabel war, allein Fälle für Anwaltskanzleien und langweilige Nachforschungsaufträge zu übernehmen – all die Dinge, die er besonders gut macht. Er brauchte einen Überwachungsspezialisten, der im Notfall auf ein ganzes Team zurückgreifen konnte, und Stevie kam ihm da gerade recht. Er ist gut, und vor allem hat er fast immer Zeit. Weil er weiß, wie leicht es ist, andere Menschen zu überwachen, ist er heimlichtuerisch bis an die Grenze zur Verdunkelung. Seine früheren Arbeitgeber kamen nicht mit ihm klar. Er besitzt keinerlei soziale Kompetenz, und wenn er gerade an einem Fall arbeitet, ist er ums Verrecken nicht auffindbar. Von niemandem.
Das ist der Grund, weshalb die kleineren Aufträge an mich gehen. Ich verfüge zwar nicht über Stevies Qualifikation, aber normalerweise erledige ich den Job zur allgemeinen Zufriedenheit.
Da ich bereits Sekretärin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bin, stellt diese Aufgabe für mich eine zusätzliche Belastung dar. Andererseits haben Seb und Leo so überhaupt erst von meinem besonderen Talent erfahren. Es entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage, obwohl es viele Menschen gibt, die von sich behaupten, fundierte theoretische Kenntnisse auf diesem Gebiet zu besitzen. Ich bin weder Dr. Watson noch Sherlock Holmes. Eher vielleicht der Typ aus Elementary. In jedem Fall steckt mehr dahinter als nur eine genaue Beobachtungsgabe. Ich weiß nicht, was das Geheimnis meiner Fähigkeit ist, und vielleicht wollte ich bislang auch gar nicht darüber nachdenken, aber ich kann jemandem aus mehreren Metern Entfernung ansehen, ob er lügt. Sobald jemand die Unwahrheit sagt – sei es, um mich zu verwirren, oder, was häufiger passiert, um seinen Arsch zu retten –, überkommt mich ein ganz eigenartiges Gefühl, fast eine Art Ekel. Meistens kann ich gar nicht genau beschreiben, woran ich es erkenne, ich kann nur sagen, dass ich es erkenne. Während langer Jahre in verschiedenen Pflegefamilien habe ich diese Fähigkeit zu einer Kunstform verfeinert.
Harrison Baichwal ist vielleicht kein Lügner, aber er verbirgt etwas. In seinem Minimarkt wurde eine Mutter zweier Kinder erschossen, und der junge Schütze weist jede Schuld von sich. Seine wohlhabenden Eltern wollen, dass Melissa Harrison Baichwal im Zeugenstand auseinandernimmt. Sie soll Zweifel daran säen, dass es tatsächlich ihr Sohn war, der an jenem Abend im Laden mit einer gestohlenen Waffe herumfuchtelte. Aber Harrison spielt nicht mit. Er ist abgetaucht, so dass seine Vorladung nicht zugestellt werden kann. Meine Aufgabe ist es nun, ihn zu finden und festzustellen, wieso.
6
Ich will nicht lügen, denn wie gesagt, lügen ist nicht meine Sache. Die ersten Jahre nach der Vergewaltigung waren die schlimmsten. Ich hatte in der Zeit drei schwere Rückfälle. Eines Morgens, knapp zwei Wochen nach Beginn des dritten, hörte ich draußen vor dem Hintereingang des Büros ein leises Rascheln. Anfangs dachte ich, es läge daran, dass ich wieder zu viel getrunken hatte, aber nachdem ich eine Stunde lang, in eine Decke gewickelt, in der Ecke gehockt hatte, wurde ich wütend. Also gut, das stimmt so nicht. Ich wurde paranoid, trank ein Bier, um meine Nerven zu beruhigen, und dann wurde ich wütend.
Als ich, mit einem Stahlrohr bewaffnet, nach draußen ging, sah ich dort ein riesiges Knäuel aus verfilztem Fell, das leicht angewidert eine Box mit verschimmelten Chow-Mein-Nudeln beschnüffelte, die ich am Abend zuvor in den Müll geworfen hatte. Das Fellknäuel sah mich aus trüben Augen an und streckte dann seinen langen, schlanken Rücken durch. Es machte jedoch keine Anstalten, den Rückzug anzutreten, selbst als ich versuchte, es fortzuscheuchen. Ich taufte den Hund – oder vielmehr: die Hündin – auf den Namen Whisper, und seit dem Tag war es vorbei mit meinen Rückfällen. Alkoholiker sind denkbar schlechte Bezugspersonen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man auserwählt wird, ist das eine Ehre, und man muss sich verdammt noch mal bemühen, ihr gerecht zu werden. So etwas passiert nicht alle Tage. Jeder, selbst ein räudiger Köter, hat immer mehrere Möglichkeiten.
Whispers Fell hat genau dieselbe graue Farbe wie das Pflaster des Gehsteigs unter unseren Füßen und die Wolken über unseren Köpfen. Sie streift bereitwillig zu jeder Tages- und Nachtzeit mit mir durch die Stadt und sieht all das, wovor andere die Augen verschließen. Obwohl ich nicht besonders tierlieb bin, kann ich nicht leugnen, dass sich zwischen uns eine beinahe familiäre Beziehung entwickelt hat. Das Beste an Whisper ist, dass sie mich fortwährend daran erinnert, dass es wenigstens ein Geschöpf auf der Welt gibt, das noch unglücklicher ist als ich. Jeden Tag sieht sie mich aus ihren kummervollen Augen an. Selbst wenn sie Blähungen hat, hat das etwas Trauriges – dieser leise Hauch eines Geräuschs, die kaum wahrnehmbare Geruchsspur. Was sie vor meine Tür geführt hat, wird auf ewig ihr Geheimnis bleiben, aber es muss hart gewesen sein, sich ausgerechnet im übelsten Teil der Stadt auf die Suche nach einem neuen Leben zu machen.
Whisper hat von Anfang an gezeigt, was sie wert ist. Ich nehme sie mit, wenn ich nach Informationen suche, denn die Menschen gehen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit ihren Hunden spazieren. Es ist eine unter Haustierhaltern allgemein anerkannte Tatsache, dass Hunde Bewegung brauchen, und der Besitzer hat dafür zu sorgen, dass sein Hund sie auch bekommt. Von jemandem, der seinen Vierbeiner Gassi führt, wird kaum Notiz genommen, erst recht nicht, wenn Hund und Halter unauffällig ihrer Wege gehen. Das macht Whisper zu einer perfekten Tarnung bei Observierungen. Sie ist nicht mehr so niedlich wie ein Welpe, aber auch noch nicht so bemitleidenswert wie ein alter Hund. Sie liegt vom Alter her irgendwo dazwischen und zieht folglich nur selten Aufmerksamkeit auf sich. Sie hat große Ähnlichkeiten mit mir, außer in ihrer Geilheit.
Der einzige Nachteil an Whisper ist ihre Sexsucht – obwohl der Arzt in der Tierklinik am anderen Ende der Straße mir versichert hat, sie sei sterilisiert. Sie ist zu fünfzig Prozent Spürhund, zu fünfzig Prozent Wolf und zu hundert Prozent Nymphomanin. Trotz des verfilzten Fells erkenne ich an ihrer ausgezeichneten physischen Konstitution, dass sie es früher gut gehabt haben muss. Vermutlich war es ihr liederlicher Lebenswandel, der dazu geführt hat, dass sie aus ihrem schönen Zuhause verstoßen wurde. Sie lässt sich bereitwillig von allem bespringen, was länger als fünf Sekunden an ihr schnüffelt. Hinterher bereut sie es und versinkt eine Woche lang in Depressionen. Auf den Hormonrausch folgt der Selbstekel. Ich mache ihr keinen Vorwurf daraus, da ich dieses Verhalten von mir selber kenne.
Sie ist ein abschreckendes Beispiel dafür, was passiert, wenn man seinen Schwächen nachgibt.
»Du kleine Hure«, sage ich nach jedem Vorfall liebevoll zu ihr. Dann winselt sie mich an und hängt ihr Gesicht in ihre Wasserschüssel, als wolle sie sich ertränken.
Nachdem Leo und Seb Feierabend gemacht haben, gehe ich runter in den Keller und wecke sie. Genau wie ich ist auch sie am liebsten nach Sonnenuntergang unterwegs.
»Wir müssen jemanden finden«, verkünde ich. Ihr Schwanz geht nach oben, als überlege sie, damit zu wedeln, doch dann fällt er mit einem dumpfen Geräusch zurück auf den Boden. Sie erhebt sich und trottet zur Tür. Sie gibt es nicht gerne zu, aber sie liebt es beinahe so sehr wie ich, Leute zu beobachten.
7
Die Weigerung des durchschnittlichen Kanadiers, sich in ausreichendem Maße fortzupflanzen, um die für den Erhalt der Bevölkerung notwendige Geburtenrate von zwei Komma eins Kindern zu erreichen, hat eine schrittweise Erhöhung der Einwanderungsquoten erforderlich gemacht. Die Kanadier dümpeln um eine Geburtenrate knapp unter zwei herum, und das ist nicht gut. Mit knapp unter zwei Kindern kann das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft auf Dauer nicht gewährleistet werden. Wer soll zu unserem Bruttosozialprodukt beitragen? Rassisten und Befürworter geschlossener Grenzen können klagen, so viel sie wollen: Sofern sie nicht anfangen, deutlich mehr Kinder in die Welt zu setzen, ist die multikulturelle Gesellschaft für Kanada der Weg der Zukunft. Ihre soziale Sicherung hängt davon ab.
In Kanada prallen also die unterschiedlichsten Kulturen aufeinander. Nur, da wir von Kanada reden, ist es weniger ein Aufeinanderprallen als ein höfliches Einander-Zunicken mit anschließenden gehässigen Bemerkungen auf dem Golfplatz. Größtenteils jedenfalls.
All diese Dinge gehen mir durch den Kopf, während ich draußen vor dem RB Mart in Surrey sitze und die Inder sowie gelegentlich den einen oder anderen Fidschianer vorbeigehen sehe. Die Menschen in diesem Viertel kommen hauptsächlich aus Südasien, aber unter den Kunden des Ladens sind alle Hautfarben vertreten. Kaugummi und Halsbonbons braucht jeder.
Whisper und ich sitzen auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf einer Bank und beobachten die Frau hinter der Kasse. Sie ist mittleren Alters, rundlich und hat lange schwarzgefärbte Haare, die sie unter einem locker sitzenden Kopftuch verbirgt. Ich bewundere die Effizienz, mit der sie ihre Aufgaben erledigt. Ihre Bewegungen sind ökonomisch, ihre schlanken Hände kassieren flink die Artikel ab, und sie antwortet routinemäßig auf Fragen der Kunden, wobei sie gerade so hilfreich ist wie nötig, nicht mehr und nicht weniger. Wenn keine Kunden da sind, widmet sie sich der Inventur.
Dies ist nicht das Verhalten einer Frau, die sich Sorgen um das Wohlergehen ihres Mannes macht.
Um exakt neunzehn Uhr übernimmt ein junger Mann Anfang zwanzig die Schicht, und Bidi Baichwal geht nach Hause. Ich folge ihr nicht. Ich weiß, wo sie zusammen mit ihrem momentan untergetauchten Ehemann, ihren alten Eltern und ihren heranwachsenden Kindern lebt. Professionelle Observierung ist immer eine Teamaufgabe, aber wie gesagt: Stevie Warsame war nicht zu erreichen, und auf Leos Tisch ist gerade ein Fall gelandet, bei dem seine Expertise als forensischer Rechnungsprüfer gefragt ist. Deswegen bin ich für den Moment auf mich allein gestellt. Ich spekuliere darauf, dass Bidi nach Hause gehen wird. Sie hatte einen langen Arbeitstag und will sicher den Abend mit ihren Kindern verbringen. Also bleibe ich und beobachte statt ihrer nun den jungen Mann, ihren Cousin, der erst letztes Jahr aus Indien nach Kanada gekommen ist. Aus der Akte, die Melissa mir auf den Schreibtisch geworfen hat, weiß ich, dass er Amir heißt. Er ist ein fleißiger Angestellter, hat aber traurige Augen, die denen von Whisper durchaus Konkurrenz machen könnten. Er arbeitet den ganzen Abend, allerdings ist sein Englisch noch nicht so geschliffen wie Bidis, und er braucht doppelt so lange, um die Fragen der Kunden zu beantworten. Denen scheint das allerdings nichts auszumachen, denn Amir hat etwas Verletzliches an sich. Etwas, das seine Mitmenschen entweder dazu veranlasst, Geduld mit ihm zu haben oder ihn ausnutzen zu wollen.
Die Zeit vergeht, und um mich herum kehrt langsam Ruhe ein. Die Stimmung erinnert mich an den Moment unmittelbar vor Morgengrauen, wenn die Stille schwer in der Luft hängt und Schlaf unmöglich wird. Wenn meine Monster unter ihrem Stein hervorgekrochen kommen und auf der Suche nach Nahrung marodierend in die Welt hinausziehen. Aber ich erlaube mir nicht, an Bonnie zu denken. Ich kenne das Mädchen ja nicht mal. Ich habe die Erinnerung an sie so viele Jahre lang unterdrückt, dass ich gar nicht weiß, wie ich sie jetzt heraufbeschwören sollte. Nein, was ich in diesem Moment vor mir sehe, ist das Gesicht meiner Schwester Lorelei. Was würde ich tun, wenn sie verschwunden wäre? Instinktiv weiß ich, dass ich dann nicht hier sitzen und irgendwelchen Fremden nachspionieren würde.
Um dreiundzwanzig Uhr schließt Amir den Laden ab und macht sich auf den Weg zu einer Wohnung in einem Hochhaus sechs Straßen vom Haus der Baichwals entfernt. Die meisten Fenster sind um diese Zeit bereits dunkel, bis auf die einiger Nachteulen. Zwei Minuten nachdem er das Gebäude betreten hat, huscht an einem Fenster im dritten Stock ein Schatten vorbei. In dieser Wohnung brennt noch Licht. Jemand hat auf ihn gewartet.
Ich harre aus, bis das Licht erlischt, während in mir der Gedanke schwärt, dass irgendwo da draußen ein vermisstes Mädchen ist, das meine Augen hat.
8
In dem Haus in Kerrisdale ist alles finster. Everett und Lynn schlafen offenbar schon. In dieser Nacht steht kein Mond am Himmel, und es gibt auch keine Straßenlaternen vor dem Haus, deshalb ist die Dunkelheit besonders tief. Doch selbst im Dunkeln kann ich sehen, dass es ein wunderschönes zweigeschossiges Eigenheim ist, mit Steingarten und einem schmucken hölzernen WILLKOMMEN-Schild über der Tür. Das Schild ist handgemacht, die Arbeit eines Hobbyhandwerkers. Wahrscheinlich Everett. Everett oder Bonnie. Vielleicht beide zusammen? Von außen ist dieses Schild der einzige Hinweis darauf, dass möglicherweise ein Kind im Haus lebt. Aber die Adresse ist richtig. Sie stand auf der Rückseite des Fotos, das Everett mir vor dem Café in die Hand gedrückt hat.
Ich bin so sehr vom Anblick des Schildes gefesselt, dass ich beinahe den Mann übersehe, der aus einer dunklen Limousine heraus das Haus beobachtet. Als ich ihn bemerke, ist es zu spät, um kehrtzumachen, also tue ich so, als wäre ich auf einem Abendspaziergang, und gehe einfach weiter. Der Mann schläft nicht, ist also kein Polizist. Außerdem isst er einen Apfel. Ich habe noch nie einen Polizisten einen Apfel essen sehen, und obwohl ich vermute, dass das von Zeit zu Zeit vorkommt, kann ich es mir im Rahmen einer Observierung einfach nicht vorstellen. Außerdem hat Everett gesagt, die Polizei habe Bonnie als jugendliche Ausreißerin eingestuft. Insofern ist es unwahrscheinlich, dass sie jemanden abstellen, um das Haus zu bewachen.
Ich gehe mit Whisper an ihm vorbei, und nachdem er meine Kleider und die dunklen Haare, die unter der Kapuze meines Hoodies hervorschauen, mit einem flüchtigen Blick registriert hat, stuft er mich als »Nanny mit Hund« ein und beachtet mich nicht weiter. Es ist eine ungewöhnliche Zeit, um einen Hund auszuführen, aber ich stelle weder eine Bedrohung dar noch bin ich sein Zielobjekt, deshalb hakt er mich ab und wendet seine Aufmerksamkeit wieder dem Haus zu.
Dass er mein Gesicht gesehen hat, macht mir keine Sorgen, denn bereits morgen früh wird er es vergessen haben. Konkret darauf angesprochen, wird er allenfalls sagen können: »Vielleicht indianischer Abstammung, mittelgroß, dünn.« Wenn er gehässig sein will, fügt er vielleicht noch »Flachbrüstig, keinen Sinn für Mode, hässlicher Köter« hinzu.
Ich gehe einmal um den Block und suche mir einen Platz, von dem aus er mich nicht sehen kann. Dann beobachte ich ihn eine Zeitlang dabei, wie er das Haus beobachtet. Oben in einem der Zimmer über der Garage geht Licht an. Das Fenster wird einen Spaltbreit geöffnet, und eine Rauchwolke schwebt nach draußen. Eine schlanke, manikürte Hand taucht im Spalt auf und wedelt den Rauch vom Fenster weg. Lynn hat Stress und raucht in einem Zimmer, das nicht ihres ist – wahrscheinlich weil sie hofft, dass Everett so nichts davon mitbekommt.
Von meinem Standort kann ich nicht eindeutig erkennen, ob der Nicht-Bulle in der Limousine Lynn ebenfalls gesehen und einen Vermerk in sein Notizbuch geschrieben hat, damit er den Vorfall später in seinem Bericht erwähnen kann. Eine Frau, deren schlechtes Gewissen sie nicht schlafen lässt, verbringt ihre Nächte rauchend im Zimmer ihrer verschwundenen Tochter.
9
Ich komme vor Morgengrauen nach Hause und schlafe bis um zehn. Seb und Leo arbeiten freitags von zu Hause aus. Montags, mittwochs und donnerstags manchmal auch. Dienstage sind ihre einzigen festen Bürotage. Seb wird mich aller Wahrscheinlichkeit nach mit den mehrstündigen Gesprächsmitschnitten allein lassen, die er mir zum Abtippen gegeben hat, aber ich weiß, dass Leo um die Mittagszeit anrufen wird, um sich ein Update im Fall Harrison Baichwal geben zu lassen.
Sebs Buch zu dem Thema, wo Kanadas Entwicklungshilfegelder hinfließen und ob sie auch wirklich dort ankommen, ist ein monumentales Unterfangen, dem er und ich uns gewissermaßen nebenbei widmen. Kürzlich musste er einige Auftragsarbeiten annehmen, um die Rechnungen bezahlen zu können. Genau darin besteht sein Dilemma, aber so ist das nun mal. Es gibt nur wenig zu tun für erfahrene Investigativjournalisten, die Kolumnen für zweitklassige Tageszeitungen schreiben wollen. Das ist so, seit das Internet es praktisch jedem, der eine WLAN-Verbindung besitzt, ermöglicht, selbst investigativ tätig zu werden und sich Journalist zu nennen. Also arbeitet Seb an The Crow, seinem Nachrichten-Blog, den auch einige größere Zeitungen auf ihren Websites haben. Damit sind wir beide gut beschäftigt, und es hält mich in Lohn und Brot, also klage ich nicht über die langen Arbeitszeiten.
Ich steige über Whisper hinweg und gehe nach oben. Unser Flügel des Gebäudes steht größtenteils leer. Nebenan sitzt ein Ein-Mann-Marketing-Dienstleistungsunternehmen, das allerdings nicht sehr viele Marketing-Dienstleistungen anzubieten scheint, da die Tür immer verschlossen ist.
Als ich ins Büro komme, sehe ich, dass zwar das rote Licht am Telefon (wie üblich) nicht blinkt, das rote Licht an meinem Handy aber schon. Ich habe es gestern Abend auf meinem Schreibtisch liegen lassen und kein bisschen vermisst. Normalerweise rufen sowieso nur Seb oder Leo an, und nach Büroschluss läuft bei ihnen meistens nicht mehr viel. Die Nummer in der Liste der verpassten Anrufe sagt mir nichts – aber der Anrufer hat eine Nachricht hinterlassen.
Ich erkenne die Stimme sofort. Hunderte von Zigaretten und jede Menge abgestandener Kaffee haben sie kratziger gemacht, aber es ist ganz ohne Zweifel der Reporter.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.