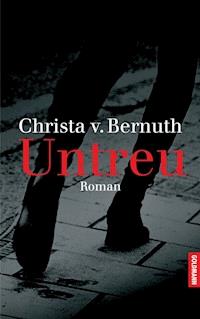
2,99 €
Mehr erfahren.
Die Belolaveks waren eine Musterfamilie. Aber jetzt ist Thomas Belolavek tot, er wurde ermordet und unter dem eigenen Gartenhaus vergraben. Von seiner Frau Karin und ihrer Tochter Maria fehlt jede Spur. Sind sie ebenfalls tot, oder sind sie in das Verbrechen verwickelt? Als Kriminalhauptkommissarin Mona Seiler zu ermitteln beginnt, wird sie mit Gerüchten konfrontiert: Theresa Leitner, eine Freundin der Belolaveks, behauptet, Karin habe ein Verhältnis mit einem jungen Mann gehabt, der wegen Mordes an seiner Freundin mehrere Jahre im Jugendgefängnis saß. Fieberhaft suchen Mona und ihre Kollegen nach dem vermeintlichen Geliebten. Als sie ihn schließlich finden, wird er kurz darauf ermordet. Und Mona weiß, dass sie rasch handeln muss, wenn sie weitere Verbrechen verhindern will ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Christa v. Bernuth
UNTREU
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
ISBN 978-3-89480-785-6V003
www.penguin.de
Inhaltsverzeichnis
PROLOGERSTER TEIL12345678910ZWEITER TEIL1112131415161718DRITTER TEIL123456789101112EPILOGDanksagungÜber das BuchÜber die AutorinCopyright
DIESER ROMAN
ENTSTAND NACH EINER IDEE
VON WOLFGANG SCHÖBEL
UND CHRISTA V. BERNUTH
PROLOG
Die Farben des Todes schimmern hellblau, giftgrün, beigebraun, mattschwarz. Fleisch ist nur noch Fleisch, Haut ist nur noch Haut. Ausdruckslos. Der Tod hat das Menschliche hinter sich gelassen. Er hat keine spirituelle Qualität. Er ist unpersönlich, ein Zustand, eine Phase, die nicht länger dauert als eine Viertelstunde. Dann spätestens verschwindet der Tod und macht dem Leben Platz.
Lucilia und Calliphora finden als Erste den Körper, der fünfzehn Minuten lang leblos und nutzlos war und jetzt eine neue Funktion als frisches Biotop hat. Lucilia oder Calliphora legen ihre cremefarbenen, mohnkorngroßen Eier in Augenwinkel, Nasenlöcher, Mund und – je nachdem – in Stichwunden oder Schusskanälen ab. Ihre Maden werden sich mit stummer, blinder Gier durch das Gewebe arbeiten, Ameisen, Käfer und Schnecken werden anschließend die Eiweißquelle finden und anzapfen. So lange, bis Erde wieder zu Erde geworden ist.
Der Tod ist nun schon sehr weit weg.
So gesehen.
ERSTER TEIL
Kapitel 1
»Das geht nicht«, sagte KK Marek Winter.
Er war sehr müde. Seine Hose kniff im Schritt, er wechselte unauffällig seine Sitzposition. Marek wog elf Kilo mehr als noch vor fünf Jahren. Er hatte einmal eine sportliche Figur gehabt und verfügte heute über einen Bauch, der auf unerklärliche Weise beständig wuchs.
»Das geht nicht«, sagte er ein zweites Mal, diesmal mit leisem Triumph in der Stimme. Die Frau, die vor ihm saß, war korpulent, und schon deshalb konnte er sie nicht leiden.
»Herr Kommissar...«
»Winter. Lassen Sie das Kommissar ruhig weg.«
»Herr ... äh ... Winter. Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Sie sind doch hier die Vermisstenstelle. Wo soll ich sonst hingehen?«
Die Frau hatte sich mit Erika Weingarten vorgestellt und ihm gleich darauf ihren Personalausweis entgegengestreckt wie einem Vampir das Kreuz, als gäbe es die Möglichkeit, dass er an ihren Worten zweifelte. Als sei ihm nicht egal, wie sie hieß und woher sie kam. Sie trug ein rostfarbenes Kostüm, darunter blitzte der Kragen einer weißen Bluse hervor. Die Kostümjacke mit den goldenen Knöpfen spannte vor Bauch und Brüsten. Marek stellte sich unwillkürlich ihren Körper vor, eine amorphe weiche Masse, notdürftig durch BH und Stützstrümpfe in Form gehalten. Er sah sich selbst in ein paar Jahren – schwammig und fett.
Widerlich.
Mühsam riss er sich zusammen. »Also, Frau Weingarten. Sie sind mit der mutmaßlich Verschwundenen nicht verwandt.«
»Nein.«
»Auch nicht verschwägert?«
»Nein.«
»Sie wohnen nicht mit ihr zusammen.«
»Nein!«
»Dann haben wir hier ein Problem.« Marek faltete seine Hände unter dem Kinn und beugte sich nach vorn, als wollte er ihr ein Geheimnis verraten. Etwas in ihm genoss die Situation. Etwas in ihm hoffte, dass sie sich tatsächlich als eine dieser Idiotinnen entpuppen würde, über die man sich anschließend in der Kantine totlachen konnte. »Die Sache ist die«, fuhr er fort. »Sie...«
»Ich weiß, ich bin nicht mit ihr verwandt«, unterbrach ihn die Frau.
»Richtig«, sagte Winter, beifällig nickend, als sei sie eine zwar minderbemittelte, aber brave Schülerin, die sich immerhin bemühte, ihr Bestes zu geben. »Unter diesen Umständen können Sie die... also die mutmaßlich Verschwundene eben nicht als vermisst melden. Für eine Vermisstenanzeige muss man mit dem Vermissten verwandt, verschwägert oder verheiratet sein. Oder wenigstens in einem gemeinsamen Hausstand leben. Verstehen Sie, da könnte sonst jeder kommen.«
»Wer soll denn da schon kommen?«, fragte die Frau zurück, sichtbar verärgert. Sie verschränkte die Arme über ihrem voluminösen Busen.
Einen Moment lang war Marek aus dem Konzept gebracht. (Es war ja so: Wenn sie nicht verrückt war, hatte sie keinen Grund, sich in dieses Büro zu bemühen. Verrückt sah sie aber eigentlich nicht aus.) »Ach, da gibt's Sachen, das glauben Sie gar nicht.«
»Ja? Zum Beispiel?«
Marek sah sie feindselig an. »Verleumdungen eben. Einbildungen. Hirngespinste. Sie sitzen zu Hause, die Decke fällt Ihnen auf den Kopf...«
»Ich will mit Ihrem Chef sprechen. Sofort.« Die Stimme der Frau war leiser als vorhin, ihr Gesicht leicht gerötet, ihr Blick gesenkt. Erika Weingarten. Eine kleine, dicke, harmlos wirkende Frau, Anfang fünfzig, wahrscheinlich ohne Kinder, die Gespenstergeschichten ausbrütete, wenn sie hinter ihren mit Bleichmittel behandelten Gardinen hockte und versuchte, die Fenster der Nachbarhäuser mit ihren Blicken zu durchdringen.
Dennoch fühlte sich Marek mit einem Schlag ernüchtert. Man wusste eben nie. In sein Bewusstsein drang der Regen, der unermüdlich, schon den ganzen Morgen lang, an das Bürofenster hinter seinem Rücken schlug. Die Nachwirkungen eines Herbststurms der vergangenen Nacht, der auf dem Land Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt und Strommasten umgeworfen hatte. Der Wind hatte nachgelassen, der Regen nicht. Es war gerade hell genug, dass man ohne Kunstlicht auskam. Marek seufzte.
»Was wollen Sie jetzt machen? Mich einfach wieder heimschicken?«
Marek seufzte ein zweites Mal. Seine Hoffnung, dass ihn ein Kollege mit einem Besuch beehrte und ihn von diesem Gespräch erlöste, erfüllte sich nicht.
»Kennen Sie jemanden, der verwandt oder verschwägert ist mit der Verschwundenen?«
»Nein. Wir sind doch bloß Nachbarn!«
»Oder mit ihrem Mann? Der ist doch auch weg.«
»Nein. Wir sind Nachbarn und haben einen guten Kontakt. Ich weiß nichts über ihre Familienverhältnisse.«
Es war elf Uhr vormittags, ein kalter, verregneter, langweiliger Herbsttag. In der Kantine würde es heute Spaghetti Carbonara geben. Eine Portion hatte mindestens tausend Kalorien. Dazu kamen die zwei Buttersemmeln, die er sich zum Frühstück genehmigt hatte. Mindestens siebenhundert Kalorien. Tausendsiebenhundert Kalorien.
»Also gut«, hörte sich Marek zu seiner Überraschung sagen. »Wir schaun mal, was wir tun können.«
Es war einer dieser Tage, an denen sich zum ersten Mal der Winter meldet. Der Himmel sah aus wie weiß beschichtet, Gras und Bäume wie erstarrt. Kein Windhauch. Du hast deinen kondensierenden Atem in die kalte Luft geblasen und dann gelacht und dir eine Zigarette angezündet. Wenn du rauchst, hältst du die Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger und nimmst mit zusammengepressten Lippen drei, vier tiefe Lungenzüge hintereinander. Mit angewidertem Gesichtsausdruck, als sei Rauchen Medizin für dich – notwendig und unangenehm.
Danach hast du den Arm um mich gelegt und wieder gelacht. Ohne Grund, einfach nur, weil wir zusammen waren und Zeit hatten. Du musst dich auch erinnern, bitte. Es war der elfte Oktober. 11.10.01-111001. Ich wende diese Kombination im Kopf hin und her, auf der Suche nach seiner verstohlenen Bedeutung. Ein Zahlenrätsel, ein Binärcode, der dazu dient, meine Festplatte neu zu programmieren. Ja-ja-ja-nein-nein-ja.
Was mich betrifft: ja.
Der elfte Oktober war ein Freitag. Wir haben uns getroffen, und du hast mich auf diese Weise angeschaut, mit einem Blick, der gleichzeitig stark und schwach, leidenschaftlich und ängstlich, selbstbewusst und demütig war. Am elften Oktober hast du mich zum ersten Mal gefragt, ob ich deine Wohnung sehen will. Als wolltest du dich entschuldigen, hast du gesagt: Ein Loch, aber besser als Knast.
Ich schließe die Augen und habe das Timbre deiner Stimme im Ohr. Heiser, sexy. Wenn ich allein bin, lege ich mich manchmal aufs Bett, lege die Hand zwischen die Beine. Ich schwöre dir, ich kann kommen, nur indem ich mir deine Stimme vorstelle, wie sie mich treibt und drängt...
Du hast mir deine Wohnung gezeigt. Sie befindet sich in einem riesigen Apartmentblock. Pyramidenförmig, aus grauem Sichtbeton, mit Balkons, die aus der Ferne aussehen wie Schießscharten. Magere Männer liefen an uns vorbei, als wir zum Lift gingen, Jungs mit erloschenen Augen lungerten im Hausflur herum. Sie starrten mich an, unverhohlen und gleichzeitig interesselos, als bräuchte ihnen niemand zu erzählen, was jemand wie ich hier zu suchen hatte. Der Lift war alt und eng, die Linolwände waren voller trostlos schwarzer Graffitis in allen Sprachen der Welt. Es stank nach Rauch und Pisse. Ich schaute nach oben und unvermutet mir selber in die Augen. Vielleicht befand sich eine Kamera hinter der verspiegelten Decke – ein Gedanke, der mich erleichtert hat. Du weißt ja, ich bin ein Feigling, auch wenn ich mich anders gebe (du weißt so viel von mir, dass es mir manchmal unheimlich ist, und trotzdem bereue ich nicht, all das von mir preisgegeben zu haben).
Für mich war es ein Abenteuer, vielleicht das erste Abenteuer meines Lebens – nein, das erste nach zu vielen Jahren. Ich war glücklich und ängstlich. Für jemanden wie dich ist das schwer zu verstehen. Du kennst nicht die Fantasien, die aus Langeweile und Mangel an Erfahrung entstehen. Du hast Erfahrungen im Überfluss, mehr als dir lieb sind, du brauchst dir nichts, gar nichts vorzustellen, es ist alles schon passiert – so oder schlimmer.
Du wohnst im achten Stock. Dein Apartment besteht aus einem Zimmer mit Kochnische plus einem winzigen, fensterlosen, braungelb gekachelten Bad mit der Dusche direkt neben der Toilette. Apartment 810 – eine weitere Chiffre meiner Sehnsucht. Der Teppich war vielleicht einmal himmelblau und ist jetzt voller verblichener Flecken, deren Ursprung ich mir nicht vorstellen mag. Dein Bett steht neben der Balkontür unter dem einzigen Fenster und ist so schmal, dass wir kaum zu zweit darauf Platz haben. Die Matratze ist steinhart. Das Zimmer dunkel und klamm, selbst wenn die Sonne scheint. Der schwere Balkon davor raubt zusätzlich Licht. Nordlage, hast du gesagt. Hier kommt nie ein Sonnenstrahl rein.
Ich konzentrierte meine Gefühle auf dich. Ich wollte alles andere ausblenden, das Schäbige, Triste deiner Umgebung und auch deine Traurigkeit, die du geschickt mit Humor und Dreistigkeit überspielst und die ich trotzdem immer spüre. Ich möchte dich glücklicher machen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es mir irgendwann gelingen könnte, dann wieder sehe ich die Nutzlosigkeit meiner Bemühungen, die tiefe Verständnislosigkeit, die sich wie eine Kluft zwischen uns auftut, selbst in intimsten Momenten.
Ich möchte so sein, wie du mich willst und brauchst. Das hast du einmal so ähnlich zu mir gesagt, und genauso fühle ich. Zumindest in dieser Hinsicht passen wir zusammen. Vielleicht ist das ein Anfang. Vielleicht können wir darauf aufbauen – eines Tages.
In deiner Wohnung ist es zum ersten Mal passiert. Anfangs weniger aus Lust als aus Verlegenheit. Du wolltest mir etwas anbieten, aber du hattest nur Bier und Wodka, und ich mag beides nicht. Deine Wohnung drohte alles zu ersticken, was zwischen uns gewachsen war. Der erbärmliche Zustand, die Unordnung eines allein lebenden Mannes – das bisschen Geschirr, das du hattest, türmte sich in der Spüle, Schuhe und Socken lagen auf dem Boden herum, der hässliche braune Kleiderschrank stand offen – alles drückte auf meine und deine Stimmung, aber ich war entschlossen, es nicht zuzulassen.
Wir standen voreinander und sahen uns an. Schließlich entspannte sich dein Gesicht, und ich konnte wieder in deinen Augen lesen, die im Halbdunkel des Zimmers riesengroß, sehr jung und gleichzeitig uralt wirkten. Acht Stockwerke unter uns, in einer anderen Welt, dröhnte der Spätnachmittagsverkehr, fuhren erschöpfte Väter und Mütter zu ihren fordernden, aufreibenden Familien. Du wolltest mich, du konntest es kaum erwarten, das war es, was ich hoffte. Trotzdem habe ich gewartet. Es sollte sich natürlich entwickeln. Ich wollte nichts erzwingen, nicht von dir, nicht von mir. Gleichzeitig wusste ich, dass es jetzt passieren musste. Oder nie. Wir hatten diese eine Chance.
Plötzlich hast du dich aufs Bett gesetzt. Es gab nichts, was du mir anbieten konntest, also dachtest du, du müsstest dich selbst anbieten, wie ein guter Gastgeber. Dieser Geistesblitz war wie eine Heimsuchung, er drückte all meine bislang zurückgedrängten Befürchtungen aus – dass du mich eben nicht wirklich wolltest, dass du nur aus einer obskuren männlichen Höflichkeit heraus so tatest, um meine Weiblichkeit nicht zu brüskieren.
Ich setzte mich neben dich. Umfassende Ratlosigkeit und Schwäche. Es gab nichts mehr, was ich tun konnte, alles lag in deiner Hand. Und in diesem Moment hast du deine Sicherheit zurückgewonnen. Du hast ganz leise gelacht (vor deiner Wohnungstür fing einer an, in einer kehligen fremden Sprache, vielleicht war es arabisch, herumzuschreien, ein anderer antwortete mit schluchzender, sich überschlagender Stimme, zwei Türen knallten nacheinander, Schritte kamen vorbei und entfernten sich), du hast mein Gesicht in deine Hände genommen, und ich spürte zum ersten Mal deine Lippen (eine Frau unterhielt sich lautstark mit einer anderen, offenbar über den Flur hinweg, beide lachten), deine Zunge fuhr über meine Zähne, erkundete meinen Mund.
Deine Lippen, deine Zunge waren warm, fest und weich. Sie gaben mir mein Selbstvertrauen zurück. Ich war wieder jemand. In deinen Armen war ich ein Körper, der existierte, eine Person, die jemandem etwas bedeutete. Wir fanden unsere eigene Sprache, jenseits aller Missverständnisse. Es war sensationell, deine Haut zu spüren, deine kräftigen Muskeln, deine Rippen. Hart und mager. Gierig und sensibel. Ich hörte mein Stöhnen und deinen schweren Atem, und es war wie eine machtvolle Musik, die alles auslöschte, was außerhalb des Universums unserer Körper existierte. Es gab in diesen Momenten nichts mehr, das uns hätte auseinander bringen können. Anfangs hast du immer wieder den Kopf gehoben und mich forschend angesehen, so als wolltest du dich vergewissern, dass alles richtig und in Ordnung war, dass ich zufrieden war. Aber irgendwann waren deine Augen so blind wie meine, und da glaubte ich endlich, dass wir eine Chance hatten.
Sie standen frierend vor dem niedrigen schmiedeeisernen Gartentor: Marek Winter, Erika Weingarten und ein Polizeiobermeister namens Bechtel, der einen Schäferhund an der Leine hielt. Es regnete immer noch, und der Wind hatte wieder aufgefrischt. Die Tropfen fegten ihnen fast waagerecht ins Gesicht. Marek hielt mit beiden Händen seinen wenig nutzbringenden Schirm über sich. »Ich werde jetzt klingeln«, sagte er missmutig, als sei das eine Drohung. Der Wind schien ihm die Worte vom Mund wegzureißen und sie irgendwohin zu tragen, wo sie niemand hören konnte.
Erika Weingarten zuckte mit den Schultern. In ihrem grauen Mantel sah sie noch unförmiger aus als vorhin in seinem Büro. »Tun Sie's doch. Sie werden schon sehen, da ist kein Mensch.«
Und Marek sah – spürte – zu seinem Ärger, dass sie Recht hatte. Das Haus mit seiner roten Backsteinfassade und den blendend weiß gestrichenen Fenster- und Türrahmen wirkte tatsächlich vollkommen verwaist. Schweres nasses Laub bedeckte den größten Teil des Rasens, der so aussah, als sei er schon lange nicht mehr gemäht worden. Unter dem Apfelbaum neben dem Gartentor lagen faulende Früchte im hohen Gras. Im Moment lebte hier niemand, so viel war sicher.
»Wo wohnen Sie?«, fragte Marek Frau Weingarten. Sie deutete mit ihrem rundlichen Kinn nach rechts, auf eine dichte, korrekt geschnittene Thujahecke, die den Blick auf das dahinter liegende Grundstück komplett abschirmte.
»Vielleicht sind sie ausgezogen«, sagte Marek
»Sind sie nicht.«
»Das können Sie ja gar nicht wissen.«
»Hab ich doch gesagt: Ich war im Garten. Mehrmals. Ich hab ins Wohnzimmer geschaut. Die Möbel stehen da, wie immer. Die sind nicht mal mit Schutzplane abgedeckt.«
»Haben Sie einen Zweitschlüssel?«
»Das ist ja das. Normalerweise haben mir die Belolaveks immer einen Schlüssel gegeben, zum Blumengießen und Nachschauen und so. Aber diesmal nicht.«
»Vielleicht waren Sie nicht da. Vielleicht hat jemand anders den Schlüssel. Was ist zum Beispiel mit den Nachbarn da drüben?«
»Die Meyers, die Scherghubers, die Steins – die hab ich alle schon gefragt. Alle. Von denen weiß keiner was. Ich hab eine Tochter im Alter von Maria Belolavek. Die hat mir erzählt, dass die Maria nicht in die Schule gekommen ist. Dabei sind die Sommerferien schon vorbei.«
Das alles hatte sie ihm bereits im Büro erzählt. Aber jetzt, wo er vor diesem abweisend und fremd wirkenden Haus stand, erschien es ihm viel überzeugender. Marek drückte auf den Knopf unter dem Metallschild, auf dem mit verschnörkelter Schreibschrift der Name Belolavek eingeritzt war. Ein durch die Mauern gedämpfter, wohlklingender Glockenton war zu hören. Erwartungsgemäß passierte nichts. Er drückte ein zweites Mal und ärgerte sich dann über sich selbst. Er hätte das den Bechtel machen lassen sollen. Jetzt war er selbst der Depp, der sinnlos an einer Tür klingelte, hinter der sich niemand befand.
Es gab einerseits keine legale Möglichkeit, sich auf dieses Grundstück zu begeben. Niemand vermisste die Bewohner, außer einer Nachbarin. Andererseits konnte Marek eine gewisse Neugier nicht verhehlen. Nun waren sie schon mal hier. Man konnte ja zumindest einen kurzen Blick hineinwerfen. Das war nicht direkt unbefugtes Eindringen in Privatgelände. Und als hätte er diesen Gedanken laut geäußert, hatte Frau Weingarten bereits über das Tor gelangt und den elektrischen Öffner von innen betätigt. Ein Surren ertönte, Frau Weingarten drückte ihren schweren Unterleib gegen das Tor, und schon marschierten sie im Gänsemarsch auf den Terrakottaplatten am Haus vorbei – Frau Weingarten als massige Vorhut, dann Marek, dann Bechtel mit seinem mittlerweile tropfnassen Hund, der sich eng an seine Beine drückte. Marek dachte noch kurz an seine Straßenschuhe, die nach diesem Abstecher wahrscheinlich durchweicht sein würden, aber dann sagte er sich, egal. Es war wenigstens eine Unterbrechung seines durchaus nicht kurzweiligen Alltags.
Auf der anderen, der Straße abgewandten Seite wirkte der Garten noch verwilderter und verlassener. Zwei abgebrochene, morsche Äste lagen mitten auf dem Rasen wie Sinnbilder für Tod und Verfall. Die angelegten Blumenbeete waren von Unkraut überwuchert. Auf der überdachten Terrasse waren zwei Stühle umgefallen, wahrscheinlich wegen des Sturms vergangene Nacht. Die Fliesen der Terrasse waren übersät mit Blättern und Erde.
»Karin hat ihren Garten geliebt«, sagte Erika Weingarten. »Manchmal war sie ganze Nachmittage draußen, immer am Jäten und Gießen und Umgraben. Immer am Räumen und Gestalten. Der Garten war ihr Schmuckstück. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie das hier aussieht!«
Aber Marek hatte sich bereits dem Wohnzimmerfenster zugewandt. Die Rollos waren oben, die Vorhänge aufgezogen. Auf dem Fensterbrett standen einige Terrakottatöpfe mit offensichtlich vertrockneten Pflanzen. Der Raum dahinter war quadratisch und spärlich möbliert – aber eben eindeutig möbliert. Man sah: Da fehlte nichts. Der Raum war komplett eingerichtet, mit zwei Leinensofas, die über Eck standen, mit einem Glastisch, mit Sesseln und Stühlen, mit Teppichen auf dem Parkettboden und Bildern an den Wänden.
»Sehen Sie die Staubschicht auf dem Boden und auf dem Tisch?«, fragte Frau Weingarten. Ihr plumper Zeigefinger drückte energisch auf die regennasse Scheibe. Marek sah im Halbdunkel des Raums nichts dergleichen. Dennoch dachte er, da stimmt was nicht. Da stimmt gewaltig was nicht. Die vertrockneten Pflanzen auf dem Fensterbrett. Der verwahrloste Garten. Die schmutzige Terrasse mit den umgekippten Stühlen.
»Die sind nie weggefahren, ohne einem von uns den Schlüssel zu geben. Schon wegen der Blumen. Die Karin hat immer drauf bestanden, dass hier regelmäßig jemand war, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist.«
In diesem Moment schlug Bechtels Schäferhund an.
»Was ist los?«, rief Marek und sah sich um.
Bechtel war nirgends zu sehen. »Bechtel! Wo seid ihr?«
Ein dumpfes »Hier!« war zu hören. »Der Geräteschuppen«, sagte Erika Weingarten. »Der ist wahrscheinlich im Geräteschuppen.« Ihre Augen glitzerten.
»Wo ist der?«
»Da hinten. Hinter dem Busch da.« Sie eilte ihm voraus, ihre halbhohen Pumps patschten durch das matschige Gras, ihre hautfarbenen Nylonstrümpfe waren im Nu dunkel vor Nässe, was sie gar nicht zu bemerken schien. Marek folgte ihr mit einem Gefühl im Magen, das sich zwischen Übelkeit und Aufregung noch nicht entscheiden konnte. Seine Füße waren mittlerweile so kalt und klamm, dass er sie kaum noch spürte.
Der Hund hatte wieder aufgehört zu bellen, aber als sich Marek dem Schuppen näherte, hörte er ihn scharren. Verdammt! Der hatte was gefunden. Es war eine gute Idee gewesen, Bechtel mitzunehmen. Es war ein Geistesblitz, beglückwünschte sich Marek im Stillen, eine astreine Instinkthandlung. Er beschleunigte seine Schritte.
Da stimmte was nicht. Ganz gewaltig nicht.
Und er war dabei, es zu entdecken. Für einen Moment verdrängte er das Problem mit dem unbefugten Betreten von Privatgelände und allem, was damit zusammenhing.
Der Schuppen aus dunkel gebeiztem Holz stand offen. Bechtel hatte den Hauptteil der Geräte hinausgeworfen, wo sie nun im Regen lagen: eine große und zwei kleine Schaufeln, eine zusammenklappbare Leiter, zwei Torfstecher, Gartenhandschuhe, Gartenschere, vier alte Plastikliegestühle, einen Eimer mit eingetrockneter Farbe. Der Hund machte sich im Inneren zu schaffen.
»Bechtel! Spinnst du! Was machst du denn da?«
Bechtel kam heraus, die Hände, die Uniform erdbeschmiert. »Das glaubst du nicht.«
»Was macht denn der Hund da?«
»Der hat die Leiche gleich gerochen.«
»Was?«
»Schau nur selber.«
»Der Hund kann hier nicht einfach... Wir haben keinen Durchsuchungsbeschluss, nichts...« Aber um die Wahrheit zu sagen: In diesem Moment war das Marek egal. Er hatte eine Entdeckung gemacht, darauf kam es an. Sie mussten sich später nur was einfallen lassen, wie sie die Sache rückblickend so verkaufen konnten, dass sie legal wurde.
Er drängte sich an Erika Weingarten vorbei in den Schuppen. Der Boden bestand aus schlecht befestigten Holzdielen. Zwei der Bretter hatte Bechtel offenbar herausgebrochen und nach draußen geschafft. Sie lagen auf dem nassen Rasen vor dem Schuppen und wirkten dunkel und vermodert. In der Hütte, in der Lücke zwischen den verbliebenen Brettern sah Marek einen einzelnen, halb skelettierten Finger aus dem weichen, feucht aussehenden Erdreich ragen. Es war beinahe komisch. Ein einzelner warnender Finger. Marek musste ein nervöses Lachen unterdrücken. Gleich darauf brach ihm der Schweiß aus, und er bekam eine Gänsehaut, dass es ihn schüttelte.
»Das ist doch nicht wahr«, sagte er. Seine eigene Stimme hörte sich fremd an in seinen Ohren.
»Da wird einem ja schlecht«, sagte Frau Weingarten in sein linkes Ohr. Sie stand direkt hinter ihm, und Marek wusste nicht, was schlimmer war: der tote weißlich graue Finger mit den einzelnen Fleischfetzen daran oder Frau Weingartens Körper, der sich so eng an ihn presste, dass er jeden einzelnen ihrer Mantelknöpfe im Kreuz spürte.
Kapitel 2
»Hör jetzt auf. Lukas kann uns hören.«
»Kann er nicht. Er ist am Strand.«
»Kann er schon. Er braucht bloß wieder hochzukommen. Er kommt ständig hoch, wenn wir nicht da sind. Er will immer wissen, was wir machen.«
»Ja, und wenn?«
»Ich will das nicht. Nicht mitten am Tag.«
»Jetzt sei halt nicht so.«
»Hör auf.« Aber es klang nicht mehr ganz so überzeugt.
Ein warmer Wind spielte mit den abscheulich gemusterten Vorhängen am Schlafzimmerfenster. Von draußen hörte man Kindergeschrei, untermalt vom Tosen der Wellen. Anfangs hatte Mona wegen des ständigen Seegangs nicht schlafen können. Inzwischen wusste sie gar nicht mehr, wie sie es jemals ohne Meer hatte aushalten können. Nachts beruhigte sie das beständige Geräusch der Wellen, morgens machte es sie glücklich, weil es Freiheit verhieß von allem, was sie sonst bewegte und beschäftigte.
Monas Lippen waren aufgesprungen und schmeckten nach Salz. Wenn man in einem Strandhaus Ferien machte, schmeckt bald alles nach Salz. Nach Salz und dem feinen weißen Sand, der einem unablässig zwischen den Zähnen knirschte. Es war Mitte September, aber heiß wie im Hochsommer. Die Luft war so trocken, dass einem die Haut in Fetzen abging, wenn man sich nicht ständig eincremte. Aber sonst war das Leben wunderbar.
Fast perfekt.
Mona lag auf dem gemachten Bett, den rechten Arm unter dem Kopf. Neben ihr Anton, der Sonnenöl auf ihren Bauch tropfen ließ und es langsam, mit kreisenden Bewegungen, verrieb.
»Nicht.«
»Was denn?«
»Nicht da. Du weißt schon.«
Aber Anton ließ seine Hand tiefer wandern, zwischen ihre Beine. Seine Hand war breit, viel stärker gebräunt als ihre sonnenempfindliche Haut, seine Nägel waren sorgfältig geschnitten und manikürt, sogar jetzt noch, nach drei Wochen Sonne und Strand. Er streichelte sie so, wie sie es mochte.
»Du bist unmöglich.«
»Soll ich dich ganz – eincremen?«
»Nein!«
»Jetzt komm schon. Nur eincremen.«
Mona schloss die Augen. Ihre Haut schien das Öl aufzusaugen wie ein Schwamm. Sie war wirklich völlig ausgetrocknet. Das Öl würde ihre Haut wieder prall und jung machen.
Plötzlich musste sie lachen.
»Was?« Anton ließ sich nicht ablenken.
»Ich bin so eine alte Schachtel. Was willst du mit so einer alten Schachtel wie mir?«
»Jetzt sei still.« Er saß jetzt im Schneidersitz vor ihr und massierte ihre Füße, ihre Beine, sorgfältig und ernst. Sie stützte sich auf ihre Ellbogen und sah ihn an.
»Zu Hause sitzt deine kleine – wie heißt sie noch? Julia?«
»Jetzt geht das wieder los.« Sein Blick haftete an seinen Händen, die unablässig in Bewegung waren, geschickt und unbeirrbar. Er platzierte ihre Beine rechts und links neben seine und nahm sich erneut ihren Bauch vor. Sie konnte seine dichten Locken sehen, die sich, seit sie hier waren, an den Spitzen aufgehellt hatten. Er hatte kein einziges graues Haar.
»Julia. Die würd dir was erzählen, wenn sie uns hier sehen würde. Wie du mit deiner alten...«
»Sei still. Immer dieses Gerede. Ich hasse das.« Anton beendete die Massage und legte sich ohne weitere Umstände auf sie, sein Gesicht wie immer schön und undurchdringlich, sein Körper überwältigend heiß und trocken. »Du bist ja ganz fettig«, flüsterte er ihr ins Ohr.
Und Mona spürte, wie sie sich unter ihm entspannte. Ein leises Frösteln kroch ihr die Wirbelsäule hoch und sie kämpfte nicht länger dagegen an. Die Hitze seines Körpers schien plötzlich ein Teil von ihr zu werden, jede Faser an ihr schien zu brennen, und es war ein gutes Gefühl. Sie brannte, und das Öl auf ihrer Haut transportierte die Hitze zu Anton, folglich würde auch er gleich brennen. Anton nahm ihre Hände und drückte sie aufs Kopfkissen. Sie schloss die Augen und stöhnte wieder.
»Mona. Hör mal, Mona.«
»Ja. Mach weiter. Bitte, bitte mach weiter.«
»Mona, du bist die Einzige für mich. So gut wie. Ehrlich.«
»Sei schon ruhig.«
»Mit Julia ist Schluss.«
»Ja. Sei ruhig.«
Abends gingen sie in die Bar in der Nähe ihres Ferienhauses, in der sie fast immer aßen, seit sich herausgestellt hatte, dass hier die Pommes frites am besten schmeckten – was wichtig war, um Lukas bei Laune zu halten. Es war ihr letzter Urlaubstag. Monas und Lukas' letzter Urlaubstag, um genau zu sein. Anton hatte, wenn man so wollte, immer Urlaub, und er war, wenn man so wollte, immer im Dienst.
Sie liefen am Meer entlang, im Rücken die untergehende Sonne, die ihre Schatten lang und immer länger machte. Der Wind frischte auf, was er häufig tat, sobald es dämmerte, als wollte er sich rechtzeitig vor Einbruch der Nacht wieder in Erinnerung bringen. Nachts war der Wind dann in der Regel stark und kühl: ein Vorbote des nahenden Herbstes, der – noch – jeden Morgen an Kraft verlor und schließlich gegen neun, zehn Uhr vor der warmen Spätsommerluft kapitulierte.
Lukas lief voraus, barfuß, mit seinen Riesensneakers in der Hand. Seine Waden wirkten zaundürr in den überweiten halblangen Jeans. Die Sonne ließ seine zerzausten Haare golden aufleuchten.
»Du schaust toll aus in dem Kleid«, sagte Anton. Er hatte den Arm um Mona gelegt und drückte sie kurz an sich.
»Ja. Du willst bloß gut Wetter machen.«
Warum sagte sie das? Warum musste sie jetzt, an ihrem letzten gemeinsamen Tag, diese herbe Note hineinbringen? Wie üblich reagierte Anton nicht darauf, aber er ließ seinen Arm von ihrer Schulter sinken, und eine Weile liefen sie schweigend nebeneinander her. Mona sah auf ihre nackten braunen Füße, die bei jedem Schritt im glitschig nassen Sand versanken. Kleine Wellen umspielten ihre Beine. Der Saum ihres Kleides war feucht, und aus irgendeinem Grund ärgerte sie das. Anton hatte ihr das Kleid in diesem Urlaub geschenkt. Später würde sie darin frieren.
»Wann geht unser Flug?«, fragte sie.
»Weißt du doch genau.« Auch Antons Stimme war jetzt gereizt. Sie hatte die Stimmung verdorben, sie war schuld.
»Halb zwölf oder zwölf?«
»Zwölf Uhr zehn.«
»Sicher?«
Er seufzte auf. »Willst du streiten oder was?«
»Wieso streiten? Ich hab dir eine ganz normale Frage gestellt.«
»Zwölf Uhr zehn. Um halb elf kommt das Taxi. Zufrieden?«
Mona antwortete nicht, weil sie fast da waren und sie nicht wollte, dass Lukas sie streiten hörte.
Die Bar war kaum mehr als ein Holzverschlag mit ein paar Holztischen und -bänken drumherum. Die Sonne war untergegangen, die wenigen Gäste der Bar packten Pullover und Wolljacken aus. Es war wie jeden Abend in den letzten beiden Wochen. Der Barbesitzer kam freudestrahlend auf sie zu und begrüßte Anton, Mona wie üblich ignorierend, mit doppeltem Handschlag wie einen lange vermissten Kameraden. »Hi, my friend Antony. So nice to see you.«
Anton grinste. »Hi Bill«. Der Barbesitzer hieß eigentlich Vasily, aber für die Touristen war er Bill, weil er, wie er Anton eines Abends anvertraut hatte, den Touristen nicht zutraute, sich einen so schwierigen Namen wie Vasily zu merken.
»Potatoe chips for the young man?«
Lukas nickte mit ernstem Gesicht. Bill war höchstens dreißig und sehr hübsch mit seinen blonden Haaren, braunen Augen und der tief gebräunten Haut. Er hatte eine englische Freundin, ein rothaariges Mädchen, das jeden Abend in seiner Nähe war, Handlangerdienste für ihn erledigte und – den Eindruck hatte Mona – offenbar einfach nicht wieder nach Hause fahren wollte. Wenn Bill nichts zu tun hatte, setzte er sich zu ihr, legte den Arm um sie, und sie küssten sich und unterhielten sich leise. Vielleicht liebte er sie wirklich.
Sie setzten sich an einen der wackligen Tische. Es dämmerte, und Bill schaltete die beiden einzigen Lampen an der Bar ein, die ein grelles Licht verbreiteten und trotzdem nicht viel erhellten. Eine Windbö wirbelte Sand auf; Mona spürte ihn in den Haaren, und er brannte wie Scheuerpulver auf ihrer trockenen, sonnengeröteten Haut. Sie bestellte Souvlaki, Anton Gyros, und Lukas Pommes frites, weil er seit einem halben Jahr kein Fleisch mehr aß. Eine mühsame Marotte, die Monas ohnehin nicht sehr ausgeprägte Kochkünste auf eine harte Probe stellte.
»Wir könnten noch hier bleiben«, sagte Anton. Mona schloss die Augen. Das war typisch für Anton. Für seine verantwortungslose Haltung. Warum sagte er so etwas vor Lukas? Lukas konnte nicht hier bleiben, auf gar keinen Fall. Lukas musste in die Schule – eine Woche, nicht länger, hatten sie ihn über die Sommerferien hinaus beurlaubt, und nur deshalb weil er im Frühsommer diesen Zusammenbruch hatte, an den Mona nicht einmal mehr denken mochte.
Sie nahm sich zusammen, Lukas zuliebe.
»Ihr zwei könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich muss leider heim.« Unter dem Tisch stieß sie Anton ans Schienbein, hoffend, dass er wenigstens einmal kapierte, dass das Thema ernst war, dass leichtfertige Bemerkungen wie diese Lukas durcheinander bringen konnten, dass Lukas im Moment nicht durcheinander gebracht werden durfte, dass man nicht alles mit Liebe, Geld, Geschenken und lockeren Sprüchen regeln konnte, dass...
»War nur'n Witz.« Anton zwinkerte ihr zu, und Mona atmete auf. »Die Pflicht ruft, was, Alter?« Er gab Lukas, der neben ihm saß, eine leichte, scherzhafte Kopfnuss.
Aber es war schon zu spät.
»Ich will nicht nach Hause! Zu Hause ist es scheiße.« Lukas' Gesicht bekam wieder diesen seltsamen Ausdruck, den Mona in den letzten Monaten fürchten gelernt hatte: verwirrt, angstvoll, in sich gekehrt, blass unter seiner Sonnenbräune. Über den Tisch hinweg nahm sie seine Hand. Er zuckte zusammen und versuchte, sie ihr zu entziehen, aber Mona ließ nicht locker. Er braucht Stärke, hatte die Therapeutin ihr gesagt. Ihre Stärke. Sie müssen unerschütterlich und konsequent sein. Für ihn.
Unerschütterlich. Was für ein Wort. Aber sie versuchte ihr Bestes.
»Zu Hause sind Herbi und Lin und Papa und ich. Wir sind alle da. Da gibt's keinen Grund, sich Sorgen zu machen.«
»Ich will nicht mehr in die Schule.«
»In der Schule sind deine ganzen Freunde.«
»Die sind alle bescheuert.«
»Blödsinn. Da ist der Martin und der Gerhard, die haben dich beide immer wieder besucht, als es dir schlecht gegangen ist. Das sind deine Freunde. Die stehen für dich ein. Die kannst du nicht enttäuschen, indem du einfach wegbleibst.«
Glücklicherweise servierte Bill in diesem Moment ihr Essen und den Wein. »Very nice, very crispy chips for the young man«, sagte er und lächelte Lukas an, als spürte er, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Als wollte er ihn beruhigen. War Lukas' Zustand selbst für Fremde schon so augenfällig, oder verfügte Bill einfach über eine besondere Sensibilität für Menschen, die Probleme hatten? Mona hoffte Letzteres und war ihm dankbar, und einen Moment lang mochte sie ihn fast gut leiden, obwohl sie ihm von Anfang an übel genommen hatte, dass sie als Antons Gefährtin für ihn immer Luft gewesen war. (So sind die Griechen halt, lautete Antons lapidare Erklärung, die in Monas Augen keine war.)
Aber letztlich war es ja egal, wie Bill sie behandelte. Für Lukas war er gut gewesen, Lukas hatte sich in seiner Gegenwart augenscheinlich immer wohl gefühlt, und das war es, was letztlich zählte: Lukas und sein Befinden, das sich unbedingt stabilisieren musste, und zwar bald, damit er nicht wurde wie...
»Hey.« Anton sah sie über den Tisch hinweg an. Lukas schlang mit gesenktem Kopf die Pommes in sich hinein und sah aus, als nähme er nichts um sich herum wahr. »Geht's dir gut?«
»Ja, sicher.« Mona nickte mehrmals, als wollte sie sich selbst überzeugen.
»Dann iss was. Dein Souvlaki wird kalt.« Anton hob sein Weinglas, und sie stießen an. Nicht auf den letzten Abend ihres Urlaubs. Sondern einfach nur so.
Das Anwesen der Belolaveks hätte nun auch der fähigste Gärtner nicht mehr retten können. Der nasse, verwilderte Rasen, die unkrautüberwucherten Beete waren in den letzten sechs Stunden von mindestens vierzig Stiefelpaaren fortwährend malträtiert worden und hatten sich – wozu der anhaltende Regen seinen Teil beitrug – in eine sumpfige, flutlichtbeleuchtete Matschlandschaft verwandelt. Polizisten ließen Leichenhunde in jeden Winkel schnuppern, unter jedem Baum, jedem Strauch wurde Erde ausgehoben, denn konnte man wissen, ob nicht die gesamte Familie Belolavek hier ihr Grab gefunden hatte?
Noch wusste man fast nichts. Die halb verweste Leiche im Geräteschuppen war geborgen worden, sie war nur hauchdünn mit Erde bedeckt gewesen, und es handelte sich um einen Mann. Alter noch ungewiss. Todeszeitpunkt noch ungewiss, aber mindestens zwei Wochen her. Morgen würde die Leiche im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden.
Auch das Haus war grell erleuchtet für eine gespenstische Party. Sechs Tatortleute in unförmigen weißen Plastikoveralls, ausgerüstet mit einem Durchsuchungsbeschluss (in diesem Fall eine bloße Formalie, da sie das Papier niemandem hatten präsentieren können), filzten Schränke, Kommoden, Keller, Speicher, Bäder, Abstellkammern, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Sie fanden keine weitere Leiche, keine Spuren von Gewalt oder Zerstörung, kein Blut – jedenfalls kein sichtbares. Sie nahmen Proben aus allen Räumen, den Teppichen, Handtüchern, Kleidern, Nasszellen, um sie im Labor untersuchen zu lassen. Mit einem Ergebnis konnte man frühestens morgen rechnen.
Außerdem waren sechs Beamte der MK 1 mit Hans Fischer als stellvertretendem Leiter und Martin Berghammer als Chef des Dezernats elf anwesend und die von der Pressestelle alarmierten Journalisten. Sie standen seit Stunden, gemeinsam mit den vielen anderen Schaulustigen, die sich von Kälte, Dunkelheit und schlechtem Wetter nicht hatten abschrecken lassen, an der weißroten Absperrung vor dem Gartenzaun. Sie filmten, fotografierten, telefonierten mit ihren Chefredakteuren, scharten sich um Berghammer oder seinen Pressesprecher, sobald sich einer von ihnen blicken ließ. Und froren in der eisig feuchten Nachtluft.
Was ist los bei euch? Irgendwas gefunden?
Wir haben nichts Neues, Leute. Immer noch nicht.
Keine weiteren Toten?
Nein, niemand.
Im Keller?
Nix. Alles clean so weit.
(Sachte Enttäuschung machte sich breit. Ein brutaler, blutiger Familienmord eignete sich allemal für mehrere Titelstories, selbst wenn es sich wieder bloß um einen Vater handelte, der seinen Job verlor und daraufhin Frau und Kinder und anschließend sich selbst umbrachte.)
Wie schaut das Haus innen aus?
Hübsche Möbel. Aufgeräumt. Absolut normal. Außer dass die Pflanzen vertrocknet sind. Da war länger niemand mehr drin, so viel ist schon mal klar.
Wann können wir rein? Fotos machen?
Später, wenn der Erkennungsdienst fertig ist. Die Tatortleute sind noch dabei. Ihr wisst ja, wie's läuft.
Fehlen Sachen? Im Haus?
Können wir jetzt noch nicht sagen. Wartet halt bis zur Pressekonferenz morgen früh.
Morgen früh! Die Journalisten murrten, aber immerhin: Ein Haus in einem der nobleren Vororte der Stadt als Schauplatz eines entsetzlichen Verbrechens. Eine bis dato unbescholtene, wohl situierte Familie, die spurlos verschwand und einen Toten zurückließ, begraben unter einem Geräteschuppen. Eine Nachbarin, die die Polizei erst auf die Spur gebracht hatte und glücklicherweise mehr als auskunftsfreudig war. Die von Erika Weingarten genussvoll weitergegebene und adäquat ausgeschmückte schaurige Story vom Knochenfinger, der aus dem Erdreich ragte wie eine Mahnung: Das war schon mal für den Anfang absolut außergewöhnlich. Das gab Stoff für weit mehr als einen Aufmacher.
Kapitel 3
Sie landeten um dreizehn Uhr fünfzig. Es war ein unruhiger Flug gewesen mit vielen Turbulenzen. Lukas hatte sich gefürchtet, aber es um keinen Preis zeigen wollen, und irgendwann hatte er sich beinahe übergeben müssen. Schließlich hatte sich der Pilot mit einer launigen Ansage gemeldet. Wir befinden uns gerade über den Alpen, und da kann's noch mal ein paar Minuten lang ruppig werden, also bleiben Sie bitte angeschnallt. Wir landen in zirka vierzig Minuten. Uns erwartet leider kein schönes Wetter, und die Temperaturen sind auch nicht ganz so angenehm wie auf Ihrer wunderschönen Urlaubsinsel...
Das Wetter war schrecklich. Sie hatten das gewusst, und trotzdem war es ein Schock. Es war nicht gut, um diese Jahreszeit Urlaub in einem warmen Land zu machen. Man konnte sich dann so schwer wieder eingewöhnen: an Regen und niedrige Temperaturen und an den herbstlichen Lichtmangel. Für Lukas war Lichtmangel nicht gut. Sie hatten in der Klinik festgestellt, dass Lichtmangel seine Symptome verschlimmerte. Mona verstand nicht ganz, worum es dabei ging. Manche Menschen, so hatte man ihr erklärt, reagierten mit Depressionen, wenn sie zu wenig Licht abbekamen. Bei Lukas schien das jedenfalls so zu sein. Die nächsten Monate würde er deshalb jeden Tag eine Stunde lang vor einer Tageslichtlampe verbringen. Lichttherapie nannte sich das, und Mona konnte kaum glauben, dass eine simple Glühbirne etwas bewirken konnte, woran bislang alle mehr oder weniger gescheitert waren: Lukas wieder zu einem gesunden Jungen zu machen.
Kaum standen sie an der Gepäckausgabe, klingelte ihr Handy. Im selben Moment begann sich das Förderband rumpelnd in Bewegung zu setzen. Anton und Lukas wandten sich in einer fast synchronen Bewegung von ihr ab und den Koffern zu, die langsam an den Passagieren vorbeiglitten. Jetzt war wieder jeder für sich, allein mit seinen Problemen und Hoffnungen und Ängsten.
Das Klingeln kam von ihrer Mailbox.
Hallo, Mona, hier ist Hans. Hans Fischer. Ruf mal an. Dringend. Danke, bis dann.
Ihr Blick fiel auf die Titelseite einer aktuellen Abendzeitung, die sie im Flugzeug wohlweislich nicht hatte lesen wollen. Grausiger Mord in Luxusvilla. Komplette Familie ausgelöscht?
»Kann Lukas heute Nachmittag bei dir bleiben?«
Anton sah auf sie herunter. »Du musst doch nicht heute schon wieder da hin.«
»Na ja. Ich muss wenigstens mal anrufen.«
»Mona, die wissen doch nicht, wann du ankommst. Die haben keine Ahnung, dass du schon da bist. Nütz das doch aus. Tu doch nicht immer so, als wärst du unentbehrlich.«
»Ich...«
»Ruf sie heute Abend an. Dann kannst du immer noch hin, wenn sie dich brauchen.«
»Es ist was passiert. Ich muss mich wenigstens melden.«
»Es ist immer was passiert. Immer. Wenn du dich jetzt meldest, kannst du auch gleich bei denen aufkreuzen, das weißt du genau. Jetzt nimm dir doch noch diesen einen Nachmittag.«
»Anton! Kann Lukas heute bei dir bleiben?«
Er nahm seinen Koffer vom Förderband und stellte ihn zu ihrem auf den Gepäckwagen. Sein Gesicht verschloss sich. »Sicher. Kein Problem.«
Niemand, der sich nicht auskannte, hätte in dem Sechziger-Jahre-Bau, eingezwängt zwischen einem Pizza-Hut und einem Kebab-Lokal, eine Polizeidienststelle vermutet. Dabei gab es sogar deren vier. Die Dezernate 11 bis 14 bearbeiteten Tötungsdelikte, organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Prostitution – alles unter einem Dach. Einem provisorischen Dach, wie ihnen schon seit ewigen Zeiten versprochen wurde. Bald, so hieß es Jahr für Jahr, würden sie umziehen. In eine bessere Gegend, in größere, hellere, besser ausgestattete Büroräume.
Mona parkte ihren Astra in der Tiefgarage. Sie hasste die Garage, in der sie einmal überfallen und entführt worden war, und das trotz Lichtschranken, elektronisch gesicherter Absperrungen und angeblich hochmoderner Überwachungskameras. Immerhin war der Vorfall – wie ihn Berghammer gern bezeichnete – zum Anlass genommen worden, stärkere Lampen zu installieren, die betongrauen Wände schneeweiß zu streichen und an jedem Parkplatz Alarmknöpfe anzubringen, die an schwarzen Kabeln von der Decke herabbaumelten. Was sehr merkwürdig aussah und einen zu allem entschlossenen Täter bestimmt von nichts abhalten würde, denn Kabel konnte schließlich jeder abklemmen.
Aber immerhin, es war jetzt taghell hier unten. Jede Ecke perfekt ausgeleuchtet. Keine Schatten mehr, kaum noch Versteckmöglichkeiten. Trotzdem waren da die gleichen Beklemmungen, die sie seit dem Überfall immer befielen.
Mona stieg aus und schlug die Tür hinter sich zu. Es gab ein hallendes Geräusch, das sie ignorierte. Sie fühlte, wie sie unter ihrer Bräune blass wurde. Sie fror und konnte sich nicht einreden, dass das nur an den herbstlichen Temperaturen lag. Hastig bewegte sie sich an den anderen parkenden Autos entlang dem Ausgang entgegen. Opel, Ford, Opel, Opel, Opel, und einer älter als der andere. An den Dienstwagen wurde immer als Erstes gespart, Dienstwagen mussten ja auch nicht repräsentativ aussehen, geschniegelt und gelackt wie die Streifenwagen, sondern sollten, so das Standardargument gegen jegliche Investition in diesem Bereich, zu Überwachungszwecken unauffällig sein. Dumm nur, dass sie mittlerweile Letzteres gerade nicht mehr waren – schließlich fuhr kaum ein normaler Mensch freiwillig solche antiquierten Modelle spazieren.
Mona beschleunigte ihre Schritte, bis sie fast lief. Ihr war bewusst, dass die Überwachungskameras ihre Panik registrierten, und sie hasste diesen Gedanken.
Nur noch ein paar Meter zum Lift.
Es war der Urlaub. Jedes Mal nach einem Urlaub überfielen sie die Ängste wie alte, hartnäckige ungeliebte Bekannte. Als gehörten sie für immer zu Mona, ob es ihr nun passte oder nicht. Als hätte der Vorfall eine Tür geöffnet, die sich nicht mehr schließen ließ.
Ein Polizeipsychologe hatte sie damals behandelt und ein leichtes Trauma konstatiert. Und ihr gleichzeitig klar gemacht, dass das überhaupt nichts Besonderes sei in ihrem Job.
Als sie endlich im Lift stand, atmete sie auf.
Zwei Minuten später hatte sie alles vergessen.
»Alles okay mit dir?«
»Klar«, sagte Bauer. Er streckte sich unwillkürlich, weil ihn Fischer fast um Haupteslänge überragte.
»Du bist aber ziemlich blass.«
»Mir geht's gut.«
»Hier.« Fischer reichte ihm eine halb leere Chipstüte über den Schreibtisch hinweg und setzte sich, ohne Bauer einen Platz anzubieten. Bauer warf einen Blick in die Tüte. Die Chips waren so ölig, dass sie an der Innenseite einen dünnen Fettfilm hinterließen. Der Geruch nach Paprika, Fett und Salz bedrängte seinen Magen.
»Nee danke.«
»Dir ist doch schlecht«, stellte Fischer fest.
Bauer schloss für eine Sekunde die Augen, kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er kam von der Schutzpolizei. Er hatte theoretisch gewusst, was ihn bei der Mordkommission erwartete, aber es war seine erste Leiche gewesen, und schon der Gedanke daran löste Brechreiz aus. So durfte einfach kein Mensch aussehen, tot oder nicht. Zerfleddert wie einer dieser uralten kaputten Pennerschuhe, die man manchmal am Flussufer fand, mit einem Rest Schnürsenkel dran. Die verbliebene Haut braunfleckig und ledrig, das Gesicht bis auf ein paar Fetzen nicht mehr vorhanden. Die weiß hervorschimmernden Knochen. Der süßlich-eklige, durchdringende Geruch, den seltsamerweise keiner von den Nachbarn wahrgenommen hatte, was vielleicht an dem frühen Kälteeinbruch und dem ständigen eisigen Regen lag. Man ging nicht mehr in den Garten, wenn es sich vermeiden ließ.
Bauer dachte an den erleuchteten Garten, an die Hektik, an die unkoordinierten Grabungsarbeiten mitten in der verregneten Nacht, an die klebrige schwarze Erde an seinen schmutzigen Handschuhen. Er hatte Herzog die Lampe halten müssen, als der die Erstuntersuchung an der Leiche vornahm.
Gehirn fast weggefressen... hey, komm mal tiefer runter mit dem Licht. Tiefer, weiter rechts, verdammt! Ich kann nichts sehen!
Okay, Verwesung weit fortgeschritten, wahrscheinlich weil Objekt nur dünn mit Erde und losen Balken bedeckt... Jetzt den Brustkorb... Junge! Nicht die Beine, den Brustkorb, Herrgott noch mal, die paar anatomischen Kenntnisse kann man ja wohl voraussetzen...
Bauer hatte die Beine angeleuchtet, weil die in einer dunkel verfärbten Hose, wahrscheinlich Jeans, steckten. So konnte man sich einbilden, der Mann, der da lag, war gar nicht so... tot? Ein Albtraum, der ihn nicht aus seinen Klauen lassen wollte. Ein Splattermovie der schlimmsten Kategorie. Ihn schauderte.
»Mir geht's gut«, hörte er sich (zum wievielten Mal?) zu Fischer sagen, dabei rauschte es in seinen Ohren und flimmerte vor seinen Augen.
»Willst du heim? Dich ausruhen?«
»Nein.« Bauer öffnete die Augen; er hörte Fischer kaum. Zu Hause wäre er um diese Tageszeit mutterseelenallein, weil seine Freundin in einem Friseursalon arbeitete. Zu Hause würden ihn die grässlichen Bilder überhaupt nicht mehr in Ruhe lassen.
Okay, wir packen ihn ein, hatte Herzog zum Schluss allen Ernstes gesagt, als handele es sich um einen defekten Stuhl. Und dann hatten Herzogs Helfer die Leiche an den Hosenbeinen und an den skelettierten Armen aus der flachen Grube gehoben, und dabei war ein Batzen vermodertes Restfleisch abgefallen – mit einem widerlichen Wittsch in die Grube zurückgefallen. Und noch immer hatte Bauer sich zusammengenommen, und sich nichts anmerken lassen. Erst in den Armen seiner Freundin, um fünf Uhr morgens war der Zusammenbruch gekommen, mit Weinen und Kotzen und Schwindelanfällen.
»Mir geht's gut.« Langsam ließ die Übelkeit nach, warum, wusste er nicht.
»Ehrlich?«
»Ja.« Bauer sah Fischer in die Augen. Er saß mittlerweile auf Fischers einzigem Besucherstuhl. Keine Ahnung, wie er da hingekommen war.
»Hallo, Mona«, sagte Fischer und sah über ihn hinweg. Bauer drehte sich hastig um. Eine große, schlanke, sonnengebräunte Frau in einem hässlichen Parka stand hinter ihm. Sie hatte mittellange braune Haare. Sie musste Mona Seiler sein, Chefin der MK 1. Er stand auf und stellte sich vor.
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, können wir uns duzen. Ich heiße Mona.«
»Patrick«, sagte Bauer folgsam. Mona, Mona, Mona. Er prägte sich ihren Vornamen ein. Sie nannten sich alle nach kurzer Zeit bei den Vornamen, redeten übereinander allerdings meistens per Nachnamen. Der Schmidt. Der Forster. Bei Frauen ging das schwieriger. Die Seiler... Das klang wie eine Beleidigung.
»Ich hoffe, es gefällt dir bei uns«, sagte Mona und setzte sich auf den Rand von Fischers Schreibtisch. Ihre Augen waren braun und ihr Blick sehr direkt und gleichzeitig auf seltsame Weise zurückhaltend. Als gäbe es viele Gedanken und Gefühle, die sie niemandem mitteilte.
»Ja. Klar. Es gefällt mir gut.«
»Na sicher«, sagte Fischer spöttisch. »Wir haben ja auch den geilsten Job der Welt. Man muss ihn einfach lieben.«
Bauer kam sich vor wie ein Idiot. Er senkte den Kopf. Immerhin gab sein Magen wieder Ruhe, und schwindlig war ihm auch nicht mehr.
»Ich würde gern mal für eine Minute mit Hans allein sprechen«, sagte Mona. »Vielleicht könntest du...«
»Ja – sicher...« Bauer sprang auf.
»Konferenz ist um fünf«, sagte Fischer, wieder mit diesem sarkastischen Lächeln. Bauer nahm seine Tasche und ging hinaus. Auf dem Weg zu seinem Büro, das er sich mit Forster teilte, stieß er fast mit Schmidt zusammen, einem kleinen nervösen Mann, der es ständig eilig hatte.
»Mona wieder da?«, fragte Schmidt.
»Ja«, antwortete Bauer. »Sie ist bei...«
Aber Schmidt war schon an ihm vorbei.
»Schätzungsweise Messerstiche«, sagte Fischer. »Er war möglicherweise schnell tot, sagt Herzog.«
»Schnell tot? Wie schnell?«
»Du weißt doch, wie er ist. Hauptsache nichts Falsches sagen.«
»Und wohin? Die Stiche meine ich.«
Fischer griff nach dem vorläufigen Sektionsprotokoll. »Ich hab die anderen übrigens schon mal losgeschickt. Ich hoffe, das war in deinem Sinn.«
»Sicher, warum nicht?«
Fischers kleines quadratisches Büro ging zum Hauptbahnhof hinaus. Der dröhnende Stop-and-go-Verkehr an der Ampel direkt unter dem Fenster, das aufdringliche Gebimmel der Straßenbahn, das kreischende Bremsgeräusch der blockierten Räder auf den Schienen, all das fiel einem immer besonders auf, wenn man länger nicht hier gewesen war. Wenn man noch Meeresrauschen in den Ohren hatte und ab und zu das vielstimmig klagende Geschrei der Möwen auf Futtersuche.
»Ich hasse diesen Lärm«, sagte Mona.
Fischer grinste sie an, zum ersten Mal an diesem Tag. Wenn er lächelte, sah er sehr gut aus. Vielleicht sollte man ihm das mal sagen, vielleicht würde er es dann öfter tun. Er bildete sich eine Menge ein auf seinen Schlag bei Frauen.
»Wie war dein Urlaub?«, fragte er und hörte sich tatsächlich interessiert an. »Du bist ja richtig braun.«
»Danke. Es war schön. Lukas hat sich auch wieder ganz gut erholt.«
»Wovon erholt?«
In einem Anfall von Vertraulichkeit hatte Mona ihm einmal von Lukas' Problemen erzählt. Er hatte es vergessen.
»Schulstress«, sagte sie.
»Und da wart ihr zwei also ganz allein in Griechenland.«
»Genau.«
»Wie ist das eigentlich so... Ich meine so als... als...«
»Als allein reisende, allein erziehende Mutter, ganz allein mit ihrem Sohn unter heißer südlicher Sonne?«
Fischer wurde rot. »Du weißt schon, was ich meine.«
»Es ist ganz okay. Unproblematisch. Die Griechen beachten Frauen nicht, die mit Kindern unterwegs sind. Du bist wie ... nicht da.«
»Mhm.« Fischer machte ein unbehagliches Gesicht, wie immer, wenn ihr Gespräch den privaten Bereich streifte, was ja ohnehin fast nie passierte. Mona jedenfalls wusste von Fischer kaum mehr als seine Adresse und dass er eine Lieblingsband hatte, die sich Prodigy nannte. Sie wechselte das Thema.
»Warst du bei der Sektion dabei?«
»Ja.« Erleichtert, dass sie gefährliches Gelände hinter sich gelassen hatten, blätterte Fischer in Herzogs Protokoll.
»Was ist das für eine Geschichte mit diesem Toten?«, fragte Mona.
»Martin noch nicht gesehen?«
»Berghammer? Der ist nicht da, sagt Lucia. Kommt in einer Stunde.«
»Du weißt noch gar nichts, richtig?«
»Im Wesentlichen, dass ihr mitten in der Nacht einen Garten umgegraben habt.«
Ich habe kein schlechtes Gewissen, und das ist das Merkwürdigste an dieser ganzen seltsamen, traurigen, schönen, verrückten Geschichte. Es ist so, als hätte ich dich verdient: die Freude, die du mir schenkst, die Ängste, die mich überfallen, sobald wir ein paar Tage nichts voneinander hören, der Schmerz, wenn mir klar wird, dass meine Gefühle dich nicht so erreichen, wie ich es gerne hätte. Und dann wieder die irrsinnige Hoffnung, dass wir doch eines Tages alles miteinander teilen können. Ich habe dich verdient, aber dein Preis ist hoch. Deine Liebe ist Glück und Strafe zugleich.
Der Gang zu deiner Wohnung: Das ist die Strafe. Ich habe sie mir selbst auferlegt. Ich ziehe sie absichtlich in die Länge. Jedes Mal möchte ich kurz vor der Eingangstür kehrtmachen, mich zurückbeamen lassen in mein altes, freundliches, unspektakuläres Dasein. Das Haus, in dem du lebst, ist nicht einfach nur schmutzig, ärmlich und hässlich. Damit würde ich zurechtkommen. Aber dieses Haus hat den Charakter seiner Bewohner angenommen, es sondert Gefühle ab wie Zorn, Furcht, Aggression, Gier, Ärger und eine spezielle Sorte von Resignation. Wer in dieses Haus zieht, hat alles probiert, hat gekämpft und geschuftet und dennoch nichts zu Wege gebracht. Das Haus ist der real existierende Gegenbeweis der These, dass man schafft, was man sich vornimmt, wenn nur der Wille stark genug ist. Euer Wille, das sehe ich und spüre ich, war einmal stark und ist jetzt gebrochen, und das Haus hat seinen Teil dazu geleistet. Das Haus schluckt euch, eure Hoffnungen und Pläne, und irgendwann, wenn es euch noch schlechter geht, wird es euch wieder ausspucken. Leere Hüllen werdet ihr dann sein, ohne Mut und Kraft, ohne Visionen, ohne Liebe.
Als ich dich das zweite Mal besuchte, hatte es nachts ein wenig geschneit. Ich denke, es war Ende Oktober, Anfang November. Ich stand am Wohnzimmerfenster, wie so oft. Ich hatte die Pflanzen gegossen, den Giftefeu, das Orangenbäumchen, den Ficus Benjamini, den Oleander. Sie gediehen nicht mehr so wie früher, als spürten sie, dass ich ihnen meine Liebe entzogen hatte, die nun ganz dir gehört. Der Oleander hatte Läuse, die resistent schienen gegen alle Schädlingsbekämpfungsmittel, der Ficus Benjamini, früher grün und üppig, verlor die Blätter, das Orangenbäumchen wollte nicht mehr blühen.
Ich sah aus dem Fenster, auf die dünne Schneedecke im Garten, aus der bräunliche Halme spitzten, auf die Sträucher dahinter, gepflanzt als eine grüne Mauer, die uns den Blick auf die anderen Gärten versperrt, und ich fühlte mich gefangen in meinem kleinen Reich, das ich mitgeschaffen hatte.
Trotzdem hielt mich etwas davon ab, meinen Mantel, meine Schlüssel, meine Handtasche mit Geld, Autopapieren, Make-up und Lippenstift zu nehmen, und aufzubrechen. Ich konnte mir nicht mehr vormachen, ahnungslos zu sein. Ich wusste jetzt, was passieren würde – ich wusste, was ich von dir wollte, und dass das mehr war als Freundschaft, vermischt mit einem kleinen, erlaubten Schuss Verliebtheit.
Wenn ich mich richtig erinnere, klingelte dann das Telefon und erlöste mich aus der Erstarrung. Ich wusste nicht, ob du das warst, um dich zu erkundigen, wo ich blieb. Wenn ja, solltest du denken, ich sei schon weg, auf dem Weg zu dir. Wenn es eine Freundin war, wollte ich nicht mit ihr reden, jetzt nicht, nicht in meinem Zustand der Unentschlossenheit und Schwäche. Der Anrufbeantworter schaltete sich ein; niemand sprach darauf. Ich zog den Mantel an, schnappte Schlüssel und Tasche und verließ mein Gefängnis. Vielleicht wäre ich sonst nicht gekommen – nie mehr. Vielleicht wäre das besser gewesen.
Nein. Streich das. Ich bin in dieser Stimmung, in der ich eigentlich besser nicht an dich denken sollte.
Ich fuhr wie in Trance. Auf den Straßen lag bräunlicher Schneematsch, durchzogen von Reifenspuren. Es war viel Verkehr. In meinem Kopf drehte sich die ewige Gedankenspirale, wie eine gesprungene Platte, die sich nicht abstellen ließ. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen.
Ich schaltete das Radio ein, aber auf allen Sendern kamen nur Nachrichten. Ich wollte Musik hören, laute Musik, die mich betäubte und gleichzeitig anregte. Ich sah im CD-Kasten nach und fand nur Klassik und Jazz.
Schließlich stand mein Auto vor deinem Haus, und ich hatte keine Ahnung, wie es da hingekommen war. Ich saß im Auto, die Hände immer noch am Steuer, die Stirn aufs Lenkrad gelegt. Ich hätte ewig so dasitzen können, aber nach ein paar Minuten kroch die Kälte durch Mantel und Schuhe (die Frau, die Ehebruch beging, weil sie keine Standheizung hatte), und ich stieg aus. Meine Strafe begann: der Spießrutenlauf durch den Hauseingang. Wieder lungerten sechs, sieben halbwüchsige Jungs an der Treppe herum, als hätten sie sich dort seit Wochen nicht wegbewegt. Wieder dauerte es eine Ewigkeit, bis der einzige Lift kam. Wieder fühlte ich mich angestarrt, gemustert und für ungenügend empfunden. Nur warst du diesmal nicht dabei. Niemand lenkte mich ab von diesen Blicken.
Ich versuchte, mutig zu sein. Ich wandte mich um, erwiderte den unverschämten Blick der Jungs mit hocherhobenem Kopf – und stellte fest, dass sie mich gar nicht beachteten. Oder zumindest so taten. Es war eine Lektion, eine von vielen, die ich lernte, seit ich dich kenne: Ich bin nicht wichtig. Es gibt außerhalb meiner engsten Umgebung niemanden, der mich auch nur wahrnimmt. Ich wollte lächeln über meinen Wahn, aber ich war zu unglücklich dazu.
Durch den Hausflur pfiff der Wind. Die Jungs schwiegen und zogen ihre Anoraks enger um sich. Ihre dunklen Gesichter wirkten grau im Neonlicht. Schwiegen sie meinetwegen?
Der Lift kam, und ich stieg ein. Es war doch alles das erste Mal für mich. Der lange Gang bis zu deiner Wohnung im achten Stock. Wie ich vor der Tür stehen blieb, wie ich die Hand hob und nicht wusste, ob ich klopfen oder klingeln sollte. Hatte ich jemals so vor einer Tür gestanden?
Du hast meine Schritte gehört und mir aufgemacht. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, ob du sauer warst, weil ich mich verspätet hatte, oder ob du froh warst, dass ich überhaupt noch kam, oder ob du vergessen hattest, dass wir uns eine Stunde früher verabredet hatten. (Um zehn. Und es war fast elf). Ich weiß nur noch, wie es für mich war, zum zweiten Mal ganz allein mit dir zu sein. Ich erinnere mich an die Verlegenheit von uns beiden, die mindestens so schlimm war wie das erste Mal.
Und trotzdem wusste ich in der Sekunde, als ich dein Gesicht sah, dass alles richtig war und gut werden würde. Es musste einfach so sein. Wir waren uns das schuldig, verstehst du?
Deine Lippen. Sie schmeckten nach Tabak und Honig. Wenn ich Zigarettenrauch rieche, muss ich an dich denken, und ich hoffe, dass mir niemand ansieht, was ich denke.
»Ein Laie«, sagte Herzog. »Schätze ich.«
»Wer? Der Täter?«
»Ja, sicher. Wer sonst?« Herzog war kleiner als Mona, aber er hatte etwas an sich, das ihn, wenn schon nicht größer, so doch präsenter und stärker wirken ließ.
»Kann ich ihn sehen?«
»Jetzt gleich?«
»Moment noch.«
Sie saßen in Herzogs geräumigem Büro, das eingerichtet war, wie Mona sich die Bibliothek eines Landhauses vorstellte. Alle Wände bis unter die Decke mit Regalen voller gewichtig aussehender fettleibiger Bücher. Sie atmete tief durch.
»Hören Sie, Frau Seiler, ich hab noch einen Termin. Also wenn Sie die Leiche sehen wollen, müssten wir ...«
»Ja. Entschuldigung. Wir können los.«
Sie standen auf. Herzog ging mit seinen forschen, breitbeinigen Schritten voran und hielt ihr die Tür auf. Draußen war es bereits dunkel geworden. Stürmisch. Regnerisch. Die Sonne Griechenlands, die Hitze, der Sand, das Meer, Anton – alles schien so weit weg wie ein Traum. Unwillkürlich ging Mona langsamer. Die quadratischen Deckenleuchten im Gang, das funzlige Licht, das sie verbreiteten, der geflammte Linolboden, der bräunliche Wasserschaden an der linken Wand kurz nach Herzogs Büro – sie kannte jeden Meter im Institut. In zehn, zwanzig Jahren würde sie hier immer noch entlanglaufen, mindestens einmal pro Woche, eher zwei- oder dreimal.
In zwanzig Jahren. Dann war sie Ende fünfzig.
Herzog wartete auf sie am Aufzug, die Hände in den Taschen seines weißen Kittels. Wie immer, wenn er es eilig hatte, wippte er auf Fußballen und Fersen hin und her. Bei jedem anderen mit einer ähnlich gedrungenen Statur hätte das lächerlich ausgesehen, bei ihm wirkte es dynamisch. Als Mona ankam, schloss er die schwere Metalltür auf, mit der der Lift gesichert war. Sie betraten die Kabine.
»Wie war der Urlaub? Sie waren doch in Urlaub, richtig?«
»Ja, war ich. Danke. Sehr schön.«
»Das glaub ich Ihnen. Schön braun geworden. Sollten Sie sich öfter leisten.«
»Tja. Sie wissen ja, wie das ist.«
»Sie müssten doch Überstunden en masse abfeiern können.«
»Tun Sie doch auch nicht.«
Herzog lächelte und antwortete nicht. Seine schwerlidrigen braunen Augen wichen ihr aus, seine Miene verzog sich ungeduldig.
Der Aufzug hielt zwei Stockwerke tiefer, und Mona wappnete sich für den Anblick, der ihr bevorstand. Ihr wurde von nichts mehr übel, auch von den scheußlichsten Verletzungen, den ekelhaftesten Fäulnisveränderungen nicht. Sie träumte auch nicht mehr von dem, was sie beschönigend ihren Job nannte.
Aber da gab es eben doch Spuren, die die vielen, vielen Toten hinterließen. Man konnte sie nicht benennen. Sie waren wie Schatten, die sich über die Welt legten und ihr die Farbe nahmen. Wie eine besondere Form der Trauer, geboren aus einem Gefühl der Vergeblichkeit. Was war das Leben wert, wenn danach nichts übrig blieb? Nichts außer einigen Erinnerungen, die noch dazu alles andere als fälschungssicher waren.
Es gibt Fotos, dachte Mona nicht zum ersten Mal. Immerhin was.
Sie hatte Fotos von dem Toten gesehen als er noch gelebt hatte – vielmehr von dem Mann, von dem sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermuteten, dass er der Tote war. Thomas Belolavek hatte gut ausgesehen. Fit und gesund. Vielleicht nicht besonders sympathisch mit seinen dünnen Lippen und seinem hageren, knochigem Gesicht, aber eindeutig lebendig. Herzog drückte auf einen Zentralschalter im Lift, und eine nach der anderen flammten die blendend hellen Lampen in dem beige-weiß gekachelten Gewölbe auf. Mona kniff die Augen zusammen. Langsam folgte sie Herzog.
Kapitel 4
Man hörte das kreischende Bremsen der Straßenbahn und das Zischen der Autoreifen auf nassem Asphalt. Es regnete schon wieder oder immer noch. Es schien nicht mehr aufhören zu wollen. Keiner der Anwesenden achtete darauf, außer Mona, die noch auf dem Rückflug auf einen goldenen Herbst gehofft hatte, auf lange Spaziergänge mit Lukas in einer klaren Oktobersonne, die das Laub rot aufleuchten ließ. Sie sah zur fast durchgehenden Fensterfront, in der sich der Konferenzraum spiegelte, als gäbe es da ein zweites Zimmer, reserviert für die blassen Geister der Teilnehmer. Ihre Lider wurden schwer, senkten sich wie ein Vorhang über die Pupillen.
Mona!
Sie riss die Augen auf, wandte den Blick weg vom Fenster und versuchte, sich im Stimmengewirr zu orientieren. Sie hoffte, dass niemand zu ihr her sah. Sie war die Leiterin der MK1. Sie musste das hier im Griff behalten.
»...eine SoKo?«
»Blödsinn!«





























