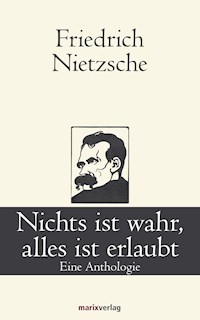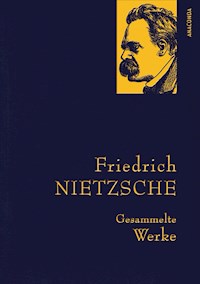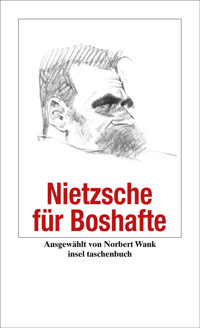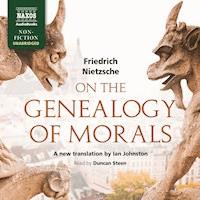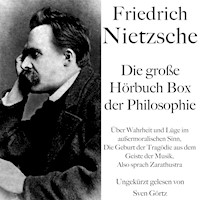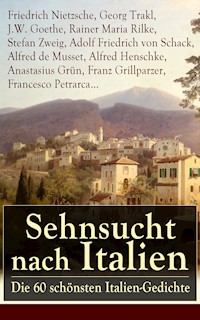1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In 'Unzeitgemäßen Betrachtungen' vollzieht Friedrich Nietzsche eine scharfsinnige Analyse der kulturellen und philosophischen Strömungen seiner Zeit. Er thematisiert das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft und beleuchtet die Bedeutung von Tradition und Fortschritt aus einer kritischen Perspektive. Der literarische Stil Nietzsches ist geprägt von aforistischen Einsichten und einer provokanten Sprache, die den Leser sowohl herausfordert als auch mitreißt. Durch eine eindringliche, oft polemische Rhetorik hinterfragt Nietzsche die Werte und Normen der modernen Welt und eröffnet dabei neue Blickwinkel auf die Philosophie sowie die Kunst des 19. Jahrhunderts. Friedrich Nietzsche, einer der einflussreichsten Philosophen des europäischen Denkens, wurde 1844 in Röcken geboren und gilt als Wegbereiter der modernen Existenzphilosophie. Sein Lebenswerk ist durch eine tiefe Auseinandersetzung mit der Idee des Übermenschen, der Willen zur Macht und dem Nihilismus geprägt. Die 'Unzeitgemäßen Betrachtungen' spiegeln Nietzsches Streben wider, sich von der akademischen Philosophie seiner Zeit zu distanzieren und stattdessen eine persönliche, provokative Philosophie zu entwickeln, die Fragen über Moral, Kunst und die Entfaltung des Individuums aufwirft. Dieser Band ist nicht nur für philosophisch Interessierte von immensem Wert, sondern auch für jeden, der die Wurzeln der modernen Denkweise untersuchen möchte. Nietzsches scharfer Verstand und sein unkonventioneller Blick auf die Gesellschaft machen das Werk zu einer faszinierenden Lektüre, die zum reflektierten Nachdenken anregt und tiefere Einsichten in die menschliche Natur und das Wesen der Gesellschaft bietet. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Unzeitgemäße Betrachtungen
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Werksammlung vereint Friedrich Nietzsches vierteilige Unzeitgemäße Betrachtungen, ein in den frühen 1870er Jahren entstandener Zyklus kulturkritischer Essays. Der Titel benennt Programm und Haltung: bewusst gegen die herrschende Zeitstimmung gerichtet, prüfend, herausfordernd, erzieherisch. Die Texte wenden sich an Leserinnen und Leser, die an der Verbindung von Philosophie, Philologie und Zeitdiagnose interessiert sind. Statt systematischer Abhandlungen bieten sie gedankliche Expeditionen, die aus der Gegenwart heraustreten, um ihr Maßstäbe zu entnehmen. Die Sammlung stellt den vollständigen Zyklus vor und macht so die innere Dramaturgie sichtbar, mit der Nietzsche seine Kritik an Bildung, Kunst, Wissenschaft und öffentlichem Geist entfaltet.
Umfang und Aufbau entsprechen der traditionellen Viergliederung: Erstes Stück David Strauß. Der Bekenner und der Schriftsteller; Zweites Stück Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben; Drittes Stück Schopenhauer als Erzieher; Viertes Stück Richard Wagner in Bayreuth. Jedes Stück ist in fortlaufend nummerierte Abschnitte gegliedert; dem zweiten geht ein Vorwort voran. Zusammen gelesen, zeigen die Teile eine Bewegung vom polemischen Zeitporträt über eine Theorie der Geschichtsnützlichkeit hin zu exemplarischen Figuren und einem zeitgenössischen Künstlerbild. Die vorliegende Zusammenstellung bietet damit keine Auswahl, sondern den geschlossenen Zyklus mit seiner charakteristischen Abfolge und inneren Spannung.
Die vertretene Textsorte ist der Essay in seiner ganzen Spannweite: polemisch zugespitzt, kulturphilosophisch reflektiert, mit Passagen des Porträts, der Programmschrift und der Betrachtung. Es finden sich weder Romane noch Dramen, weder Gedichte noch Briefe oder Tagebücher, sondern kunstvoll gebaute Prosatexte, die Denken als Bewegung sichtbar machen. Der Essay dient Nietzsche als freies, aber streng geführtes Instrument, das Argument, Bild und Urteil verbindet. In dieser Sammlung entstehen so Prosaformen, die zugleich angreifen und aufbauen, prüfen und entwerfen, und die von der Einzelbeobachtung zur allgemeinen Diagnose übergehen.
Der verbindende Zweck der Betrachtungen ist die Kritik an einer sich selbst genügenden Modernität, die ihre Maßstäbe aus Gewohnheit und Konvention bezieht. Nietzsche fragt, was Kultur dem Leben schuldig ist, und wie Bildung zu Kraft statt zu bloßer Wissensanhäufung wird. Er sucht Maßstäbe, die nicht aus Moden oder Mehrheitsmeinungen stammen, sondern aus der Erziehung zur Eigenständigkeit. Dabei richtet sich der Blick auf die Möglichkeiten des Einzelnen, auf die Vorbildkraft seltener Gestalten und auf die Bedingungen, unter denen eine lebendige, rangbewusste Kultur entstehen kann.
Das erste Stück nimmt ein prominentes Phänomen der damaligen Geisteswelt auf, um den Ton der ganzen Reihe zu setzen. Unter der Oberfläche eines aktuellen Anlasses wird eine Typologie des zeitgenössischen Schriftstellers sichtbar, der zum Symptom allgemeiner Geschmacks- und Bildungszustände wird. Der Essay ist weniger persönliche Abrechnung als exemplarische Fallstudie: Er prüft, wie Bekenntnis, Stil und Öffentlichkeit miteinander verkehren, und woran sich Echtheit geistiger Arbeit zeigen lässt. Aus der Kritik gewinnt Nietzsche Kriterien, die für die folgenden Stücke leitend bleiben: Unabhängigkeit, Wahrhaftigkeit und der Mut zur Unzeitgemäßheit.
Das zweite Stück entwickelt eine Theorie des Verhältnisses von Geschichte und Leben. Es fragt, in welchen Dosen und Formen historische Erkenntnis befruchtend wirkt und wo sie lähmt. Der Essay entfaltet unterschiedliche Weisen des historischen Bewusstseins und prüft ihre Funktion für Gegenwart, Charakterbildung und Handlungsfähigkeit. Nicht Wissensvermehrung um ihrer selbst willen, sondern Maß, Zweck und Richtung der Erinnerung stehen im Zentrum. So entsteht ein Begriff von Historie, der aus der Praxis des Lebens beurteilt wird, statt das Leben an die Archive zu fesseln. Die Überlegung zielt auf eine produktive, selektive und verantwortliche Aneignung der Vergangenheit.
Das dritte Stück stellt eine exemplarische Gestalt in den Mittelpunkt, um Erziehung als Selbstbildung am Vorbild zu denken. Der Essay zeichnet kein Gelehrtenleben im üblichen Sinn, sondern sucht in einer Philosophenfigur das, was den Einzelnen zu sich selbst erweckt. Erziehung erscheint als Befreiung aus fremden Erwartungen, als Ausbildung des Geschmacks und als innere Disziplin. So verbindet Nietzsche die Frage nach Lehrerinnen und Lehrern mit der Frage nach dem eigenen Maß: Nicht Nachahmung, sondern Ermutigung zur Eigenform ist der Sinn des Vorbilds. Das Stück fungiert als Programmschrift einer anspruchsvollen, auf Charakter zielenden Bildung.
Das vierte Stück betrachtet einen zeitgenössischen Künstler als kulturelle Möglichkeit. Anlass ist ein Festspielort, doch der Blick reicht über das Ereignis hinaus auf Werk, Wirkung und Hoffnung, die sich mit einer starken Kunst verbinden. Der Essay tastet die Bedingungen einer gemeinschaftsbildenden Kunst ab und prüft, was ein großer Künstler für eine Kultur bedeuten kann. Es handelt sich um eine kulturkritische und zugleich ästhetische Betrachtung, die Kunst nicht als Luxus, sondern als Form von Erkenntnis und Erziehung versteht. So schließt der Band den Bogen vom Zeitporträt über Theorie und Vorbild zur künstlerischen Praxis.
Stilistisch verbindet Nietzsche scharfe Begriffsarbeit mit anschaulicher Bildkraft, gelehrter Anspielung mit polemischer Pointierung. Die Prosa arbeitet mit Antithesen, Steigerungen und Typologien; sie wechselt zwischen analytischer Nüchternheit und pathetischer Anrufung. Charakteristisch ist der Versuch, Urteilskraft im Vollzug zu zeigen: Denken erscheint als Handlung, Kritik als Form der Selbstprüfung. In dieser Mischung entsteht eine essayistische Ethik des Lesens und Schreibens, die den Leser nicht nur informiert, sondern fordert. Die Texte sind damit weniger Kommentare zur Zeit als Übungen in Urteil und Geschmack.
Thematisch kreisen die Betrachtungen um Maßstäbe der Kultur, die Rolle des Einzelnen, den Rang geistiger Arbeit und die Gefahren einer überbordenden Wissensakkumulation. Wiederkehrend sind Motive von Gesundheit und Krankheit der Kultur, von Erziehung durch Beispiele und von der Verantwortlichkeit der Erinnerung. Kunst und Philosophie erscheinen nicht als getrennte Sphären, sondern als komplementäre Kräfte der Formung. So entsteht ein Zusammenhang: Kritik der Gegenwart, Neufassung der Historie, Ermutigung zur Selbstbildung, Prüfung der Kunst – vier Perspektiven auf dieselbe Frage nach der Möglichkeit einer höheren, lebensdienlichen Kultur.
Die anhaltende Bedeutung der Unzeitgemäßen Betrachtungen liegt in ihrer Fähigkeit, Grundfragen des Kulturlebens jenseits akademischer Spezialismen zu formulieren. Sie wirken weiter in Debatten über Bildungsziele, Öffentlichkeit, Wissenschaftspraxis und Kunstverständnis. Wer heute nach Orientierung in einer überinformierten Gegenwart sucht, findet hier Kriterien für Auswahl, Maß und Priorität. Zugleich zeigen die Stücke, wie Kritik ohne Ressentiment und Pathos ohne Blindheit möglich sind. Der Zyklus markiert eine frühe Phase im Denken Nietzsches und öffnet Zugänge zu späteren Problemstellungen, ohne auf deren Begriffe oder Lösungen angewiesen zu sein.
Diese Ausgabe lädt zu einer Lektüre ein, die zwischen den Stücken hin- und hergeht und ihre wechselseitige Beleuchtung nutzt. Die nummerierten Abschnitte erleichtern die Orientierung und erlauben thematische Querverbindungen. Empfehlenswert ist ein Lesen, das die Texte als Übungen versteht: im Wählen und Weglassen, im Unterscheiden und Bewerten. So erfüllt sich der unzeitgemäße Anspruch der Sammlung im Leser selbst: Maß zu finden, ohne nachzugeben; sich bilden zu lassen, ohne sich anzugleichen. In diesem Sinn ist der Band keine bloße Dokumentation, sondern ein Angebot zur geistigen Selbsttätigkeit.
Autorenbiografie
Friedrich Nietzsche (1844–1900) war ein deutscher klassischer Philologe und Philosoph, dessen Wirkung weit über seine Epoche hinausreicht. Er gilt als scharfer Diagnostiker moderner Kulturverhältnisse, als Stilist von seltener Prägnanz und als Anreger eigenständigen Denkens. Inmitten der Umbrüche des 19. Jahrhunderts wandte er sich gegen Selbstzufriedenheit, geistige Bequemlichkeit und Bildungsroutine. Früh kristallisierten sich diese Anliegen in der Sammlung Unzeitgemäße Betrachtungen, vier Essays, die zwischen 1873 und 1876 erschienen. Dort prüfte Nietzsche die geistige Lage seiner Zeit an exemplarischen Fällen und stellte Fragen nach dem Nutzen von Geschichte, nach Erziehung, Vorbildern und künstlerischer Erneuerung. Die Texte fanden Aufmerksamkeit und stießen auf heftigen Widerspruch.
Nietzsche erhielt seine schulische Prägung an der Landesschule Pforta, wo er eine gründliche Ausbildung in den klassischen Sprachen erwarb. Anschließend studierte er zunächst in Bonn, dann in Leipzig klassische Philologie, beeinflusst von der strengen Methode seines Leipziger Lehrers Friedrich Wilhelm Ritschl. In dieser Zeit vertiefte er sich in die griechische Antike und begegnete Schriften, die seinen Blick weiteten, darunter die Philosophie Arthur Schopenhauers. 1868 lernte er Richard Wagner kennen, dessen künstlerisches Pathos und kulturkritische Ansprüche ihn zunächst beeindruckten. Die Verbindung von philologischer Genauigkeit, philosophischer Problemleidenschaft und ästhetischer Sensibilität wurde zur Signatur seines Denkens und bereitete seine spätere, eigenständige Position vor.
1869 wurde Nietzsche im Alter von Mitte zwanzig an die Universität Basel berufen, wo er klassische Philologie lehrte und mit großer Energie forschte. Die Basler Jahre waren geprägt von intensiver Lehrtätigkeit, philologischen Studien zur griechischen Kultur sowie von wachsendem Interesse an zeitdiagnostischen Fragen. Zwischen 1873 und 1876 veröffentlichte er die vier Unzeitgemäßen Betrachtungen: David Strauß. Der Bekenner und der Schriftsteller; Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben; Schopenhauer als Erzieher; Richard Wagner in Bayreuth. Sie markieren eine Verschiebung von enger Fachphilologie zu weitgreifender Kulturkritik. Wiederkehrende gesundheitliche Belastungen führten schließlich 1879 zu seinem Rückzug aus dem Lehramt.
Im ersten Stück, David Strauß. Der Bekenner und der Schriftsteller, knüpft Nietzsche an einem damals vielgelesenen Autor an, um eine breiter angelegte Kulturkritik zu entfalten. Ihm gilt die selbstzufriedene Popularisierung anspruchsvoller Gedanken als Symptom einer bequemen Bildungswelt, die hohe Ansprüche rhetorisch behauptet, aber praktische Wahrhaftigkeit und Strenge meidet. Die Figur des „Bekenner[s]“ steht als Gegenbild zu einem Schriftstellerideal, das intellektuelle Redlichkeit und schöpferischen Mut verlangt. Nietzsches Polemik zielt weniger auf eine Einzelperson als auf einen Stil des Denkens, der das Leben beruhigt, statt es zu steigern. Die Streitbarkeit des Essays machte ihn früh zur kontrovers diskutierten Stimme.
Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben vertieft diese Kritik, indem es die Rolle des Historischen im Dasein neu beurteilt. Nietzsche unterscheidet Formen der Geschichtspraxis – etwa monumentale, antiquarische und kritische – und fragt, wann sie dem Leben nützen oder schaden. Übermaß an Historienwissen kann, so seine Diagnose, Tatkraft lähmen, Urteilskraft verwässern und Gegenwartssinn schwächen. Dem setzt er eine lebensdienliche Maßhaltung entgegen, in der Erinnerung, Maßstab und Vergessen produktiv austariert werden. Der Essay reagiert damit auf die Zeitbegeisterung für Wissenschaft und Archiv, ohne die Bedeutung der Geschichte zu leugnen, aber ihr Ziel am Gedeihen schöpferischer Gegenwart ausrichtend.
Mit Schopenhauer als Erzieher bestimmt Nietzsche die Figur eines „Erziehers“, die nicht bevormundet, sondern zur Selbstbildung ermutigt. Schopenhauer dient ihm als Beispiel einer unabhängigen, unbestechlichen Geisteshaltung, die den Mut zur Einsamkeit und zur eigenen Maßsetzung lehrt. Richard Wagner in Bayreuth knüpft daran an, indem es das Projekt Bayreuth als Möglichkeit einer künstlerischen Erneuerung deutet, die Gemeinschaft, Stil und Erhebung stiften sollte. Beide Stücke zeigen Nietzsches Suche nach Vorbildern, an denen sich Persönlichkeiten bilden, die den Zeitgeist prüfen statt ihm nachzugeben. Sie vereinen persönliche Verehrung, programmatische Forderungen und die Frage, wie geistige Autorität ohne Dogmatismus denkbar ist.
Nach dem Rücktritt von seinem Basler Lehramt arbeitete Nietzsche als freier Schriftsteller, zunehmend unabhängig von akademischen Routinen und institutionellen Erwartungen. Seine spätere Entwicklung vertiefte die in den Unzeitgemäßen Betrachtungen angelegten Motive einer lebensbejahenden Kritik der Kultur, verbunden mit stilistischer Zuspitzung und experimentierfreudiger Form. 1889 erlitt er einen Zusammenbruch und war fortan nicht mehr arbeitsfähig; er starb 1900. Sein Nachruhm wuchs im 20. Jahrhundert erheblich. Heute werden die Unzeitgemäßen Betrachtungen als frühe, zugespitzte Standortbestimmung gelesen, die bis in Gegenwartstheorien von Bildung, Erinnerung, Kunst und Persönlichkeit hineinwirkt und die Spannungen moderner Kultur mit unverminderter Schärfe sichtbar macht.
Historischer Kontext
Friedrich Nietzsche (1844–1900) verfasste die vier Unzeitgemäßen Betrachtungen zwischen 1873 und 1876, während seiner Basler Professur für klassische Philologie (seit 1869). Die Einzelstücke erschienen nacheinander: David Strauß. Der Bekenner und der Schriftsteller (1873), Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874), Schopenhauer als Erzieher (1874) und Richard Wagner in Bayreuth (1876). Sie richteten sich an ein gebildetes Publikum im neu gegründeten Deutschen Kaiserreich und verbanden Diagnosen der Gegenwart mit exemplarischen Porträts. Nietzsche verstand sie als Interventionen gegen die geistige Selbstzufriedenheit seiner Epoche, weniger als systematische Philosophie, mehr als kulturkritische Essays mit unmittelbarer Gegenwartsbindung.
Der politische Hintergrund ist die Reichsgründung von 1871 nach den Einigungskriegen (1864, 1866, 1870/71). Der militärische Sieg über Frankreich, die Annexion von Elsass-Lothringen und die Krönung Wilhelms I. zum Deutschen Kaiser in Versailles erzeugten Selbstbewusstsein und nationalen Pathos. Unter Reichskanzler Otto von Bismarck stabilisierte sich ein föderaler Nationalstaat mit preußischer Prägung. Universitäten, Museen und Theater galten als Repräsentationsorgane der Kulturnation. In dieser Atmosphäre des Triumphs und der nationalen Integrationspolitik setzten Nietzsches Betrachtungen Akzente der Distanz: Sie stellten die Frage, wie Kultur, Bildung und Persönlichkeit unter Bedingungen von Sieg, Einheit und politischer Macht bewahrt oder erneuert werden könnten.
Die frühen 1870er Jahre waren von der Gründerzeit geprägt: beschleunigte Industrialisierung, Eisenbahnausbau, Banken- und Börsenboom, Spekulation und ein expandierender Buch- und Zeitungsmarkt. Der Gründerkrach von 1873 beendete die Phase des rauschhaften Wachstums und führte zu wirtschaftlichen Verwerfungen. Träger der kulturellen Öffentlichkeit war das Bildungsbürgertum, dessen Wertekanon – Fleiß, Bildung, nationale Loyalität – den Ton im Feuilleton und im Vereinswesen angab. Nietzsche zielte mit der Figur des Bildungsphilisters auf jene bürgerliche Selbstsicherheit, die Bildung in gesellschaftliches Prestige und konsumierbares Kulturgut verwandelte. Seine Essays intervenierten damit in eine Debatte über den Zweck von Wissen und Kultur im modernen Wirtschaftsstaat.
Das 19. Jahrhundert in Deutschland war vom Historismus geprägt. Die Ranke-Schule etablierte eine quellenkritische Geschichtswissenschaft, Archive und Editionen blühten, Denkmäler und Jubiläen prägten den öffentlichen Raum. In Schulen und Universitäten wuchs die Bedeutung historischer Fächer; zugleich gewann ein historisierender Stil in Architektur und Kunst an Einfluss. Nietzsches zweite Betrachtung reagierte auf diese Konstellation, indem sie die Überfülle historischen Wissens und die Autorität der Historikerzunft problematisierte. Die Frage lautete, welche Formen von Erinnerung einer lebendigen Gegenwart dienen und welche sie lähmen. Diese Kritik zielte nicht gegen Forschung als solche, sondern gegen deren Übergewicht im kulturellen Selbstverständnis.
Die Bildungslandschaft erlebte zugleich Ausdifferenzierung und Professionalisierung. Das humanistische Gymnasium blieb prestigeträchtig, doch Realgymnasien und technische Hochschulen gewannen an Gewicht. Die Universität entwickelte sich zur Forschungsinstitution mit Seminaren, Spezialphilologien und Fachzeitschriften. Nietzsche, selbst aus der philologischen Schule stammend, betrachtete die Verengung auf Spezialwissen skeptisch. Seine Betrachtungen kreisen um die Formung der Persönlichkeit, die Rolle von Vorbildern und die Gefahren einer bloß akkumulierenden Wissenskultur. Damit traf er laufende Reformdebatten über Unterrichtszwecke, Prüfungswesen und die Vereinbarkeit von Bildung und Beruf. Basel bot ihm dafür Beobachterdistanz, blieb aber in Sprache und Zielpublikum eng an die deutsche Universitätskultur gebunden.
Religiös-intellektuell standen liberale Theologie und historisch-kritische Bibelforschung hoch im Kurs. David Friedrich Strauss wurde seit seinem Leben Jesu (1835) als umstrittener Erneuerer wahrgenommen; mit Der alte und der neue Glaube (1872) adressierte er den gebildeten Laien und fasste eine naturwissenschaftlich informierte Kulturreligion zusammen. Strauss’ Buch wurde ein Bestseller und Symbol einer selbstzufriedenen, säkularen Bürgerfrömmigkeit. Nietzsches erste Betrachtung wählte Strauss als Fallfigur, um den Ton der Zeit zu kritisieren: die Glätte populärer Weltanschauungsliteratur, die Reduktion philosophischer Fragen auf gefällige Kompromisse und die Vermarktung von Geist. Diese Intervention zielte auf die Zeitdiagnostik, nicht auf konfessionelle Polemik.
In den 1860er und 1870er Jahren gewann Arthur Schopenhauer postum enorme Resonanz. Zeitgleich befeuerte Eduard von Hartmanns Philosophie des Unbewussten (1869) eine breite Pessimismusdebatte. Die Frage, ob moderne Zivilisation Fortschritt oder Sinnverlust bedeute, prägte Feuilletons und akademische Streitgespräche. Nietzsches dritte Betrachtung griff Schopenhauer als Erzieher auf – nicht als Dogmenlieferanten, sondern als Gestalt intellektueller Unabhängigkeit gegen Modetrends. Damit positionierte sich Nietzsche zugleich innerhalb und gegen den zeitgenössischen Pessimismusdiskurs. Er interessierte sich für die Möglichkeit, aus der Begegnung mit großen Geistern Maßstäbe für Selbstbildung zu gewinnen, ohne in Schulsysteme oder weltanschauliche Schulen einzutreten.
Naturwissenschaft und Technik veränderten Denkstile nachhaltig. Darwins Evolutionstheorie (1859) wurde im deutschen Sprachraum durch Popularisierer wie Ernst Haeckel breit diskutiert; Physiologie, Chemie und Physik etablierten experimentelle Standards. Der Materialismusstreit seit den 1850er Jahren hatte die Deutungshoheit über Natur und Mensch zum Konfliktfeld gemacht. Positivistische Tendenzen beeinflussten auch Geisteswissenschaften. Nietzsches Betrachtungen reagieren auf diese Konstellation, ohne sie zu leugnen: Sie kritisieren eine Verkürzung des Menschenbildes durch wissenssoziologische Modewahrheiten und eine Übertragung naturwissenschaftlicher Methoden in Lebensfragen, die andere Formen von Einsicht erfordern. Die Essays fragen nach Rangordnungen des Wissens und nach der Verantwortung von Gelehrten gegenüber dem Leben.
Die wagnersche Kunstreligion prägte die Kulturpolitik der Zeit. Mit Bayreuth entstand seit 1872 ein eigenständiges Festspielhaus, unterstützt durch König Ludwig II. von Bayern und ein europaweites Netzwerk von Vereinen. 1876 wurde der Ring des Nibelungen erstmals vollständig aufgeführt, als nationales und zugleich europäisches Ereignis. Nietzsche stand seit Ende der 1860er Jahre mit Wagner in engem Austausch und sah in Bayreuth lange einen möglichen Kristallisationspunkt erneuerter Kultur. Die vierte Betrachtung trägt diesem Kontext Rechnung, indem sie das Projekt kulturgeschichtlich deutet. Sie gehört damit zu jenen Stimmen, die Bayreuth nicht nur musikalisch, sondern als gesellschaftliches Experiment interpretierten.
Nietzsche schrieb die Betrachtungen aus der Perspektive eines in der Schweiz tätigen Gelehrten. 1870 hatte er sich freiwillig als Sanitäter im Deutsch-Französischen Krieg gemeldet und dabei schwere Krankheiten (u. a. Dysenterie und Diphtherie) erlitten, die seine Gesundheit dauerhaft belasteten. Die Erfahrung von Krieg, Verwundbarkeit und nationaler Erregung bildete einen biografischen Hintergrund, der die Skepsis gegenüber Kriegsbegeisterung verstärkte. Basel bot zugleich eine Art Außenstation: geografisch nahe, politisch neutral, kulturell verflochten. Von dort aus kommentierte Nietzsche Entwicklungen im Reich, ohne sich parteipolitisch zu verorten. Seine Zielgruppe blieb jedoch das deutschsprachige Bildungs- und Lesepublikum.
Die mediale Infrastruktur der 1870er erlaubte schnelle, massenhafte Meinungsbildung. Illustrierte Familienzeitschriften wie Die Gartenlaube erreichten Hunderttausende; Buchclubs, Leihbibliotheken und eine dichte Verlagslandschaft förderten Debatten. Strauss’ Spätwerk profitierte von dieser Öffentlichkeit, ebenso die Kontroversen um Wagner. Nietzsches Betrachtungen erschienen bei E. W. Fritzsch in Leipzig, also im Umfeld wagnerscher Publizistik, und wurden in Rezensionen und Gegenpamphleten diskutiert. Der Essay als Form eignete sich, komplexe Fragen in pointierter, polemischer Sprache an ein breiteres Publikum heranzutragen. Zugleich konkurrierten solche Texte mit einer wachsenden Flut populärer Weltanschauungen, die Nietzsche als Symptom eines nivellierten Geisteslebens wahrnahm.
Gesellschaftlich polarisierte das Jahrzehnt zwischen Kulturkampf und Arbeiterbewegung. Bismarcks Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche (ca. 1871–1878) durch Schul- und Kirchengesetze spaltete das Reich entlang konfessioneller Linien. Parallel organisierten sich Arbeiterparteien: ADAV (1863) und SDAP (1869) vereinigten sich 1875 in Gotha; die sozialistische Presse expandierte. Zwar liegen die Sozialistengesetze erst ab 1878, doch prägten Klassen- und Bekenntniskonflikte bereits zuvor die Öffentlichkeit. Nietzsches Essays vermeiden konkrete Tagespolitik, reagieren aber auf die Moralisierung politischer Lager und die Rhetorik kollektiver Identitäten. Sie fragen nach der Möglichkeit individueller Maßstäbe, wenn Massenparteien, Vereine und Kirchen das Denken normieren.
Die Bezugnahme auf die griechische Antike war ein Zentralstück bürgerlicher Bildung. Seit Winckelmann und Humboldt diente Hellas als normatives Kulturideal; Gymnasien und Universitäten pflegten Philologie als Leitdisziplin. Nietzsche hatte mit Die Geburt der Tragödie (1872) eine unorthodoxe Deutung der Griechen vorgelegt, die mit der klassischen Schulphilologie kollidierte. In den Betrachtungen setzt er diese Auseinandersetzung indirekt fort, indem er die Frage nach dem lebensstiftenden Gehalt von Bildung stellt. Nicht Antiquariatswissen, sondern exemplarische Kräfte sollten Maß geben. Diese Umakzentuierung traf ein Milieu, das Antike zugleich verehrte und in Prüfungsstoff überführte, und verschärfte bestehende fachliche Spannungen.
Die unmittelbare Resonanz war gespalten. Anhänger Strauss’ wiesen die Attacke als ungerechtfertigt zurück; liberale Feuilletons verteidigten das populäre Weltanschauungsbuch. In der Philologie war Nietzsche seit der Kontroverse um Die Geburt der Tragödie – mit scharfer Kritik u. a. von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1872) – ohnehin umstritten. Wagnerisch gesinnte Kreise begrüßten einzelne Thesen, doch selbst dort blieb die Zustimmung begrenzt. Insgesamt erreichten die Betrachtungen ein interessiertes, aber nicht massenhaftes Publikum. Sie festigten Nietzsches Ruf als streitbarer Kulturkritiker, erschwerten jedoch seine akademische Karriere. Die Texte wurden mehr als Interventionen der Gegenwart denn als gelehrte Studien wahrgenommen.
Im weiteren Verlauf der 1870er Jahre verschob sich Nietzsches Position. Die Distanz zu Wagner wuchs, sichtbar an Schriften ab 1878 (Menschliches, Allzumenschliches). Gleichwohl markieren die Betrachtungen eine Schlüsselphase: Sie bündeln Motive aus der Geburt der Tragödie und bereiten spätere Kritikformen vor, etwa die genealogische Analyse von Moral, Kultur und Wissenschaft. Historisch wichtig ist weniger eine Doktrin als die Haltung, Gegenwart an übergreifenden Maßstäben zu messen und die Selbstgewissheit der Epoche zu befragen. Damit stehen die Essays exemplarisch für die intellektuelle Unruhe eines Jahrzehnts, das zwischen nationalem Erfolg, wissenschaftlichem Fortschritt und kultureller Verunsicherung oszillierte.
Um 1900 und in den Jahrzehnten danach wurden die Betrachtungen in verschiedenen Kontexten neu gelesen. Lebensphilosophische Strömungen, Reformpädagogik und Teile der Jugendbewegung griffen die Idee persönlicher Selbstformung auf, oft ohne die historische Schärfe der Polemik mitzunehmen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zirkulierten selektive, teils ideologisch gefärbte Lesarten, während das Nietzsche-Archiv in Weimar Editionshoheit beanspruchte. Nach 1945 setzten kritische Ausgaben und Forschungen – später maßgeblich die Colli-Montinari-Edition ab den 1960er Jahren – zuverlässigeren Textgrundlagen und Kontextualisierungen. Seither gilt die Sammlung als Schlüsselquelle für die Kritik des Historismus und das Verständnis von Nietzsches Frühwerk.
Im historischen Kontext erscheinen die Unzeitgemäßen Betrachtungen als Kommentar zu tektonischen Verschiebungen der 1870er Jahre: Nationalstaatsbildung, industrieller Kapitalismus, Verwissenschaftlichung, Massenmedien und kulturelle Institutionenformierung. Die Essays wählen exemplarische Gegner und Leitfiguren, um Grundfragen zu stellen: Wozu Geschichte? Wozu Bildung? Welche Rolle spielen Kunst, Philosophie und Persönlichkeit im Spannungsfeld von Staat, Markt und Öffentlichkeit? Zeitgenössische Debatten über Theologie, Pessimismus, Wissenschaft und Musik bilden den Resonanzraum. Spätere Deutungen haben die Sammlung teils als Übergangswerk, teils als eigenständige Diagnose gelesen. In verlässlichen Editionen eröffnet sie weiterhin Zugänge zur Selbstkritik der Moderne im deutschsprachigen Raum.
Synopsis (Auswahl)
Unzeitgemäße Betrachtungen: Gesamtprofil
Die vier Unzeitgemäßen Betrachtungen erkunden eine bewusst gegenwartswidrige Haltung: Kulturkritik, die nicht dem Zeitgeist dient, sondern das Leben und die Bildung starker Individuen stärkt. Wiederkehrend sind Angriffe auf philiströse Selbstzufriedenheit, akademische Routine und leere Fortschrittsgläubigkeit, verbunden mit dem Ruf nach geistiger Disziplin, Mut und schöpferischer Erneuerung. Stilistisch verbinden sich Polemik, psychologische Beobachtung und programmatische Zuspitzung zu einer erzieherischen, oft kämpferischen Prosa.
Erstes Stück: David Strauß. Der Bekenner und der Schriftsteller
Dieses Stück nutzt die Auseinandersetzung mit David Friedrich Strauss als Fallstudie über den Bildungsphilister und eine selbstzufriedene, populärwissenschaftliche Religions- und Kulturhaltung. Nietzsche zeigt, wie konforme Gelehrsamkeit sich als Wahrhaftigkeit ausgibt und damit echte Kultur und geistige Strenge erstickt. Der Ton ist satirisch und scharf, mit dem Ziel, zeitgenössische Trägheit und Selbstbeweihräucherung aufzurütteln.
Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben
Hier unterscheidet Nietzsche verschiedene Weisen, mit der Vergangenheit umzugehen, und zeigt, wie Geschichte dem Leben nützt oder schadet. Gegen eine historistische Überfülle setzt er die Forderung, Erinnerung an Maß, Zweck und Zukunftsorientierung zu binden, damit Tatkraft, Urteil und schöpferische Neuerung möglich bleiben. Der Text ist diagnostisch und appellativ, zwischen Analyse und erzieherischer Anleitung.
Drittes Stück: Schopenhauer als Erzieher
Am Beispiel Schopenhauers entwirft Nietzsche ein Ideal des Erziehers, der nicht durch Lehrsätze, sondern durch Lebensform zur geistigen Selbstständigkeit anstiftet. Thematisiert werden Wahrhaftigkeit, Einsamkeit, Maßhaltung und der Mut, gegen öffentliche Meinung und Berufsroutine das Eigene zu bilden. Der Ton ist persönlich und ermutigend, als Programm individueller Selbstbildung.
Viertes Stück: Richard Wagner in Bayreuth
Das Porträt Wagners rahmt Bayreuth als kulturelles Gesamtexperiment und fragt, ob große Kunst eine erneuernde Gemeinschaft stiften kann. Nietzsche zeigt Bewunderung für künstlerische Größe, aber auch Sensibilität für die Gefahren von Kult, Missverständnis und pathetischer Verklärung. Die Darstellung ist feierlich und visionär, durchzogen von kritischer Kulturdiagnose.
Unzeitgemäße Betrachtungen
Erstes Stück David Strauß. Der Bekenner und der Schriftsteller
1
Die öffentliche Meinung in Deutschland scheint es fast zu verbieten, von den schlimmen und gefährlichen Folgen des Krieges, zumal eines siegreich beendeten Krieges zu reden: um so williger werden aber diejenigen Schriftsteller angehört, welche keine wichtigere Meinung als jene öffentliche kennen und deshalb wetteifernd beflissen sind, den Krieg zu preisen und den mächtigen Phänomenen seiner Einwirkung auf Sittlichkeit, Kultur und Kunst jubilierend nachzugehen. Trotzdem sei es gesagt: ein großer Sieg ist eine große Gefahr. Die menschliche Natur erträgt ihn schwerer als eine Niederlage; ja es scheint selbst leichter zu sein, einen solchen Sieg zu erringen, als ihn so zu ertragen, daß daraus keine schwerere Niederlage entsteht. Von allen schlimmen Folgen aber, die der letzte mit Frankreich geführte Krieg hinter sich dreinzieht, ist vielleicht die schlimmste ein weitverbreiteter, ja allgemeiner Irrtum: der Irrtum der öffentlichen Meinung und aller öffentlich Meinenden, daß auch die deutsche Kultur in jenem Kampfe gesiegt habe und deshalb jetzt mit den Kränzen geschmückt werden müsse, die so außerordentlichen Begebnissen und Erfolgen gemäß seien. Dieser Wahn ist höchst verderblich: nicht etwa weil er ein Wahn ist – denn es gibt die heilsamsten und segensreichsten Irrtümer – sondern weil er imstande ist, unseren Sieg in eine völlige Niederlage zu verwandeln: in die Niederlage, ja Exstirpation des deutschen Geistes zugunsten des »deutschen Reiches«.
Einmal bliebe immer, selbst angenommen, daß zwei Kulturen miteinander gekämpft hätten, der Maßstab für den Wert der siegenden ein sehr relativer und würde unter Verhältnissen durchaus nicht zu einem Siegesjubel oder zu einer Selbstglorifikation berechtigen. Denn es käme darauf an, zu wissen, was jene unterjochte Kulturwert gewesen wäre: vielleicht sehr wenig: in welchem Falle auch der Sieg, selbst bei pomphaftestem Waffenerfolge, für die siegende Kultur keine Aufforderung zum Triumphe enthielte. Andererseits kann, in unserem Falle, von einem Siege der deutschen Kultur aus den einfachsten Gründen nicht die Rede sein: weil die französische Kultur fortbesteht wie vorher, und wir von ihr abhängen wie vorher. Nicht einmal an dem Waffenerfolge hat sie mitgeholfen. Strenge Kriegszucht, natürliche Tapferkeit und Ausdauer, Überlegenheit der Führer, Einheit und Gehorsam unter den Geführten, kurz Elemente, die nichts mit der Kultur zu tun haben, verhalfen uns zum Siege über Gegner, denen die wichtigsten dieser Elemente fehlten: nur darüber kann man sich wundern, daß das, was sich jetzt in Deutschland »Kultur« nennt, so wenig hemmend zwischen diese militärischen Erfordernisse zu einem großen Erfolge getreten ist, vielleicht nur, weil dieses Kultur sich nennende Etwas es für sich vorteilhafter erachtete, sich diesmal dienstfertig zu erweisen. Läßt man es heranwachsen und fortwuchern, verwöhnt man es durch den schmeichelnden Wahn, daß es siegreich gewesen sei, so hat es die Kraft, den deutschen Geist, wie ich sagte, zu exstirpieren – und wer weiß, ob dann noch etwas mit dem übrig bleibenden deutschen Körper anzufangen ist!
Sollte es möglich sein, jene gleichmütige und zähe Tapferkeit, welche der Deutsche dem pathetischen und plötzlichen Ungestüm des Franzosen entgegenstellte, gegen den inneren Feind, gegen jene höchst zweideutige und jedenfalls unnationale »Gebildetheit« wachzurufen, die jetzt in Deutschland, mit gefährlichem Mißverstande, Kultur genannt wird: so ist nicht alle Hoffnung auf eine wirkliche echte deutsche Bildung, den Gegensatz jener Gebildetheit, verloren: denn an den einsichtigsten und kühnsten Führern und Feldherrn hat es den Deutschen nie gemangelt – nur daß diesen oftmals die Deutschen fehlten. Aber ob es möglich ist, der deutschen Tapferkeit jene neue Richtung zu geben, wird mir immer zweifelhafter und, nach dem Kriege, täglich unwahrscheinlicher; denn ich sehe, wie jedermann überzeugt ist, daß es eines Kampfes und einer solchen Tapferkeit gar nicht mehr bedürfe, daß vielmehr das meiste so schön wie möglich geordnet und jedenfalls alles, was not tut, längst gefunden und getan sei, kurz daß die beste Saat der Kultur überall teils ausgesät sei, teils in frischem Grün und hier und da sogar in üppiger Blüte stehe. Auf diesem Gebiete gibt es nicht nur Zufriedenheit; hier gibt es Glück und Taumel. Ich empfinde diesen Taumel und dieses Glück in dem unvergleichlich zuversichtlichen Benehmen der deutschen Zeitungsschreiber und Roman-, Tragödien-, Lied- und Historienfabrikanten: denn dies ist doch ersichtlich eine zusammengehörige Gesellschaft, die sich verschworen zu haben scheint, sich der Muße- und Verdauungsstunden des modernen Menschen, das heißt seiner »Kulturmomente« zu bemächtigen und ihn in diesen durch bedrucktes Papier zu betäuben. An dieser Gesellschaft ist jetzt, seit dem Kriege, alles Glück, Würde und Selbstbewußtsein: sie fühlt sich, nach solchen »Erfolgen der deutschen Kultur«, nicht nur bestätigt und sanktioniert, sondern beinahe sakrosankt, spricht deshalb feierlicher, liebt die Anrede an das deutsche Volk, gibt nach Klassiker-Art gesammelte Werke heraus und proklamiert auch wirklich in den ihr zu Diensten stehenden Weltblättern einzelne aus ihrer Mitte als die neuen deutschen Klassiker und Musterschriftsteller. Man sollte vielleicht erwarten, daß die Gefahren eines derartigen Mißbrauchs des Erfolges von dem besonneneren und belehrteren Teile der deutschen Gebildeten erkannt, oder daß mindestens das Peinliche des gegebenen Schauspieles gefühlt werden müßte: denn was kann peinlicher sein, als zu sehen, daß der Mißgestaltete gespreizt wie ein Hahn vor dem Spiegel steht und mit seinem Bilde bewundernde Blicke austauscht. Aber die gelehrten Stände lassen gern geschehn, was geschieht, und haben selbst genug mit sich zu tun, als daß sie die Sorge für den deutschen Geist noch auf sich nehmen könnten. Dazu sind ihre Mitglieder mit dem höchsten Grade von Sicherheit überzeugt, daß ihre eigene Bildung die reifste und schönste Frucht der Zeit, ja aller Zeiten sei, und verstehn eine Sorge um die allgemeine deutsche Bildung deshalb gar nicht, weil sie bei sich selbst und den zahllosen Ihresgleichen über alle Sorgen dieser Art weit hinaus sind. Dem sorgsameren Betrachter, zumal wenn er Ausländer ist, kann es übrigens nicht entgehen, daß zwischen dem, was jetzt der deutsche Gelehrte seine Bildung nennt, und jener triumphierenden Bildung der neuen deutschen Klassiker ein Gegensatz nur in Hinsicht auf das Quantum des Wissens besteht: überall wo nicht das Wissen, sondern das Können, wo nicht die Kunde, sondern die Kunst in Frage kommt, also überall, wo das Leben von der Art der Bildung Zeugnis ablegen soll, gibt es jetzt nur eine deutsche Bildung – und diese sollte über Frankreich gesiegt haben?
Diese Behauptung erscheint so völlig unbegreiflich: gerade in dem umfassenderen Wissen der deutschen Offiziere, in der größeren Belehrtheit der deutschen Mannschaften, in der wissenschaftlicheren Kriegführung ist von allen unbefangenen Richtern und schließlich von den Franzosen selbst der entscheidende Vorzug erkannt worden. In welchem Sinne kann aber noch die deutsche Bildung gesiegt haben wollen, wenn man von ihr die deutsche Belehrtheit sondern wollte? In keinem: denn die moralischen Qualitäten der strengeren Zucht, des ruhigeren Gehorsams haben mit der Bildung nichts zu tun und zeichneten zum Beispiel die mazedonischen Heere den unvergleichlich gebildeteren Griechenheeren gegenüber aus. Es kann nur eine Verwechslung sein, wenn man von dem Siege der deutschen Bildung und Kultur spricht, eine Verwechselung, die darauf beruht, daß in Deutschland der reine Begriff der Kultur verlorengegangen ist.
Kultur ist vor allem Einheit des künstlerischen Stiles in allen Lebensäußerungen eines Volkes. Vieles Wissen und Gelernthaben ist aber weder ein notwendiges Mittel der Kultur, noch ein Zeichen derselben und verträgt sich nötigenfalls auf das beste mit dem Gegensatze der Kultur, der Barbarei, das heißt: der Stillosigkeit oder dem chaotischen Durcheinander aller Stile.
In diesem chaotischen Durcheinander aller Stile lebt aber der Deutsche unserer Tage: und es bleibt ein ernstes Problem, wie es ihm doch möglich sein kann, dies bei aller seiner Belehrtheit nicht zu merken und sich noch dazu seiner gegenwärtigen »Bildung« recht von Herzen zu freuen. Alles sollte ihn doch belehren: ein jeder Blick auf seine Kleidung, seine Zimmer, sein Haus, ein jeder Gang durch die Straßen seiner Städte, eine jede Einkehr in den Magazinen der Kunstmodehändler; inmitten des geselligen Verkehrs sollte er sich des Ursprunges seiner Manieren und Bewegungen, inmitten unserer Kunstanstalten, Konzert-, Theater- und Musenfreuden sich des grotesken Neben- und Übereinander aller möglichen Stile bewußt werden. Die Formen, Farben, Produkte und Kuriositäten aller Zeiten und aller Zonen häuft der Deutsche um sich auf und bringt dadurch jene moderne Jahrmarkts-Buntheit hervor, die seine Gelehrten nun wiederum als das »Moderne an sich« zu betrachten und zu formulieren haben; er selbst bleibt ruhig in diesem Tumult aller Stile sitzen. Mit dieser Art von »Kultur«, die doch nur eine phlegmatische Gefühllosigkeit für die Kultur ist, kann man aber keine Feinde bezwingen, am wenigsten solche, die, wie die Franzosen, eine wirkliche, produktive Kultur, gleichviel von welchem Werte, haben, und denen wir bisher alles, meistens noch dazu ohne Geschick, nachgemacht haben.
Hätten wir wirklich aufgehört, sie nachzuahmen, so würden wir damit noch nicht über sie gesiegt, sondern uns nur von ihnen befreit haben: erst dann, wenn wir ihnen eine originale deutsche Kultur aufgezwungen hätten, dürfte auch von einem Triumphe der deutschen Kultur die Rede sein. Inzwischen beachten wir, daß wir von Paris nach wie vor in allen Angelegenheiten der Form abhängen – und abhängen müssen: denn bis jetzt gibt es keine deutsche originale Kultur.
Dies sollten wir alle von uns selbst wissen: zudem hat es einer von den wenigen, die ein Recht hatten, es im Tone des Vorwurfs den Deutschen zu sagen, auch öffentlich verraten. »Wir Deutsche sind von gestern« sagte Goethe einmal zu Eckermann, »wir haben zwar seit einem Jahrhundert ganz tüchtig kultiviert, allein es können noch ein paar Jahrhunderte hingehen, ehe bei unseren Landsleuten so viel Geist und höhere Kultur eindringe und allgemein werde, daß man von ihnen wird sagen können, es sei lange her, daß sie Barbaren gewesen.«
2
Wenn aber unser öffentliches und privates Leben so ersichtlich nicht mit dem Gepräge einer produktiven und stilvollen Kultur bezeichnet ist, wenn noch dazu unsere großen Künstler diese ungeheure und für ein begabtes Volk tief beschämende Tatsache mit dem ernstesten Nachdruck und mit der Ehrlichkeit, die der Größe zu eigen ist, eingestanden haben und eingestehen, wie ist es dann doch möglich, daß unter den deutschen Gebildeten trotzdem die größte Zufriedenheit herrscht: eine Zufriedenheit, die, seit dem letzten Kriege, sogar fortwährend sich bereit zeigt, in übermütiges Jauchzen auszubrechen und zum Triumphe zu werden. Man lebt jedenfalls in dem Glauben, eine echte Kultur zu haben: der ungeheure Kontrast dieses zufriedenen, ja triumphierenden Glaubens und eines offenkundigen Defektes scheint nur noch den Wenigsten und Seltensten überhaupt bemerkbar zu sein. Denn alles, was mit der öffentlichen Meinung meint, hat sich die Augen verbunden und die Ohren verstopft – jener Kontrast soll nun einmal nicht dasein. Wie ist dies möglich? Welche Kraft ist so mächtig, ein solches »soll nicht« vorzuschreiben? Welche Gattung von Menschen muß in Deutschland zur Herrschaft gekommen sein, um so starke und einfache Gefühle verbieten oder doch ihren Ausdruck verhindern zu können? Diese Macht, diese Gattung von Menschen will ich bei Namen nennen – es sind die Bildungsphilister.
Das Wort Philister ist bekanntlich dem Studentenleben entnommen und bezeichnet in seinem weiteren, doch ganz populären Sinne den Gegensatz des Musensohnes, des Künstlers, des echten Kulturmenschen. Der Bildungsphilister aber – dessen Typus zu studieren, dessen Bekenntnisse, wenn er sie macht, anzuhören jetzt zur leidigen Pflicht wird – unterscheidet sich von der allgemeinen Idee der Gattung »Philister« durch einen Aberglauben: er wähnt selber Musensohn und Kulturmensch zu sein; ein unbegreiflicher Wahn, aus dem hervorgeht, daß er gar nicht weiß, was der Philister und was sein Gegensatz ist: weshalb wir uns nicht wundern werden, wenn er meistens es feierlich verschwört, Philister zu sein. Er fühlt sich, bei diesem Mangel jeder Selbsterkenntnis, fest überzeugt, daß seine »Bildung« gerade der satte Ausdruck der rechten deutschen Kultur sei: und da er überall Gebildete seiner Art vorfindet und alle öffentlichen Institutionen, Schul-, Bildungs- und Kunstanstalten gemäß seiner Gebildetheit und nach seinen Bedürfnissen eingerichtet findet, so trägt er auch überallhin das siegreiche Gefühl mit sich herum, der würdige Vertreter der jetzigen deutschen Kultur zu sein, und macht dementsprechend seine Forderungen und Ansprüche. Wenn nun die wahre Kultur jedenfalls Einheit des Stiles voraussetzt, und selbst eine schlechte und entartete Kultur nicht ohne die zur Harmonie eines Stiles zusammenlaufende Mannigfaltigkeit gedacht werden darf, so mag wohl die Verwechslung in jenem Wahne des Bildungsphilisters daher rühren, daß er überall das gleichförmige Gepräge seiner selbst wiederfindet und nun aus diesem gleichförmigen Gepräge aller »Gebildeten« auf eine Stileinheit der deutschen Bildung, kurz auf eine Kultur schließt. Er nimmt um sich herum lauter gleiche Bedürfnisse und ähnliche Ansichten wahr; wohin er tritt, umfängt ihn auch sofort das Band einer stillschweigenden Konvention über viele Dinge, besonders in betreff der Religions- und der Kunstangelegenheiten: diese imponierende Gleichartigkeit, dieses nicht befohlene und doch sofort losbrechende tutti unisono verführt ihn zu dem Glauben, daß hier eine Kultur walten möge. Aber die systematische und zur Herrschaft gebrachte Philisterei ist deshalb, weil sie System hat, noch nicht Kultur und nicht einmal schlechte Kultur, sondern immer nur das Gegenstück derselben, nämlich dauerhaft begründete Barbarei. Denn alle jene Einheit des Gepräges, die uns bei jedem Gebildeten der deutschen Gegenwart so gleichmäßig in die Augen fällt, wird Einheit nur durch das bewußte oder unbewußte Ausschließen und Negieren aller künstlerisch produktiven Formen und Forderungen eines wahren Stils. Eine unglückliche Verdrehung muß im Gehirne des gebildeten Philisters vor sich gegangen sein: er hält gerade das, was die Kultur verneint, für die Kultur, und da er konsequent verfährt, so bekommt er endlich eine zusammenhängende Gruppe von solchen Verneinungen, ein System der Nicht-Kultur, der man selbst eine gewisse »Einheit des Stils« zugestehen dürfte, falls es nämlich noch einen Sinn hat, von einer stilisierten Barbarei zu reden. Ist ihm die Entscheidung freigegeben zwischen einer stilgemäßen Handlung und einer entgegengesetzten, so greift er immer nach der letzteren, und weil er immer nach ihr greift, so ist allen seinen Handlungen ein negativ gleichartiges Gepräge aufgedrückt. An diesem gerade erkennt er den Charakter der von ihm patentierten »deutschen Kultur«: an der Nichtübereinstimmung mit diesem Gepräge mißt er das ihm Feindselige und Widerstrebende. Der Bildungsphilister wehrt in solchem Falle nur ab, verneint, sekretiert, verstopft sich die Ohren, sieht nicht hin, er ist ein negatives Wesen, auch in seinem Hasse und seiner Feindschaft. Er haßt aber keinen mehr als den, der ihn als Philister behandelt und ihm sagt, was er ist: das Hindernis aller Kräftigen und Schaffenden, das Labyrinth aller Zweifelnden und Verirrten, der Morast aller Ermatteten, die Fußfessel aller nach hohen Zielen Laufenden, der giftige Nebel aller frischen Keime, die ausdorrende Sandwüste des suchenden und nach neuem Leben lechzenden deutschen Geistes. Denn er sucht, dieser deutsche Geist! und ihr haßt ihn deshalb, weil er sucht, und weil er euch nicht glauben will, daß ihr schon gefunden habt, wonach er sucht. Wie ist es nur möglich, daß ein solcher Typus, wie der des Bildungsphilisters, entstehen und, falls er entstand, zu der Macht eines obersten Richters über alle deutschen Kulturprobleme heranwachsen konnte; wie ist dies möglich, nachdem an uns eine Reihe von großen heroischen Gestalten vorübergegangen ist, die in allen ihren Bewegungen, ihrem ganzen Gesichtsausdrucke, ihrer fragenden Stimme, ihrem flammenden Auge nur eins verrieten: daß sie Suchende waren, und daß sie eben das inbrünstig und mit ernster Beharrlichkeit suchten, was der Bildungsphilister zu besitzen wähnt: die echte, ursprüngliche deutsche Kultur. Gibt es einen Boden, schienen sie zu fragen, der so rein, so unberührt, von so jungfräulicher Heiligkeit ist, daß auf ihm und auf keinem anderen der deutsche Geist sein Haus baue? So fragend zogen sie durch die Wildnis und das Gestrüpp elender Zeiten und enger Zustände, und als Suchende entschwanden sie unseren Blicken: so daß einer von ihnen, für alle, im hohen Alter sagen konnte: »ich habe es mir ein halbes Jahrhundert lang sauer genug werden lassen und mir keine Erholung gegönnt, sondern immer gestrebt und geforscht und getan, so gut und so viel ich konnte«.
Was urteilt aber unsere Philisterbildung über diese Suchenden? Sie nimmt sie einfach als Findende und scheint zu vergessen, daß jene selbst sich nur als Suchende fühlten. Wir haben ja unsere Kultur, heißt es dann, denn wir haben ja unsere »Klassiker«, das Fundament ist nicht nur da, nein auch der Bau steht schon auf ihm gegründet – wir selbst sind dieser Bau. Dabei greift der Philister an die eigene Stirn.
Um aber unsere Klassiker so falsch beurteilen und so beschimpfend ehren zu können, muß man sie gar nicht mehr kennen: und dies ist die allgemeine Tatsache. Denn sonst müßte man wissen, daß es nur eine Art gibt, sie zu ehren, nämlich dadurch, daß man fortfährt, in ihrem Geiste und mit ihrem Mute zu suchen, und dabei nicht müde wird. Dagegen ihnen das so nachdenkliche Wort »Klassiker« anzuhängen und sich von Zeit zu Zeit einmal an ihren Werken zu »erbauen«, das heißt, sich jenen matten und egoistischen Regungen überlassen, die unsere Konzertsäle und Theaterräume jedem Bezahlenden versprechen; auch wohl Bildsäulen stiften und mit ihrem Namen Feste und Vereine bezeichnen – das alles sind nur klingende Abzahlungen, durch die der Bildungsphilister sich mit ihnen auseinandersetzt, um im übrigen sie nicht mehr zu kennen, und um vor allem nicht nachfolgen und weiter suchen zu müssen. Denn: es darf nicht mehr gesucht werden; das ist die Philisterlosung[1q].
Diese Losung hatte einst einen gewissen Sinn: damals als in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts in Deutschland ein so mannigfaches und verwirrendes Suchen, Experimentieren, Zerstören, Verheißen, Ahnen, Hoffen begann und durcheinanderwogte, daß dem geistigen Mittelstande mit Recht bange um sich selbst werden mußte. Mit Recht lehnte er damals das Gebräu phantastischer und sprachverrenkender Philosophien und schwärmerisch-zweckbewußter Geschichtsbetrachtung, den Karneval aller Götter und Mythen, den die Romantiker zusammenbrachten, und die im Rausch ersonnenen dichterischen Moden und Tollheiten achselzuckend ab, mit Recht, weil der Philister nicht einmal zu einer Ausschweifung das Recht hat. Er benutzte aber die Gelegenheit, mit jener Verschmitztheit geringerer Naturen, das Suchen überhaupt zu verdächtigen und zum bequemen Finden aufzufordern. Sein Auge erschloß sich für das Philisterglück: aus all dem wilden Experimentieren rettete er sich ins Idyllische und setzte dem unruhig schaffenden Trieb des Künstlers ein gewisses Behagen entgegen, ein Behagen an der eigenen Enge, der eigenen Ungestörtheit, ja an der eigenen Beschränktheit. Sein langgestreckter Finger wies, ohne jede unnütze Verschämtheit, auf alle verborgenen und heimlichen Winkel seines Lebens, auf die vielen rührenden und naiven Freuden, welche in der kümmerlichsten Tiefe der unkultivierten Existenz und gleichsam auf dem Moorgrunde des Philisterdaseins als bescheidene Blumen aufwuchsen.
Es fanden sich eigene darstellende Talente, welche das Glück, die Heimlichkeit, die Alltäglichkeit, die bäuerische Gesundheit und alles Behagen, welches über Kinder-, Gelehrten- und Bauernstuben ausgebreitet ist, mit zierlichem Pinsel nachmalten. Mit solchen Bilderbüchern der Wirklichkeit in den Händen suchten die Behaglichen nun auch ein für allemal ein Abkommen mit den bedenklichen Klassikern und den von ihnen ausgehenden Aufforderungen zum Weitersuchen zu finden; sie erdachten den Begriff des Epigonen-Zeitalters, nur um Ruhe zu haben und bei allem unbequemen Neueren sofort mit dem ablehnenden Verdikt »Epigonenwerk« bereit sein zu können. Eben diese Behaglichen bemächtigten sich zu demselben Zwecke, um ihre Ruhe zu garantieren, der Geschichte und suchten alle Wissenschaften, von denen etwa noch Störungen der Behaglichkeit zu erwarten waren, in historische Disziplinen umzuwandeln, zumal die Philosophie und die klassische Philologie. Durch das historische Bewußtsein retteten sie sich vor dem Enthusiasmus, – denn nicht mehr diesen sollte die Geschichte erzeugen, wie doch Goethe vermeinen durfte: sondern gerade die Abstumpfung ist jetzt das Ziel dieser unphilosophischen Bewunderer des nil admirari, wenn sie alles historisch zu begreifen suchen. Während man vorgab, den Fanatismus und die Intoleranz in jeder Form zu hassen, haßte man im Grunde den dominierenden Genius und die Tyrannis wirklicher Kulturforderungen; und deshalb wandte man alle Kräfte darauf hin, überall dort zu lähmen, abzustumpfen oder aufzulösen, wo etwa frische und mächtige Bewegungen zu erwarten standen. Eine Philosophie, die unter krausen Schnörkeln das Philisterbekenntnis ihres Urhebers koïsch verhüllte, erfand noch dazu eine Formel für die Vergötterung der Alltäglichkeit: sie sprach von der Vernünftigkeit alles Wirklichen und schmeichelte sich damit bei dem Bildungsphilister ein, der auch krause Schnörkeleien liebt, vor allem aber sich allein als wirklich begreift und seine Wirklichkeit als das Maß der Vernunft in der Welt behandelt. Er erlaubte jetzt jedem und sich selbst, etwas nachzudenken, zu forschen, zu ästhetisieren, vor allem zu dichten und zu musizieren, auch Bilder zu machen, sowie ganze Philosophien: nur mußte um Gotteswillen bei uns alles beim alten bleiben, nur durfte um keinen Preis an dem »Vernünftigen« und an dem »Wirklichen«, das heißt an dem Philister gerüttelt werden. Dieser hat es zwar ganz gern, von Zeit zu Zeit sich den anmutigen und verwegenen Ausschreitungen der Kunst und einer skeptischen Historiographie zu überlassen, und schätzt den Reiz solcher Zerstreuungs- und Unterhaltungsobjekte nicht gering; aber er trennt streng den »Ernst des Lebens«, soll heißen den Beruf, das Geschäft, samt Weib und Kind, ab von dem Spaß: und zu letzterem gehört ungefähr alles, was die Kultur betrifft. Daher wehe einer Kunst, die selbst ernst zu machen anfängt und Forderungen stellt, die seinen Erwerb, sein Geschäft und seine Gewohnheiten, das heißt also seinen Philisterernst antasten – von einer solchen Kunst wendet er die Augen ab, als ob er etwas Unzüchtiges sähe, und warnt mit der Miene eines Keuschheitswächters jede schutzbedürftige Tugend, nur ja nicht hinzusehen.
Zeigt er sich so beredt im Abraten, so ist er dankbar gegen den Künstler, der auf ihn hört und sich abraten läßt; ihm gibt er zu verstehen, daß man es mit ihm leichter und lässiger nehmen wolle, und daß man von ihm, dem bewährten Gesinnungsfreunde, gar keine sublimen Meisterwerke fordere, sondern nur zweierlei: entweder Nachahmung der Wirklichkeit bis zum Äffischen, in Idyllen oder sanftmütigen humoristischen Satiren, oder freie Kopien der anerkanntesten und berühmtesten Werke der Klassiker, doch mit verschämten Indulgenzen an den Zeitgeschmack. Wenn er nämlich nur die epigonenhafte Nachahmung oder die ikonische Porträttreue des Gegenwärtigen schätzt, so weiß er, daß die letztere ihn selbst verherrlicht und das Behagen am »Wirklichen« mehrt, die erstere ihm nicht schadet, sogar seinem Ruf als dem eines klassischen Geschmacksrichters förderlich ist, und im übrigen keine neue Mühe macht, weil er sich bereits mit den Klassikern selbst ein für allemal abgefunden hat. Zuletzt erfindet er noch für seine Gewöhnungen, Betrachtungsarten, Ablehnungen und Begünstigungen die allgemein wirksame Formel »Gesundheit« und beseitigt mit der Verdächtigung, krank und überspannt zu sein, jeden unbequemen Störenfried. So redet David Strauß, ein rechter satisfait unsrer Bildungszustände und typischer Philister, einmal mit charakteristischer Redewendung von »Arthur Schopenhauers zwar durchweg geistvollem, doch vielfach ungesundem und unersprießlichem Philosophieren«. Es ist nämlich eine fatale Tatsache, daß sich »der Geist« mit besonderer Sympathie auf die »Ungesunden und Unersprießlichen« niederzulassen pflegt, und daß selbst der Philister, wenn er einmal ehrlich gegen sich ist, bei den Philosophemen, die seinesgleichen zur Welt und zu Markte bringt, so etwas empfindet von vielfach geistlosem, doch durchweg gesundem und ersprießlichem Philosophieren.
Hier und da werden nämlich die Philister, vorausgesetzt, daß sie unter sich sind, des Weines pflegen und der großen Kriegstaten gedenken, ehrlich, redselig und naiv; dann kommt mancherlei ans Licht, was sonst ängstlich verborgen wird, und gelegentlich plaudert selbst einer die Grundgeheimnisse der ganzen Brüderschaft aus. Einen solchen Moment hat ganz neuerdings einmal ein namhafter Ästhetiker aus der Hegelschen Vernünftigkeits-Schule gehabt. Der Anlaß war freilich ungewöhnlich genug: man feierte im lauten Philisterkreise das Andenken eines wahren und echten Nicht-Philisters, noch dazu eines solchen, der im allerstrengsten Sinne des Wortes an den Philistern zugrunde gegangen ist: das Andenken des herrlichen Hölderlin, und der bekannte Ästhetiker hatte deshalb ein Recht, bei dieser Gelegenheit von den tragischen Seelen zu reden, die an der »Wirklichkeit« zugrunde gehen, das Wort Wirklichkeit nämlich in jenem erwähnten Sinne als Philister-Vernunft verstanden. Aber die »Wirklichkeit« ist eine andere geworden: die Frage mag gestellt werden, ob sich Hölderlin wohl in der gegenwärtigen großen Zeit zurechtfinden würde. »Ich weiß nicht«, sagte Fr. Vischer, »ob seine weiche Seele so viel Rauhes, das an jedem Kriege ist, ob sie soviel des Verdorbenen ausgehalten hätte, das wir nach dem Kriege auf den verschiedensten Gebieten fortschreiten sehen. Vielleicht wäre er wieder in die Trostlosigkeit zurückgesunken. Er war eine der unbewaffneten Seelen, er war der Werther Griechenlands, ein hoffnungslos Verliebter; es war ein Leben voll Weichheit und Sehnsucht, aber auch Kraft und Inhalt war in seinem Willen, und Größe, Fülle und Leben in seinem Stil, der da und dort sogar an Äschylus gemahnt. Nur hatte sein Geist zu wenig vom Harten; es fehlte ihm als Waffe der Humor; er konnte es nicht ertragen, daß man noch kein Barbar ist, wenn man ein Philister ist.« Dieses letzte Bekenntnis, nicht die süßliche Beileidsbezeigung des Tischredners geht uns etwas an. Ja, man gibt zu, Philister zu sein, – aber Barbar! Um keinen Preis. Der arme Hölderlin hat leider nicht so fein unterscheiden können. Wenn man freilich bei dem Worte Barbarei an den Gegensatz der Zivilisation und vielleicht gar an Seeräuberei und Menschenfresser denkt, so ist jene Unterscheidung mit Recht gemacht; aber ersichtlich will der Ästhetiker uns sagen: man kann Philister sein und doch Kulturmensch – darin liegt der Humor, der dem armen Hölderlin fehlte, an dessen Mangel er zugrunde ging.
Bei dieser Gelegenheit entfiel dem Redner noch ein zweites Geständnis: »Es ist nicht immer Willenskraft, sondern Schwachheit, was uns über die von den tragischen Seelen so tiefgefühlte Begierde zum Schönen hinüberbringt« – so ungefähr lautete das Bekenntnis, abgelegt im Namen der versammelten »Wir«, das heißt der »Hinübergebrachten«, der »durch Schwachheit Hinübergebrachten«! Begnügen wir uns mit diesen Geständnissen! Jetzt wissen wir ja zweierlei durch den Mund eines Eingeweihten: einmal, daß diese »Wir« über die Sehnsucht zum Schönen wirklich hinweg-, ja sogar hinübergebracht sind, und zweitens: durch Schwachheit! Eben diese Schwachheit hatte sonst in weniger indiskreten Momenten einen schöneren Namen: es war die berühmte »Gesundheit« der Bildungsphilister. Nach dieser allerneuesten Belehrung möchte es sich aber empfehlen, nicht mehr von ihnen als den »Gesunden« zu reden, sondern von den Schwächlichen oder, mit Steigerung, von den Schwachen. Wenn diese Schwachen nur nicht die Macht hätten! Was kann es sie angehen, wie man sie nennt! Denn sie sind die Herrschenden, und das ist kein echter Herrscher, der nicht einen Spottnamen vertragen kann. Ja, wenn man nur die Macht hat, lernt man wohl gar über sich selbst zu spotten. Es kam dann nicht viel darauf an, ob man sich eine Blöße gibt: denn was bedeckt nicht der Purpur! was nicht der Triumphmantel! Die Stärke des Bildungsphilisters kommt ans Licht, wenn er seine Schwachheit eingesteht: und je mehr und je zynischer er eingesteht, um so deutlicher verrät sich, wie wichtig er sich nimmt und wie überlegen er sich fühlt. Es ist die Periode der zynischen Philisterbekenntnisse. Wie Friedrich Vischer mit einem Worte, so hat David Strauß mit einem Buche Bekenntnisse gemacht: und zynisch ist jenes Wort und dieses Bekenntnisbuch.