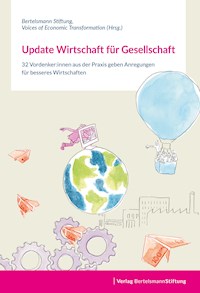
Update Wirtschaft für Gesellschaft E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Bertelsmann Stiftung
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor großen sozial-ökologischen Transformationsaufgaben. Hierzu bündelt die Publikation "Update Wirtschaft" vielfältige Ideen, Beispiele und Forderungen, die aus der betriebswirtschaftlichen Praxis stammen. Sie zeigt, wie ein besseres, nachhaltigeres Wirtschaften zum Wohl der Gesellschaft gelingen kann. 32 Vordenker:innen analysieren in ihren stilistisch unterschiedlichen Beiträgen, was Transformation für Unternehmen bedeutet. Sie entwickeln interdisziplinäre Lösungen für einen gesellschaftlichen Wandel, der in ihren Augen nur gelingen kann, wenn die Politik, die Wirtschaft und die Bürger:innen diesen gemeinsam gestalten. Zu Wort kommen motivierte junge Führungskräfte aus mittelständischen Betrieben sowie aus der Tech- und Start-up-Szene mit ihren progressiven Positionen. Die Autor:innen sind überwiegend weiblich und divers. Geübt über den Tellerrand des eigenen Betriebs zu schauen eint sie das Ziel, mit ihren Impulsen und gedanklichen Anregungen die Lust auf Veränderung und Vernetzung zu steigern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bertelsmann Stiftung,Voices of Economic Transformation (Hrsg.)
Update Wirtschaft für Gesellschaft
32 Vordenker:innen aus der Praxis geben Anregungen für besseres Wirtschaften
Die Herausgeber:innen:Rana Deep Islam • Sven Liebert • Julia Scheerer • Christian Schilcher
Inhalt
Vorwort
Hubertus Heil, MdB, Bundesminister für Arbeit und Soziales
Einleitung
Plädoyers für gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell in der Modeindustrie
Carl Warkentin, Gründer und Geschäftsführer, Monaco Ducks
Wir müssen Verantwortung übernehmen – für uns und andere!
Ryan Holowka, Head of CSR, Peek & Cloppenburg
Der deutsche Mittelstand – eine Laudatio auf die verborgenen Held:innen unserer Gesellschaft
Lencke Wischhusen, Unternehmerin und Politikerin
Geld und Finanzen für eine gerechtere Gesellschaft
ESG – Bankenrevolution oder Mythos?
Maya Hennerkes, Direktorin für grüne Finanzsysteme, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)
Wie privates Kapital die Welt verändern kann
Impact Investing in Entwicklungsländern als Marktplatz für zukunftstaugliches Weltwirtschaftswachstum
Bianca C. Perina, Investment Finance Manager, Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB)
Vertrauen in neue Technologien durch gemeinsame Regulierung
Sujata Wirsching, Senior Policy Advisor, Gruppe Deutsche Börse
Finanzkriminalität als Gefahr für eine nachhaltigere und gerechtere Wirtschaftswelt
Stefan Raul, Internal Auditor, Siemens; Thomas Seidel, Senior Manager Sopra Steria & Gründer antifinancialcrime.org
Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels
Digital ist besser!
Sechs Lektionen für ein digitales Deutschland und eine zukunftsfähige Gesellschaft
Sina Kaja Frank, Head of State & Local Government Affairs Germany, Cisco Systems GmbH
Datentransparenz statt Angst
Janina Mütze, Gründerin und Geschäftsführerin, Civey GmbH
Ich traue meinen Augen nicht
Deepfakes oder wie wir einer drohenden Infokalypse begegnen können
Stefanie Valdés-Scott, Head of Government Relations Central Europe, Adobe
Die plattformbasierte Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung
Alexander Schellinger, Leiter Entwicklung Versorgungsmanagement, TK
Wirtschaft und Politik gemeinsam für Umwelt- und Klimaschutz
Upgrade Europa
Mit dem European Green Deal und Innovationen made in EU die Welt retten
Daniel Sahl-Corts, Director und Gobal Sustainability Lead Public, Capgemini Gruppe
Umdenken: Wie ein neuer Unternehmergeist den Unterschied macht
Caroline Heil, Vorständin, The New Meat Company
Prototypen der Mobilitätswende
Daniela Blaschke, Public Affairs and Innovation Strategist, Volkswagen Group Japan
Social Mobility Hub
Klimaneutrale Mobilität zwischen neuer Arbeit, urbaner Gesundheit und Community Building
Martha Marisa Wanat, geschäftsführende Gesellschafterin MOND – Mobility New Designs, BICICLI Holding GmbH
Nachhaltigkeit und Smart City
Tobias Schock, Referent Wirtschaftsförderung, Gemeinde Kirchheim bei München
Unternehmenspraxis zu Gleichberechtigung, Vielfalt und Verständigung
Chancengleichheit dringend gesucht
Mehr soziale Diversität bringt Wirtschaft und Gesellschaft voran
Natalya Nepomnyashcha, Gründerin, »Netzwerk Chancen«; Vivien Götz, freie Journalistin
Gut fürs Geschäft und wichtig für die Gesellschaft
Zur Notwendigkeit, DE&I ganzheitlich zu betrachten
Constanze Osei, Head of Society and Innovation Policy, Meta
Gender-Parity
Von der Frauenförderung zur echten Chancengerechtigkeit
Sofia Strabis, Leitung Diversity and Inclusion Management, Commerzbank AG
Let people be!
Wie Vertrauen Organisationen beflügelt
Jan Saarmann, Digital Marketing Manager, Comspace
Vor dem Monitor sind alle gleich
Wie Corona den klassischen Führungsstil herausfordert
Victoria Nguyen, Manager Economic Policy & Regulation, Amazon Deutschland GmbH
Mehr Mut und Authentizität sind gefragt
Dominik Cziesche, Kommunikationsberater
Missverstehen wir uns richtig!
Über die Notwendigkeit gelingender Verständigung in Gesellschaft und Ökonomie
Philipp Hommelsheim, Co-Founder, Camino
Reflexionen zur Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft
Die Frage nach dem tieferen Sinn
Über die befähigende Rolle von Purpose für eine nachhaltige Wirtschaft
Rana Deep Islam, Management Consultant & Public Sector Expert
Nachhaltigkeitsgenerationen im Unternehmen
Wie bei vielen Wahrheiten eine gemeinsame Linie gelingen kann
Céline Bilolo, Senior Manager Sustainable Development & Making More Health, Boehringer Ingelheim
Hinterzimmer ade!
Zur notwendigen Weiterentwicklung der verantwortlichen Interessenvertretung von Unternehmen
Sven Liebert, Head of Public Policy Germany, METRO AG
Konsum verringern!
Suffizienzorientierte Wirtschaft statt Old Economy
Katharina Reuter, Geschäftsführerin, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft BNW e.V.
New Work bedeutet, neue und alte Mitbestimmung mitzudenken
Alice Greschkow, Autorin, Beraterin zu Zukunft der Arbeit
Von der Wirtschaft lernen: Ein neues Betriebssystem für die Verwaltung
Kassandra Becker, Co-Founder, work forward; René Lange, Venture Lead Installment Loans, Hypoport SE
Anhang
Civey-Begleitbefragung
Die Autor:innen
Abstract
Impressum
Vorwort
Wir leben in Zeiten der Transformation. Es ist ein Wandel, der inzwischen so gut wie alle Bereiche unseres Alltags umfasst: wie wir arbeiten, uns fortbewegen, wie wir zusammenleben und kommunizieren.
Die meisten dieser Entwicklungen sind längst globaler Natur. Digitalisierung und Klimawandel sind ebenso weltweite Phänomene wie Ressourcenknappheit oder Migration. Ihre Gleichzeitigkeit bringt enormen Veränderungsdruck mit sich – besonders für die Wirtschaft. Denn Wirtschaft ist Gesellschaft – heute mehr denn je.
Noch vor 20 Jahren war Massenarbeitslosigkeit die größte Herausforderung am Arbeitsmarkt. Heute ist die Situation eine andere. Statt Arbeitsplätze fehlen vielerorts Arbeitskräfte, vor allem Fachkräfte. Im Februar 2022 wurde ein Rekordhoch bei der Zahl der offenen Stellen in Deutschland gemeldet. Bundesweit blieben fast 1,7 Millionen Stellen im vierten Quartal 2021 unbesetzt – der höchste je gemessene Wert seit 1989.
Fast alle Branchen suchen neues Personal – vom Einzelhandel bis zum Technologiekonzern. Ich bin überzeugt: Die Personalfrage wird für Unternehmen in Zukunft zur Existenzfrage. Benötigt wird deshalb vor allem eine Veränderung der Unternehmens- und Arbeitskultur, um Fachkräfte auszubilden, zu halten, zu qualifizieren und an das eigene Unternehmen zu binden.
Vier Dinge, die es dafür braucht:
1. Gute Arbeitsbedingungen
Was früher manchem als Kür erschien, ist heute längst Pflicht. Dabei geht es nicht nur um den ergonomischen Schreibtisch oder das subventionierte Mittagessen. Es geht um echte Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, gehört ebenso dazu, wie flexible Arbeitszeitmodelle, die Kita-Öffnungszeiten oder um häusliche Pflege abzubilden. Arbeit muss zum Leben passen – nicht umgekehrt. Der Dreh- und Angelpunkt guter Arbeitsbedingungen sind gute Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Deshalb wird diese Bundesregierung auch weiterhin die Sozialpartnerschaft stärken.
2. Gute Führung, gutes Team
Menschen verlassen Führungskräfte – nicht Unternehmen. Der cholerische und permanent kontrollierende Chef hat ausgedient. Wertschätzung, eine gute Feedback- und Fehlerkultur sowie echtes Teamwork sind für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft wichtiger als ein höheres Gehalt. Und wir brauchen diverse Teams. Mit der Bildungszeit wollen wir für mehr Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt sorgen. Es darf keine Rolle spielen, welches Geschlecht man hat, woher man kommt, woran man glaubt oder wen man liebt. Ein Team ist umso besser, je mehr unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen.
3. Betriebliche Mitbestimmung
Teamwork gilt ebenfalls beim Thema »betriebliche Mitbestimmung«. Sie sorgt für ein faires Miteinander und die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das mehr soziale Sicherheit. Wir wollen dafür sorgen, dass auch neue, plattformbasierte Geschäftsmodelle, die durch die Digitalisierung entstehen, sozial abgesichert werden. Ein Anliegen dieser Regierung ist, die Digitalisierung und ihre Auswirkungen sozial zu begleiten. Etwa bei der Frage von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz. Auch hier müssen die Beschäftigten mitgenommen werden. Denn Technologie muss dem Menschen dienen – nicht umgekehrt.
4. Qualifizierung
Aus- und Weiterbildung sind der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit im Strukturwandel und zentral für das Thema »Fachkräftesicherung«. Wir wollen daher die berufliche Ausbildung stärken, zum Beispiel mit einer Ausbildungsgarantie. Außerdem ermöglichen wir mit der Bildungszeit mehr Selbstbestimmung bei der Karriereplanung. Damit unterstützen wir auch eine Umorientierung hin zu den Jobs von morgen.
In dem vorliegenden Buch werden viele dieser Gedanken aufgegriffen. 32 Vordenkerinnen und Vordenker analysieren in unterschiedlichsten Beiträgen, was Transformation für Unternehmen bedeutet, und entwickeln Ideen, wie besseres Wirtschaften zum Wohl der Bevölkerung gelingen kann. Auch die neue Ampel-Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP stellt in ihrem Koalitionsvertrag den Wandel in den Mittelpunkt. Sie ist ein Bündnis für Fortschritt.
Wir sorgen dafür, dass die dringend erforderliche ökologisch-industrielle Transformation zum Schutze unseres Klimas einhergeht mit guter Arbeit und sozialer Sicherheit. Wir nutzen und gestalten die Möglichkeiten der digitalen Arbeitswelt und geben allen die Chance, daran teilzuhaben. Wir verbinden beim Einsatz digitaler Technologien den volkswirtschaftlichen Mehrwert mit einem individuellen Mehrwert der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das machen wir im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das machen aber auch viele der Unternehmen, um die es in diesem Buch geht.
Und genau diesen Schulterschluss braucht es jetzt, um die anstehenden Veränderungen zu meistern. Die ökologische Transformation wird nur gelingen, wenn auch die soziale gelingt, die digitale nur, wenn sie dem Menschen dient. Und die gesellschaftliche Transformation gelingt nur, wenn wir sie zusammen gestalten: die Politik, die Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
HUBERTUS HEIL
MdB, Bundesminister für Arbeit und Soziales
Einleitung
Wirtschaft und Gesellschaft sind untrennbar miteinander verflochten. Daher ist es essenziell, wirtschaftliche, soziale und politische Themen ganzheitlich zu denken. Von Unternehmen wird immer stärker erwartet, dass sie zu gesellschaftlichen Herausforderungen eine Haltung einnehmen. Ihre gesellschaftspolitische Verantwortung erschöpft sich allerdings nicht darin, Stellung zu beziehen bzw. sich zu positionieren, während die Verantwortung zum Gestalten an Politik und Zivilgesellschaft delegiert wird. Die Wirtschaft und die Gesellschaft stehen vor großen sozial-ökologischen Transformationsaufgaben. Hierzu können und sollten Unternehmen Ideen entwickeln, mit Maßnahmen vorangehen und zeigen, wie besseres, nachhaltigeres Wirtschaften zum Wohl der Gesellschaft gelingen kann.
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit einer Wirtschaft, die im Sinne der Gesellschaft handelt. Es versammelt Ideen, Beispiele und Forderungen, die in erster Linie aus den Erfahrungen der betriebswirtschaftlichen Praxis stammen.
Wie alles begann …
Die Idee zum Buch hat sich im Austausch diverser Menschen in privaten und beruflichen Netzwerken entwickelt und aus der Überlegung, motivierte junge Leute aus dem Wirtschaftskontext mit progressiven Positionen zu Wort kommen zu lassen. Als selbstorganisierte Gruppe, die sich unabhängig von vorgegebenen Strukturen einbringen und gemeinsam wirken möchte, entstand für das Buchprojekt die Initiative »Voices of Economic Transformation«.
… und wer sich gefunden hat
In diesem Band wenden sich vielfältige Stimmen aus der Wirtschaft bzw. der betrieblichen Praxis direkt an die Leser:innen. Die Autor:innen sind in erster Linie junge Führungskräfte, wie etwa Direktor:innen oder Abteilungsleiter:innen und Senior Manager:innen aus Großkonzernen, aus mittelständischen Betrieben sowie aus der Tech- und Start-up-Szene. Sie sind jung – an Lebensjahren und vor allem im Denken. Sie sind überwiegend weiblich und divers und sie eint besonders eines: Sie schauen über den Tellerrand des eigenen Betriebes und sie möchten grundsätzliche Veränderungen bewirken.
Die thematischen Hintergründe
Eine traditionelle Säule des gesellschaftspolitischen Engagements von Unternehmen sind Spenden und karitative Beiträge oder die Gründung gemeinnütziger Unternehmensstiftungen. Diese Aktivitäten des Unternehmens als »corporate citizen« wurden in der Theorie und Praxis der Unternehmensverantwortung unter dem breiteren Dach der Corporate Social Responsibility (CSR) zusammengeführt. Zu den bisherigen CSR-Aktivitäten in Deutschland gibt es kritische Einschätzungen. Diese besagen, CSR sei in der Vergangenheit von Unternehmen bzw. deren Kommunikationsabteilungen eher als Pflichtaufgabe – bzw. als Berichterstattungsaufgabe – abgehandelt worden, statt sie als vorstandsrelevant oder gar als Teil der strategischen Unternehmenssteuerung zu sehen.
Doch die Einschätzungen zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen unterliegen neuen Dynamiken – aus diesen Gründen:
Die Größe und die Dringlichkeit globaler Herausforderungen sind nicht mehr zu übersehen. Ein starkes Wachstum der Weltbevölkerung, begleitet von dem permanenten Anstieg des Ressourcenverbrauchs und der steigenden Nachfrage nach öffentlichen Gütern vor dem Hintergrund planetarer Grenzen, eine immer größere Kluft zwischen Privilegierten und Schlechtergestellten, Populismus, politische Autoritarismen und die Schwächung internationaler Organisationen: All das verstärkt die Problematik des Klimawandels, verschärft die Ungleichheit und erhöht die Gefahren für freiheitlich demokratische Gesellschaftsordnungen. Diese Herausforderungen sind so gravierend, dass sie ein umfassendes und gemeinschaftliches Handeln dringend erfordern. Die großen Fragen des 21. Jahrhunderts benötigen Antworten aller gesellschaftlichen Sektoren: aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – und Unternehmen sind hier ausdrücklich mitgemeint.
Die sozial-ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist mittlerweile politisch gewollt und öffentlich legitimiert. Das Pariser Abkommen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, wurde durch das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung 2021 gesetzlich festgeschrieben. Die Europäische Union will mittels des EU Green Deal der erste klimaneutrale Kontinent werden und unter anderem mit der EU-Taxonomieverordnung die Wirtschaft – und damit jedes einzelne Unternehmen – beeinflussen.
Viele Firmenlenker:innen haben erkannt, dass die Geschäftstätigkeit ihres Betriebes sich nicht unabhängig von diesen gesellschaftspolitischen Entwicklungen abspielt. Über die Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft nachzudenken und unternehmerische Antworten für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln, sind daher kein betriebliches »nice to have«, sondern gehören zu einer langfristigen, klugen und verantwortungsbewussten Unternehmensführung. Wenn erreicht werden soll, dass ökonomisches Wachstum sich mit sozialem und ökologischem Nutzen verbindet und das Wohlergehen von Menschen, das gesellschaftliche Zusammenleben und der Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen in das Zentrum von Wirtschaften rücken, dann stehen Unternehmen vor der Aufgabe, ihre Geschäftsmodelle und ihre License to Operate gründlich zu überdenken.
Gemeinsam vorausdenken
Dieser Sammelband befasst sich mit den verschiedenen Aspekten verantwortungsvollen Wirtschaftens. Die Beiträge geben Impulse, formulieren mitunter Forderungen und regen an, über notwendige Veränderungen in und für Unternehmen zu diskutieren.
Die Beiträge sind äußerst vielfältig und unterscheiden sich auch stilistisch. Zum Teil sind sie persönlich, zum Teil eher analytisch formuliert, manche sind starke Aufrufe, andere geben eher Einblicke. Allen gemeinsam ist, dass sie nicht bei Problembeschreibungen stehen bleiben, sondern immer auch Lösungsideen entwickeln. Es geht nie nur um den Status quo, sondern immer auch um die Zukunft. Und es geht stets um die Frage, was verantwortliches Wirtschaften im Kontext einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung konkret heißen kann.
Um die Fragen nach notwendigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen beantworten zu können, braucht es Ideen und Austausch. Beides soll dieses Buch anregen – und das nicht nur durch seine Inhalte, sondern auch durch seine Form.
Wissen teilen und mehren
Um eigene Gedanken zu entwickeln, lässt das Buch genügend Raum für Notizen: Die Leser:innen sollen ihre guten Ideen sofort notieren können. Auch das Design und die Illustrationen regen, neben dem geschriebenen Wort, zu weiterführenden Ideen an.
Gegliedert ist der Band in sechs Abschnitte. Diese fassen die 29 Beiträge der 32 Autor:innen unter folgenden Themen zusammen:
Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
Geld und Finanzen für eine gerechtere Gesellschaft
Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels
Beiträge von Wirtschaft zu Umwelt- und Klimaschutz
Gleichberechtigung, Vielfalt und Verständigung in Unternehmen
Die Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft und neue Organisationsstrukturen
Wir möchten wirtschaftspolitisch interessierte Menschen in und außerhalb von Unternehmen erreichen – in der Politik, der Zivilgesellschaft, in Verbänden, der Öffentlichkeit und in den Medien. All diejenigen, denen an interdisziplinären Lösungen für ein besseres Wirtschaften von guten Unternehmen in einer nachhaltigen Gesellschaft liegt, sollen sich angesprochen fühlen.
Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Neue Ideen bilden sich in einem Prozess, in den Anregungen von anderen einfließen, und gute Debatten profitieren von Meinungen, die gehört und diskutiert werden.
Die Beiträge stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Das gibt uns und den Leser:innen die Möglichkeit, sie weiterzugeben, über Social Media zu kommunizieren, für Blogs zu nutzen und Ähnliches. Daher gibt es dieses Buch nicht nur als gedruckte Ausgabe, sondern auch als Online-Veröffentlichung.
Wie auch immer Sie diesen Band lesen und nutzen: Er regt Sie hoffentlich zu neuen Ideen und Gedanken an und steigert die Lust auf Veränderung und Vernetzung.
Für die Herausgeber:innen:
Sven Liebert, Julia Scheerer und Christian Schilcher
RANA DEEP ISLAM
SVEN LIEBERT
JULIA SCHEERER
CHRISTIAN SCHILCHER
Plädoyers für gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die wir für unser Leben benötigen oder die es bequemer gestalten oder uns schlicht erfreuen. Indem Unternehmen diese Produkte und Dienstleistungen anbieten, vermehren sie Geld. Und das ist ihr einziger Zweck. Die dabei entstehenden Kosten werden weitgehend der natürlichen Umgebung oder den Menschen, die für die Erstellung zuständig sind, angelastet – sprich: externalisiert. Stark verkürzt ist das eine gängige Vorstellung dessen, welche Rolle ein Unternehmen in der Gesellschaft spielt. Die Beiträge dieses Kapitels zeigen, wie die gegenteilige Praxis unternehmerischer Aktivitäten aussehen kann, sich mit Gutem für Umwelt und Gemeinschaft Geld verdienen lässt und wie gesellschaftspolitische Positionierung sich auszahlt.
Eindrucksvoll zeigt Carl, dass nachhaltige Unternehmen heute im Trend sind und warum es sich lohnt, aus persönlicher Überzeugung ein Unternehmen zu gründen, das Nachhaltigkeit und Stil verbindet.
Ryan schreibt aus der Perspektive eines für Nachhaltigkeit verantwortlichen Managers, wie wichtig es ist, dass Unternehmen und Politik die Klimakrise endlich ernst nehmen und die bestehenden Herausforderungen gemeinsam lösen. Er fordert starke Anreizstrukturen für nachhaltiges Handeln und harte Sanktionen bei Zuwiderhandlung.
Lencke widerspricht den Vorurteilen, die gegenüber Unternehmen bestehen, und argumentiert dafür, insbesondere die meist über Generationen geführten mittelständischen Unternehmen differenzierter zu betrachten. Unternehmensgründungen zu erleichtern und Arbeitskräfte flexibler einzusetzen – auch über die Organisationsgrenzen eines einzelnen Unternehmens hinweg –, sind für sie zentrale Stellhebel, damit Unternehmen entstehen können, die Mehrwert für die Gesellschaft bieten.
Leser:innen sind nach der Lektüre dieses Kapitels mindestens inspiriert, wenn nicht sogar emotional berührt.
Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell in der Modeindustrie
CARL WARKENTIN
Carl Warkentin betrieb nach dem Studium in Deutschland, den USA und Italien die Digitalisierung eines deutschen Anlagenbauers und unterstützte den Aufbau eines digitalen Konzernbereichs mit 1.600 Mitarbeitenden. Zudem gründete er Unternehmen in Kalifornien und investierte selbst in Technologie-Start-ups. 2017 gründete er das Sneaker-Unternehmen Monaco Ducks, das – in einem der giftigsten Industriezweige – führend im Bereich Kreislaufwirtschaft ist und auch industrieübergreifend Maßstäbe setzt.
Abstract: Nachhaltiger Konsum, ohne auf die schönen Dinge im Leben zu verzichten. Ob das geht, welche Verantwortung Politik, Unternehmen und Konsument:innen in der heutigen Gesellschaft übernehmen und wie wir unser Verhalten den nächsten Generationen gegenüber rechtfertigen – davon handelt dieser Beitrag.
Ich kenne viele Menschen, die ihren Hausmüll trennen, bei Inlandsreisen Zug fahren, statt das Auto oder den Flieger zu nehmen, die Bioprodukte im Supermarkt bevorzugen und hochwertige Mode gegenüber Fast Fashion. Auch ich bin überzeugt, sehr nachhaltig zu leben und bewusst mit den Ressourcen unserer Welt umzugehen. Doch wenn man ganz ehrlich ist, muss man sich eingestehen, dass man nicht alles weiß. Konsument:innen können oft nicht wissen, wie etwas hergestellt wurde oder auf welche Faktoren zu achten ist. So bieten etwa Fast-Fashion-Konzerne Produkte aus recycelten Stoffen an, man kann sogar seine Altkleider dort zum Recyceln abgeben und erhält Rabatt auf den nächsten Einkauf. Da muss man sich ja wohlfühlen.
Gerne greift man auch zu Produkten, die aus recyceltem PET (Polyethylenterephthalat) bestehen. Doch viele wissen gar nicht, dass es mehr solcher Produkte gibt, als es PET gibt. Entsprechend wird extra PET produziert – nur um es anschließend recyceln zu können. Ein anderes Beispiel sind vegane Produkte, wie Sneaker aus veganem Obermaterial. Dabei bedeutet vegan oft auch Rohöl, ist also nicht automatisch besser und nachhaltiger. Wer genau hinsieht, erkennt, wann es sich um einen Marketingtrick handelt und kein nachhaltiges Konzept dahintersteht. Der Begriff »Nachhaltigkeit« wird mittlerweile so inflationär verwendet, dass es für tatsächlich nachhaltige Unternehmen schwer wird, glaubwürdig zu bleiben.
Der Teufel steckt im Detail …
… und irgendwie auch im Menschen. Wir wollen nämlich gerne nachhaltig und bewusst leben, aber verzichten möchten wir eigentlich auf nichts. So kommt es auch, dass wir als reiche Industrieländer die Umwelt viel mehr belasten als arme Schwellenländer – obwohl das nicht direkt ersichtlich ist. Denn wenn man in Entwicklungsländern unterwegs ist, kann man kaum glauben, welche umweltschädlichen Autos auf der Straße fahren, wie klimaschädlich gebaut, geheizt und gekühlt wird oder wie sorglos mit Plastiktüten um sich geworfen wird. Die Sorgen sind dort ganz andere, als den Planeten zu schützen – und dennoch sind wir Industrieländer das eigentliche Problem. Denn in entwickelten Ländern wird deutlich mehr konsumiert. In unserer Gesellschaft ist es beinahe unmöglich, wirklich nachhaltig zu leben, ohne anzuecken.
Nachhaltige Mode klingt gut, muss aber auch gut aussehen. Lokales Biofleisch klingt gut, muss aber bezahlbar sein. So kommt es, dass wir gerne auf die Marketingtricks der Konzerne reinfallen und darauf bauen, dass in Deutschland und Europa schon alles seine Richtigkeit hat. »Alles andere wäre ja nicht erlaubt.« Doch gibt es viele Unternehmen, die auch hier Produkte vertreiben, welche unter schlimmsten Bedingungen und mithilfe von Kinderarbeit produziert werden. Nur damit wir noch ein T-Shirt für vier Euro im Schrank liegen haben, das wir wahrscheinlich niemals tragen werden. Denn statistisch gesehen tragen die Deutschen einen Großteil ihrer Kleidung nicht ein einziges Mal.
Spricht man über Nachhaltigkeit, kommen Fast-Fashion-Unternehmen nicht gut weg. Sofort fallen uns die schwarzen Schafe aus der Industrie ein. Dennoch wird die Verantwortung für nachhaltigen Konsum den Konsument:innen zugerechnet. Nach dem Motto, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Doch an der Kasse hört die Moral oft auf. Wer ist nun also verantwortlich? Am Ende alle. Doch meiner Meinung nach kann man die alleinige Verantwortung nicht dem Einzelnen übertragen. Ich denke, dass Politik sowie Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Dabei denke ich nicht daran, dass die Politik zahllose Restriktionen und Steuererhöhungen einführen soll. Dennoch muss Politik lenken. Negative Effekte von Produkten müssen steuerlich eingepreist werden, damit die Innovation von nachhaltigen Produkten unterstützt wird. Unternehmen müssen ihre eigenen Leistungskennzahlen überdenken. Statt als einzig relevante Kennzahl den Gewinn zu optimieren, sollte auch der ökologische Fußabdruck eine Rolle spielen. Es muss möglich und unternehmerisch spannend sein, anständige Produkte zu produzieren und allen zugänglich zu machen.
Alle gängigen Praktiken der Modeindustrie hinterfragen
Vor fünf Jahren habe ich mit einem Freund ein eigenes Schuh-Modeunternehmen gegründet. Wir kannten uns vorher nicht in der Industrie aus, hatten keine Beziehungen in dem Markt und keine Ahnung, wie man einen Schuh produziert. Uns hat vielmehr die Herausforderung als Unternehmer gereizt, eine Industrie zu innovieren, die jahrzehntelang keine Innovation vorangebracht hat und die der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt ist, direkt nach der Ölindustrie.
Unser Unternehmen ist intelligent aufgestellt und hinterfragt alle gängigen Praktiken der Modeindustrie. Wichtig ist uns dabei nicht nur, nachhaltige Obermaterialien zu verwenden oder irgendwo einen Prozentsatz recycelte Materialien zu nutzen. All unsere Produkte und unser Unternehmen sind klimaneutral. Das bedeutet, dass wir von allen verwendeten Materialen wissen, woher sie kommen und wie klimaschädlich bzw. -freundlich sie sind. Auch die Produktionsstätten und Lieferwege werden unter die Lupe genommen. Hier gehört auch dazu, wie die Mitarbeiter:innen von uns oder unseren Manufakturen zur Arbeit fahren, welcher Strom verwendet und wie geheizt wird und wie viele Computer im Einsatz sind. Sobald alle Daten erhoben sind, wissen wir genau, wie viele Emissionen wir in Umlauf bringen, und können diese mit Unterstützung klimafreundlicher Projekte neutralisieren.
Das ist aber nur der erste Schritt, denn dieser Prozess zeigt uns, wo die meisten Schadstoffe entstehen, beispielsweise auf langen Transportwegen oder beim Sohlenmaterial für Sneaker. Im nächsten Schritt können wir diese Bereiche angehen und nachhaltigere Lösungen finden. So sind wir etwa dabei, mit Partnerfirmen komplett nachhaltige, biologisch abbaubare Sohlen zu entwickeln oder vegane Stoffe, für die man kein Rohöl verwenden muss. Denn auch hier wissen viele Konsument:innen nicht, dass vegan nicht immer nachhaltiger ist.
Unser Unternehmen denkt aber auch hier noch weiter. Viele einzelne Komponenten von Schuhen können zwar so produziert werden, dass sie biologisch abbaubar sind, doch der Schuh müsste dann aufwendig auseinandergenommen und in die einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Daher arbeiten wir an Konzepten wie dem modularen Schuh, sodass die Sohle sich beispielsweise leicht vom Obermaterial lösen lässt. Somit können die Kund:innen einzelne Komponenten austauschen. Am Ende seines Lebenszyklus kann der Schuh einfach in alle Komponenten zerlegt und jede Komponente kann recycelt oder abgebaut werden. Aktuell arbeiten wir an einem Konzept inklusive des sogenannten Take-Back-Service und treiben das Thema »Kreislaufwirtschaft« (Circular Economy) in der Modeindustrie voran. Hier arbeiten wir mittlerweile auch industrieübergreifend mit anderen großen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen zusammen, wie etwa der Automobilindustrie.
Wichtig ist, dass nicht nur das Produkt, sondern auch das Geschäftsmodell nachhaltig ist. So trägt die Überproduktion einen erheblichen Teil zur Umweltbelastung bei. Luxusunternehmen verbrennen häufig ihre Produkte, damit diese nicht im Schlussverkauf landen. Andere Unternehmen produzieren eigens für den Schlussverkauf Ware – oft in verminderter Qualität. So wird das Produkt dann indirekt vom Kunden entsorgt, indem er es nie oder nur für kurze Zeit trägt. In unserem Unternehmen können wir dank kurzer Produktionszyklen on demand, also auf Nachfrage, nachproduzieren. Das bedeutet einen positiven Cashflow fürs Unternehmen und belastet nicht die Umwelt.
In diesem Sinne hinterfragen wir alle gängigen Prinzipien der Modeindustrie. Der Grundstein für unseren Erfolg und die Voraussetzung für unser nachhaltiges Geschäftsmodell ist, ebenso ressourcen- wie kosteneffizient zu arbeiten.
Mit dem eigenen Unternehmen ein Zeichen setzen
Als Unternehmer, aber auch mit unserer Schuhmarke möchten wir keinesfalls belehrend wirken. Vielmehr möchten wir Gutes tun, ein anständiges Produkt anbieten, das wirklich nachhaltig ist, fair und hochwertig produziert wird, kompromisslos gut aussieht sowie den Kund:innen einen Mehrwert bietet. Genau danach streben wir mit unserer klimaneutralen Designermarke Monaco Ducks. Das Beste dabei ist, dass es ganz viele Märkte und Produkte gibt, bei denen die gleichen Eigenschaften zum Tragen kommen (sollten).
Ich bin leidenschaftlicher Unternehmer und möchte mit meinem Unternehmen ein Zeichen setzen, zeigen, dass sich Erfolg und echte Nachhaltigkeit nicht ausschließen. Egal, wie klein oder groß, wie jung oder alt und in welcher Industrie: Jede:r kann einen Unterschied machen. Es ist wichtig, dass wir konsequent und mutig vorangehen, mehr machen, als nur darüber zu reden und es toll zu vermarkten. Wir Unternehmer sind auch gleichzeitig Konsumenten und was wir als Konsumenten schon denken, müssen wir auch als Unternehmer verinnerlichen. Konsument:innen verlangen immer mehr Transparenz und Verantwortungsbewusstsein von den Unternehmen. Sie erwarten, dass Unternehmen faire, nachhaltige, also einfach anständige Produkte produzieren. Nachhaltigkeit wird irgendwann gar kein Begriff mehr sein, mit dem man Kundschaft anlockt. Es wird die Norm sein. Und das ist gut! Die Idee ist also, nicht zu belehren, sondern zu begeistern, zu inspirieren, einen Unterschied zu machen, zu zeigen, dass es geht.
Der Stakeholder Value liegt nicht mehr darin, den maximalen Profit aus dem Geschäft zu ziehen, sondern beinhaltet heute und in der Zukunft weitere Faktoren wie Fairness, Nachhaltigkeit und Aufrichtigkeit. Die Art des Arbeitens verändert sich. So suchen auch wir nach neuen Lösungen gemeinsam mit Partnern und sogar mit Wettbewerbern. Ziel ist für uns nicht nur, nachhaltige Schuhe zu verkaufen, sondern den gesamten Markt nachhaltiger zu gestalten. Nur wenn man auch eigene Konzepte teilt, wird einem an anderer Stelle weitergeholfen. Ich glaube, ein Miteinander funktioniert auch in der Wirtschaft besser als ein Gegeneinander – und das merken wir bereits heute.
Wirtschaft und Politik müssen nun vorangehen, um Verantwortung und eine Vorbildfunktion zu übernehmen. Frühere Generationen mussten sich immer wieder den jungen Generationen gegenüber verantworten. Ich sehe die bedeutendste Herausforderung darin, dass wir uns einmal unseren Enkelkindern gegenüber verantworten können mit dem Leben, wie wir es heute führen.
Wir müssen Verantwortung übernehmen – für uns und andere!
RYAN HOLOWKA
Ryan Holowka durfte bereits früh in seiner Karriere Verantwortung übernehmen. Im Alter von 28 Jahren wurde ihm die Leitung der nachhaltigen Transformation von Vodafone Deutschland anvertraut. Er baute hierfür ein neues Team auf und entwickelte die Nachhaltigkeits- und Purposestrategie des Konzerns. Seit 2021 leitet er als erster Sustainability Manager in der 120-jährigen Unternehmensgeschichte die Nachhaltigkeitsbemühungen von Peek & Cloppenburg Düsseldorf.
Abstract: Dies ist ein Plädoyer für mehr Verantwortung. Für mehr Verantwortung von Politik und Wirtschaft im Umgang mit unserem Planeten. Der Schutz des Planeten muss wichtiger sein als die Gewinnmaximierung der Unternehmen und wichtiger als parteipolitische Interessen. Wir können die Klimakrise noch stoppen, aber nur, wenn wir uns solidarisch verhalten und Verantwortung übernehmen: für uns und für andere.
Der Irrglaube: Privatpersonen sind für den Klimaschutz verantwortlich
Das gängige Narrativ von Politik und Wirtschaft lautete lange: Klimaschutz ist Aufgabe von Privatpersonen. Sie könnten, etwa durch den Umstieg auf Grünstrom oder die Reduzierung von Autofahrten, die Klimakrise aufhalten. Ein geschickter Schachzug, mit dem Politiker:innen und Wirtschaftslenker:innen versuchen, sich ihrer Verantwortung für den Klimaschutz zu entledigen. Selbstverständlich ist jede:r Einzelne dazu angehalten, das eigene Leben nachhaltiger zu gestalten. Alles, was wir kaufen, alles, was wir konsumieren, alles, was wir unternehmen, hat einen ökologischen Fußabdruck. Jede:r Einzelne sollte daher bewusst konsumieren und den persönlichen Beitrag leisten.
Aber zu behaupten, Einzelpersonen seien maßgeblich für die Bewältigung der Klimakrise verantwortlich, ist falsch. Wir alle müssen unseren Beitrag leisten, doch es ist vor allem die Aufgabe von Politik und Wirtschaft, die Klimakrise zu stoppen. Die Wirtschaft muss nachhaltige Angebote schaffen und die Politik hierfür die richtigen Rahmenbedingungen. In der Vergangenheit haben Unternehmen zu oft auf die Nachfrage am Markt gewartet, um nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Hat sich die entsprechende Nachfrage nicht eingestellt, wurde die Entwicklung nachhaltiger Angebote depriorisiert. Das können wir uns heute nicht mehr leisten. Die Zuspitzung der globalen Klimakrise erfordert den sofortigen Umstieg auf eine nachhaltige und soziale Marktwirtschaft. Dies bedeutet, dass wir bestehende Produkte nicht einfach grün anmalen können, sondern sie von Anfang bis Ende nachhaltig denken müssen. Wir brauchen ein neues, zirkuläres Design von Produkten, mit nachhaltigeren Materialien und nachhaltigeren Herstellungsprozessen, die am Ende nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als dem Kreislauf wieder zugeführt werden.
Die Verantwortung hierfür tragen die Führungsetagen unserer Wirtschaft. Sie, die Topmanager:innen und Wirtschaftsbosse, müssen Sorge dafür tragen, dass nachhaltige Produkte in den Markt gelangen und Kennzahlen der Nachhaltigkeit mindestens genauso wichtig sind wie Finanzkennzahlen. Ein besonders wichtiges Ziel muss der Abbau von Barrieren zur Nutzung nachhaltiger Produkte sein. Nachhaltiger Konsum muss für die Verbraucher:innen genauso einfach oder sogar einfacher sein als nicht nachhaltiger Konsum.
Die Aufgabe der Politik ist hierbei, für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen. Dies geschieht idealerweise durch Anreize – Anreize, die sowohl die Unternehmen als auch die Bürger:innen anspornen, nachhaltiger zu werden. Wo Anreize nicht funktionieren, muss der Staat durch Verbote und Beschränkungen korrektiv eingreifen – so wie in vielen anderen Bereichen auch. Gleichzeitig muss die Politik mit positivem Beispiel vorangehen, muss ambitionierte, wissenschaftlich fundierte Ziele definieren und ihre eigenen Prozesse radikal auf Nachhaltigkeit umstellen.
Die Lüge: Durch Greenwashing wird aus Grau Grün
Auf dem Papier sind sowohl Politik als auch Wirtschaft bereits heute nachhaltig. Gewaltige Anstrengungen werden unternommen, um nachhaltig zu wirken. Nicht unbedingt, um nachhaltig zu sein, aber um den Anschein zu erwecken. Es gibt groß angekündigte Ziele, begleitet von einem regelrechten Kommunikationsfeuerwerk. Politiker:innen und Topmanager:innen lassen keine Chance ungenutzt, über die Bedeutung des Themas »Nachhaltigkeit« für ihr Land, ihr Unternehmen und sie persönlich zu sprechen. Man habe verstanden, wie wichtig das Thema sei, und scheue keine Kosten und Mühen, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen.
Zwischen Realität und Versprochenem klaffen jedoch gravierende Lücken – nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. So große Lücken, dass das Bundesverfassungsgericht das erste Klimagesetz der Bundesregierung in Teilen für verfassungswidrig hält. Dieses Gerichtsurteil verdeutlicht das fundamentale Versagen der Politik im Bereich Klimaschutz. Eine vergleichbare Situation erleben wir in der Wirtschaft, in der die Ziele zur Rettung unserer Erde mit konträren Zielsetzungen konkurrieren. Während die Wirtschaft sich als geläutert verkauft und den Wandel hin zum Stakeholder Value propagiert, regiert in den Führungsetagen der Konzerne weiterhin das Mantra der Shareholder-Value-Maximierung. Der Ertrag der Investor:innen wird also über alle anderen Interessen gestellt. Es drängt sich der Eindruck auf, die Welt müsse zwar gerettet werden, aber eben nicht um jeden Preis.
Das Verhalten von Politik und Wirtschaft macht deutlich: Der Ernst der Lage wird noch immer verkannt. Dabei ist das Thema »Nachhaltigkeit« keinesfalls neu. Wissenschaftler:innen wie beispielsweise der Nobelpreisträger Syukuro Manabe warnen bereits seit den 1970er-Jahren vor den Gefahren des Klimawandels. Und in Konzernen gibt es schon seit Jahrzehnten Umweltbeauftragte, CSR-Manager:innen o. Ä., die die Aufgabe haben, ihre Unternehmen nachhaltiger zu machen. Doch wurde ihnen, genau wie den Wissenschaftler:innen, in der Vergangenheit zu wenig Gehör geschenkt. So durften sie zwar für die Sicherstellung der Compliance sorgen oder Projekte zur Steigerung der Außenwirkung umsetzen, aber die benötigte nachhaltige Transformation ihrer Unternehmen blieb in der Regel aus.
Besonders beliebte Projekte zur Steigerung der Außenwirkung sind dabei schon immer Baumpflanzaktionen gewesen. Das Pflanzen von Bäumen ist ein guter und kostengünstiger Weg, um CO2-Emissionen zu senken. Aber auch Bäume sind keine Wunderwaffe und können nicht allein die Klimakrise bewältigen. Trotzdem scheint es, als wollten sich die Unternehmen mit ihren Pflanzaktionen förmlich überbieten. Sie schreien dazu immer größere Ziele heraus: Einhunderttausend, eine Million, zehn Millionen Bäume wollen sie pflanzen. Eingebettet in eine holistische Strategie, können Baumpflanzaktionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten, sind aber häufig leider ein Ablenkungsmanöver. Sie dienen dem Ziel der Reputationssteigerung, ohne dass der benötigte Wandel innerhalb der Unternehmen vorangetrieben wird. Die wichtigste Maxime ist noch immer die Gewinnmaximierung, egal, ob durch Steigerung des Umsatzes oder Reduzierung der Kosten – das, was unterm Strich dabei rauskommt, zählt.
Das Problem: Die Klimakrise ist global
Klimaschutz ist ein globales Thema. Er hört weder an der eigenen Haustür auf noch an der eigenen Landesgrenze. Allzu oft hören wir heute von Politiker:innen und Wirtschaftsvertreter:innen: »Wir können den Klimawandel nicht alleine aufhalten, denn China, denn Indien, denn …« Das Versagen der anderen wird als vermeintlich legitimes Argument angeführt, um die eigene Untätigkeit zu rechtfertigen. Dass auch andere ihren Beitrag leisten müssen, wird als Vorwand genutzt, um die nötigen Veränderungen zu behindern oder zu verlangsamen.
Stellen Sie sich bitte vor – ich verwende hier bewusst die Metapher von Greta Thunberg, die als Begründerin der Fridays-for-Future-Bewegung die Stimme einer ganzen Generation wurde: Das Haus steht in Flammen. Und nicht nur irgendein Haus, sondern Ihr Haus, Ihr Zuhause steht in Flammen. Sie schauen aus dem Fenster und sehen, dass auch das Haus Ihrer Nachbarn brennt. Und das Haus daneben. Genauso wie das Haus auf der anderen Straßenseite und das Haus am Ende des Blocks. Überall brennt es. Nun wäre der natürliche Instinkt der meisten Menschen zu versuchen, das Feuer zu löschen. Die Flammen unter Kontrolle zu bringen, um das, was ihnen wichtig ist, zu retten. Um zu verhindern, dass das, wofür sie hart gearbeitet haben und was sie ihren Kindern überlassen wollen, zerstört wird.
Nicht aber in der Welt, in der wir 2022 leben. In dieser Welt stehen Sie in Ihrem brennenden Haus. Statt jedoch zu versuchen, die Flammen zu löschen, die alles zu zerstören drohen, zeigen Sie auf die anderen Häuser, die ebenfalls brennen. Diese Häuser werden bisher noch nicht gelöscht. »Warum soll ich denn mein Haus löschen, wenn doch die anderen ihre Häuser auch nicht löschen?«, fragen Sie. »Erst wenn die anderen ihre Häuser löschen, fange ich auch mit meinem an.«
Unsere Welt steht schon jetzt, buchstäblich wie auch metaphorisch, in Flammen: Der Mittelmeerraum, Australien, die USA und sogar Russland brennen. Überflutungen ungeahnten Ausmaßes erfassen Deutschland, Belgien, Japan oder auch China. Zeitgleich befinden wir uns noch immer inmitten der Covid-19-Pandemie, der gravierendsten Gesundheitskrise der Moderne, mit über 300 Millionen Infizierten und mehr als fünf Millionen Toten weltweit. Wir leben in einer Welt, in der Wissenschaftler:innen wie Niklas Boers feststellen, dass der Jetstream, der für ein stabiles Klima seit Beginn der Menschheit sorgt, Gefahr läuft, dauerhaft instabil zu werden – mit nicht absehbaren, potenziell katastrophalen Folgen.
Eine Welt, die bereits 1,1 Grad Celsius wärmer ist als noch im Jahr 1850. Eine Welt, in der das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015 kaum noch haltbar scheint und in der eine Limitierung des Temperaturanstiegs auf unter zwei Grad Celsius in immer weitere Ferne rückt. Die Beweislast ist erdrückend, die Wissenschaft ist sich einig: Die Klimakrise ist menschengemacht. Unser zögerliches Verhalten und Festhalten am Status quo wird der Herausforderung, vor der wir stehen, in keiner Weise gerecht.
Die Chance: Wir können die Klimakrise bewältigen
Noch ist es nicht zu spät. Es fällt manchmal schwer, diese Aussage zu glauben, wenn doch Bericht um Bericht feststellen muss, dass wir ungebremst in die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte hineinrasen. Ob IPCC, Vereinte Nationen, Weltbank oder Welthungerhilfe – der Appell ist immer der gleiche: reduce emissions now – Reduziert die Emissionen sofort; nur dann haben wir eine Chance. Das Positive ist: Dieser Appell wird mittlerweile von Millionen gehört.
Besonders stark ist die Resonanz bei den jungen Menschen. Fridays for Future ist der Ruf einer ganzen Generation nach mehr Nachhaltigkeit. Mit ihrem Engagement haben die jungen Leute Politik wie auch Wirtschaft aus dem Tiefschlaf geholt und dazu gebracht, sich mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen. Branchenübergreifend gibt es nun erste Unternehmen, die sich ernsthaft mit dem Thema befassen. Sie versuchen, Lösungen zu erarbeiten, um ihre eigenen Emissionen zu senken – und mindestens genauso wichtig: um die Emissionen in ihren Lieferketten zu verringern.
Und sie denken das Thema »Nachhaltigkeit« holistisch. Das heißt, sie haben die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und Problemen wie Armut, Gesundheit oder Bildung erkannt und gehen sie an. Sie entwickeln neue Technologien und Ansätze und arbeiten dabei eng mit der Wissenschaft zusammen. Es liegt nun an der breiten Masse der Unternehmen, diesen Vorreitern zu folgen und ihren eigenen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Sie müssen den Planeten und die Menschen an erste Stelle setzen: Planet and People before Profit.
Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, mit einem der höchsten CO2-Fußabdrücke pro Kopf sowie einer gewaltigen historischen Klimaschuld. Wir können die Klimakrise nicht allein bewältigen – das erwartet auch niemand. Aber es ist unsere Pflicht, in der ersten Reihe derer zu stehen, die die Klimakrise bekämpfen. Es ist unsere Pflicht, uns für die Menschen einzusetzen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind und am wenigsten zu ihrer Entstehung beigetragen haben. Es ist unsere Pflicht, den Schutz unseres Planeten an erste Stelle zu setzen.
Die Klimakrise berührt all unsere Lebensbereiche und ist treibender Faktor für viele unserer Probleme. Wir müssen den Klimaschutz daher über persönliche oder parteipolitische Interessen stellen und dafür sorgen, dass wir eine lebenswerte Welt erhalten und eine prosperierende Zukunft gestalten. Wir haben das Wissen, um die Klimakrise zu stoppen. Wir haben die Ressourcen, um die Klimakrise zu stoppen. Nun brauchen wir den kollektiven Willen, um die Klimakrise zu stoppen. Deutschland muss vorangehen und Verantwortung übernehmen – für sich und für andere.
Der deutsche Mittelstand – eine Laudatio auf die verborgenen Held:innen unserer Gesellschaft
LENCKE WISCHHUSEN
Lencke Wischhusen – bekannt aus der VOX-Gründershow »Die Höhle der Löwen« – war bis 2019 geschäftsführende Gesellschafterin des Familienunternehmens W-Pack GmbH mit Hauptsitz in Bremen. Von 2012 bis 2015 war sie Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer und setzte sich für den deutschen Mittelstand und die Generationengerechtigkeit ein. Seit 2015 ist sie Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten in der Bremischen Bürgerschaft und Mitglied des Bundesvorstandes.
Abstract: Der deutsche Mittelstand ist ein wesentlicher Stabilisator für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Garant für den sozialgesellschaftlichen Frieden. Soll das so bleiben, müssen wieder mehr Menschen gründen. Die Gründer:innen von heute sind die Familienunternehmer:innen von morgen. Dafür braucht es weniger bürokratische Hürden und bessere ökonomische Bildung. Das so falsche wie anachronistische Bild vom egozentrischen Unternehmer gehört in die Mottenkiste öffentlicher Mythen. Wir brauchen mehr Lust am Gründen statt Neidkultur.
Der Mittelstand mit seinen meist von Inhaber:innen geführten Unternehmen ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die Zahlen sprechen für sich und lassen an dieser viel geäußerten These keine Zweifel: 99,6 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), 88 Prozent davon sind inhaber:innengeführt; im Mittelstand arbeiten 32,3 Millionen Menschen, was circa 71,3 Prozent aller Beschäftigten entspricht. Sie erwirtschaften rund 58 Prozent der Nettowertschöpfung und zahlen, anders als internationale Großkonzerne, ihre Steuern in Deutschland (BVMW 2021).
Mit diesem starken Auftritt sichert der deutsche Mittelstand unseren Wohlstand und den sozialgesellschaftlichen Frieden. Mit seinem einmaligen Know-how produziert er international gefragte Produkte, bietet hoch spezialisierte Dienstleistungen an und sorgt damit für Arbeitsplätze. Um diese starke bürgerliche Mitte werden wir weltweit beneidet.
Umso erstaunlicher ist, dass es vor allem die großen, international agierenden Konzerne sind, die in allen relevanten Wirtschaftsbereichen von der Politik vornehmlich gehört werden. Das wirtschaftspolitische Handeln ist auf sie fokussiert. Die speziellen Bedürfnisse und besonderen Anliegen der KMU hierzulande geraten dabei schnell aus dem Blick. So wird die Marktmacht der Konzerne oft nachhaltig gestärkt, der Mittelstand aber langfristig geschwächt. Spitzt man diese Tendenz zu, entwickeln sich in einem zunehmend staatlich beeinflussten Wirtschaftssystem die Konzerne zu zentral geleiteten Kombinaten, während dem Mittelstandsmotor in einer derart gelenkten marktwirtschaftlichen Dynamik langsam der Treibstoff ausgeht. Gerade mit Blick auf die kommende Generation eine traurige Entwicklung, die einer dringenden Kurskorrektur bedarf.
Die duale Ausbildung – ein unterschätztes Erfolgsmodell
Das in Deutschland fest etablierte duale Ausbildungssystem ist weltweit einzigartig. Der Mittelstand weiß um diesen Schatz und ist sich seiner regionalen und sozialen Verantwortung bewusst. Er trägt daher dieses duale System finanziell und organisatorisch maßgeblich mit. Über 80 Prozent der Auszubildenden hierzulande werden vom deutschen Mittelstand ausgebildet (KfW Research 2021a). Die Fachkräfte von morgen werden so direkt nach der Schule in die Firmen und damit unmittelbar in den Arbeitsmarkt integriert. Um diesen Nachwuchs konkurrieren die KMU aber auch mit den großen, prestigeträchtigen Konzernen.
Der Ruf der Konzerne ist verlockend, ihre Angebote sind oft attraktiv. Diesen sogenannten War for Talents können die KMU nur gewinnen, wenn sie selbst noch stärker in die duale Ausbildung investieren und Nachwuchskräfte frühzeitig an sich binden. Die duale Ausbildung ist das Erfolgskonzept gegen den Fachkräftemangel und gleichzeitig wirksamstes Mittel – das lehrt der Vergleich mit Spanien – gegen Jugendarbeitslosigkeit: Diese liegt in Spanien mit etwa 40,7 Prozent der Jugendlichen sehr hoch (Suhr 2021). Um ihr aktiv zu begegnen, wird nun versucht, das duale System im Land zu integrieren. Die Bertelsmann Stiftung hat sich mit ihrem Deutsch-Spanischen Forum eindrucksvoll engagiert und genau jene Verbindungen geknüpft, mit denen der Transformationsprozess des dualen Ausbildungssystems made in Germany in die spanische Wirtschafts- und Bildungslandschaft erfolgreich umgesetzt werden kann (Forum der Bertelsmann Stiftung 2021).
Mittelstand – kein Konzern im Miniformat
Der deutsche Mittelstand garantiert ein stabiles soziales Miteinander. Unternehmer:innen leben diese zentrale Verantwortung für unsere Gesellschaft völlig selbstverständlich und ohne dabei ihre treibende Rolle für die langfristige Stabilität des Systems zu hinterfragen. Was aber macht den Mittelstand so besonders und was zeichnet ihn aus? Es ist das einmalige Gefüge von persönlicher Verantwortung für das – oft innerfamiliär entwickelte – Unternehmen in der Hand der Eigentümer:innen. Das Selbstverständnis der unternehmerischen Verantwortung entfaltet sich aus einem stabilen, historisch und gesellschaftlich gewachsenen Wertekanon.
Dieses Werteverständnis von mittelständischen, meist inhaber:innengeführten Unternehmen unterscheidet sich maßgeblich von dem der manager:innengeführten Konzerne. Diese These ist provokant und natürlich nicht allgemeingültig. Selbstverständlich gibt es auch Manager:innen, die sich selbst als Unternehmer:innen begreifen, jahrelange Betriebszugehörigkeit aufweisen und entsprechend agieren. Dennoch bleibt ein Unterschied signifikant: Konzerne, geführt von angestellten Manager:innen, sind ausgerichtet auf den kurzfristigen Erfolg. Im Vordergrund steht die schnelle Gewinnmaximierung; ein großer Bonus am Jahresende und die Steueroptimierung sind handlungsleitend. Soziale Projekte werden zwar im Rahmen einer professionellen Vermarktung umgesetzt, im Zentrum aber steht ein zufriedener Shareholder mit hoher Dividende.
Der Mittelstand tickt anders. Deutschland ist weltberühmt für seinen »German Mittelstand« – 3,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen machen den starken Motor der deutschen Wirtschaft aus. Dank der mittelständischen Struktur ist dieses Land gegenüber Krisen gewappnet, denn die Unternehmen haben im Durchschnitt Eigenkapitalquoten von 32 Prozent und können in schweren Zeiten das Unternehmen stabil halten, ohne im großen Stil Mitarbeiter:innen zu verlieren (KfW Research 2021a; IHK für München und Oberbayern 2021).
Größtes Alleinstellungsmerkmal ist die Vereinigung der Prinzipien von Risiko und Haftung in einer Hand. Die persönliche Haftung der Unternehmer:innen mahnt zu unternehmerischer Vorsicht bei gleichzeitiger Weitsicht für das internationale Geschehen, um wettbewerbsfähig bleiben zu können. Von 2.700 Hidden Champions, also unbekannten Weltmarktführern, weltweit stellt die deutsche Mittelstandspower mit 1.300 etwa die Hälfte dieser heimlichen Gewinner (Kuschka 2018; iwd 2021).
Standorttreue ist ein Wert, der im Mittelstand ebenfalls großgeschrieben wird. Viele Unternehmen sind heimatverbunden und insbesondere die Flächenländer profitieren von diesem Bekenntnis zur eigenen Region. Die regionale Verbundenheit schließt die Menschen vor Ort ein. Viele Unternehmer:innen engagieren sich gemeinnützig in Kunst, Kultur, Sport, Kirche und Bildung. Etliche Institutionen wären ohne diese unternehmerische Verantwortung existenziell bedroht, da die Mittel der öffentlichen Hand nicht ausreichen, um sie in entsprechender Breite zu finanzieren. Dieses gesellschaftliche Pflichtgefühl der KMU äußert sich – je nach Möglichkeiten – ganz unterschiedlich: von den neuen Trikots der örtlichen Jugendmannschaft bis hin zu millionenschweren Forschungsinvestitionen. Besonders erfolgreiche Unternehmensfamilien haben eigene Stiftungen gegründet. Prominente Beispiele sind unter anderem die Familien Mohn (Bertelsmann Stiftung), Miele (Miele Stiftung), Oetker (Rudolf-August Oetker-Stiftung), Braun (B. Braun-Stiftung), Würth (Stiftung Würth) oder Henkel (Gerda Henkel Stiftung).
Trotz dieser enormen gesellschaftlichen Leistung ist der Mittelstand bodenständig geblieben und tritt bescheiden auf. Die Akteur:innen in den Leitungsfunktionen betrachten sich als Teil des Ganzen, packen mit an und leben den persönlichen Kontakt zur Belegschaft. Die unternehmerische Verantwortung zu tragen bedeutet für sie immer auch jederzeit eine Vorbildrolle einzunehmen. Das, was von den Mitarbeiter:innen erwartet wird, muss selbst im Herzen und im eigenen Tun gelebt werden. Genau diese Überzeugung zeigt Dr. August Oetker eindrucksvoll in einem Interview. Als ein Journalist ihn nach der Oetker Hotel Collection fragt, antwortet er: »Das sind Hotels der allerobersten Kategorie. Für unsere Familie ist es zu teuer, dort zu wohnen. (…) Es gibt bei uns eine Kultur, die von Arbeit geprägt ist. Das ist eine Frage der Haltung« (Gassmann 2014).
Erfolg für Generationen – selbstverständlich nachhaltig
Für die KMU ist generationsübergreifendes und nachhaltiges Denken keine neue Erfindung. Ihr Handeln war immer schon geprägt von dem Wunsch nach möglichst langfristiger Stabilität – auch das unterscheidet sie von Konzernen. Der Mittelstand denkt langfristig und nicht bis zur nächsten Vertragsverlängerung des CEO. Das tägliche Handeln erfolgt im Verständnis, dass das Unternehmen für eine Generation anvertraut wird, und mit dem Ziel, es im bestmöglichen Zustand zukunftsfest mit Rücklagen an die nächste Generation weiterzugeben. Das, auch für viele Start-ups, charakteristische Exit-getriebene Denken ist für den Mittelstand untypisch. Stattdessen gibt es einen Governance-Kodex, der von einer Kommission renommierter Wissenschaftler:innen und Unternehmer:innen für Familienunternehmen entwickelt wurde. Er behandelt folgende Punkte:
das Selbstverständnis der Inhaber:innen und damit das klare Bekenntnis zu einem verantwortungsvollen Unternehmertum
die Ausgestaltung der Inhaber:innenrechte und -pflichten
die Empfehlung, freiwillig einen Beirat oder Aufsichtsrat zu integrieren, der die Stabilität und Innovationskraft mit einem Blick von außen bewertet
die Unternehmensführung, die als Leitplanke der vorgegebenen Werte und Ziele fungiert
die Ergebnisermittlung und Verwendung, da mittelständische Unternehmen der Sicherung ihrer Kapital- und Liquiditätsbasis besondere Aufmerksamkeit widmen müssen und aufgrund ihrer generationsübergreifenden Orientierung auf die von den Familien/Inhaber:innen zur Verfügung gestellten Finanzmittel angewiesen sind
die Übertragung der Inhaberschaft und das Ausscheiden aus dem Gesellschafterkreis





























