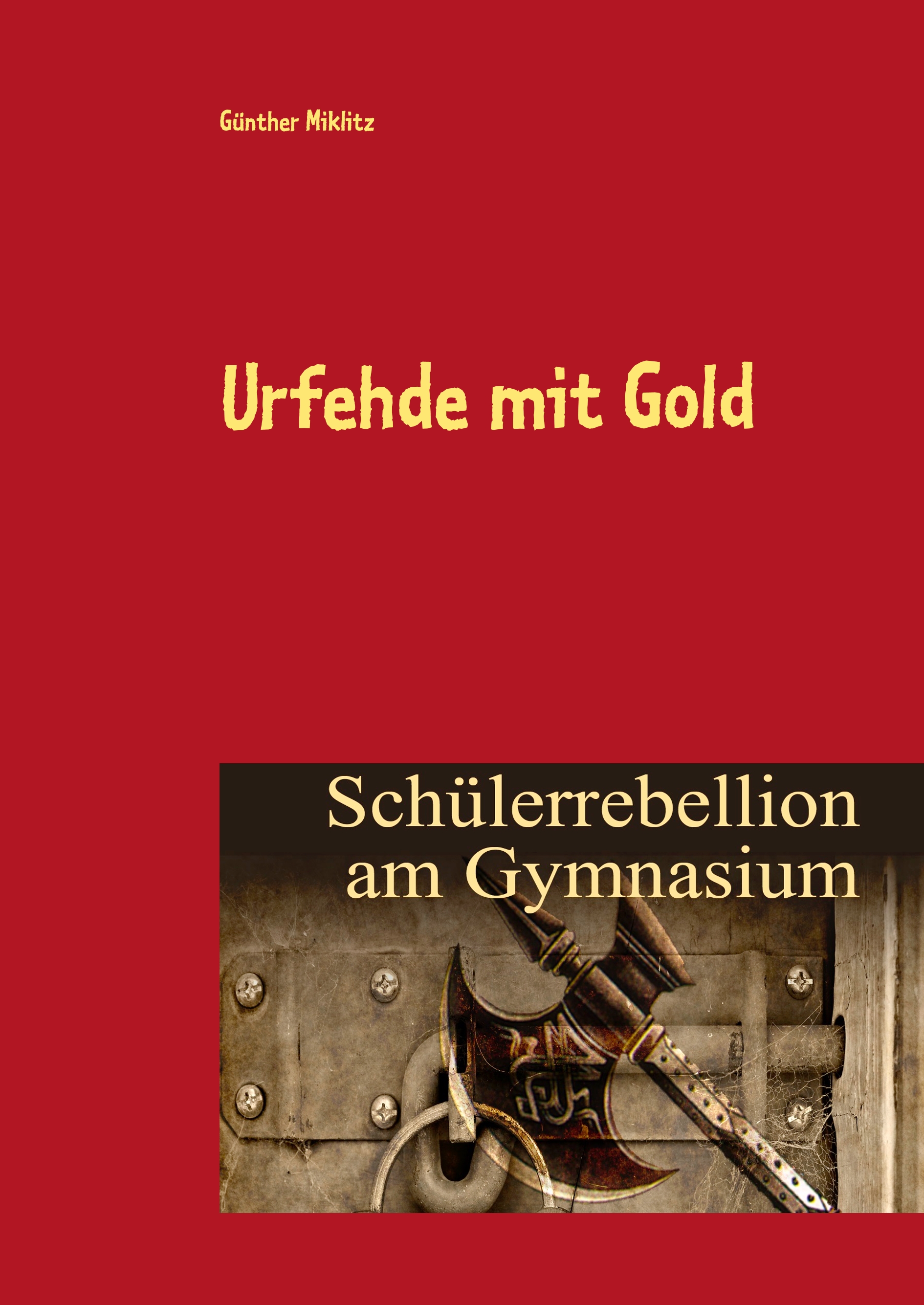
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Historischer Tatsachenroman über die Rebellion von 1589 am nordhessischen Gymnasium in Korbach. Der Schüler Friedrich von Bernstorff verfasst eine Schmähschrift gegen den Rektor, befreit seine Kameraden aus dem Schulgefängnis und kommt vor das städtische Gericht, wo er Urfehde schwören muss. Er wird durch Fürsprache und durch eine Goldzahlung unterstützt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Was bedeutet Urfehde?
Prolog: Ein mysteriöser Blog im Internet
Die Geschichte des Schülers Fredericus von Bernstorff aus Thüringen,
Kapitel: Abschied beim Bürgermeister
Kapitel: Nach Korbach
Kapitel: Durchs Tränke-Tor in die Stadt
Kapitel: Ankunft
Kapitel: Bernstorff wird eingeweiht
Kapitel: Beim Pfarrherrn der Kilianskirche
Kapitel: Mit dem Küster in der Kilianskirche
Kapitel: Widerspruch im Klassenzimmer
Kapitel: Lesestunde beim Korbmacher
Kapitel: Böse Geister
Kapitel: Aufruhr in der Landesschule
Kapitel: Ein Flugblatt schürt das Feuer
Kapitel: Adeles Zorn
Kapitel: Eine gräfliche Beratung
Kapitel: Geld und Gold des Waldecker Grafen
Kapitel: Befreiung
Kapitel: Friedrich will flüchten
Kapitel: Drei Väter im Gasthaus zum Rathaus
Kapitel: Gefährliche Flucht nach Lengefeld
Kapitel: Treffen am Mühlenbach
Kapitel: Auf dem Eisenberg
22. Kapitel: Im Goldbergwerk
Kapitel: Die Untersuchung beginnt
Kapitel: Im Schloss des Waldecker Grafen
Kapitel: Bernstorff wird gesucht
Kapitel: Ermittlungen führen zum Ziel
Kapitel: Unterwerfung im Rathaus
Kapitel: Bernstorffs Ehrenbrief
Kapitel: Friedrich kommt frei
Kapitel: Friedrich verlässt die Stadt
Epilog:
Literaturhinweise
Die Fakten in den Geschichtsquellen:
Was bedeutet Urfehde?
Im späten Mittelalter und in der Neuzeit bedeutete „Urfehde“ den Eid, den ein Verurteilter oder ein begnadigter Angeklagter zu leisten hatte. Wer Urfehde schwor, erklärte damit, keine Rache zu nehmen an Ankläger, Richter, Gerichtspersonen oder an der Stadtgemeinde, die ihn des Landes verwies. Eine Urkunde über diesen geleisteten Eid wurde in Form eines sogenannten Urfehdebriefes ausgestellt.1
Normalerweise denkt man bei dem Wortteil „ur“ an besonders alt. Und man weiß, dass „Fehde“ ein altes Wort für „Streit“ ist, und zwar aus einer Zeit, als die Menschen ohne den Staat privat ihr Recht erkämpften.
Aber in unserem Zusammenhang geht „ur“ auf eine andere Bedeutung zurück: „herausgehen aus“, „beenden“. Also bedeutet „Urfehde“, dass ein Streit endgültig zu Ende ist. Man könnte auch sagen, die Urfehde ist eine Art Gelöbnis, aus dem Streit herauszugehen und zukünftig Frieden zu bewahren. Das Schwören von Urfehde ist daher auch ein Friedensgelöbnis.
1Bernd Kröpelin/Stadtarchiv Korbach (Hg.), Urfehdebriefe Korbacher, Gerichtsurkunden aus dem 16. u. 17. Jahrhundert, Korbach 1989
I. Prolog: Ein mysteriöser Blog im Internet
„Ich habe in Korbach Urfehde geschworen, aber meine Rettung verdanke ich dem Gold aus dem Eisenberg.“ Der Satz war durchgestrichen. Der geänderte Text lautete:
"Ich, Fredericus von Bernstorff aus Erfurt
in Thüringen, erkläre hiermit bei meiner Ehre:
Heute, am 16. Mai 1589, musste ich auf dem Rathaus in Korbach einen Urfehdebrief unterschreiben, um meinen Hals zu retten.
Man hat mich mit dem Tode bedroht, weil ich am Korbacher Gymnasium den Geist des Fortschritts und der Vernunft unterstützt habe und weil ich Mitschüler aus dem Schulgefängnis befreite.
Meine Rettung verdanke ich dem Gold aus dem Eisenberg bei Korbach.“
Diesen Text nahm Gerda Huveisen am 3. Januar 2005 im Archiv der Stadt Korbach in die Hand, ein vergilbtes Pergament, von Hand beschrieben in schwarzer Tinte, ein altes Manuskript.
Das Manuskript war die Abschrift einer ca. 425 Jahre alten, in deutscher Schreibschrift abgefassten Urkunde, die genauso in einem grauen Pappkarton verwahrt wurde wie viele andere Dokumente des Archivs.
„Die Pappkartons sind die kleinen grauen Zellen, mit denen wir uns an die Vergangenheit erinnern”, pflegte Gerda Huveisen zu sagen, wenn einer der seltenen Besucher erstaunt fragte, was die vielen Kartons bedeuteten.
Die städtische Archivmitarbeiterin machte eine Pause.
Das bedeutete für sie einen Klick im Internet auf ihre Lieblingsseite:_
„Feine Silber- und Goldschmiedearbeiten.“
Sofort sah sie den neuen Eintrag. Ein Link, der zu dem Blog „Gold-Kilianer – Gold in einer westdeutschen Kleinstadt um 1600 von Fredericus Bernstorff, Schüler am Korbacher Gymnasium Alte Landesschule“ führte. „O, wer ist denn das?“, wunderte sie sich und überflog neugierig die Liste der Postings.
Und damit kam die Enthüllung der folgenden Geschichte ins Rollen. Die Einzelheiten dazu beschreiben wir im Nachwort.
Zuerst aber der Text selbst, der ins spätmittelalterliche Korbach führt, in eine Kleinstadt in Nordhessen. Es wird darin erzählt, was es mit dem Urfehdebrief von Friedrich von Bernstorff und der Schülerrebellion von 1589 am Gymnasium in Korbach auf sich hat.
II. Die Geschichte des Schülers Fredericus von Bernstorff aus Thüringen,
seine Rebellion am Korbacher Gymnasium und seine Rettung durch Gold aus dem Eisenberg
Ein Romanfragment
1. Kapitel: Abschied beim Bürgermeister
Der Federkiel des Bürgermeisters kratzte über das weißgraue Papier: Erfurt, anno 1588; mit leichtem Schwung setzte er seine Unterschrift darunter: Jost Bücking. Dann blickte er auf den aufgeweckten Jungen, der vor ein paar Minuten in seine Amtsstube eingetreten war.
„Groß ist er geworden“, dachte er. „Und er sieht gut aus: schlank, blondes Haar, gesunde, von der Sonne gebräunte Gesichtsfarbe. So sieht ein Junge aus einem alten Adelsgeschlecht aus, zu dem seit Jahrhunderten Freiherren auf einer Burg und Ritter mit großem Landbesitz gehören. Standesbewusstsein, Anspruch auf höhere Positionen und die Bereitschaft, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, zeichnete seine Familienmitglieder aus.
Friedrich von Bernstorff war gekommen, um Abschied zu nehmen. Der Bürgermeister von Erfurt sagte: „So, 15 Jahre alt bist du jetzt, und Dein Vater schickt dich schon hinaus in die Welt an ein Gymnasium im Ausland.“
Der Bürgermeister war ein kräftiger Mann mit freundlicher Ausstrahlung. Sein dünn gewordenes blondes Haar zeigte an, dass er sein mittleres Alter überschritten hatte. Er kniff die hellblauen Augen leicht zusammen und schaute den Jungen scharf an: „Bernstorff, du gehst also nach Korbach. Das ist eine Hansestadt von Bedeutung. Sie ist in den letzten 200 Jahren zu Ansehen und Wohlstand gekommen. Das zeigen ihre zwei großen Kirchen, Sankt Kilian und Sankt Nikolai. Du findest dort vornehme Patrizier, reiche Kaufleute und tüchtige Handwerker.“
Der Bürgermeister hielt inne, um Luft zu holen. Die Rede fing an, Bernstorff zu langweilen. Er dachte: „Nun fehlen nur noch seine Lieblingsworte, die er in seinen Ansprachen mehrfach gehört hatte: Bürgerfleiß und Gottesfurcht.“
Doch bei den folgenden Sätzen spitzte er die Ohren, wenn er auch vor seinem Plan eines Auslandsstudiums kaum etwas von Korbach gehört hatte. Und im europäischen Bund der Hanse, der den Fernhandel förderte und sicherer machte, waren nach seinem Wissen Lübeck, Hamburg und Bremen die führenden Städte.
Aber eine wirklich bedeutende Stadt für den Austausch von Waren und Ideen, das war für ihn immer noch allein Erfurt in Thüringen, seine Heimatstadt. Und ebenso wie seine Stadt sollte dieses Korbach eine ähnliche Bedeutung haben?
Bücking fuhr fort: „Auf einem hohen Berg bei Korbach liegt das Schloss Eisenberg, welches Graf Josias von Waldeck gerade erneuern und vergrößern ließ. Und der Berg, darauf das Schloss stehet, ist reich an Erz, weshalb man dort Goldgruben geschaffen hat.”
Hatte Bücking „Gold“ gesagt? Also war Korbach ganz sicher nicht irgendein Landstädtchen.
Bernstorff wurde aufmerksamer, als der Bürgermeister ergänzte: „Vielleicht erfährst du etwas von den Plänen des Waldecker Grafen. Das Schloss auf dem Eisenberg ist den Grafen sehr teuer zu stehen gekommen. Jetzt braucht er Geld, um eine Kapelle zu bezahlen, die er sich neben dem Schloss hat errichten lassen. Zu seinem Glück wohnt er neben einer seit Jahrhunderten bekannten Goldmine. Früher war sie ergiebig, aber jetzt kann man sie nur dann wirtschaftlich betreiben, wenn man moderne Bergwerkstechnik einsetzt.
Der Graf will das Gold im Eisenberg mit neuestem Gerät abbauen lassen. Die wichtigsten Geldgeber im Reich, die Fugger in Augsburg, die selbst den Kaiser finanzieren, sollen schon bereit sein, einen großen Kredit zu geben.“
Der Bürgermeister machte eine Pause, indem er kurz hustete und sich zum Fenster wandte. Ihm war plötzlich bewusst geworden, dass er wieder einmal, ohne es zu wollen, ins Politische gekommen war. Was sollte der Junge mit diesen Gedanken anfangen? Sein Blick fiel wieder auf den Jungen, der mit der rechten Hand beschäftigt war, den grünen Samtkragen auf seinem Wams gerade zu ziehen.
Bücking merkte, dass er sich mehr auf sein Gegenüber konzentrieren musste. Mit dem erfahrenen Blick eines Mannes, der es gewohnt war, die Zuhörer seiner Rede zu überzeugen, bemerkte er auch sogleich, wie er bei ihnen ankam. Er sah die Aufmerksamkeit im Gesicht des Jungen aufleuchten, als er vom Golde sprach.
Geschickt nahm er den Faden seiner Rede wieder auf. Seine Worte sollten den jungen Burschen fesseln: „Eigentlich brauchst du gar nicht in den Berg hineinzufahren, um Gold zu finden. Am Fuße des Berges, wenn du von Osten kommst, triffst du Leute, die aus Kies und Sand Gold herauswaschen.“
Das hörte Bernstorff gern: Goldwaschen, kleine Goldstückchen einfach mit einem Sieb aus dem Wasser heben und reich werden! Ja, das würde er gern probieren. Erwartungsvoll sah er den Bürgermeister von Erfurt an, um noch mehr vom Gold des Eisenbergs bei Korbach zu hören.
Aber der war inzwischen beim eigentlichen Ziel seiner Rede angekommen: „Du gehst nach Korbach, weil es dort eine neue Schule gibt. Die Grafen zu Waldeck haben da das ehemalige Kloster zum Bereich am Ederfluss eingezogen. Es war im Schlendrian der Mönche verkommen. Da haben die gräflichen Landesherren beschlossen, mit dem Geld aus der Verpachtung des ehemals kirchlichen Besitzes das neue Gymnasium des Waldecker Landes zu finanzieren.
„An dieser Schule sollst du lernen. Dass du dir ja nicht die Flausen vom schnellen Reichwerden durch Gold in den Kopf setzt!“, sagte Bücking und fügte gewichtig hinzu: „Wissen und Einsicht zu erlangen ist unendlich wertvoller als Silber und Gold. So steht es im Alten Testament. Sprüche: 16,16.“
„Du gehst also nach Korbach. Dort haben die Waldecker Grafen, der Landesherr und sein Bruder, hervorragende Lehrer berufen. Einer von ihnen, ein humanistischer Gelehrter aus Südfrankreich, genauer: aus Bordeaux, ist Schüler des berühmten Erasmus von Rotterdam. Er hat die kritischen Schriften von Michel de Montaigne, der auch in Bordeaux lebt, nach Deutschland gebracht.
Du wirst an dieser Schule die rechte Vorbereitung auf die Universität bekommen und dich in Lateinisch, Griechisch und Hebräisch sowie in Mathematik und Naturwissenschaft ausbilden. Daher richte dein Gemüt und deinen Sinn darauf, gute freie Künste und Sitten zu studieren. Zu diesem Beruf – oder Zweck wie man heute sagt – sollst du dich dem Herrn Rectori Magistro Langio als einen gehorsamen, frommen und redlichen Schüler angeloben und dich dazu gebührend verhalten. Versprichst du das?“
„Ja, ich verspreche und gelobe es“, antwortete Bernstorff schnell, denn er war froh, dass die Ansprache vorbei war und der Bürgermeister ihm endlich das begehrte Empfehlungsschreiben in die Hand drückte.
„Dieses Schreiben, Bernstorff, wird dir helfen, in die Korbacher Schule aufgenommen zu werden. Denn eigentlich ist sie nur für Kinder der Grafschaft Waldeck gedacht – und du willst ja als Ausländer Aufnahme finden. Aber wir bieten dafür einem jungen Mann aus der Grafschaft Waldeck hier in Erfurt einen Studienplatz an unserer Universität.” Bernstoff nahm das Schreiben mit einer tiefen Verbeugung entgegen.
In diesem Augenblick erklang das Geläute der großen Domglocke, von der Bernstorff wusste, dass sie die größte zu seiner Zeit war. Er war ergriffen, dankte und verabschiedete sich artig.
Der Bürgermeister trug ihm noch Grüße an seinen Vater auf und sagte wohlwollend: „Bei hoffentlich schönem spätsommerlichen Wetter steht nun eine lange Reise von Erfurt nach Korbach vor dir. Es erwartet dich ein neues Gymnasium mit guten Büchern und gebildeten Lehrern.
Ich gebe dir folgende Worte mit, die ich gedruckt gefunden habe: `Wer viel liest und viel reist, sieht vieles und erfährt vieles.´ Ich wünsche dir Glück und Erfolg auf deinem Weg.”
2. Kapitel: Nach Korbach
Der Klang der Erfurter Domglocke, gegossen im Jahre 1497 im Beisein des Großvaters, wie er von seinem Vater wusste, hallte in Bernstorffs Gedächtnis nach und erinnerte ihn an seinen Abschied von der Heimat und an den Besuch beim Bürgermeister. Jetzt war er froh, dass seine Mitfahrgelegenheit, ein mit zwei Ochsen bespannter Kastenwagen, endlich hinter der Ortschaft Strothe den Wald vor Korbach durchquert hatte und eine der letzten Höhen genommen war. Nun konnte er wieder in diesem rumpelnden Fahrzeug ausruhen.
Er war hundemüde. Um die Ochsen zu entlasten, hatte er eine lange Strecke zu Fuß gehen müssen. Von Erfurt über Hersfeld und Fritzlar kommend waren sie durchs Edertal gezogen. In Berich, wo sich ein vom Waldecker Grafen eingezogenes Kloster und eine Hütte für die Verarbeitung von Eisenerz befand, hatten sie Rast gemacht. Dann war der Weg durchs Werbetal gegangen. In Oberwerbe hatte Zentner ebenfalls haltgemacht. Er ging in die alte Klosterkirche, um zu beten.
Oberhalb der Kirche auf einem Felsen sahen sie das frühere Nonnenkloster. Es war nicht mehr in Betrieb, der Graf hatte es aufgehoben. Weiter ging der Weg an hohen Berghängen entlang. Zum Teil folgten sie dem Eisensteinweg, der von den schweren Eisenfuhrwerken aus Adorf auf dem Weg zur neu errichteten Bericher Hütte benutzt wurde. In den Tälern waren die Straßen zu ausgefahren und weich für schwere Fuhrwerke.
Sie waren durch die Ortschaften Freienhagen, Sachsenhausen, Meineringhausen und Strothe gekommen, immer ging es von einem Berg über den anderen.
Bernstorff hatte es sich hinten im Wagen neben einem Sack Waid – Farbstoff für die Herstellung von Tuchen – bequem gemacht, so gut es ging. Davor lagerte der wichtigste Teil der Ladung: schwere geschmiedete Wellen und eiserne Stangen für das Getriebe einer großen Wasserpumpe, wie sie damals im Bergbau eingesetzt wurden.
Der Wagen rumpelte auf seinen Holzspeichenrädern, die mit fingerdicken Eisenreifen beschlagen waren, über den Feldweg. Und das hielt ihn wach. Eine Reise von zwei Wochen lag hinter ihm, nun waren sie fast in Korbach. Die Abschiedsrede des Erfurter Bürgermeisters, der mit seinem Vater, einem Rittergutsbesitzer auf dem Lande, sehr gut bekannt war, ging ihm zum wiederholten Male durch den Kopf.
Bürgermeister Bücking hatte noch gesagt: „Korbach liegt auf einer Hochebene in der Mitte des Waldecker Landes zwischen den Flüssen Diemel und Eder.“
Aus einem Stück Brachland flatterte ein Schwarm Feldhühner auf und flog über den Wagen hinweg. Unwillkürlich musste er beim Anblick dieses Geflügels mit der Zunge in den Zähnen nach Fleischresten suchen.
Er dachte bei sich, dass er nun in reicheres Gebiet kam, in die Gemarkung einer freien Stadt, in der es kein Jagdrecht für den Landesherrn gab und die Bürger das Geflügel und Wild aus den Feldern selbst verzehren konnten. Das hatte er von Fuhrmann Zentner erfahren, der ihn auf dem Ochsenkarren mitfahren ließ und der sich in diesen Dingen auskannte.
Die Stoppeln eines frisch abgeernteten Weizenfeldes kündeten mit ihrem leicht süßlichen Geruch den Spätsommer an. Noch einmal musste er an die Rede des Bürgermeisters denken und daran, wie dessen Ausführungen zu Korbach dann weiter gegangen waren: „Zwei Fernstraßen kreuzen sich dort: Eine von Köln über Kassel und Leipzig, die andere von Bremen nach Frankfurt. An diesem Knotenpunkt triffst du weitgereiste und gebildete Menschen.“
Plötzlich wurde er aufgeschreckt: „Bernstorff! Raus aus dem Wagen! Was träumst du nur?! Glaubst du die Ochsen können die schwere Last des Wagens alleine halten. Mach, dass du an die Bremse kommst!“ Kaufmannsgehilfe Ulrich Zentner, ein großgewachsener Mann aus dem Mecklenburgischen, der das Fuhrwerk lenkte, gab dem kostenlos mitfahrenden Jungen immer dann diesen Befehl, wenn es steil bergab ging.
Mit einem kräftigen Schwung sprang Bernstorff herunter. Der schwere Kastenwagen schob schon sehr stark gegen die zwei Zugochsen, die sich in ihren Jochen dem Druck entgegenstemmten.
Schnell drehte er an der Bremse, den etwa einen Fuß langen, rund geschmiedeten Eisenschwengel, sodass die Bremsbacken - Holzklötze so groß wie ein Ellenbogen - quietschend auf die Metallreifen der Hinterräder gedrückt wurden.
Nun musste er genau aufpassen, wie viel Bremskraft nötig war. Mal war die Bremse zu lockern, mal wieder anzuziehen. An einem besonders steilen Bergstück des durch Fahrspuren zerfurchten Weges ließ er die Räder blockieren; sie rutschten knirschend auf kleinen Steinen und Sand weiter; der Wagen drückte gegen die Zugtiere.
„Gut gemacht, Bernstorff!“, hörte er Zentner rufen: „Die Bremse lockern und wieder anziehen, damit die Ochsen gut im Zaume gehalten werden. So halte es immer im Leben: Lerne das Loslassen und das passende Anziehen der Bremse, damit das Wilde und Ungestüme in der Natur gebändigt wird. - Siehst du die nächste Höhe dort? Da machen wir Pause."
Als die letzte Anhöhe erreicht war, hatten sie einen herrlichen Blick auf die Stadt: zwei mächtig aufragende spitze Kirchtürme. Um die Stadt herum lief ein doppelter Mauerring mit einigen Türmen. Die Stadtbefestigung wurde von fünf Stadttoren unterbrochen, zu denen zahlreiche Fuhrwerke unterwegs waren.
Weit im Westen traf die Korbacher Hochebene auf die Ausläufer des Rothaargebirges. „Wie hoch die spitzen Kirchtürme in den Himmel ragen!", rief Bernstorff aus.
Aber Zentner streckte den Arm vor und zeigte über die Stadt hinweg auf die Ausläufer des Rothaargebirges. Er sagte: „Siehst du dort auf der anderen Seite der Stadt, ein paar Kilometer gen Westen, siehst du den Berg mit einem burgähnlichen Schloss, das dem Himmel noch näher ist als die spitzen Kirchtürme?
Das ist der Eisenberg mit dem Sitz des Waldecker Grafen. Dort oben lässt er ein Goldbergwerk betreiben. Die Bergarbeitersiedlung Goldhausen ist nur ein paar Minuten von seinem Schloss entfernt. Ein Schacht von 200 Meter Tiefe führt im Dorf in den Berg hinein.“
Das hörte Bernstorff mit sofort erwachter Begeisterung für ein Abenteuer. Er überlegte still: „Wie schaff‘ ich es, in den Berg hinein zu kommen? Wer zeigt mir den Weg zum Gold?“ Laut fragte er: „Lässt man uns in den Berg hinein, wenn wir das schwere Gerät abliefern?"
Fuhrmann Zentner jedoch sprach belehrend weiter: „Ich habe dir etwas anderes klar machen wollen: Wer das Gold hat, der ist dem Himmel wirklich am nächsten. Der Graf mit seiner Wohnburg überragt die beiden Kirchen. Früher war das anders. Die Gotteshäuser waren die höchsten Gebäude in der Stadt, in der ja auch der Graf bis heute sein Hauptschloss hat. Aber seitdem in Korbach die Reformation eingeführt wurde, wohnt der Graf in größerer Höhe als alle anderen, und er hat jetzt auch die beiden Kirchen in der Hand."
Bernstorff hatte sofort den ersten Satz in sein Gedächtnis genommen und sprach ihn innerlich nach, um ihn fest zu behalten: „Wer das Gold hat, der ist dem Himmel wirklich am nächsten." Aber laut wiederholte er den letzten Satz: „... und jetzt hat er auch die beiden Kirchen in der Hand."
3. Kapitel: Durchs Tränke-Tor in die Stadt
Das Ochsengespann war über die Strother Straße den Berg heruntergerollt und näherte sich dem Befestigungsring der Stadt. „Bernstorff!“, rief Fuhrmann Zentner und ließ die Peitsche knallen, damit die beiden Ochsen kräftiger in ihre Joche drückten.
„Komm nach vorn, setz dich zu mir, wir fahren gleich durchs Stadttor.“ Zentner kannte die Stadt von mehreren Reisen und erklärte:
„Wegen der Viehtränke ganz in der Nähe nennen die Korbacher es das Tränketor.“
Bernstorff schwang sich vom Wagen, lief nach vorne und nahm neben Zentner Platz. Zentner, eine von Natur aus schon stattliche Gestalt, hatte sich recht in Pose gesetzt. Derweil fuhr Bernstorff mit den Händen durch sein blondes Struwwelhaar, damit es etwas gefälliger aussah.
Er zog die Jacke gerade und klopfte sich den Staub von den Hosenbeinen, denn er wusste, dass auf jedes auswärtige Fuhrwerk, das in die Stadt hereinrollte, viele neugierige Blicke fielen. So kannte er das Neugierverhalten von zu Hause in Erfurt: Neu ankommende Reisende in der Stadt bedeuteten auch neue Nachrichten von weit her.
Frauen mit kleinen Kindern oder mit einem Säugling auf den Armen blieben stehen. Handwerker, zu Fuß oder mit einem Fuhrwerk unterwegs, verharrten und schauten, ob ein bekanntes Gesicht unter den Neuankömmlingen war. Alle gafften.
Bernstorffs Blick fiel auf zwei etwa vierzehnjährige gutaussehende Mädchen. Die eine, vornehm und mit hübschem Gesicht, tuschelte der nicht weniger schönen Begleiterin etwas zu. Beide trugen grüne Jägerkleidung und hatten lange braune Haare, deren Locken die Schultern berührten.
„Prächtige Ochsen“, sagte die eine, worauf beide loskicherten und immer wieder halb verstohlene Blicke sowohl auf die Zugtiere als auch auf den stattlichen Wagenlenker sowie seinen sportlichen jungen Mitfahrer warfen.
„Woher kommt das Gespann?“, fragte die Vornehmere laut und blickte sich um, und zwar auf eine selbstsichere Art, die darauf hinwies, dass sie es gewohnt war, Anordnungen zu geben.
Da trat aus der Menge einer von zwei etwa fünfzehnjährigen Jungen hervor. Er trug eine braune Kappe mit einer Fasanenfeder. Dem schönen Fräulein antwortete er mit kräftiger, klarer Stimme: „Sie kommen aus Erfurt in Thüringen. Ich hab es gehört, als die Stadtwachen das Tor frei gaben.“ Gleichzeitig machte er eine Verbeugung, indem er seine Kappe mit der Hand gegen die Brust drückte. Sein Freund ergänzte trocken: „Ja, aus der Stadt des Dr. Martin Luther!“
Die beiden jugendlichen Damen blickten kurz zu den Jungen hin; die Vornehme machte eine leichte Bewegung mit der Hand, um zu zeigen, dass sie verstanden hatte. Gleichzeitig trafen die braunen Augen ihrer Begleiterin nur kurz auf den Blick des Jungen mit der Fasanenfeder. Der konnte kaum verbergen, dass ihn das schöne Gesicht des Mädchens anzog. Er hörte nicht auf, sie wie gebannt anzusehen.
Die Mädchen aber, statt ein kurzes Dankeswort zu sagen, drehten sich weg und setzten lustig ihre Unterhaltung fort. Der Kamerad des Jungen mit der Fasanenfeder trug an einem Stock ein Säckchen über der Schulter. Den Stock zierten Schnitzereien, die er mit seinem Messer eingeritzt hatte.
Als er sah, dass die Mädchen weitergegangen waren und außer Hörweite bei den Wachen am Stadttor standen, fügte er hinzu: „Der auf dem Ochsenwagen ist bestimmt ein Neuer für unsere Schule. Er ist nicht arm, denn sein Wams hat einen Kragen aus grünem Samt. Das gräfliche Fräulein Margarete hat sich für ihn interessiert.“
„Und du hast mit deinen Blicken die Begleiterin des gräflichen Fräuleins verschlungen", bemerkte der mit der Fasanenfeder. „Wieder einer aus Thüringen. Rektor Lange wird sich freuen", fügte er hinzu, denn er wusste, dass die aus Thüringen in der Regel Lutheraner waren.
Fuhrmann und Kaufmannsgehilfe Ulrich Zentner hatte gerade die Lenkseile auf den breiten Rücken des Leitochsen klatschen lassen und mit einem kräftigen „Hüh!" das Gespann in Gang gesetzt, als ein Geschrei und Gedränge der Menschen um den Wagen herum ihn aufschreckte. Er zog an der Leine, und mit seinem „Brr!" blieb der Wagen wieder stehen.
„Du Lump, lass Dich nie wieder in Korbach blicken!", schrien zwei Stadtknechte. Bernstoff sah, wie die Menge zurückwich, während verschiedene Stimmen das Geschehen mit „Vorsicht! Weg da!" und „Hinaus mit ihm!" kommentierten.
Zwei kräftig gebaute Stadtknechte, einer mit einer Hellebarde bewaffnet, nahmen einem etwa zwanzigjährigen, zerlumpt und unrasiert aussehenden Mann, der sich duckte und verängstigt dreinsah, die Handfesseln ab, um sodann mit Ruten auf ihn einzuschlagen. „Hier, nimm diese Rutenstreiche, du Lump, und lauf aus dem Stadttor hinaus. In Korbach haben Schufte wie du, die saufen, lärmen und Bürger belästigen, nichts zu suchen!"
Dazu bekam er immer wieder die Ruten über den Rücken gezogen, wobei er jedes Mal laut aufheulte. Endlich gab die Menge noch etwas mehr Platz frei, sodass er zuerst ausweichen und schließlich laufen konnte.
Zentner sagte schmunzelnd: „Siehst du, Bernstorff, die Korbacher sorgen für Sicherheit und Ordnung in ihrer Stadt. Soeben hat ein Gauner und Herumtreiber seine gerechte Strafe bekommen. Sie jagen ihn mit Rutenstreichen aus der Stadt. Er kann wohl froh sein, dass er so gut dabei wegkommt. Anderswo gibt es härtere und unchristlichere Strafen."
(Foto G.M.: Ausgespannte Zugochsen) 1
4. Kapitel: Ankunft
Das Ochsengespann rumpelte die Tränkestraße entlang. Zentner überlegte, welches seiner Ziele er zuerst ansteuern sollte. Dabei dachte er für sich: „Ich werde den Jungen zu seiner neuen Wohnung in die Rathausgasse bringen, und danach fahre ich in die Enser Straße und lade mein wertvolles Gerät für den Goldbergbau des Waldecker Grafen ab. Auch die Ware für die Korbacher Färber soll ich dort lagern. Der Graf will ja, dass alles im Steinhaus gelagert wird, weil es dort sicher vor Feuer und Diebstahl ist.”
Dann wandte er sich zu Bernstorff und sagte: „Ich fahre dich zu deiner Gastfamilie Trumming. Später werde ich am Steinhaus in der Enser Straße abladen.
Du musst wissen, dass die Arbeit im Steinhaus nicht jedermanns Sache ist. Viele Korbacher fürchten sich vor dem alten Gebäude. Sie nennen es das Spukhaus, weil dort nachts Geister hausen sollen. Im Stillen dachte er: „Ich habe noch nie etwas bemerkt, aber nachts würde ich mich darinnen auch nicht aufhalten.“
Man kann ja nie wissen! Bei diesen Gedanken näherte sich das Fuhrwerk der Einmündung in die Rathausgasse.





























