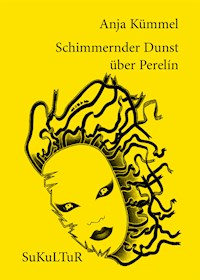9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hablizel
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
London in nicht allzu ferner Zukunft. Private Überwachungsorganisationen und chinesische Konzerne kontrollieren die Stadt. Ihre Bewohner sind gechippt und permanent online, sämtliche Interaktionen in der Cloud gespeichert. Nur im East End leben einige Anonyme, die sich der ständigen Beobachtung entziehen. Im Jahr 1980 macht sich der junge Mexikaner Mesca von Los Angeles auf den Weg nach London, um seine verlorene Liebe zu suchen. Doch statt auf Post-Punk und New Wave trifft er auf eine düstere Stadt voller Drohnen und futuristischer Technologie. Und auf einen Typen im Hasenkostüm, der ihn mitnimmt in den Maschinenraum dieser schönen neuen Welt. Island in nicht allzu ferner Zukunft. Fenna kehrt der von Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit gebeutelten Insel den Rücken und nimmt einen Job als Auftragskillerin in London an. Statt in einer High-Tech-Metropole findet sie sich jedoch in einem leicht verschobenen London des Jahres 1980 wieder. Im legendären Club „V" gerät sie in den Sog der schillernden New-Romantics-Bewegung und verliebt sich in den unnahbaren E., der ihrem Opfer verdammt ähnlich sieht. In einem ehemaligen Sanatorium am Rande Londons treffen die beiden aus der Zeit Gefallenen schließlich aufeinander. „V oder die Vierte Wand" ist ein ebenso fesselnder wie außergewöhnlicher Roman. Wie ein mehrfach in sich verdrehtes Möbiusband schrauben sich die verschiedenen Zeitebenen und Erzählstränge ineinander. Anja Kümmel setzt sich in ihrem sprachlich ganz eigenen Flow mit den Themen Identität, Überwachung, Erinnerung und den sozialen Implikationen technologischen Fortschritts auseinander. Der Titel ist nominiert für die Hotlist 2016.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DIE VIERTEWAND
ANJA KÜMMEL
Erste Auflage 2016
© 2016 Hablizel, Lohmar
Alle Rechte vorbehalten.
Korrektorat: Christian Rief
Gestaltung / Satz : Bureau Mario Lombardo
Erschienen bei Hablizel, Lohmar
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-941978-22-5eISBN 978-3-941978-23-2
www.hablizel-verlag.de
Prolog
Donnerstag, 16:48
Was ich jetzt sage, ist nicht für die Cloud. Es ist für mich, Fenna.
Ich werde nichts davon teilen können. Niemand wird es liken, taggen, kommentieren.
Der einzige, mit dem ich manches teile, ist dieser schwule Mexikaner. Der vermutlich verrückt ist. Er behauptet, einen Wächter zu besitzen. Oder sogar mehrere, ganz sicher scheint er da selbst nicht zu sein.
Wächter – diese Mini-Kamera-Hubschrauber, die überall in London rumfliegen. Sie haben die Dinger auch in Reykjavík getestet. Es gab Proteste; das Ganze war von Anfang ein Flop. In Island gibt’s ja keine Anonymen. Oder besser gesagt: Alle sind anonym. Denn niemand ist gechippt. Trotzdem gibt’s so gut wie keine Verbrechen. Der Regierung fehlte jede Rechtfertigung.
Der Mexikaner nennt sich Mesca. Er hat alles Mögliche geschluckt, in seiner Jugend, von der er redet, als sei sie ewig her. Vor allem eine Droge namens Mescalin, daher der Name. Vielleicht hat er sich das aber auch nur ausgedacht. Den Namen und die Droge.
Die Wächter will er mir nicht zeigen. Zu gefährlich, sagt er.
Aber das Steuerelement. Das gibt es wirklich. Ich hab’s gesehen. Es sieht aus wie ein FlexxPad.
17:01
Wahrscheinlich ist Mesca verrückt.
Gut möglich aber auch, dass ich verrückt bin.
Wie ich hier auf dieser Müllhalde hocke und mit meinem Pad rede, das jetzt nur noch als Diktiergerät taugt.
Tāmā de! Jetzt hat mich diese Zeit, in der ich fälschlicherweise gelandet bin, schon so weit, dass ich von ihr als Jetzt denke. Dabei ist die Zeit, aus der ich komme, in der ich eigentlich in diesem Augenblick sein sollte, das Jetzt! Oder anders: Der Bekloppte und ich sind – wie auch immer das passieren konnte – in ein ziemlich desolates Früher gefallen, das es so nie gegeben hat.
Wer jetzt denkt, das klingt total abstrus, hat absolut recht.
Aber zumindest habe ich eine Theorie, wie alles anfangen hat.
I
es regnet. tag und nacht.
häuser stehen auf dem kopf. menschen sprechen mit sich selbst. durch manche von ihnen kann man hindurchfassen, als wären sie luft.
nach etwa sechs tagen in london lässt der regen nach.
zwei oder drei tage waren wir draußen im verseuchten äußersten osten; drei tage saßen wir auf j.d.s couch und haben huiyún gespielt. j.d. hat diese dinger, die er pads nennt, auf den tisch gelegt. eins für sich, eins für mich. und dann kamen aus der gegenüberliegenden wand superschnelle, ultralaute fighter rausgeflogen. sie sausten durch staub und asche, direkt auf uns zu. wir mussten die fighter sehen, bevor sie uns sahen, irgendwie herummanövrieren um diese massen von asche, und dann mussten wir sie abschießen. mit unsren fingern.
nach jedem level sagt j.d.: teilen, steht auf, holt nachschub an dünnem bier und fettigen käsesandwiches. manchmal piept dann sein pad, er brummt: ja ja, zu viel cholesterol, und wenn es ihm zu blöd wird, zieht er seine jacke über. dann ist das pad still.
meist sieht es aus wie ein zippo-feuerzeug, dessen eine seite aus glas besteht. manchmal aber auch wie eine muschel. oder ein flaches, sehr dünnes armband. es ändert seine form, wenn man gerade nicht hinschaut, und manchmal auch seine farbe. das teil, das er mir geliehen hat, liegt da wie tot, wenn wir gerade nicht damit spielen. seins ist ein wunderding, meins wohl eher so was wie eine stinknormale fernbedienung.
hin und wieder wirft j.d. eine kleine weiße pille ein und rollt sich auf der couch zusammen. für mich bedeutet das: ein paar stunden schlaf. schlaf, aus dem ich manolo zu verbannen versuche. weil selbst das träumen von ihm hier keinen sinn mehr macht.
sobald j.d. wieder wach ist, ist das nächste level dran. so geht das drei tage lang.
dann, plötzlich, stehen die fighter still.
ich warte drauf, dass was passiert, aber nichts passiert. ich sehe zu j.d., der regt sich nicht. ich sehe zur wand. da blinken stumm zwei worte: HIGH SCORE. ich habe jedes spiel verloren.
etwas fehlt. das unablässige geprassel an den scheiben.
j.d. lauscht, nun höre ich es, er lauscht wie ich in das summen des gebäudes, das rauschen der A12 tief unter uns hinein. dann ballt er die faust, zerknüllt den himmel, an dem die flugzeuge stehen, wie ein blatt papier, und sagt: eh.
die wand ist, ohne den himmel, auf einmal sehr grau. der raum wirkt winzig, unsrer kampfgeschwader beraubt.
j.d. geht auf den balkon und streckt die hand raus.
pisst nicht mehr. eh!
so reden die leute in E16. verstümmelt, durchmischt mit lauten, die ich nicht verstehe. vielleicht reden so die leute in ganz london. j.d. und seine eltern jedenfalls. sie leben in einem siebenundzwanzigstöckigen hochhaus in E16. seine schwester und ihr baby in carradale, wo auch immer das ist.
wir müssen auf die insel, hat j.d. gesagt. schon vor tagen, und ich glaube, er hat gemeint: sobald es aufhört zu regnen. jetzt hat es aufgehört. ich beuge mich runter und binde meine schuhe und stecke einen teil von gerris koks ein. der rest ist draußen im verseuchten äußersten osten, an einem sicheren ort.
j.d. hat mich nicht aus nächstenliebe aufgenommen. auch nicht aus geilheit. er ist nämlich gar nicht schwul. obwohl er bei unserer ersten begegnung diese komische, grelle kleidung trug. an seiner wand räkeln sich, jetzt wo die flugzeuge weg sind, nackte mädchen. manchmal bewegen sie sich, aber meist liegen sie ziemlich still. keine von ihnen hat einen schwanz. anscheinend steht j.d. nicht auf schwänze. er will mir nicht an die wäsche. er will was ab von meinem stoff, genauer gesagt: vom geld, das wir dafür kriegen. j.d. kennt jemanden, der ihn will. behauptet er. halbe-halbe, hat er gesagt. halbe-halbe. diese worte kenne ich. sie sind so schön, dass ich ihn küssen könnte. aber ich halte mich zurück.
j.d. hat beim schimmernden bären im untergeschoss der paddington station gewartet. natürlich nicht auf mich. auf wen, weiß ich bis heute nicht.
mir war schwindlig und übel, seit 24 stunden kein schlaf und nichts zu beißen. das schiff war in bristol gelandet. dann hatte ich den zug genommen – british rail heißt das hier –, auch das als blinder passagier, eingeklemmt zwischen koffern und katzen in transportboxen. kontinuierlicher niesel schlug gegen die scheiben, und es war bitterkalt. nach drei, vier wochen auf dem meer dachte ich, ich würde noch immer von sanften wellen hin und her gerollt. der zug hielt, aber der boden schwankte noch immer, und die decke, der himmel, was immer es war, wölbte sich, pulsierte: ich wusste nicht, dass london zwei sonnen hat. da war eine treppe, die aussah, als führte sie nach unten. tatsächlich brachte sie mich dem gewölbten himmel näher. dabei hatte ich eigentlich die untergrundbahn gesucht. die gestirne nahmen zu. keine sonnen: ovale, pochende organe. faserige sonnenschirme, vor jahren ins wasser gefallen. es gab da unten, also über mir, eine strömung, ein sanftes schaukeln, das die schirme torkeln ließ wie riesige quallen, die leuchteten. dann ging der himmel aus.
ich hatte mir einen stadtplan besorgen wollen. ich hatte in den verwinkelten straßen von covent garden das V suchen und dann dort hingehen wollen, jeden dienstag, zur nacht für helden, so lange, bis ich manolo gefunden hätte. aber irgendwie war dies nicht das london, das ich erwartet hatte. es war ein ganz, ganz anderes london. es war nicht mal ein stadtplan zu finden. weit und breit kein zeitungskiosk, kein buchladen, nicht ein einziges geschäft, das irgendetwas normales verkaufte. irgendetwas, das ich erkannte. so was wie: schuhe, klamotten, souvenirs.
dabei war ich in einer art einkaufszentrum gelandet. menschen gestikulierten und lachten, manche sprachen laut zu sich selbst, andere bewegten stumm die lippen. ich verstand nur die, die mir sehr nah kamen. wär das nicht was für dich?, sagte zum beispiel eine schlanke blondine zu einem pummeligen mädchen. die blonde zeigte auf irgendwas, das träge in einem der schaufenster rotierte. neunundneunzig prozent übereinstimmung mit deinen pals. vierundsechzig likes von interests und potentials!
xuàn!, hauchte die kleine dicke.
unwillkürlich drehte ich den kopf nach dem ding, auf das die blonde zeigte. es war klein, flach und pink.
als ich wieder geradeaus schaute, war die blonde im begriff, mir auf den fuß zu treten. sie lachte das mädchen an, so als würde sie mich gar nicht sehen. ich verharrte, wie ein kojote im scheinwerferlicht, gefasst auf den zusammenprall.
doch wir stießen nicht zusammen. die blonde ging einfach durch mich durch.
keine kollision, kein streifen, nicht mal ein luftzug.
alles um mich rum bewegte sich. viel zu schnell. der himmel blieb verschwunden. noch immer kein stadtplan, kein zugang zur metro, keinerlei aussicht auf orientierung.
dann sah ich den halbdurchsichtigen, schimmernden bären. er trug einen koffer in der hand, einen schlapphut auf dem kopf und schaute ziemlich verloren. so, als würde er schon seit stunden vergeblich auf jemanden warten. menschen gingen eilig um den bären herum oder durch ihn durch, so wie die blonde eben durch mich hindurch gegangen war.
neben dem bären tänzelte ein nervös zuckender, bleicher junge von einem bein aufs andere.
irgendetwas an ihm wirkte vertraut. dabei sah er manolo kein stück ähnlich. im vergleich zu seiner bunten kleidung waren die haare und die augen dieses jungen beinahe absurd farblos.
es war sein warten. es war ein warten, das ich kannte. vom eingang des gold cup, von den stufen der baptistenkirche.
vielleicht konnte er mir weiterhelfen. irgendwie.
ich atmete durch. lockerte die knie. visualisierte eine gerade. auf den jungen zu. lässig in seine richtung schlendern, den blick auf den schlapphut des bären geheftet.
und richtig: der junge sprach mich an.
was er sagte, war eine art trockenes husten. ich musste zweimal nachfragen, bis ich ihn verstand.
ami, eh?
ich nickte, obwohl das ja eigentlich eine lüge war.
erst jetzt, nach einer knappen woche, gewöhne ich mich dran, wie hart er die worte hervorstößt. verschliffene schnalzlaute, unmotiviert aneinandergereiht.
der junge fasste mich unsanft am oberarm. tastete da herum, befühlte die weiche innenseite, drehte mich, als wäre ich ein lebloses mannequin, besah sich auch den anderen arm, nahm schließlich meine hände und drückte in den hautfalten zwischen daumen und zeigefinger herum. dann ließ er mich los. sein kinn ruckte.
eh!
es klang anerkennend diesmal, ein bisschen herausfordernd fast.
auf dem gesamten weg in den verseuchten äußersten osten sagte j.d. kein wort. die bahn, die wir nahmen, sah noch futuristischer aus als die national rail, mit der ich aus bristol gekommen war. wir gingen bis zum ende des bahnsteigs und betraten den hintersten waggon durch die hinterste tür, die sich nicht automatisch öffnete, die j.d. aber mit einem kleinen flachen gegenstand in sekundenschnelle aufbekam. das ganze ging so smooth wie ein autodiebstahl in downtown.
wir fuhren eine lange strecke. draußen war es erstaunlich dunkel; nur abenteuerlich gezackte häusersilhouetten, die sich kaum vom himmel abhoben. und ich hatte gedacht, london sei ein lichtermeer.
wo war die stadt, von der die rockats erzählt hatten? von der manolo geschwärmt hatte?
ein paar mal machte ich den mund auf, um j.d. nach dem V zu fragen. und klappte ihn dann einfach wieder zu. von meile zu meile erschien mir die frage absurder. das V immer undeutlicher. wie etwas, das im rückspiegel sehr schnell kleiner wurde.
es dauerte, bis wir die stadt hinter uns gelassen hatten. ungefähr so lange, wie es dauert, von hollywood bis in die wüste zu gelangen. nachdem wir aus der bahn gestiegen waren, gingen wir noch eine ganze weile zu fuß. nieselregen benetzte unsere haut. ich wollte wissen, warum hier nichts war, und j.d. sagte: weil das hier der verseuchte äußerste osten ist.
vor uns kroch dämmerung über den horizont.
ich fragte: warum verseucht?
er rollte mit den augen und murmelte was von pestopfern und verbranntem müll.
nach ungefähr zwei meilen ragte aus der platten graswüste ein imposantes gebäude empor. verfallen, allerdings.
war mal n sanatorium. fengzi.
mehr war aus j.d. nicht rauszukriegen.
irgendwann müssen im verseuchten äußersten osten also doch menschen gelebt haben, dachte ich. vielleicht war dies einst ein riesiges parkgelände außerhalb der stadt, ein rückzugsort für superreiche. irgendwann in den vagen jahrhunderten zwischen pestkatastrophe und müllverbrennung.
wir erklommen die halbzerbröckelte veranda und stiegen durch ein glasloses fenster ins innere.
j.d. machte licht mit einem kleinen gegenstand, keine taschenlampe, aber so was ähnliches. sein pad, vermute ich jetzt, wo ich’s im schwach flackernden licht seines zimmers gesehn hab, sein pad in einer anderen form. das licht war sehr hell dafür, dass das, was es produzierte, in seinen handteller passte.
botschaften und zeichen zierten die wände, aber ich hatte keine zeit, sie zu deuten. wir durchquerten eine reihe von zimmern, alle mit wildem graffiti bedeckt. j.d.s lichtgekrakel zuckte darüber und verschwand, zuckte darüber und verschwand … als würde ich von jemand sehr ungeduldigem binnen minuten durch ein weit verzweigtes höhlensystem voller urzeitlicher malereien geschleift.
zuletzt kamen wir in einen großen raum mit hohen decken. sah aus, als wäre hier mal ein speisesaal gewesen. durch drei hohe fenster fiel schwaches licht; in der mitte stand ein alter flügel. ansonsten war der saal völlig leer. auch die wände waren kahl. j.d. bedeutete mir stehenzubleiben. das licht zeigte zu boden. da war etwas. bewegung. sich wiegende bündel kauerten um den flügel herum.
wèi, sagte j.d.
zwei der bündel drehten ihre köpfe, und j.d. leuchtete in ihre gesichter.
pickelige haut, lange wimpern, darunter neugierige, leicht feindselige blicke, substanzgedämpft: ein haufen gestalten, die man so oder ähnlich auch in disgraceland oder im canterbury hätte antreffen können.
zum ersten mal seit meiner ankunft fühlte ich mich richtig. das heißt: nicht völlig aus der zeit gefallen. ausgerechnet da draußen, im zerfallenen sanatorium.
hier ist das anders. in diesem siebenundzwanzigstöckigen gebäude, in dem j.d. mit seinen eltern haust. hier bin ich ein fremder, der nichts begreift. die einsamkeit, die sinnlosigkeit meines hierseins, höhlt mir den bauch aus. das V in der erinnerung zusammengeschnurrt zu einem winzigen punkt. keine mission mehr, außer j.d. zu folgen.
auf die insel, hat er gesagt.
das licht flackert einmal pro stockwerk, auf dem weg nach unten – zuverlässig – neunzehn mal.
auch an den innenwänden des fahrstuhls prangt graffiti. allerdings sind die schmierereien hier nicht halb so kunstvoll wie die im sanatorium. der boden klebt undefinierbar; ein halbliter-styroporbecher rollt mit jedem rucken von einer ecke in die andere.
draußen ist es kühl. es ist, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, immer kühl. j.d. behauptet, es sei sommer, aber so ganz glaube ich ihm nicht.
über einen klobigen betonsteg mit massivem geländer bewegen wir uns hinein in die kalte, viel zu dunkle nacht.
von außen sieht der zweigeteilte betonklotz mit seinen schmalen, schießschartenartigen fenstern aus wie ein gefängnis oder ein wachturm. beim reinkommen war ich zu müde, der regen zu dicht oder die nacht zu dunkel, um darauf zu achten.
j.d., fällt mir ein, hat sich nicht von seinen eltern verabschiedet. sein lou dou schlief im sessel, als wir rausgingen, seine mutter war keine-ahnung-wo. AFRO-tower steht in unregelmäßigen, rostgestreiften buchstaben neben dem eingang. irgendwie lustig: ich hab im ganzen gebäude keinen einzigen schwarzen gesehen. dafür massenweise inder. auf j.d.s flur roch es die gesamten drei tage über nach curry. ich nehme an, die inder sind für london das, was wir mexikaner für l.a. sind. aber das gehört zu den dingen, die ich j.d. lieber nicht frage.
ohnehin macht hier, wo sich die A12 und die A13 ineinander verknäulen, der lärm das reden unmöglich.
wir sind zu fuß unterwegs. stumm passieren wir die zufahrt zum blackwall-tunnel. j.d. hat mir die stelle auf seinem pad gezeigt. ich frage ihn nicht, woher sein pad all das weiß. ich frage ihn auch nicht nach den autos, die aussehen wie aerodynamische mehrzweckobjekte aus einem science-fictionfilm. ich frage ihn nicht nach den schwindligmachenden glasbauten, die sich zu unsrer linken erheben. sie sind unten schmaler als oben und winden sich auf eine art und weise, die ich glas und stahl nie zugetraut hätte, fünfzig oder mehr stockwerke in die höhe. ich frage nicht nach der dunkelheit, die über E16 liegt. im AFRO-tower und in den umliegenden wohnblocks brennt vereinzelt licht. die straßen dagegen sind stockdunkel. und auch die glas-und-stahl-konstruktionen, die tags den regen spiegeln, werden nachts zu toten, schwarzen flächen. in l.a. waren die nächte so hell, dass man keine sterne sah.
ich stelle keine fragen. auch dann nicht, als die motorengeräusche verklingen.
die komischen kugelautos verschwinden im blackwall-maul. wir biegen ab und gehen über einen kleinen friedhof, in dessen mitte eine weiße kirche steht.
dann wieder eine straße, auf der ungefähr jede dritte oder vierte laterne brennt. poplar high.
kein mensch, dafür eine drückende kälte von links. j.d. geht vor mir. er hat ein gesicht, das man in jedem stück dunkelheit vergisst. einzig die schatten unter seinen wangenknochen vergess ich nicht. sie sind klein und tief wie schusswunden.
kaum sind wir eine halbe meile gelaufen, fängt es wieder an zu nieseln. ich frage mich, wie weit noch bis zur insel.
und ihn: fahren hier nicht alle leute mit dem taxi?
das weiß ich aus filmen, die in england spielen.
j.d. schaut mich von der seite an. seine augen sind völlig farblos, auch im licht. du hast keinen chip, sagt er, in einem ton, als hätte ich ihn gefragt, wie man atmet.
okay okay, er hat es mir erklärt, da draußen. oder zumindest: versucht zu erklären. die leute hier haben chips in den armen. nein, keine kartoffelchips! mikrochips. das war übrigens auch der grund, warum wir in der bahn das mit den türen machen mussten.
MCs und MPs, meshchips und meshpads – mir schwirrt noch immer der kopf.
mexiko ist ein bisschen hinten dran, technologisch gesehen, rechtfertige ich mich.
schließlich hab ich inzwischen kapiert, dass dies nicht nur ein fremdes land, sondern überdies eine fremde zeit ist. auch wenn ich keine ahnung habe, wie das passieren konnte.
als das schiff in new york auslief, war 1980. jahre müssen vergangen sein, da auf dem ozean. vielleicht sogar jahrzehnte. ich bin nicht sicher, wie viele, und es ist nicht leicht rauszufinden. man kann passanten auf der straße nach der uhrzeit oder nach dem datum fragen. aber: entschuldigen sie bitte, welches jahr haben wir?
ausgeschlossen.
sieht so aus, als müsste ich mich abfinden mit dieser fremden welt, all ihren zeichen und begriffen. E16. der osten. die insel. carradale. pads. huīyún.
schwer zu verstehen wären die briten auch 1980 gewesen, das weiß ich von den rockats. sie reden abgehackt, als hätten sie permanent schluckauf, und benutzen ausdrücke, die ich noch nie gehört habe. auch wenn die ausdrücke jetzt vermutlich andere sind. wann immer dieses jetzt ist.
eh, macht j.d., dann runzelt er die stirn. aber die kartelle …
jaaa, unterbreche ich ihn mit größtmöglicher überzeugung. die kartelle! das ist was anderes.
in einer spielpause hab ich’s ihm versucht zu erklären. wie ich mit dem zug von mexiko nach arizona kam, dann nach l.a., und von dort, jahre später, mit greyhoundbussen quer über den kontinent. wie ich als blinder passagier im hafen von new york in den bauch eines frachters kroch, und wie mich dieser frachter dann nach bristol brachte. jahreszahlen hab ich nicht erwähnt. manolo natürlich auch nicht. ohnehin denkt j.d. ja, dass ich ein bisschen ga-ga bin.
j.d. nickt und holt seinen drip tip raus. ich musste mir das lachen verkneifen, als ich ihn zum ersten mal dieses wort sagen hörte. drip tip, das klingt irgendwie nach schwulenporn. er behauptet, es sei eine art zigarette, aber für mich sieht es aus, als würde er auf einem teuren kugelschreiber rumkauen.
dachte, nur in paar afrikanischen wüstenstaaten wärn die leute ungechippt, nuschelt j.d. um das phallische ding herum. und island, eh.
in diesem moment höre ich zum ersten mal das brummen. es ist in der luft. irgendwo über uns, um uns. zu sehen ist nichts. zu sehen ist dafür was anderes, nämlich eine gigantische wand, die den himmel verdeckt. hinter den häusern, die man im licht der vereinzelten laternen erkennt, befinden sich noch viel höhere häuser. sie stehen so dicht, dass sie miteinander verschmelzen, und sind so hoch, dass man sie für sternenlosen himmel halten könnte.
mir wird noch kälter; die feuchtigkeit legt sich wie eine eisige folie um meine haut. wenn ich den kopf in den nacken lege, rutschen die gebäude nach hinten weg. die wolkenkratzer in new york waren freundlich, strahlten weihnachtsbaummäßige wärme ab. was hier den mond und sämtliche sterne schluckt, riecht nach tod. eine unregelmäßige reihe verrotteter zähne im maul einer bestie.
j.d. sieht all das nicht. oder er ist den anblick gewöhnt. er fummelt mit seinem drip tip. tröpfelt, schraubt, schnipst.
je näher wir der schwarzen wand kommen, desto deutlicher werden die zeichen ihres zerfalls: große stücke sind aus den türmen gebrochen, die spitzen entstellt – als hätte sich king kong oder godzilla mit den pranken daran zu schaffen gemacht.
um den schwindel dieser fremden welt zu vertreiben, denke ich das tröstende wort. freeway. stelle mir seine silben vor, seinen klang. free-way, summt es in mir drin wie ein schlaflied. free-way. free way …
einzig das summen, das außen ist, stört.
was ist das, frage ich.
da ist nichts, sagt j.d. mit flacher stimme. er versucht den rauch, vielmehr: den dampf, so lange wie möglich in den lungen zu behalten.
doch, da ist was. hubschrauber. irgendwo in der nähe fliegen hubschrauber. ich suche den himmel ab. doch da, wo himmel sein sollte, ist nur die schwarze wand. dann erinnere ich mich an ein wort, das j.d. benutzte: wächter.
aus j.d.s mund strömt eine weiße wolke, die nach vanille riecht.
das brummen, sage ich. könnten das die wächter sein?
chě! j.d. klingt bestimmt. die wächter sieht und hört man nicht.
ich höre sie.
noch mehr weißer dampf. du trippst, xiǎozi.
das ist eine weitere sache, an die ich mich langsam gewöhne: dass j.d. alle xiǎozi nennt, die nicht ganz offensichtlich mädchen sind.
stur schüttele ich den kopf.
ich spinne nicht. das brummen ist da. es ist ziemlich nah, und es kommt immer näher.
zwei oder drei tage waren wir draußen im osten. zwei oder drei tage, die ich brauchte, damit der schwindel sich legte. die seekrankheit aus dem schiffsbauch und die seekrankheit nach der ankunft in paddington. der schwindel des zeitsprungs, von dem j.d. natürlich nichts weiß. zwei oder drei tage, in denen j.d. mir die grundregeln dieser stadt erklärte.
erstens: wir gehören nach E16. E19 ist verbotenes dìpán.
zweitens: viele dìpáns werden von gangs regiert. cannies – von one canada – tragen rot. young cannies pink. doggies – von isle of dogs – tragen blau. puppies violett. dann gibt es noch die millwall sharks. die tragen gold.
drittens: manche gangs haben eine art spiel draus gemacht, wächter abzuschießen. je mehr wächter eine seite vom himmel holt, desto mehr punkte. j.d. sah mich an. wie bei huīyún. ich nickte, obwohl ich noch immer rätselte, was er mit wächter meinte.
klebriger kleinkrieg, redete j.d. weiter. gibt natürlich auch tote, manchmal. die regeln sind simpel: cannies gegen doggies, doggies gegen sharks. und alle gegen die AllSec.
an dieser stelle wagte ich eine verständnisfrage. AllSec? ist das sowas wie die regierung?
regierung? j.d. runzelte die stirn, so als hätte ich versehentlich in meiner sprache ein wort gesagt, das in seiner arschfick bedeutet.
die stadt gehört dem drachen, brummte er, so gleichgültig, als wäre es allgemeinwissen.
dem … drachen?
na den chinks. er lachte sein trockenes, keckerndes lachen.
chinks. den … chinesen? das war schwer zu verdauen. meines wissens liegt london in großbritannien, und das gehört irgendwie zu europa. oder auch nicht. jedenfalls ganz sicher nicht zu asien.
AllSec ist n ami-ding. ohne die gäb’s hier nur noch schutt und asche. wie nach der v-nacht.
er machte eine kurze pause, schniefte und spuckte liquid in ein loch der veranda.
v-nacht, dachte ich. das V, in dem ich manolo hatte suchen wollen, kam mir jetzt vor wie eine vage vorstellung aus einem traum. es hätte keinen sinn gemacht, j.d. danach zu fragen. er hätte mich bloß verständnislos angeglotzt. trotzdem klappte ich nochmal den mund auf. doch j.d. sprach schon weiter: die AllSec baut die kleinsten, feinsten wächter der welt. kaum zu treff…
wächter? ich musste einfach nachfragen. ständig benutzte er dieses wort.
wächter, wiederholte er. fliegende augen.
fliegende augen? ich begann mich wie ein absurdes echo zu fühlen.
na diese mini-hubschrauber mit eingebauten kameras und scannern … j.d. sah nun nicht mehr gelangweilt aus, sondern irritiert. gibt’s die in mexiko nicht?
doch, erwiderte ich hastig. wir nennen sie nur anders … ähm. wohin mit dem koks?
ich dachte: ich werf ihm das einfach mal so hin. um von meinem beschämenden unwissen abzulenken. und tatsächlich – jetzt guckte j.d. verdutzt. wie sollte er auch wissen, dass ich in new york nicht ohne ein paar hundert gramm der weißen dame an bord gegangen war. reinster kolumbianischer abstammung, versteht sich.
eine halbe sekunde später wurden seine augen glasig. die pupillen bewegten sich rasch hin und her, als würde er einen text überfliegen.
dann hauchte er: kào!
die leute hier sprechen nicht mit sich selbst – noch so eine sache, die ich langsam begreife –, sie sprechen miteinander, über länder und kontinente hinweg.
echtes koks, sagte j.d. findest du in diesem ganzen beschissenen land nicht mehr. nirgendwo in der eurozone. außer island.
schon wieder island. ich wartete, ob noch was kommen würde, irgendeine erklärung, aber es kam nichts.
stattdessen fing j.d. an mit seiner idee. überschlug sich wie ein junger hund. ein paar leute, behauptete er, wären bereit, eine menge geld für echtes koks. ja, er könne sich vorstellen, wer. ob er mir …? warum nicht. ich vermittel dir käufer, sagte er, plötzlich ganz hibbelig. und dafür krieg ich sechzig prozent. was sagst du?
ich sagte nichts.
er trat von einem fuß auf den anderen. halbe-halbe. hao bu hao?
ich zögerte. dann nickte ich.
ich weiß nicht, was es war. vielleicht nostalgie. vielleicht die tatsache, dass ich kein geld hatte und noch weniger ahnung, wie ich in dieser welt an welches kommen sollte. oder ganz einfach: die idee einer neuen mission.
etwas piept, und j.d. kommt torkelnd zum stehen.
als hätten seine zehen einen abgrund berührt, streckt er den hintern raus, die arme rudern in der luft.
dann fängt er sich. stocksteif, den zeigefinger auf den lippen. sein profil glänzt blau im lampenlicht, das pflaster schwarz vom regen.
die insel liegt jetzt direkt vor uns.
ich geh zwei schritte vor, breite die arme aus, dreh mich im kreis.
was erwartet er? elektromagnetische felder? unsichtbare fallstricke?
j.d. bewegt sich keinen millimeter. mir zittern die knie, xiǎozi. in seiner stimme schwingt panik. seine finger spannen und lockern sich, spannen und lockern sich. ich sehe das ständig; anscheinend ein verbreiteter tick.
E19, flüstert er. seit sein pad ihm die zonengrenze angezeigt hat, spricht er mit gesenkter stimme. das ist nicht unser dìpán … kopfschüttelnd kaut er auf seiner unterlippe rum.
du hast gesagt, hier lang, flüstere ich.
ja, flüstert er zurück, in einem ton, der jeden weiteren einwand erstickt. weil man anders nicht auf die insel kommt.
vor uns erhebt sich eine milchige glasröhre, die aussieht, als hätte man sie auf weiße speerspitzen gespießt. laut j.d. eine LRT-station. Light Rail Transport. das ist so was ähnliches wie die u-bahn, verläuft aber oberirdisch. vollautomatisch. auto-drive. LRT poplar, verkündet ein blaues schild. die schienen werden noch benutzt, aber diese station wird ganz offensichtlich nicht mehr angefahren. poplar ist das tor zu niemandsland.
ich bin nur hier, um dem typen seine ration zu verticken. ich sage es abgewandt, gleichgültig fast. dem typen, weil j.d. aus allem ein geheimnis macht.
j.d. seufzt. also gut. aber lass uns weiter westlich reingehen. der LRT-übergang wird tag und nacht von cannies bewacht.
am ärmel seiner crypto-jacke lässt er sich über die grenze ziehen. wir wechseln elegant die position. ich knete den knisternden stoff um seine schultern, schiebe ihn sanft von hinten an.
vibration, diesmal unter den sohlen. aspen way, verkündet j.d.s pad. eine hohe betonmauer trennt uns von den autos. doch das dröhnen ihrer motoren schluckt alles, übertönt sogar das vibrieren in der luft. wir gehen in diesem dröhnen unter, unsere schritte; ich fühle mich sicher darin, so sicher, dass ich zu summen beginne: hey, white boy, what you doin’ uptown? hey, white boy, you chasin’ our women around?
j.d. wirft mir blicke aus den augenwinkeln zu. er muss denken, ich hätte niemals angst.
dabei habe ich angst! fast jede nacht, auf seiner zu kurzen couch, während er sich durch seine oxycodonträume quält. und auch das summen in mir drin ist nichts als ein schwaches gegengift gegen den schwindel dieser stadt.
über unseren köpfen verzweigen sich tote LRT-linien.
ich hab das alles hier nur auf mich genommen, um manolo wiederzusehen. und bin in einer welt gelandet, in der es keinerlei sinn macht, auch nur nach ihm zu suchen. inmitten dieser trostlosigkeit lässt sich das leider schwer verdrängen.
bloß nicht heulen. ich geh ein stück voraus.
irgendwo in westferry, vor einer tunnelzufahrt, packt j.d. meine hand. wir rennen über die autobahn, acht spuren, mittelstreifen, eine niedrige mauer aus beton.
E19 – der schlund einer kalten, konturenlosen hölle. keine einzige laterne. niemand ist auf der straße. der mond von einer himmelfüllenden wolke verdeckt. j.d. folgt seinem pad, hinein ins nichts. der aspen way bleibt hinter uns zurück. solange der verkehrslärm in meinem rücken schwach zu hören ist, habe ich keine angst. doch j.d. entfernt sich vom tröstlichen rauschen der autos, geht entschlossen aufs wasser zu. zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass die schwarze fläche vor uns wasser ist. schwache lichtpunkte markieren ein jenseitiges ufer. eine gitterstruktur teilt das wasser, trennt uns vom fallen. j.d. bleibt stehen. ich weiß nicht, wohin. überall dunkelheit. feuchtigkeit schlägt mir ins gesicht. die stille ist vollkommen.
bis auf –
das knistern der rotoren. es ist wieder – oder immer noch – da. beinahe beruhigend in seiner gleichförmigkeit. als wären über unseren köpfen elektrische leitungen gespannt.
j.d. hört nichts. er tastet sich am geländer entlang. ich tue es ihm nach.
wir nehmen den uferweg, flüstert er. das ist weniger gefährlich. die cannies haben nur die häuser im innern besetzt.
warum?
die äußeren sind angreifbar. sein atem geht flach und zittrig. späher. vom surrey docks depot, wasserschutzpolizei und so.
wir tasten uns vorwärts. das abblätternde geländer überzieht unsere finger mit eisigem rost. einziger anhaltspunkt für eine welt außerhalb von kälte und schmerz sind die schwachen lichtkegel, die auf der anderen seite im wasser schwimmen.
auf dieser seite ist nichts als dunkelheit. ich sehe keine häuser, weder innen noch außen. nur schemenhafte silhouetten. zwei kopfstehende riesen. ein brontosaurus, der den hals reckt. ein phallus aus chrom und glas. daneben eine doppelhelix, die sich zwei-, dreihundert meter in den himmel schraubt. im himmel, eine undefinierbare wellenform.
schräg vor uns ragt ein kriegsschiff auf, mit lauter kleinen rettungsbooten, terrassenförmig abgestuft …
j.d. hält mich am arm zurück.
das geländer hat plötzlich aufgehört. unter uns fischige feuchte. irgendwo schnalzt wasser gegen stein.
in diesem moment gibt die wolke den mond frei.
tama de!, keucht j.d.
vor uns erstreckt sich ein loch, gigantisch wie ein meteoriteneinschlag. riesige skeletthände bohren sich von allen seiten in die dunkelheit. nicht zu entscheiden, wo land, wo wasser ist.
die demolierte skyline fällt mir ein.
ist hier … der dritte weltkrieg ausgebrochen?
j.d. gibt mir seinen mundwinkelzuckenden seitenblick. wir schleichen am rand des kraters entlang. das kriegsschiff entpuppt sich, als wir näher kommen, als treppenartiger häuserblock mit hundert kleinen balkonen.
man nennt es aufwertung, sagt j.d. so plötzlich, dass ich zusammenzucke. du denkst, hier wär’s schlimm? er lacht sein keckerndes, tonloses lachen. den meisten ländern geht‘s noch viel dreckiger. island zum beispiel. island hat sich schon vom ersten crash nicht mehr erholt …
island. schon wieder. mentale notiz: koks. und: crash.
mit gesenkter stimme redet j.d. weiter. überall hässliche gerippe und baulöcher, wo neue bankgebäude oder irgendwelche firmensitze stehen sollten, luxusapartments, was weiß ich … hier liegt erst seit zwanzigneunzehn alles brach.
zu unserer linken liegt ein gläserner wal, aus dessen zerbrochenem rücken bäume sprießen.
was ist das alles?
j.d. spreizt die finger. sein pad blitzt auf, und unter seinen lidern bewegt sich was.
das hier, j.d. zeigt auf den wal, war die canada one crossrail. die zwei türme da haben HSBC gehört, die pyramide der CCB, und das monstrum dahinter war die walmart mall. deren lichtspielereien waren chao xuàn. je nach stand des mondes fiel das licht so an den seiten runter, wie regen, in türkis, pink oder blau. hättste dir mal auf LL reinziehen müssen, xiǎozi.
äh … und jetzt?
hier ging’s nach einundzwanzig richtig ab. die riots. davon haste doch bestimmt gehört. sogar drüben in cali-for-NI-A!
hm, mache ich vage.
na jedenfalls – die bankgebäude standen leer, und überall scheiß-wohnungsnot, eh. dann kamen die gangs und haben sich die canary wharf unter den nagel gerissen. natürlich fanden die chinks das bùzǎdì. die ham ja damals schon hier spekuliert. also flogen paar bomben, sprengsätze und so …
da ist das wasser wieder. als wäre unsere kreisbewegung ins inselinnere nur einbildung gewesen.
von nahem sieht das gestrandete kriegsschiff aus wie ein hotel aus irgendeinem gruselfilm. diese verlassenen gebäude bilden also die stadtmauer um ein namenloses, gewaltbereites inneres, denke ich, während j.d. unbeirrt weitererzählt. entweder, er hat seine angst vergessen, oder er redet verzweifelt gegen sie an.
sein zittern, kapier ich allmählich, kommt gar nicht so sehr von der angst vor E19. das sind entzugserscheinungen. kein oxycodon und keine möglichkeit zu teilen, hier in niemandsland.
das knattern der unsichtbaren helikopter wird mal lauter, mal leiser.
… cannies, sagt j.d. gerade. das waren damals noch die cherries, zusammen mit den young cherries, die verfeindet waren mit den blacks und den …
hä?
j.d. bleibt stehen. du hast in l.a. gelebt, xiǎozi, knurrt er. die ganze made stadt wird von gangs regiert!
als ich dort war, nicht, will ich sagen. korrigiere mich dann aber und sage: dort, wo ich war, nicht.
schwaches mondlicht erhellt die promenade, dahinter schwappt schwarzes wasser. wir drücken uns an den mauern der toten häuser entlang.
na jedenfalls, wispert j.d., die sharks haben sich ums millwall dock rum postiert, und die doggies im süden. da isses sicher. meine schwester hat n kind von nem shark. die sharks und die doggies sind seit jahren zhì jiao. der norden ist quasi sperrgebiet, für uns sowieso, und überhaupt für alle, die noch n funken verstand im hirn haben.
aha, mach ich.
der norden ist so off limits, dass er n eigenen code gekriegt hat. weißte ja. E19.
äh, ja. und der süden?
na der wurde an SE angeschlossen. und heißt jetzt SE29.
aha, mach ich nochmal.
gleich am zweiten oder dritten tag hab ich j.d. von meinen aussetzern erzählt. damit er mich nicht für bekloppt erklärt, wenn’s passiert. mein hirn, hab ich gesagt, hat so ne art wackelkontakt. er seufzte bloß und ließ die stirn nach vorne fallen. scheiß-drogen, xiǎozi!
jetzt sagt er: ADS, eh?
letzte nacht hat sich das noch ganz anders angehört. wir waren beim huiyún; ständig sah ich diese jagdbomber im tiefflug, und dann fielen mir die einbeinigen auf dem boulevard wieder ein. ich hatte das gefühl, was sagen zu müssen, und da sagte ich eben was von napalm und vietnam. darauf j.d.: manchmal quatschst du, als wärst du aufm college gewesen, xiǎozi. nicht zu entscheiden, ob das bewundernd oder abfällig gemeint war. also hab ich ihm gesagt, dass ich nie auf dem college war, aber ziemlich viel lebenserfahrung habe. so wie es derzeit aussieht, stimmt das sogar.
zu unserer linken reißt ein stück himmel die häusersilhouetten auf. j.d. macht licht mit seiner hand. wie draußen im osten. wie zeus. für den bruchteil einer sekunde ist da eine freie fläche – vielleicht ein kleiner park. keine zehn fuß vor uns steht ein übergroßer mensch ohne gesicht. auf seinen schultern trocknet der letzte schauer. und wieder dunkelheit.
was ist das?, frage ich.
unser durchgang, flüstert j.d.
ich meine, wer?
ach so. seine augenlider zucken. so n kunstsammler. werbefuzzi. j.d.s stimme verflacht. hat früher mal der AllSec zum aufstieg verholfen mit seinen slogans … er stockt. seine pupillen bewegen sich. … dann TL … und zuletzt die LL-kampagne geleitet. na und eben kunst gesammelt.
wieso hat er kein gesicht?
hm. gab wohl wenig bilder von dem typ. hat um seine identität n großes geheimnis gemacht. j.d.s finger spreizen sich, als wollten sie ein insekt wegschnipsen. willste noch mehr wissen?
ich schüttel den kopf.
ganz ehrlich, xiǎozi, ich versteh von diesem kunstzeug nix. er steckt sein pad weg, und wir biegen ab ins inselinnere. was ich für einen park hielt, ist in wahrheit plattgetrampeltes geröll.
hier stand mal seine galerie. j.d. redet jetzt so leise, dass ich ihn kaum verstehe. bis zum brand von zwangzigneunzehn.
ganz kurz meine ich, schwelendes holz zu riechen. aber der brand, von dem j.d. spricht, muss jahre her sein.
ist das hier schon … SE29?
j.d. legt den finger an die lippen und schüttelt den kopf.
wir passieren apartmentanlagen, die aussehen wie groß gezogenes kinderspielzeug: vierecke aus spiegelglas, variable schiebeelemente, zur straßenseite hin spitzwinklige einflugschneisen, aufgereiht in symmetrischer ordnung. alle balkone sind leer, alle fenster dunkel. doch wenn man j.d. glauben schenkt, könnte hinter jedem einzelnen ein canny lauern, die waffe im anschlag. uns im visier.
j.d.s schritte werden von biegung zu biegung langsamer. ständig hebt er die hand ans ohr und lauscht. das surren der rotoren, das uns auch hier begleitet, hört er noch immer nicht.
hinter der nächsten kurve, auf der linken straßenseite, duckt sich zwischen den monumentalen glaskästen ein kleiner backsteinbau. das abgestufte spitzdach erinnert an das einer kirche. viktorianische säulchen zieren die rundbögenfenster. sie sind alle dunkel oder vernagelt. nur durch ein rundes stück buntglas unterm giebel dringt fahlrotes licht.
j.d. verlangsamt seinen schritt. seine schultern sinken sichtlich.
die fassade der turmlosen kirche ist ein rußverfärbtes mosaik aus rot und blau. links und rechts des vernagelten eingangs: eine weiße, schwenkbare kamera. drum herum ein maschendrahtzaun.
the peat, murmelt j.d. und rüttelt vorsichtig am tor.
wir warten. nichts regt sich. die mini-helikopter stehen, irgendwo über uns, still.
der mond verschwindet wieder hinter einer wolke, und ich merke, wie kaputt ich bin. so ist es immer, die müdigkeit schlägt hinterrücks zu. ich möchte sagen, ich leide an einer milden form von narkolepsie. die knie geben nach; mein hintern gleitet auf ein pilzförmiges eisending.
j.d.s hosenbeine riechen nach vanilledampf. er wippt zu einer musik, die ich nicht höre, sondiert die gegend, fummelt an seinem gürtel, die tasten seines pads leuchten silbern auf, pulsen, pulsen schwächer, verschwimmen dann in gnädiger dunkelheit.
merkwürdig, dass ihm jede musik, die er hören will, direkt ins ohr gespeist wird, er aber nicht mitkriegt, dass hubschrauber über unseren köpfen stehen.
seine finger sind dicht bei mir, zucken nervös. luftzug im haar. er hat gesagt, er dürfe nicht auf LL. nicht suchen, nicht teilen, nicht posten. sonst könnten sie ihn finden. was auch immer das heißt.
meine nase gräbt sich einen bau, gräbt nach wärme in schichten von textil. brennstoff und waschmittel. kein moschus da.
das knistern elektrischer leitungen, der rotoren, das federn von aircushioned-sneakers auf nassem asphalt, das vibrieren der atemluft aus j.d.s nase.
irgendwann hält er es nicht mehr aus: klick. rauschen. patrouille drei und vier quieken und scharren, wie ratten hinter einer wand, wie die tonspur eines alten super-acht ÷¿ film_ {TUCSON_arizona_(feb_1977)} H// riss
da ist ein
riss
in der wand, den wir täglich beobachten. er weitet sich, mit jedem tag, an dem zwei dutzend nackte rücken dagegen lehnen, ein bisschen mehr. dies ist ein erdbebengebiet, sagt luis.
wir warten. sie haben unsere schuhe und alles, was wir dabeihatten, auf dem weiten weg hier her.
es gibt nichts als diesen riss, worauf zu starren sich lohnt, nichts, das sich ändert. hoch oben sind zwei sonnen, oder das eine ist der mond. vielleicht war dies das kinderzimmer. es fällt kaum licht herein. decken vor den fenstern machen die luft stickig, schwer atembar. 90, 100 grad. sie sehen es, wenn wir uns an den vorhängen zu schaffen machen. manolo hat es getestet. nachts ist es heller als tags. tico, der älteste, hat eine uhr, wer weiß wo versteckt, aber niemand will die zeit wissen. die zeit ist irrelevant. wenn man sie wahrnähme, wäre sie gegen uns. die frauen – es sind nicht viele – sind im anderen raum. manchmal hört man durch die wand ein kind schreien.
der jüngste in diesem zimmer ist manolo. ich schätze, nicht älter als 16. er ist derjenige, von dem sie sagen: er wird es uns allen versauen. wie ein eingesperrter kojote schlägt er um sich, tritt mit nackten füßen gegen die wände, raucht, obwohl das rauchen verboten ist, drückt seine kippen im pissfarbenen teppich aus. einmal ging der rauchmelder an. sie kamen ihn holen. nichts in seinem gesicht, in seiner haltung hatte sich verändert, als er stunden später leise über die schlafenden stieg. sein oberkörper glänzte dunkel vor schweiß, der gürtel seiner weiten hose war enger geschnallt. in mir der wilde impuls, aufzustehen und ihn in die arme zu nehmen, fest seinen schmalen brustkorb ... aber ich blieb liegen, das gesicht auf den verschränkten händen, und stellte mich schlafend.
tico sagt, manolo kam den ganzen weiten weg von ecuador.
wenn manolo redet, dann schreit er, hysterisch fast, überkippend, und jemand muss ihn feshalten, damit er nicht die decken von den fenstern reißt. er schreit: ich brauch keine schuhe zum weglaufen! ihr diebe! diebe!! diebe!!!, bis er heiser ist.
das wasser wird knapper, die luft verdampfter schweiß, das warten unerträglich. manche betteln um telefonate. die schlepper holen uns einzeln. mich lassen sie in ruhe. meine zunge zerlegt das wort: freeway. freeway. free-way ... salvatore zahlt. ich habe, was er braucht, an stellen, von denen sie nichts ahnen.
leere plastikflaschen quellen aus den müllsäcken; zu dem gestank nach menschen gesellt sich der nach faulendem essen. am vierten oder fünften tag des eingesperrtseins höre ich auf, wir zu denken. starre den riss an, der größer wird. was, wenn sie nicht still lägen wie sardinen, wenn sie aufstünden und tanzten, alle gemeinsam auf und ab sprängen, sich gegen die wände würfen, was würde geschehen, wenn der riss sich dehnte, wenn das haus um uns einstürzte, wenn licht hereinflutete und wir plötzlich die straße sehen könnten und die stadt um uns einen namen bekäme ...?
doch nichts dergleichen geschieht. sie warten und fressen bohnen aus büchsen, im stupor an die wände gelehnt wie ...
halbtote, zischt manolo verächtlich zum schmierigen spiegel, als ich das bad betrete. ich zucke, unsinnig stolz, dass er ein wort an mich richtet. halbsteif, als würde er beim pissen immer schon ans ficken denken, keine hoffnung, keine angst –
ich starre und denke: free-way. das geld ist auf dem weg. vielleicht ist es längst da. in ein paar tagen ... und dann, als hätte mir jemand eine ohrfeige verpasst, treffen sich unsre blicke im spiegel: seine feuchten, überreifen lippen, das fleisch seiner wangen, das man zerbeißen möchte, von außen, von innen, die festen locken, die sein gesicht schmal und schattig machen; seine strahlenden zähne zermahlen das motto der doppelten klinge.
er ist der einzige, der sich noch die mühe macht, seine zähne zu putzen.
immerhin etwas hat meine mutter mir beigebracht, nuschelt er, den roten stiel im mundwinkel, schaut schwerlidrig über die schulter, den sehnigen arm aufs waschbecken gestützt. das bad ist schmutzig, aber hier, zwischen den unwesentlich kühleren kacheln, sind wir manchmal allein. in den folgenden nächten prüft er mich, neckt mich, fordert mich heraus. vielleicht bin ich sein riss in der wand, etwas zum ansehen, etwas, das sich verändert.
komm mit mir!, locke ich ihn, locke mit der stadt der engel, flüstere: angelito, angelito ... in sein ohr. er grinst nur und spuckt mir schaum in den mund.
dies ist mein drittes leben, sagt er beiläufig und spült den mund mit untrinkbarem wasser.
ich will wissen, wie viele er gekauft hat. schaffe es aber nicht zu fragen.
das neonlicht färbt den permanenten schweißfilm auf unseren gesichtern grün.
aus angst vor seiner ungefragten antwort platze ich heraus: in deinem vorigen warst du michelangelo merisi, hab ich recht?
er hebt die brauen. mein herz hüpft. nicht viel kann ihn schockieren.
derek jarman, 86, murmele ich zu meinen zehen. manchmal weiß ich nicht, woher diese bilder kommen, von dingen, die noch passieren werden. sie sind einfach da.
klar! manolo zieht die volle oberlippe hoch, entblößt die schönen schneidezähne.
und du, angeber, kommst aus der zukunft, was? er packt mich, gräbt mir die kurzen, scharfen nägel in die schultergrube. blut schießt mir in den schwanz.
aus der vergangenheit, bringe ich heraus, zitternd lächelnd: kleiner kranker bacchus. aus der vergangenheit
ttt// {LA_CA_(may_1978)}\\1977*1980FLDR
auch jetzt noch, da sal neben mir liegt, auf matratzen aus alten slash zines auf dem boden von lizzies apartment im canterbury-komplex, höre ich manolos atemzüge, höre sie aus allen anderen raus.
black randy heult auf dem dach, während unten in der lobby alice von den bags ihr nächtliches gefecht mit bobby pyn – jetzt darby crash – austrägt. eine schrille frauenstimme hallt durch die flure wie in alten horrorfilmen – meine augen sind fest geschlossen; ich sehe das alles nicht. ich sehe manolo: in manchen träumen höhlen krater seine wangen, die zähne schmelzen durch. ich kann die augen dann nicht öffnen, kann mir nicht erklären, warum. im wachen weiß ich, als wär ich dabei gewesen: die bestie hat ihn auf dem ge__{k$u739ܧ: [bck]wissen die anderen, wo wir sind?
j.d. klinkt sich aus. setzt sich auf einen zweiten poller neben meinem und steckt sein kuli-ding in den mund.
die beta-augen werden einfach totgeschwiegen, murmelt er zu seinen füßen. und dann zu mir: bist du sicher, dass du sie gehört hast?
wen?
na die rotoren. er spricht langsam und überdeutlich, als wäre ich schwerhörig oder schwachsinnig. die ro-to-ren der he-li-kop-ter.
ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal darauf zurückkommt. geschweige denn, dass er mir plötzlich glaubt.
ich nicke.
j.d. sieht zu boden. seine finger spielen mit dem drip tip, und seine kiefermuskeln mahlen, als wäre ich seine geliebte, die ihm einen seitensprung gestanden hat.
dann springt er auf.
vor n paar tagen hab ich mir den trident-stream reingezogen, redet er über meinen kopf hinweg mit der nacht. das zittern in seiner stimme ist jetzt so hoch und fein, als würde eine gigantische zunge die saite einer violine bearbeiten. schon wieder vier augen vom himmel geholt. und spurlos verschwunden. das gesamte abschussgebiet wurde abgesucht. nichts. sie können niemanden verantwortlich machen. weder die cannies noch die doggies noch eine der gangs aus dem westen …
redet er mit mir? mit sich selbst? oder mit jemand am anderen ende der stadt?
da feuert jemand aus der dunkelheit, sagt er, ruhiger jetzt, fast nachdenklich. dieser jemand kennt die flugrouten. räumt gründlich auf … und die tridents haben keine ahnung, was dieser jemand mit dem schrott anfängt …
ich rätsele noch, als plötzlich eine zweite stimme spricht.
ein shark, sagt die stimme hinter unseren rücken, hat mit ner M77 auf n beta-auge gefeuert. zwölfmal. kam letzte nacht auf SecondGuesses.
ein schmächtiger typ mit schirmmütze ist hinter uns aus der backsteinkirche getreten. leise, katzengleich. er tritt ans tor, öffnet es aber nicht. seine hände sind dunkel; das gesicht liegt im schatten des basecap.
j.d.s lider flattern kurz. inzwischen kenne ich es, das typische zucken beim empfangen oder abrufen einer information.
wa…!, macht er.
wa, auch das hab ich inzwischen kapiert, ist eine abkürzung für ein chinesisches wort, das cool bedeutet, oder einfach nur wow.
das ding bleibt in der luft, sagt der typ aus dem peat. dreht ab und verschwindet verschwindet ...
auch seine stimme hat etwas katzenhaftes, einen schnurrenden unterton.
n shark, eh?, fragt j.d. so n fetter inder mit postcode-tattoo?
katzenmann nickt. zwei stunden später standen tridents im wohnzimmer seiner eltern ...
j.d. lacht. es klingt abgehackt, mehr wie ein husten. das stand auf LL!
die beiden unterhalten sich mal laut, mal stumm. ich sitze auf dem eisenpoller und verstehe, selbst wenn sie ihre münder benutzen, nur ungefähr jedes zweite wort. als kinder hatten sal und ich eine fantasiesprache erfunden, die ähnlich funktionierte. damit uns kein erwachsener verstand, fügten wir in das, was wir eigentlich sagen wollten, haufenweise sinnlose silben ein.
ich sag dir, xiǎozi, schnurrt katzenmann. da zieht jemand die fäden, von dem nicht mal dai lo weiß ...
j.d. schweigt. auch der andere sagt lange nichts.
dann hebt er abwehrend die hände. oh nein. nicht squid. nicht hier drin.
hao ... j.d. seufzt. ist der spielplatz sicher?
katzenmann nickt.
j.d. tippt mir auf die schulter. ich stehe auf. gefügig wie eine marionette.
rechts von der backsteinkirche führt ein schmaler, zugewachsener pfad nach irgendwo. da hinein lotst j.d. mich. pflanzen verdecken den mond, streifen uns mit tropfenden blättern und faulig riechenden blütenkelchen. auf der anderen seite sind meine schultern und haare klatschnass. erst jetzt fällt mir auf, dass wir allein sind. katzenmann hat sich unbemerkt davongemacht.
SE29. das gelobte land: ein unscheinbares wohngebiet. zwei- bis dreistöckige häuser. weiße garagentore. sporadisch brennen laternen. alle fenster sind mit rolläden abgeriegelt; durch einige sickert schwaches licht.
den spielplatz hätte ich niemals als spielplatz erkannt. da ist kein sand, sondern ein gummiboden, der unsere schritte schluckt.
undefinierbare gestänge stecken ohne erkennbare ordnung im boden. die dünnen stangen sind blau, die dicken grau. von ferne hätte ich sie für falsch zusammengesetzte gasleitungen gehalten.
wir setzen uns auf ein verwaistes rundes ding. es bewegt sich keinen millimeter, und ich frage mich: wozu? im mondlicht hat der gummiboden die farbe eines hämatoms.
irgendwo am himmel summt es. in j.d.s ohren summt es; ich sehe es an seinen lippen, dem wippen seiner knie. lässt mich einfach allein mit der stille.
ich singe leise:
he's never early, he's always late
first thing you learn is you always gotta wait
i'm waiting for my man ...
my man ...?, unterbricht mich j.d. seine stirn wirft falten.
das einzige, was mich immer wieder überrascht an seinem gesicht: wie sehr ich nicht auf ihn stehe. und das, obwohl mich ziemlich lange niemand mehr angefasst hat. wer auch, da unten im schiffsbauch? wochen, vielleicht monate. oder, so wie es derzeit aussieht – jahrzehnte.
j.d. hält mir sein pad unter die nase, als wär’s ein mikro.
bei ihm zu hause lief grime und neo hop, chopped & screwed. so zumindest hat er das gemisch aus verzerrten atari-sounds und künstlichen drumbeats genannt, das von allen wänden auf uns runterkrachte, solange wir beim ersten level huiyún waren.
mit dünner stimme singe ich weiter.
dann höre ich auf. wir sollten nicht warten, sage ich. es sollte andersrum sein. was machen wir falsch?
j.d. wischt mit dem daumen übers pad. oh! seine lider flattern, und seine züge hellen sich auf. velvet underground. er nickt zufrieden. 1967, eh?
er steckt das pad weg und holt sein kuli-ding raus.
heute ist ausnahme, weißte, die alten regeln gelten nicht. er umschließt den drip tip mit den lippen. an der spitze glüht ein grünes lämpchen auf, wenn er daran saugt. fast wie bei einer echten zigarette. ich werd dir jetzt was verraten. j.d. lächelt still den weißen dampf in sich hinein, zögert den moment hinaus. du bist im begriff ... langsam haucht er mir vanille ins gesicht … squid kennenzulernen.
sein mund ist verdeckt von rauch; seine augen leuchten erwartungsvoll. ich hab das gefühl, als sollte ich ohnmächtig werden. aufspringen. lachen … weinen? keine ahnung, was von alledem.
ich räuspere mich. squid?
j.d.s augen sind so farblos, dass der dampf sie mühelos füllt.
bist du nie auf LL?
einen moment lang habe ich angst, dass er mich schlägt. aber er lässt nur seinen blick über meinen körper wandern. im schritt bleibt er hängen. ob er doch …?
ach stimmt. nicht mal n pad ... j.d. schaut zwischen seine sneakers, schüttelt den kopf und seufzt.
regel nummer wer-weiß-wie-viel: ein typ ohne pad ist in dieser welt wie ein typ ohne cojónes.
j.d. zieht seins aus der gürtelhalterung.
darf ich vorstellen – der durchgeknallteste graffitikünstler aller zeiten.
er hält das pad, das jetzt tarnschwarz ist, auf armeslänge von sich.
das ist von squid.
die betonwand gegenüber verwandelt sich in schmutzigroten backstein. darauf erscheint der umriss eines gigantischen auges, das ein rundes fenster mit kreuzverstrebung als iris nutzt. das auge – ein linkes – ist mit weißer farbe auf den backsteingrund gesprüht.
j.d.s finger zucken, auge und fenster verschwinden. machen einem weiteren auge platz. diesmal ein rechtes. disparate teile von ein und derselben person? die rasche aufeinanderfolge der linkische versuch, die zeit zurück…
fällt dir was auf?, fragt j.d.
nein. nur dies: statt eines hohlraums zeigt die iris des zweiten auges fächerförmig angeordnete muskeln. eine realistische darstellung, bis auf die harten tropfen, die in seinem äußeren winkel blitzen. glastränen? sehr man ray …
noch während ich leise lache, macht die mauer einen satz auf mich zu.
das auge ist jetzt riesig und … hell. ich bin geblendet, möchte schreien. was sich da auftut, ist ein gott der anderen art. der pulsende strahlenkranz saugt mich ein. gedankenlos arbeitende maschinerie. die pupille ein gefräßiges loch, das sich dehnt und dehnt und dehnt ... doch das ist noch nicht die erschreckende wahrheit.
die erschreckende wahrheit: die pupille ist das auge einer kamera.
es ist auf mich gerichtet.
wākào, eh?
langsam zoomt j.d. raus.
meine muskeln geben nach. natürlich entzückt ihn mein keuchen, mein spitzer schrei. j.d., der denkt, ich hätte niemals angst.
das auge im auge, kichert er. squiddy-boy ist feng, aber ein genie ...
das gehäuse der kamera, erkenne ich jetzt, versteckt sich im komplexen muskelgewirr, das die pupille umgibt. bevor das auge seine ursprungsgröße erreicht, klickt j.d.s nervöser finger weiter, projiziert ein grelles ganggraffito an die wand. E19 rulez. vom auge ist nur noch eine einzelne runde träne zu sehen, der rest verschwunden unter der raumgreifenden verkündigung in blutrot.
mit einem fingerschnipsen knallt j.d. mir wieder die triste betonwand hin. jähe dunkelheit. von j.d. bleibt nur das nachleuchtende pad.
das auge, höre ich seine stimme, war nicht mal 24 stunden an der wand.
er setzt sich. ich tue es ihm nach. der, auf den wir warten, ist immer noch nicht hier.
die cannies mögen ihn nicht besonders, hm?
j.d. stößt luft aus. squid ist scheißegal, wer ihn mag! er ist künstler, er kann tun und lassen, was …
die müdigkeit ist zurück. ich lege die wange aufs knochige handgelenk, verschränkte arme wie nachts in tucson, sehe gerade noch, wie j.d. mich angrinst, sichtlich stolz, dass er die anspielung in dem song kapiert hat.
sogar seinen dealer warten lassen. squid lebt nach anderen standardzzzzzzzz
Tāmā de. Seine Lippen formen das Wort, beinahe tonlos. Über sein Gesicht flackert das miniaturistische Geschehen Dutzender Bildschirme. Ohne Platz zu verschwenden sind sie an der Innenseite des kuppelartigen Raums angebracht, die unterste Reihe auf Augenhöhe eines Stehenden.
Der einzige Mensch im Raum jedoch sitzt. Er sitzt in einem Drehstuhl. Seine Augen sind Lichtpunkte, die sich dehnen. Sie starren, während Pixelregen niedergeht, vor sich auf den Resopaltisch. Seine langen Finger halten einen kleinen, flachen Gegenstand. Die Kuppen seiner Finger wirken stumpf, als hätte jemand sie an willkürlicher Stelle abgeschnitten, weil sie sonst einfach zu lang geworden wären. Die Haut seiner Hände ist hell, der Gegenstand, den sie halten, ebenfalls. Farben sind hier nicht voneinander zu unterscheiden. Alles flackert im gleichen bläulichen Licht. Er klopft mit der schmalen Seite des Vierecks mehrmals auf den Tisch. Ruckartig, routiniert. Dunkle Haarsträhnen lösen sich, fallen ihm mit jedem Stoß ein Stückchen weiter in die Stirn
lange weiße plüschohren schieben sich über den horizont. alice und das weiße kaninchen, kommt mir schläfrig in den sinn. lupita hat sal und mir daraus vorgelesen, während wir uns mit geschlossenen augen die bilder, die wir kannten, auf die nackten rücken malten. das herausziehen der taschenuhr kitzelt zwischen den rippen. ich öffne die augen.
das vieh stoppt, schnuppert, zieht spöttisch die schnurrhaare hoch. aber –
dies hier ist SE29, nicht wunderland, und ich bin clean.
will mich irgendwo festhalten, das scheißding dreht sich doch, kriege j.d.s arm zu fassen. j.d., dessen gesicht immer neu ist, j.d., der neben mir auf einem toten spielplatz sitzt. und endlich in die richtung schaut, aus der sich das karnickel nähert.
squid, ruft er halblaut und winkt.
schultern tauchen auf, ein breiter brustkorb. halsabwärts sieht squid aus wie ein normaler mensch, wenn auch in weiter, heller leinenkleidung, die keiner mir bekannten mode entspricht. er nähert sich mit abwesendem, schlenkrigen gang. minutenlang scheint es, als sei er blind. als hätte seine maske keine löcher für die augen. doch dann gewinnen seine schritte an entschlossenheit. lautlos betritt er den gummiboden. einen meter vor uns bleibt er stehen.
sie kennen mich, sagt squid anstelle einer begrüßung, gedämpft durch die maske, mit undefinierbarem akzent. aber sie kennen nicht mein gesicht. auf seine worte folgt ein hohes, irres lachen. verwirrend, keine mimik zu sehen, verwirrend auch die unmöglichkeit, blickkontakt aufzunehmen.
ich muss an die augen denken, nicht squids hinter der maske, auch nicht die aufgesprühten, sondern die beta-augen, wie j.d. sie nennt, denke, wie nah sie sind, beuge mich zu j.d. und murmele durch die zähne: das is n hase und kein tintenfisch.
das dumpfe knattern steigt vom asphalt auf, durchzieht die sohlen unserer schuhe, unsre körper, bis unter den scheitel. schwer vorstellbar, dass die beiden nichts merken.
lass uns abhauen, sage ich lauter, so dass auch squid mich durch schichten aus fell und plastik versteht, hier sind beta-augen unterwegs.
j.d. schaut skeptisch, squid undeutbar hinter seiner maske.
woher weißt du ...?, setzt squid an. ungläubig, interessiert oder belustigt?
kein bisschen, fällt mir plötzlich auf, wirkt er wie ein typ auf entzug.
mein zeigefinger zeichnet kreise in die luft.
die rotoren, übersetzt j.d.
aber ... niemand ... die plüschohren wippen von mir zu j.d. und wieder zurück. ein grotesker anblick, über den ich, wenn wir gemütlich bei j.d. auf dem sofa säßen, wahrscheinlich gelacht hätte.
frag nicht, xiǎozi. j.d. zuckt mit den achseln. frag mesca nie, warum. oder warum nicht … er klopft mir auf den rücken, wie einem kind, dem man großmütig ein paar harmlose spinnereien erlaubt. er reist auch durch die zeit. stimmt’s, mesca?
es ist jetzt nicht der moment, um laut zu werden oder herauszufinden, ob j.d. das ernst meint, oder welche blicke squid mir aus seiner stoffkapsel heraus zuwirft.
was zählt ist, dass die wächter richtung nordosten fliegen. und dass mich etwas erfasst. der drang zu wissen, wohin. wer oder was hinter diesen beta-drohnen steckt. die erste regung, der erste wirklich heftige impuls, seit ich manolo – in dieser welt – verloren gab.
meine beine setzen sich in bewegung, ohne dass ich was dagegen tun kann.
j.d. und squid folgen mir, ob nun perplex oder selbst von neugier gepackt.
die gegend, durch die wir gehen, wirkt auf surreale weise unbelebt, aber nicht besonders bedrohlich. in den reihenhäusern zu unserer rechten wohnen menschen, verbarrikadiert hinter jalousien. die häuserzeile zu unserer linken steht offensichtlich leer. dahinter, erklärt j.d., ist das millwall dock.
auf der anderen seite des hafenbeckens liegt E19. gelegentliche durchbrüche zur uferpromenade offenbaren schwärze, durchsetzt von lichtpunkten, die am jenseitigen ufer schweben wie die glühenden augen nachtaktiver tiere. die promenade an der südseite des hafenbeckens begrenzt jetzt die todeszone. kaum vorstellbar, murmelt j.d., dass dort vor gar nicht langer zeit verliebte flanierten, kinder spielten, omas ihre pudel gassi führten …