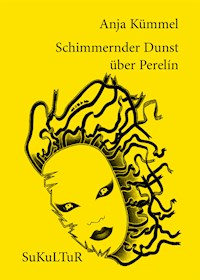7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Science-Fiction-Preis 2013. Sieben Jahre nach Ende des dritten Weltkriegs. Wirtschaftskonzerne regieren den ehemaligen Nordblock. Geschlechterunterschiede gibt es nicht mehr. Zumindest an der Oberfläche. Ashur und Elf leben im Untergrund. In virtuellen Räumen, in U-Bahn-Schächten, in der Kanalisation. Obwohl sie einander nicht kennen, haben sie etwas gemeinsam: Sie träumen. Von vergangenen Zeiten, von sich, von einander, in veränderter Gestalt. Ashur wird Adina wird Ana Luz. Elf wird Emrys wird Evaita. Und nichts ist mehr, wie es schien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sieben Jahre nach Ende des dritten Weltkriegs. Wirtschaftskonzerne regieren den ehemaligen Nordblock. Geschlechterunterschiede gibt es nicht mehr. Zumindest an der Oberfläche. Ashur und Elf leben im Untergrund. In virtuellen Räumen, in U-Bahn-Schächten, in der Kanalisation. Obwohl sie einander nicht kennen, haben sie etwas gemeinsam: Sie träumen. Von vergangenen Zeiten, von sich, von einander, in veränderter Gestalt. Ashur wird Adina wird Ana Luz. Elf wird Emrys wird Evita. Und nichts ist mehr, wie es schien.
Anja Kümmel
Träume digitaler Schläfer
Roman
Impressum Überarbeitete Neuausgabe eBook-Ausgabe: © Culturbooks Verlag 2013www.culturbooks.de Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg Tel. +4940 31108081, [email protected] Alle Rechte vorbehalten. Printausgabe: © Thealit 2012 Lektorat: Stefanie Möller, Antje Wagner, Zoë Beck, Thomas Wörtche
Inhalt
***
Verblichen wie das Bild eines körnigen alten Röhrenbildschirms hing der Himmel über dem Skyway. Vereinzelt lösten sich staubige Wirbel aus der monochromen Fläche. Sie purzelten abwärts, als seien sie der Schwerkraft unterworfen, und verfingen sich auf dem Weg nach unten in der Stahlkonstruktion, die die Giga-Mall mit der Bahnstation verband. Pfeifend jagten sie einander durch die Zwischenräume der Verstrebungen, um schließlich, ihres Treibens überdrüssig, die launische Verstimmung an den Kohlefasertrossen auszulassen, die mit langgezogenem, unwilligen Knarren reagierten. Bald hier, bald dort wickelten sich die Windquirle um Trossen und Pfeiler, peitschten gegen den unbewegten Stahl, heulend vor Kränkung oder Übermut, wie in einem Kinderspiel, das aus einem Haufen absurder, willkürlicher Regeln besteht. Auf der Oberseite der Brücke trat Ashur aus der Plastglaskapsel der Station hinaus ins Freie. Ungerührt ließ es sich von den Menschen anrempeln, die es eiliger hatten und sich an ihm vorbeiquetschten. Eine frontale Bö krallte sich in seine Rippen. Sie fuhr ihm unter die Kleidung und ließ seine Mantelschöße flattern, trotz ihrer kunstledernen Schwere.
Mit gesenkten Stirnen und zusammengekniffenen Mündern stemmten sich die Neuankömmlinge gegen den Wind. Ashur hob den Kopf und sog die Luft ein. Der Wind war scharf. Nicht aufgrund seiner Stärke, sondern wegen des salpetrigen Nachgeschmacks, den er auf der Zunge hinterließ. Es war eine Schärfe, die man erst nach ein paar Atemzügen wahrnahm. Ein charakteristisch-ätzendes Prickeln auf den Schleimhäuten. Der Wind musste von der Peripherie herüberwehen. Die Rache des Chemieabfalls, der dort draußen vor sich hin rottet, dachte Ashur.
Pai war ein paar Schrittlängen voraus. Wie jeden Tag hatten sich Schlangen vor dem Freizeitzentrum gebildet. Ein keilförmiger Sog aus wogenden Schultern, dessen Spitze von der Glaskuppel der Mall verschluckt wurde. An dem Seufzen verdrängter Luft hinter sich hörte Ashur, wie die Schwebebahn dabei war, einen neuen Schwall Menschen auszuscheiden. Leiber quollen nach und verursachten Stockungen auf dem Übergang. Unter den Sohlen kaum merkliche Vibration. Flüchtig fragte sich Ashur, ob sie vom Gleichschritt der Menschenkolonne erzeugt wurde, vom Wind oder von den winzigen Explosionen der Fusionsmotoren drunten. Es klang wie das Schlagen von Millionen rasender Herzen. Ashur stellte sich eine Horde in Panik versetzter Ratten vor, die unter der Brücke hindurchhetzte, auf der Flucht vor irgendetwas.
Ein Stück vor ihm in der Menge tanzte Pais schwarzer Bob auf und ab. Für einen Moment sickerte Sonnenlicht durch den Smog. Ashur verengte die Augen zu Schlitzen und sah in die Ferne. Jenseits des gläsernen Doms glitzerten die zerbrochenen Sonnenkollektoren der Arcologien. Nutzlos seit der suburbanen Deckelung. Niemand dachte daran, sie zu reparieren. Trotz des Andrangs ging es zügiger voran als erwartet. Sie mussten neue Eingänge geschaffen haben. Oder aber sie nahmen es momentan mit den Sicherheitsmaßnahmen nicht so genau, wie immer, wenn sich lange keine Anschläge ereignet hatten.
Pai und Ashur waren kaum mehr zehn Schritte von den Iriserkennungsgeräten entfernt. Ashur ergriff eine unterschwellige Anspannung. Endlich drehte Pai sich zu ihm um. „Verdammter Wind“, fluchte es, so laut, dass die Wartenden es hören konnten – wenn sie denn auf die beiden geachtet hätten. Ashur sah, wie Pai sich die Augen rieb und dabei die Linsen routiniert im Hemdsärmel verschwinden ließ.
Der Scanner senkte sich auf Pais Augenhöhe, und schon ertönte die körperlose Stimme: „Passieren.“ Zum abertausendsten Mal an diesem Tag. Die Prozedur dauerte keine Sekunde.
„Passieren“, sagte das Gerät auch zu Ashur. „Passieren“, im Schrittrhythmus derer, die die Giga-Mall betraten. Oder aber die Schritte der Menschen hatten sich im Laufe der Zeit dem Takt des Geräts angepasst. So genau wusste das keines mehr. Mit einem gestressten Ratsch spuckte der Automat ihre gefälschten ID-Karten aus. Blinkte: Autorisiert. Nächste Karte.
Techniker, las Ashur darauf, als es seine Karte wieder an sich nahm, und verkniff sich ein Grinsen. Typisch. Für Pai musste es immer etwas Besonderes sein. Sich einen zu hohen Rang in der Arbeitshierarchie anzumaßen, könnte unwillkommene Aufmerksamkeit erregen. Der Vermerk Techniker hingegen war neutral. Gute Mittelschicht. Teileingeschränkter Netzzugang.Techniker standen eine Stufe über Servicepersonal und zwei über Kontraktern. Die meisten ID-Karten wiesen ihre Inhaber als Kontrakter aus.
Auch den Metalldetektor, ein Relikt vergangener Tage, passierten sie problemlos.
„An dem Tag, an dem sie DNA-Erkennungsgeräte an die Eingänge stellen, kotz ich in die Ecke“, knurrte Pai, sobald sie sich von den Sicherheitsschranken entfernt hatten. Mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung wischte es sich über die Augen. Fuhr sich energisch durch das kinnlange Haar. Doch es wollte keine Unordnung entstehen. Im nächsten Moment war das Haar in seine perfekte Form zurückgefallen.
Ashur erwiderte nichts. Der Zynismus seines Begleiters war eigentlich der Normalzustand, aber heute wirkte Pai zusätzlich gereizt. Nicht ohne Grund, wusste Ashur: Pai hatte eine Mission zu erfüllen, deren Ziel nur es selbst kannte. Ashur dagegen war privat hier. Heute hatte es den Mund zu halten. Die beiden hasteten durch die Hallen, sprangen von einem Rollband aufs nächste, und wichen im Slalom den 3-D-Reklamen aus, die sich immer wieder phantomartig zwischen den Menschenleibern erhoben. Geschäftszeilen, Restaurants und Spielhallen, aus denen periodisch Lärm an Ashurs Ohr drang, glitten vorüber. Gern hätte es die Hand nach einem der 3-D-Wesen ausgestreckt, die die Passanten zur Interaktion einluden. Oder wäre stehen geblieben, um die Werbedoku, die über den gigantischen OLED-Bildschirm oberhalb der Galerie flimmerte, zu verfolgen. Aber dazu blieb keine Zeit. Um nicht aufzufallen, mussten sie sich dem Tempo des Stroms anpassen. Nur einmal verlangsamte Pai seinen Laufschritt und hielt Ashur am Arm zurück. Irgendetwas, das ihm verdächtig vorkam, musste in seinem Infrarotraster hängengeblieben sein. Ashur brauchte einige Sekunden, bis es sah, was Pai meinte. Es war ein halbintelligenter Mehrzweck-Replikant, der in stoischer Gleichgültigkeit mit seinen vier Wischarmen das Schaufenster eines Tattooshops polierte. Im Gegensatz zu den Mindsnatchern hatte man sich bei ihnen nicht einmal die Mühe gemacht, sie humanoid erscheinen zu lassen. Soweit Ashur wusste, wurden sie in den Pre-Invasions-Gesetzen über künstliche Intelligenzen nicht einmal berücksichtigt. Pai stieß einen knappen Nasallaut aus, eine Mischung aus Verachtung und Erleichterung. Während der kurzen Pause auf dem Fahrband war Ashur auf die glatte, körperlose Stimme aufmerksam geworden, die den Film kommentierte, so als riefe sie ihnen etwas hinterher. „ ... Potentiale moderner Embryologie optimal genutzt ...“ Mit halbem Ohr lauschte es, auch nachdem Pai es längst weiter gezogen hatte. „ ... die Wiege des Lebens – unser aller Ursprung. Täglich kommen Dutzende von gesunden, resistenten Babys zur Welt ...“ Kurze Pause, von heiterer Musik untermalt. „ ... vom Babypark zum Kindererziehungszentrum, wo die Kleinen vom ersten Tag an mit ihresgleichen sozialisiert werden ...“ Die Stimme waberte durch den Raum, schien aus allen Ecken gleichzeitig zu kommen, wickelte sich um die Pfeiler, wie der Wind draußen, kroch in Ashurs Gehörgänge und fand dort: die Augen eines zweidimensionalen Porträts, das in einem dunklen Flur hing. Sie verfolgten Ashur. Unzählige Male war es diesen Korridor entlang gegangen, furchtsam und eilig. Das Gemälde zeigte ein Fremdes, seltsam gekleidet, mit ölig goldenem Teint, aus dem die Augen hämisch lodernd herausstachen. Trotz der ungewohnten Flachheit der Darstellung ... Ashur krümmte sich, als habe es einen Faustschlag erhalten. Es war geschrumpft. Fühlte sich zart und winzig. Von oben herab sah das Fremde ihm schwerlidrig nach. Die Lippen waren verschlossen. Trotzdem war da noch immer die wohl modulierte Stimme im Hintergrund: „ ... beobachten wir mit Freude das Heranwachsen einer optimierten Generation, resistent gegen verschiedene Krankheiten und Allergien aufgrund von Umweltbelastungen, mit denen viele veraltet Geborene massiv zu kämpfen haben, und noch wichtiger, ausgestattet mit einem Höchstmaß an sozialer Kompetenz ...“ Die Stimme konterkarierte das herrische Schweigen an der Wand. Der Blick des zweidimensionalen Fremden jedoch ließ Ashur nicht los. Noch als es längst vorbeigegangen war, brannte er in seinem Nacken ...
„Scheiße!“, knurrte Pai. Ashur zuckte zusammen. Über das Ende des Laufbands stolperte es zurück ins Jetzt.
Kurz fragte es sich, ob die Verwünschung seines Freundes dem Aufklärungsfilm in ihrem Rücken galt. Nein. Pai verfluchte halblaut die jungen XYs, über die es fast gestrauchelt wäre. Die Kleinen waren stehen geblieben, sahen mit großen Augen zu den Holos auf, die sie angesprochen und sich freundlich lächelnd zu ihnen hinabgebeugt hatten, und verursachten auf diese Weise eine Stockung am Laufbandende. Ihr Betreuungsservice übte sich mit leerem Blick in Geduld. Pai griff Ashurs Ellbogen und zog es aus dem Gedränge. Unübersichtlichkeit bedeutete erhöhtes Risiko, Infrarotlinsen hin oder her.
Die Türen des gigantischen Glasfahrstuhls glitten genau vor ihren Nasen zu. Pai legte den Kopf in den Nacken und schaute der Kabine nach, die fast geräuschlos in die Höhe sauste.
„Wie willst du das eigentlich bewerkstelligen?“, wisperte Ashur. „Ich meine, von einem öffentlichen Terminal aus ...“
Pai schien gar nicht zuzuhören. „Da oben muss der Zentralprozessor sein“, murmelte es abwesend.
Ashur folgte Pais Blick. Da oben ... Ashur konnte nichts erkennen, nur virtuelles Wolkengerinnsel, das puderweiß und in Anbetracht der Windstille etwas zu schnell über ihnen vorbeizog. Vom Programmieren, von Datenpiraterie, ja selbst von virtueller Realität hatte Ashur nicht mehr als die allernötigste Ahnung. Obwohl es in einer Welt lebte, die von derartigen Dingen gesättigt war. Ashurs Gebiet war die Gentechnik. Darin hatte es sich verschanzt, seit das Versteckspiel begonnen hatte.
Als der Krieg auf den Nordblock übergegriffen hatte, war Ashur gezwungen gewesen, sein gerade begonnenes Studium – Hauptfach Molekularbiologie mit Spezialisierung in Gentechnologie, Nebenfach Bioethik – abzubrechen. Dann hatte es Amari kennen gelernt. Und Amari hatte einen Türcode besessen. Es hatte keiner großen Überredungskunst bedurft, um Ashur für das Projekt zu gewinnen.
Eben wollte es seine Frage wiederholen, da sah es, wie Pai sich verstohlen ans Kinn tippte. Schirm deine Gedanken ab. Instinktiv, tausendmal trainiert, fuhr Ashur die Barrieren hoch. Es spürte Bewegung im Rücken. Stimmen redeten durcheinander; jemand rief: „Sicherheit!“
Ashur drehte sich um und sah, wie die Menschen auseinander wichen; ein Körper ging zu Boden. Die Holos hatten sich aufgelöst; das Betreuungsservice riss mehrere junge XYs zurück.Eines von ihnen schrie. Ein anderes begann zu weinen. Zwei Sicherheitsservice in blauen Uniformen eilten herbei, versperrten Ashur die Sicht. „Es ist ohnmächtig geworden“, hörte es das Service sagen, „ohnmächtig.“ Etwas würgte Ashur. Über die Schultern der Schaulustigen hinweg versuchte es zu erkennen, wer dort am Boden lag. Ein Terrorist? Ein XX, dessen Stoff versagt hatte ...?
Jemand packte seinen Arm. Ashur zuckte, hätte beinahe geschrien. Dann erkannte es Pai. Ein neuer Schwall Menschen drängte in den gläsernen Fahrstuhl. Pai zog Ashur mit hinein. Die Miene, jeder Muskel zum Zerreißen gespannt, wie kurz vorm Sprung. Sein Blick war undurchdringlich. Es ist hier. Unter uns. Mit kaum merklichem Rucken verloren sie den Boden unter den Füßen.
Ashur versuchte, das Bild des leblosen Körpers zu verdrängen. Wünschte, sein Herz würde sich beruhigen. Es durfte sich jetzt keine Fragen stellen. Ein Mindsnatcher war unter ihnen.
Für geschulte Augen waren sie leicht zu erkennen. Pai und die anderen nannten sie Greifer, doch in Ashur rief dieses Wort eine unbestimmte, tief sitzende Angst hervor, die ihm den kalten Schweiß ausbrechen ließ und die es verraten hätte. Es bevorzugte den Begriff Snatcher. Wenn man sich einmal klarmachte, dass sie nichts als bessere Roboter waren, fiel bei genauem Hinsehen alles Menschliche von ihnen ab, und man fragte sich, wie man sie jemals hatte verwechseln können. Auch jetzt hatte Ashur den Kopf mit dem perfekt gescheitelten braunen Haar, den glasharten Augen und dem cremefarbenen Teint, der eine Spur zu gleichmäßig war, sofort zwischen den anderen Fahrgästen ausgemacht.
Es war ein langwieriger und schmerzhafter Prozess gewesen zu verinnerlichen, wie weit die Gedanken sich zurückziehen mussten, um abgeschirmt zu sein. Vor einigen Jahren, als die ersten K.I.s mit hochsensiblen Brain-Mapping-Funktionen ausgestattet wurden, hatte das Training begonnen. In der ersten Einheit hatten sie gelernt, zwischen gefährlichen und ungefährlichen Gedanken zu unterscheiden. Diese Trennung musste in den Instinkt übergehen. Der zweite Schritt bestand in der bildlichen Vorstellung, die gefährlichen Gedanken mit meterdicken Mauern zu umgeben. Bis zu acht Stunden am Tag hatten diese Visualisierungsübungen gedauert.
Monatelang war Ashur das Training unerträglich und sinnlos erschienen. Eine Bleiwand drückte auf sein Hirn, als hätte es eine ganze Packung Drowner auf einmal geschluckt. Dennoch war die Abschirmung löchrig, unvollkommen. Was blieb, waren hämmernde Kopfschmerzen ...
Ashur spürte, wie das Mindsnatcher, ohne eine Miene zu verziehen, in regelmäßigen Abständen Scanning-Impulse aussandte. Wie das kreisende Licht eines Leuchtturms tastete es sich durch die Hirne der Fahrgäste, während sie nach oben sausten. Immer mehr Menschen stiegen aus, und kaum neue stiegen zu. Hier oben gab es weniger Geschäfte für Konsumartikel. Hier begannen die Stockwerke der Computerhallen. Obwohl Ashur das Abschirmen inzwischen perfekt beherrschte, war es ihm auf derart engem Raum mit einem Snatcher zu gefährlich, an irgendetwas zu denken, was das Projekt betraf. Unwillkürlich driftete es zurück zu den Traumbildern.
Amari hatte ihm vom Guru erzählt, von dem es hieß, es könne Träume deuten. Nicht lange bevor es von seinem ersten und einzigen Ausflug ins Kontinuum nicht zurückgekehrt war. Ohne den Kopf zu drehen, warf Ashur einen Blick zu Pai hinüber. Pai starrte durch die Glashaut ins Leere. Seine Schilde blieben hochgefahren.
Nach Amaris spurlosem Verschwinden hatte Pai, ohne dass viele Worte darüber verloren wurden, die Führung übernommen. Auch Pai war bei der Gründung dabei gewesen. Über Amaris Verbleib herrschte Schweigen in der Gruppe. Es war allzu wahrscheinlich, dass es liquidiert worden war. Liquidiert – genau wie die Person unten, die man ohnmächtig aus der Menge gezogen hatte ...
Niemand wusste, was Amari im Kontinuum gesucht hatte, in das es, ohne den Schutz des Stoffs, hinausgetreten war. Seit Amaris Verschwinden stand Pai Ashur am nächsten. Obwohl es einiges an Pai vermisste, das es an Amari geschätzt hatte. Amari hatte ihm nicht nur vom Guru erzählt, es hatte überdies ein außergewöhnlich reichhaltiges Wissen über vergangene Zeiten besessen. Ein Guru, überlegte Ashur. Was mochte das heißen? Hatte das Guru denn keinen Namen?
Viele Nächte und manche Tage hatten sich die Träume wiederholt. Nun setzten sie sich fort, begannen, eine Geschichte zu spinnen. Nein. Keine Geschichte, dachte es. Alles, was passierte, fühlte sich real an. So absurd es klang: Ashur lag in einem virtuellen Raum, auf einer virtuellen Liege, und seine Träume fühlten sich real an! Es träumte von einer Zeit, von der es nichts wusste, als dass es sie gegeben hatte. Im Traum lag es auf dem nackten Boden eines Kerkers, gefangen in einer Art Dämmerschlaf. Dann und wann fiel Licht durch eine schmale Scharte im Gemäuer. Es ging Wind. Helle Flecken spielten auf dem Zellenboden. Etwas in ihm fühlte sich hingezogen zu diesem Licht ... Doch obwohl Ashur all das so real erlebte, blieb nach dem Erwachen nicht mehr haften als vage Bilder und Empfindungen. Es wusste nur, dass es noch sehr jung war in jenen Träumen. Und dass es ein ... eine – Ashur kniff die Augen zusammen, versuchte sich an das Gefühl zu erinnern, das das Wort mit sich bringen würde – eine Schwester hatte. Schwester. Ein Wort, von dem Ashur nicht einmal gewusst hatte, dass es existierte. Die Hartnäckigkeit der Träume hatte ihm Angst eingejagt. Eine Weile hatte es geglaubt, verrückt zu werden. Vielleicht war der Stoff Schuld. Als XX brauchte Ashur ihn, um ins Kontinuum hinauszugehen. Amari hatte sie immer wieder vor den Spätfolgen gewarnt, die niemand absehen konnte. Pai hatte es für seine Übervorsichtigkeit ausgelacht. Vielleicht hatte Amari recht, dachte Ashur jetzt, und der Stoff wird uns früher oder später das Hirn zersetzen.
In der Televirtualität konnte sich, wer über die entsprechenden technischen Mittel verfügte, die Welt nach Belieben kreieren. Niemand träumte. Zu träumen war einfach verrückt.
„Es gibt nichts außerhalb der uns bekannten Dimensionen.“ So hatte Pai es ausgedrückt. „Was du Träume nennst, ist weder Teil des Kontinuums noch des virtuellen Raumes noch des Netzes. Sie existieren in keiner Dimension. Das heißt: es gibt sie nicht.“
Als die Angst vor dem Verrücktwerden Ashur aufzufressen drohte, hatte es sich Amari anvertraut. Amari hatte ihm aufmerksam zugehört und ihm schließlich geraten, das Guru aufzusuchen. Ohne ihm zu verraten, wer oder was das Guru war.
Mittlerweile befanden sie sich allein im Fahrstuhl. Er schien geschrumpft, so als seien die gläsernen Wände flüssig und formbar. Auch schien er sich nun langsamer zu bewegen. Das Snatcher hatte sie kein einziges Mal auch nur angesehen, bevor es schließlich auf der zwölften Ebene ausgestiegen war.
Ashur musste an die Szene drunten denken. „Das Fleisch ist ein Alptraum“, flüsterte es.
„Wir können nicht bis in alle Ewigkeit in unserem virtuellen Schutzbunker hocken“, fing Pai energisch an, als sei dies eine lange vorbereitete Verteidigungsrede. „Ohne XYs neues Leben zu erschaffen ist schön und gut, aber – was ist mit all den schon Erwachsenen? Den XX-Menschen, die verschwunden sind?“ Ihre Blicke verhakten sich. „Ich will raus. Ich will es wissen.“
Ashur schluckte. „Darum also kommst du hierher ...?“
„Natürlich“, erwiderte Pai lapidar und sah beiseite.
„Aber dich innerhalb des Kontinuums in den Hauptcomputer zu hacken, um die Blue Pagode zu knacken ... Das ist doch ... das ist ...“, begann Ashur. Pai zuckte mit den Schultern. „Niemand hat behauptet, dass es ungefährlich ist.“
Es gab Renegatengruppen, die es im Kontinuum aushalten mussten. Die wortwörtlich im Untergrund hausten. Eine davon fiel Ashur jetzt ein. Ihren Namen wusste es nicht. Vielleicht hatten sie keinen. Sie gehörten nicht zu denjenigen, die in sinnlosen Kamikazeaktionen selbstgebastelte Bomben in öffentliche Einrichtungen schmuggelten. Dazu hielten sie sich zu bedeckt. Bis auf eine Ausnahme hatte es keines ihrer Mitglieder je gesehen. Fast alle dieser illegalen Zusammenschlüsse waren untereinander verfeindet, wofür es hunderte Gründe gab, aber keinen, der Ashur einleuchtete. So war es schon seit Kriegsende gewesen, ein Zustand, den niemand hinterfragte. Ashur wagte sich vor: „Das XX vorhin in der Schwebebahn ... Hast du es auch gesehen? Angeblich sollen in seiner Gruppe eine Menge Leute sein, die Accessing studiert haben, wie du.“ Es hielt inne und räusperte sich. „Es heißt, dass einige berühmte Datenpiraten dabei sind. Weißt du, ob ...“
Pai stieß unwillig Luft aus. „Dors Gruppe. Projekt Torus I. Ich weiß.“ Dann fuhr es leiser fort: „Dor ist doch bloß noch ein Schatten seiner selbst.“
„Ich dachte nur, wenn wir mit den Hackern kooperieren würden, unser Wissen austauschen sozusagen ...“ Ähnliche Vorschläge hatte Ashur schon öfter gemacht und war damit immer auf Ablehnung gestoßen.
Wie erwartet schnitt Pai ihm das Wort ab: „Unmöglich! Darauf würden die sich nie einlassen.“ Enttäuscht schwieg Ashur. „Sie verachten uns!“, rief Pai. „Sie würden nie im Leben mit uns zusammenarbeiten.“
Ja, und genauso verachten wir sie. Das nehmen sie zumindest an, dachte Ashur.
„Sie verachten uns, weil wir die Türen haben und sie im Untergrund leben müssen“, fuhr Pai hitzig fort. „Im Grunde genommen ist es Neid. Ein schwachsinniger Grund, jemanden zu hassen, klar. Schließlich sieht die Welt so aus. Zweigeteilt, und meist auch noch völlig willkürlich. So wie der verdammte Krieg sie hinterlassen hat. Ich hab die Linsen. Du hast sie nicht. Diese Stadt hat die Mall. Die Slums, die Peripherie, die Ruinen da draußen haben sie nicht. Manche Bezirke haben die Schwebebahnen, andere haben sie nicht ...“
„Aber es ist doch keine Sache des Zufalls!“, unterbrach Ashur: „Diese Zweiteilung ist eine Farce. Eine Lüge!“ Ihm kam die 3-D-Reproduktion von ZZ in den Sinn, die zwischen den Wolkenkratzern von Ten hing.
ZZ – der Star der beliebtesten Sportart des Kontinuums, eine motorisierte, brutale und nicht selten tödliche Abwandlung des klassischen Baseball. ZZ hatte schon derart lange überlebt, dass es an ein Wunder grenzte. Die größte und eindrucksvollste Holo-Reklame, die jemals existiert hat, prahlten die Macher von Ten. So herrschte ZZ, unermüdlich keulenschwingend und mit dümmlichem Grinsen, über die Stadt. Ob ZZ jemals sein Einverständnis für diese überdimensionale Reproduktion seiner selbst gegeben hatte, wusste niemand. Manchmal zweifelte Ashur sogar daran, dass ZZ real existierte. ZZ war ein Produkt der Medien, der Corporations. Sofern es ZZ gab, hatte die Tartz-Cortez längst die Rechte an seinem Dasein erworben, da war Ashur sicher.
„Dieses XX ...“, begann Pai, und seine Zögerlichkeit, die ungewohnte Weichheit seiner Stimme, ließen Ashur aufhorchen. „Kennst du es?“
Etwas zu rasch schüttelte Ashur den Kopf. Dabei war es die Wahrheit. Nie hatte Ashur sich getraut, länger als eine Sekunde den Blick auf ihm ruhen zu lassen. Es hätte nicht einmal sein Aussehen beschreiben können, wusste nur, dass es das Wesen auf unbeschreibliche Weise ungeheuer anziehend gefunden hatte.
„Dafür, dass du es überhaupt nicht kennst, erwähnst du es aber erstaunlich oft“, sagte Pai. Seine Augen blitzten.
Ashur wandte sich ab, für den Fall, dass es rot werden würde. Durch die Glaswand fiel sein Blick nach draußen. Der weiße Gang ohne Türen. „Hier muss ich raus“, sagte es, und der Fahrstuhl hielt. Draußen war – nichts. Nur weiße Wände.
„Dieses ... Guru ... hat eine Tür?“, fragte Pai verwundert. Ashur nickte. Die Fahrstuhltüren glitten auseinander.
„Wessen Avatar ist das Guru eigentlich?“ In Pais Stimme schwang Misstrauen.
Ashur zuckte mit den Schultern. Diese Frage hatte es sich noch gar nicht gestellt. Es blieb in der offenen Fahrstuhltür stehen.
„Pass auf dich auf“, mahnte Pai. „Vergiss nicht, dich abzuschirmen. Und geh sofort zum Lager zurück, wenn der Stoff anfängt, seine Wirkung zu verlieren ...“
Ashur nickte. Ein unerklärlich ungutes Gefühl überkam es, als Pais feste schlanke Hand die seine drückte und sich einen winzigen Augenblick lange spitze Fingernägel in seine Handflächen bohrten.
„Es heißt Elf“, hörte es Pai sagen, als sich die Glastüren schlossen. Sämtliche Gedanken und Gefühle, die Ashur eben noch gehabt hatte, kamen zum Stillstand.
Elf, dachte Ashur, wie in Trance. Es stand noch wie angewurzelt, als der Fahrstuhl Pai längst außer Sichtweite getragen hatte.
Je länger Ashur den nicht enden wollenden Gang entlang ging, desto stärker blendete das Weiß. Es war überall. Links, rechts, oben, unten. Wände, Boden und Decke waren kaum voneinander zu unterscheiden. Einzig zu seinen Füßen mischte sich in das weiße Strahlen ein Tropfen Rot. Erstaunt hielt Ashur inne und drehte die Handteller nach oben. Erst jetzt merkte es, dass sie aus jeweils vier winzigen Wunden bluteten.
Das Guru saß auf einer bunt überzogenen Pritsche und erzeugte für Ashurs Ohren fremdartige, angenehme Klänge auf einem mit Saiten bespannten Holzkasten. Die Tür war aufgegangen, bevor es noch den Code hatte eingeben können.
Es dauerte einige Minuten, bis das Guru aufsah. Derweil schaute sich Ashur in dem mit allerlei sonderbaren Gegenständen vollgestellten Raum um. Dies war mit Abstand der unaufgeräumteste Cyberspace, den es je gesehen hatte. Schließlich legte das Guru sein Instrument beiseite, lächelte mit entblößten Zähnen zu Ashur empor und winkte es heran. Sein Schädel war kahl; es trug etwas um seinen Körper geschlungen, das aussah wie ein Laken. Sein Alter sowie seine Rassenzusammensetzung waren schwer einzuordnen. Vermutlich war es ein Mestizo, wie Ashur selbst.
Ashur räusperte sich. „Wie heißt du eigentlich?“, entschied es sich dann zu fragen. „Amari hat dich immer nur das Guru genannt.“
Das Glatzköpfige schien das amüsant zu finden. „Wenn Amari mich so nennt ...“, sagte es mit leisem Schmunzeln, „ ... dann wird das seine Richtigkeit haben.“
Ashur nickte. Ihm fiel auf, dass das Guru von Amari in der Gegenwart sprach.
„Ashur“, murmelte das Guru, und Ashur zuckte unwillkürlich zusammen. Hatte Amari ihm seinen Namen verraten?
„Stammen deine Vorfahren aus dem ehemaligen Nord-Süd-Grenzstreifen?“ Ashur verengte die Augen. Vorfahren? Es war sich nicht im Klaren, worauf das Guru hinauswollte, und erwiderte: „Kann schon sein. Aber was für eine Relevanz hat das?“
Das Guru nickte bedächtig. „Ich dachte nur. Im ehemaligen Nord-Süd-Grenzstreifen gab es einmal ein Land, das Assyrien hieß.“
Ashur machte nur „Mh“ und wechselte das Standbein. Ihm war ein wenig unwohl. Wie konnte es sein, dass das Fremde binnen weniger Sekunden so viel Information aus ihm gezogen hatte?
„Erzähl mir von deinen Träumen.“ Einladend deutete das Guru auf einen rot gepolsterten Sessel, von dem es einige nachlässig über die Lehne geworfene Kleidungsstücke nahm.
Ashur setzte sich. Der Sessel war bequem. Etwas ganz anderes als die funktionalen Arbeitsstühle im Labor. Allerdings stellte es fest, dass es, nun da es einmal hier saß, gänzlich die Lust verloren hatte, über seine Träume zu sprechen. Angesichts der Mission, die Pai erfüllte, angesichts der Priorität des Projekts schienen ihm seine Träume mit einem Mal außerordentlich unbedeutend.
„Fang einfach irgendwo an, vorne oder in der Mitte oder am Ende“, sagte das Guru.
„Ich ... ich kann nicht“, murmelte Ashur. „Die Träume sind sehr ... real, aber im Wachen kann ich mich an kaum etwas erinnern.“
Das Guru zog fragend die Augenbrauen hoch. „An nichts?“
„Na ja ...“, Ashur legte die Stirn in Falten. „In diesen Träumen ... herrscht ein Gefühl von absoluter Geborgenheit. Zugleich gibt es eine Bedrohung ...“ Ashur seufzte. Es war unmöglich in Worte zu fassen. „Sie spielen in einer fernen Vergangenheit. Ich bin sehr jung“, fügte es schließlich hinzu. „Ich habe eine ... eine Schwester.“ Ashur verstummte. Es kam sich blöd vor. „Ich weiß nicht mal, was das ist – eine Schwester.“
Das Guru strich sich übers Kinn. „Du wirst dich schon erinnern“, meinte es schließlich tröstend. „Eigentlich ist es ganz einfach: Bleib offen.“
Offen ? Ashur starrte das Guru an.
„Das ist das Geheimnis: Offen bleiben“, wiederholte das Guru nachdrücklich, anscheinend ohne Ashurs Entsetzen zu bemerken.
„Aber – offen bleiben ist Selbstmord! Weißt du denn nicht, dass da draußen überall Mindsnatcher rumlaufen?“
Das Guru winkte ab. „Natürlich. Es gibt Widrigkeiten. Und nicht gerade wenige. Trotzdem ist Offenheit das Wichtigste. Nur so kann sich die Geschichte verändern. Nur so können Muster durchbrochen werden.“ Ashurs Hände gestikulierten ohne Ziel und Absicht. „Das ist Selbstmord!“, beharrte es.
„Da irrst du dich. Es wird dir das Leben retten.“
Ashur ließ resigniert die Hände sinken. Vielleicht war das Guru verrückt. Etwas in ihm wollte aufspringen und das Weite suchen, doch es wäre zu anstrengend gewesen, sich aus dem tiefen roten Sessel zu erheben.
„Erzähl mir von deinen Träumen“, wiederholte das Guru und streckte seine erdfarbene Hand aus, um sie Ashur über die Lider zu legen. Ashur versteifte sich. Dann jedoch wurde ihm durch die Augäpfel hindurch angenehm warm. Ashur fühlte, wie sein Körper erschlaffte, und die Dunkelheit hinter seinen Lidern verwandelte sich in orangefarbenes Strahlen.
„Evita!“
Der Flügelschlag eines Nachtfalters streifte lautlos die Wände. Ich hinterher, ein gehetzter Schatten. Vorbei an der Vision Johannes des Täufers, vorbei an der Darstellung des Ecce Homo.
Erneut rief ich den Namen meiner Schwester, verlangsamte und kam in einem fahlen Spitzbogen aus Mondlicht zum Stehen. In regelmäßigen Abständen fiel es durch die glaslosen Fenster herein, verlieh den Heiligenbildern und Passionsszenen an der gegenüberliegenden Wand eine unirdische Patina. Der Himmelsstreif über dem jenseitigen Dach des Innenhofs war hell, als breche jeden Augenblick der Morgen an.
„Evita!“, rief ich lauter und lauschte in die nächtliche Stille. Nichts.
Von fern der Schrei eines Waldkäuzchens.
Ich schlang die Arme um den Oberkörper. Der Stein wurde kalt unter meinen nackten Sohlen. Längst hatte der Boden die dumpfige Bettwärme aufgesogen.
„Evita!“, rief ich noch einmal, obschon ich kaum mehr wusste, warum. Die stillverzückten Antlitze in Öl, erhellt von ursprungslosem Licht, schienen näher zu kommen, mich zu umringen, je länger ich ausharrte. Fragten stumm, was ich hier tat.
Ich hatte es vergessen.
War ich bei der Totenwache gewesen, die sie für unsere Amme gehalten hatten? Im Erwachen hatte ich geglaubt, jene Nacht sei zum zweiten Mal Wirklichkeit geworden. Ich war aufgesprungen, in Evitas Zimmer gegangen und hatte ihr Bett leer vorgefunden. In jener Nacht war ich durch den Kreuzgang gelaufen, der den Innenhof umgab, und in die Gesindekammer gelangt. Dort hatte ich meine Schwester schließlich gefunden, inmitten der Dienerschaft kauernd, mit gesenktem Kopf, so als schlafe sie, ihr langes rotes Haar bis auf den Boden fallend. Steif und mit gefalteten Händen lag Amparo in der Mitte des Raumes aufgebahrt. Ich mochte nicht hinschauen und tat es doch.
Schatten hatten sich den hinteren Teil des Raumes einverleibt. Klebriger Dunst und Weihrauch teilten sich den Rest. Ich roch die Blumen zu Füßen der Toten, die die Besucher am Vortag gebracht hatten. Während ich in der Tür stand, die Nacht im Rücken, wurde ihr welker süßlicher Duft eins mit der Schwüle, den menschlichen Ausdünstungen und der beginnenden Verwesung.
Als stiege man in einen warmen Fluss, umfing mich die Totenlitanei in an- und abklingenden Wellen. Cristina, die Kammerfrau, leitete das Gebet.Mater Christi – Ora pro nobis ... Ihre Stimmen waren rau, denn sie beteten bereits die ganze Nacht. Mater purissima – Ora pro nobis. Mater castissima – Ora pro nobis. Mater inviolata – Ora pro nobis ... Niemand bemerkte mein Kommen. Sie alle schienen mit halbgeöffneten Augen zu schlafen, und auch das volle schwere Raunen kam träge und regelmäßig wie der Atem eines Schläfers. Virgo fidelis – Ora pro nobis. Speculum justitiae – Ora pro nobis ... Der Klang staute sich unter der niedrigen Decke. Gierig sog das wurmstichige Gebälk ihn auf. Es waren zu viele Menschen für den kleinen Raum, und durch die flackernden Umrisse an den Wänden schienen es noch mehr. Die Kerzen in den Zinnleuchtern, die zu beiden Seiten der Totenbahre standen, fraßen zusätzlich Luft. Mir war schwindlig geworden ...
Ein Geräusch schreckte mich auf. Vom Innenhof fächelte ein zittriger Wind herein.
Das Rascheln eines Gewandes, sehr dicht bei mir, ohne dass ich mich bewegt hätte.
Ich fuhr herum – und sah in Doña Victorias Gesicht. Ihre Miene glich der einer Statue. Ich schlug die Augen nieder und knickste automatisch.
“Señora ...“, stammelte ich mit gesenktem Kopf. „Ich dachte, das ganze Haus schläft.“
„Und was tust du zu dieser Stunde?“ Sie klang nicht streng, eher eine Spur belustigt.
Unsicher hob ich den Blick. Sie war vollkommen angekleidet und sah frisch aus, die Wangen gerötet, als käme sie von einem Spaziergang oder einem Ausritt zurück. Ich sah sie selten, darum überraschte mich ihr Auftauchen umso mehr.
„Evita“, begann ich. „Ich habe Evita gesucht ...“
Erst jetzt gewahrte ich, wie dicht Doña Victoria bei mir stand. Sie trug ein gebauschtes, bodenlanges Brokatkleid, dessen Farbe im Mondlicht nicht zu bestimmen war, mit einem tiefen, runden Ausschnitt. Auf ihrer marmornen Brust lag, wie ein Tier, das sich dort im Schlafe anklammert, ein großzügiger Smaragd. Mit jedem ihrer Atemzüge hob und senkte sich der grüne Stein, unstet funkelnd, beinahe als atme auch er. Ein süßlicher, betäubender Duft ging von ihr aus, der mir die Blumen der Totenwache in Erinnerung rief.
„Ich habe geträumt“, murmelte ich, „von der Totenwache der Amme. Dann sah ich nach Evita, wie in jener Nacht, und fand sie nicht in ihrem Bett.“
Sanft lächelte Doña Victoria mich an. „Amparo – Gott sei ihrer Seele gnädig – ist vorgestern bestattet worden. Das weißt du doch. Schließlich warst du selbst dabei.“ Die ungewohnte Sanftheit ihrer Stimme erschreckte mich. Sie strich mir übers Haar. Diese Geste erschien mir unpassend, war ich doch beinahe so groß wie sie. Ich wollte etwas sagen, aber sie kam mir zuvor. „Du hast die Augen deines Vaters.“ In Zeitlupe nahm sie die Finger von meiner Schläfe, verweilte kurz an meiner Wange. Ihre Handinnenfläche war heiß. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich mich getäuscht hatte. Ihr rötlicher Teint rührte nicht von Bewegung und frischer Luft. Eher sah es aus, als hätte sie sich eben erst ausgehfertig gemacht. Rouge färbte ihre Wangen. Es war nicht das Mondlicht allein, das ihre Augen glänzend machte. Ihr Atem, der stoßweise durch das blumige Parfum drang, roch nach Rotwein.
„Es ist lange her, dass ich dich in ganzer Größe gesehen habe, Ana Luz. Du bist tüchtig gewachsen. Auch deine schlanke, starke Statur hast du von deinem Vater.“ Einige Wimpernschläge lang ließ sie ihren Blick an mir auf und ab wandern.
Schließlich entgegnete ich, leicht unbehaglich: „Ich habe Don Juan Varo lange nicht gesehen.“ Tatsächlich stand mir sein Porträt im Flur deutlicher im Geiste als er selbst. Seine Augen mussten braun sein, wie die meinen.
„Dein Vater ist viel beschäftigt“, seufzte Doña Victoria kopfschüttelnd, aber es klang nicht bedauernd. Ihre Lippen lächelten noch immer. Mir fiel wieder ein, warum ich hier war. Ich schluckte. „Evita war wirklich nicht in ihrem Zimmer.“
Kaum merklich senkten sich Doña Victorias Mundwinkel. Ihre Miene wurde unleserlich. „Manchmal schlafwandelt sie“, fügte ich flüsternd hinzu.
Doña Victoria straffte die Schultern. „Dann lass uns nachsehen.“ Das war die Stimme, die ich kannte. Nüchtern und mit gebieterischem Unterton, selbst dann, wenn sie eine Bitte oder einen Vorschlag aussprach. Sie wandte sich in die Richtung, aus der ich gekommen war. „Ich bin sicher, dass es nur ein Traum war“, sagte sie, ohne sich umzudrehen, während wir die Treppe hochstiegen, die zu unseren Schlafgemächern im Turm des Nordwestflügels führte. Ich folgte ihr stumm.
Oben angekommen, öffnete Doña Victoria die Tür zu Evitas Stube.
Mit wild schlagendem Herzen trat ich vor, streifte Doña Victorias samtenen Arm. Sie hatte recht. Evita lag friedlich schlafend in ihrem Bett. Ihre roten Locken flossen über das Bettzeug wie Tang auf der Oberfläche eines stillen Wassers. Sie schlief so ruhig, dass es beinahe unheimlich war.
Hinter uns knarrte eine Tür, und Cristinas verschlafene Stimme ertönte. Doña Victoria drehte sich um und legte den Finger an die Lippen. Sofort verstummte die Kammerfrau. Im Nachthemd war sie aus ihrem Zimmer getreten, das direkt an unsere Gemächer anschloss. Die Öllampe in ihrer Hand schwankte; einige graue Strähnen hatten sich aus dem Knoten gelöst und hingen ihr wirr in die Stirn. Leise schloss Doña Victoria die Tür zu Evitas Zimmer, ohne dass ihre Augen Cristina dabei losließen. Aus ihrem Blick sprach eine Mischung aus Anklage und Geringschätzung.
„Evita träumt oft schlecht“, sagte ich atemlos, um die sonderbare Spannung zu brechen. „Manchmal höre ich Schritte durch die Mauern ...“
Doña Victoria löste den Blick von der Kammerfrau, die noch immer wie erstarrt in der Tür stand, und wandte sich mir zu. „Der Tod eurer Amme hat deine Schwester sehr mitgenommen“, sagte sie mit unvermittelter Anteilnahme. „Vergiss nicht, dass Amparo von Geburt an wie eine Mutter für sie war. Du hingegen zähltest schon vier Jahre, als sie ins Haus kam.“ Doña Victoria sprach, als sei sie dabei gewesen, als kenne sie uns gut. Ich nickte. „Sei nicht verwundert oder besorgt, wenn sie sich ein wenig absonderlich verhält. Das ist ganz natürlich nach einem so tragischen Verlust. Sie ist noch ein Kind. Du kannst jetzt nichts für sie tun, auch wenn ich weiß, dass du es gerne möchtest.“ Etwas war in ihren Worten, wogegen ich mich auflehnen wollte, aber mein Kopf fuhr fort zu nicken.
„Mir war, als hörte ich eine Tür gehen“, ließ Cristina jäh verlauten. Doña Victoria sah sie streng an. „Ana Luz hat ihr Zimmer verlassen, um nach Evita zu sehen. Es war ihre Tür, die Sie hörten.“ Das leere Bett, wurde mir jetzt klar, musste ebenso ein Traum gewesen sein wie die Totenwache. Trotzdem wiederholte ich: „In manchen mondhellen Nächten schlafwandelt Evita. Ich habe Angst, dass ihr etwas zustößt, dass sie stürzt oder irgendwo hinunterfällt ...“
Ich brach ab, und einen Moment lang war es still. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Doña Victoria die Lippen schürzte. Dann ordnete sie an, so als hätte sie es die ganze Zeit vorgehabt: „In Zukunft werden Fenster und Tür verschlossen, zu ihrer Sicherheit.“ Knapp hob sie ihr Kinn in Richtung der Kammerfrau und sagte dann zu mir: „Nun geh wieder ins Bett, Ana Luz, bevor du dich erkältest.“
Es war unsere vierte Unterrichtsstunde bei dem jungen Doktor aus Italien. El Venecianonannten Evita und ich ihn heimlich. Sein Nachname klang, als singe ein Vogel, schön, aber lang und unaussprechlich. Er wohnte bereits einige Wochen bei uns, und seit Amparo nicht mehr war, aß er an ihrer Stelle mit uns zu Abend – ein abrupter Wechsel des Gewohnten, der schweigsame Mahlzeiten nach sich zog. Dabei war er mir nicht unangenehm. Nur fremd. Ich wusste nicht, was ich mit einem weltgewandten Herrn wie ihm hätte sprechen sollen. Manchmal nahm ich wahr, wie er uns von der Seite musterte, während wir schweigend aßen.
Beinahe war es, als hätte der Vater das Dahinscheiden der Amme vorausgeahnt. Allerdings war das unmöglich, denn sie war ganz unerwartet erkrankt. Der Bader, nach dem eilends geschickt worden war, hatte ein hohes Fieber festgestellt, für das er keine Erklärung fand und gegen das keine Medizin und kein Aderlass geholfen hatten. Binnen einer Stunde nach seinem Eintreffen war sie gestorben. El Veneciano hingegen war schon im Haus gewesen, als Amparo noch kerngesund schien ...
„Bist du mit der Konjugation fertig?“, schreckte mich El Veneciano auf.
„Noch nicht, Doktor“, gestand ich und blickte beschämt auf mein Blatt. Sto, steti, statum ... Ich hätte längst fertig sein können. Zwischen „stare“ und „currere“ waren meine Gedanken abgeschweift. Er sollte nicht denken, ich sei langsam oder hätte kein Interesse. Denn das Gegenteil war der Fall. Wenn auch Latein nicht gerade mein Lieblingsfach war.
„Du musst nicht unbedingt deiner Schwester nacheifern“, hörte ich El Veneciano sagen, als er an meinem Tisch vorbei schritt. Ich wusste, worauf er anspielte, und hätte ihm zu ihrer Verteidigung ihre Eigenheiten gern erklärt. Andererseits hatte er nicht böse geklungen. Höchstens ein wenig ironisch.
Curro, cucurri, cursum ... Ich beeilte mich mit dem Rest der Verben und rief ihn zu mir. Er setzte sich auf die Kante meines Pultes, um meine Arbeit zu kontrollieren. Verstohlen musterte ich sein Profil. Doña Victoria hatte gesagt, er sei noch sehr jung, als sie ihn uns im Namen des Vaters, der kurzfristig nach Madrid beordert worden war, vorgestellt hatte. Ich konnte sein Alter schwer schätzen. Wie alt musste man sein, um die Doktorwürde zu erhalten? Er hatte feste dunkelbraune Locken, die eng an seinem schmalen Schädel lagen, und einen modischen Backen- und Spitzbart. Sein Mund war klein und voll, wie der einer Frau. Ungewöhnlich rot leuchteten seine Lippen zwischen dem Barthaar hervor. Am liebsten aber mochte ich seine Augen. Stets blitzten sie wachsam und freundlich, egal ob er in ein Buch vertieft war oder aß oder sich unterhielt. An diesem Mittag trug El Veneciano einen schlichten schwarzen Samtanzug mit kleinem Stehkragen. Ob das die venezianische Mode war?
„Alles richtig“, lobte er und gab mir das Blatt zurück. „Sehr gut.“ Flüchtig legte er mir die Hand auf die Schulter. Mir wurde warm. Ich stellte mir vor, dass er so einen Kollegen behandeln würde.
Er gab mir einen Abschnitt zum Übersetzen und entfernte sich. Ich schielte zu Evitas Pult hinüber und versuchte zu erahnen, ob sich die Feder in ihrer Hand bewegte. Manche Male erledigte sie ihre Aufgaben tadellos. Andere Male starrte sie lange Zeit vor sich hin und brachte nichts zuwege, so als habe sie gar nicht gehört, was man ihr aufgetragen hatte. Schon immer hatte sie dazu geneigt, in seltsame Zustände zu verfallen. Aber so schlimm wie jetzt war es noch nie gewesen. Sie bemerkte weder meinen Blick noch das Herannahen des Hauslehrers. Ich unterdrückte ein Seufzen und machte mich an die Übersetzung. Drüben murmelte El Veneciano leise.
„Doktor“, fragte ich ihn, als ich fertig war, ermutigt durch sein Lob: „Werdet Ihr uns noch andere Fremdsprachen lehren?“
Er sah mich aufmerksam über den Rand des Blattes hinweg an. „Welche Fremdsprachen meinst du?“
„Nun ... Sprachen, die man spricht.“ Ich räusperte mich. „Französisch oder Englisch vielleicht. Oder Portugiesisch.“
Er öffnete seine Karmesinlippen, schien zu überlegen, sagte
aber nichts. Schließlich erwiderte er, indem er den Kopf wiegte: „Beizeiten, beizeiten ... Latein ist die Grundlage, musst du wissen. Es ist eine sehr wichtige Sprache ...“ Er brach ab, legte das nebensächlich gewordene Papier zurück auf mein Pult und war in drei langen Schritten bei dem großen Nussbaumtisch, auf dem er seine Bücher deponiert hatte. „Komm einmal herüber“, winkte er mich heran. Die Neugier besiegte meine Unsicherheit. Ich stand auf und folgte ihm, Evitas Blick im Rücken.
Seit der ersten Unterrichtsstunde hatte der Bücherstapel auf dem Schreibtisch meine Aufmerksamkeit erregt. Uns Kindern war es strengstens untersagt, die Bibliothek des Vaters zu betreten. Lediglich die heilige Schrift sowie einige Lehrbände, die wir zum Katechismusunterricht benötigten, waren uns frei zugänglich. Kürzlich waren einige neu erschienene Bände der Mystiker hinzugekommen, die Doña Victoria uns im Auftrag des Vaters ans Herz legte. Evita hatte sie zu verschlingen begonnen; ich machte mir wenig daraus. Die Bücher des Doktors hingegen übten eine unerklärliche Faszination auf mich aus. Mein Mund wurde trocken, während ich versuchte, die lateinischen Titel auf ihren ledernen Rücken zu entziffern.
„Siehst du“, vernahm ich seine heitere Stimme hinter mir: „Dafür lohnt es sich, Latein zu lernen. Eines Tages wirst du all diese Bücher lesen können.“
Zwar verstand ich nicht jedes der goldgeprägten Wörter, aber zumeist erschloss sich der Sinn aus der Verwandtschaft zum Kastilischen. Zuoberst lag ein medizinisches Werk, wie ich es für einen Arzt nicht anders erwartet hatte: De contagione et contagiosis morbis. Darunter ein Titel, mit dem ich nichts anzufangen wusste: De revolutionibus orbium coelestium. Dann eine Reihe dünnerer Bände mit langen, kleingedruckten Titeln. Zuunterst lag eine Bibel. Ich war erstaunt, ohne recht zu wissen warum.
„Gibt es ein Thema, das dich besonders interessiert?“, erkundigte sich El Veneciano.
Ich war nahe daran, „Religion“ zu sagen, weil ich zu gern gewusst hätte, welche Anschauungen der vielgereiste Doktor vertrat, aber da mir diese Materie zu heikel erschien, antwortete ich: „Ethik und Philosophie.“
„Sehr gut.“ El Veneciano nickte langsam. Sein langer, gebogener Daumen fuhr die Buchrücken entlang, als suche er etwas. Einen Augenblick lang war ich abgelenkt. Etwas bewegte mich dazu, über die Schulter zu sehen. Evitas Blick fing den meinen. Sie saß unverändert, bewegungslos. Dieser Tage wirkte sie noch stiller, noch durchscheinender, noch abwesender als üblich. Sie war sehr blass.
„Die ethischen Lehren betreffend habe ich nur ein Werk bei mir, zudem leider ein nicht mehr ganz aktuelles“, holte mich El Veneciano zurück. Er hielt mir das Buch, von dem er sprach, unter die Nase. Tractatus de immortalitate animae, entzifferte ich. „Bücher sind zurzeit nicht eben leicht zu ...“ Er schien sich zu verschlucken, und beendete den Satz: „ ... zu transportieren.“
Allmählich mutiger geworden, hakte ich nach: „Weil sie so schwer sind?“
El Veneciano antwortete mit einer angedeuteten Kopfbewegung, die sowohl ein Nicken als auch ein Kopfschütteln sein konnte. Zwar sprach er mit fremdartiger Betonung, doch sein Kastilisch war nahezu perfekt. Ich konnte mir sein plötzliches Stocken einzig damit erklären, dass es sich zumindest teilweise um Schriften handeln musste, deren Einfuhr verboten war. Von dem „Index librorum prohibitorum“ hatte ich wohl gehört, verehrte Don Juan Varo doch das Heilige Officium, das ihn erstellt hatte, beinahe mit derselben Inbrunst wie die Hochheilige Dreifaltigkeit.
„Dieses habe ich jedenfalls bei mir“, fuhr El Veneciano, wieder mit kräftiger Stimme, fort: „Eher aufgrund eines Zufalls denn einer sorgfältigen Auswahl. Es ist keineswegs das grundlegende Werk der modernen Philosophie, und wie gesagt etwas veraltet.“
Er ließ mir den Tractatus de immortalitate animae in die Hände gleiten. Ein Brennen kroch meine Arme hinauf, als sei das Buch ein Schürhaken, direkt aus dem Feuer gezogen. Zugleich jedoch überkam mich Niedergeschlagenheit. „Ich werde noch Jahre brauchen, bis ich es lesen kann.“ Ich ließ den Band sinken und sah zu unserem Maestro auf.
Er lächelte. „Zweifelst du derart an meinen Fähigkeiten?“
„Nein, natürlich nicht, Doktor“, beeilte ich mich zu erwidern und wollte mich erklären, aber er schnitt mir das Wort ab. „Selbst wenn du Jahre brauchen solltest. Ich will der letzte sein, der deiner Wissbegier im Weg steht. Möchtest du, dass ich dir daraus vorlese und dir übersetze?“
Ich nickte eifrig. „Könnt Ihr mir sagen, worum es sich im Groben handelt?“
Falten bildeten sich auf seiner hohen Stirn, die ihn jäh älter erscheinen ließen. „Der Verfasser, Pomponazzi, schreibt über die Fähigkeit jedes Einzelnen, im Leben Gutes zu bewirken. Aber nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, oder gar aus Angst vor dem Fegefeuer, sondern aufgrund der Notwendigkeit des harmonischen Zusammenlebens ...“ Immer wieder pausierte er. Es war ihm anzumerken, wie vorsichtig er seine Worte wählte. „Aus der Verwirklichung persönlicher Ziele, die gleichzeitig dem Wohlergehen der Gesamtheit dienen, schöpft der Mensch ein Glücksgefühl, das er nirgends als in sich selbst zu finden vermag, und nirgends als in diesem einen Leben ...“
Noch während er sprach, begann ich zu ahnen, dass ich mich doch auf gefährliches Terrain gewagt hatte. In diesem einen Leben ... Seele, Paradies und Fegefeuer. Über derlei Themen hatte ich die Dienerschaft hitzig debattieren hören.
„Nach aristotelischen Lehren ist die Unsterblichkeit der Seele unbeweisbar“, fuhr El Veneciano fort. „Das Wesen eines Menschen beruht auf seiner Fähigkeit zu ethischem Erkenntnisgewinn, ohne sich jedoch darin zu erschöpfen. Mit dem Tod vergeht nicht nur die Seele, sondern zugleich der Geist und alle darin gespeicherten Erfahrungen. Darum tut man besser daran, ihn zu Lebzeiten zu entfalten.“
Unwillkürlich versteifte ich mich, so als hätte er mich an einer unschicklichen Stelle berührt. Wenn El Veneciano die Überzeugung Pomponazzis teilte, es gäbe kein Fegefeuer – leugnete er damit auch die Existenz von Himmel und Hölle?
Was die Bediensteten anbelangte, so bezeichneten sie diejenigen, die solcherlei Behauptungen aufstellten, als „Häretiker“. Oft hatte ich sie heimlich belauscht, waren sie es doch, die hinaus durften und mit Leuten sprachen, und sei es nur für einen Marktbesuch oder einen Botengang.
Indes war El Veneciano nicht entgangen, dass ich ihm nicht mehr zuhörte. Mit gesenktem Kopf wartete ich darauf, für meine Unaufmerksamkeit gescholten zu werden. Doch El Veneciano schwieg. Er legte den Tractatus de immortalitate animae oben auf den Bücherstapel und ließ seine Hand darauf ruhen, wie bei einem Schwur.
Nach einer kurzen Pause sagte er: „Ich lese dir einmal in Ruhe daraus vor.“ Er sah mich fest an, und diesmal hielt ich seinem Blick stand, obwohl mir heiß wurde.
Ich wollte gerade den Mund öffnen, da ertönte vom Salon her ein heller Glockenton. El Veneciano holte ein kleines Oval hervor, das um seinen Hals hing – eine Art Medaillon, wie mir schien – klappte es auf, sah darauf und klappte den Deckel wieder zu.
„Es ist Zeit“, sagte er. „Wir müssen den Unterricht beenden.“
„Lasst mich noch eine Frage stellen“, bat ich hastig, und er gab mir mit einem Nicken statt. „Ihr glaubt also nicht an eine ewig währende Dynamik, an eine Art Mechanismus, der dem menschlichen Handeln zu Grunde liegt?“
Evita war aufgestanden und lautlos herangekommen. El Veneciano schob uns, ohne dass ich die Berührung seiner flachen Hand im Rücken wahrnahm, sanft in den dunklen Flur hinein, der zum Salon führte. „Doch“, erwiderte er. „Aber diese Mechanismen sind Produkte menschlicher Errungenschaften und individueller geistiger Reifung. Sie müssen in irgendeiner Form erinnert und festgehalten werden. Wie sonst sollte die Erfahrung der Vergangenheit dem künftigen Handeln eine Richtung weisen? Wie sonst wäre eine Vervollkommnung möglich?“
Damit schloss der Doktor die Tür hinter uns. Einen Moment lang umfing uns Finsternis. Ich spürte, wie Evita sich an mich drängte. Dann ging am anderen Ende die Tür auf, und Licht strömte vom Salon herein, wo Cristina und das Mädchen uns mit Tee und einer leichten Merienda erwarteten.
Auf halber Höhe der Wendeltreppe, die zum Nordwestturm führte, ließ Evita verlauten: „El Venecianoist ein Ketzer.“ Sie klang bestimmt, so als sei dies das Ergebnis reiflicher Überlegung, und gleichzeitig so leichthin, als mache sie mich auf einen am Fenster vorbeifliegenden Vogel aufmerksam.
„Was sagst du da?“ Ich blieb stehen und hielt sie am Arm zurück. Einige Sekunden lang schnappte mein Mund nach Worten, aber schließlich war alles, was mir zu seiner Verteidigung einfiel: „Ich mag ihn.“
„Ich mag ihn auch“, stellte Evita schulterzuckend fest, so als täte das nichts zur Sache. „Aber was er sagt, verstößt gegen den Glauben.“
„Er ist kein Ungläubiger“, hielt ich dagegen. „Auf dem Tisch lag eine Bibel.“ Evita antwortete nicht. Ihr Blick rutschte zur Seite, als hätte sie schlagartig das Interesse verloren.
„Er ist kein Ketzer“, wiederholte ich energisch. „Ich glaube, er ist ein ...“ Ich zögerte kurz, denn ich war mir über das Wort nicht sicher: „ ... ein Humanist.“
Diesen Ausdruck hatte ich Cristina benutzen hören. Er klang weniger schlimm als „Ketzer“. Andererseits hatte ich irgendwo den boshaften Kommentar aufgeschnappt, der Humanismus käme aus Italien, wie die Mal de Naples ... Diesen Namen wiederum, das wusste ich von El Veneciano, hatten die Franzosen der Syphilis gegeben.
Evita hatte sich wieder in Bewegung gesetzt. Oben angekommen, wandte sie sich abrupt nach mir um, sodass ich beinahe mit ihr zusammengestoßen wäre. „Du glaubst doch nicht daran, dass die Seele stirbt?“ Also hatte sie uns unten im Studierzimmer sehr wohl zugehört! Ihr Blick suchte Halt in meinem.
„Ich weiß nicht“, wich ich ihr aus und sah beiseite.
„Du musst an die Unsterblichkeit der Seele glauben“, flüsterte Evita, noch eine Spur flehentlicher. Sie packte mich an den Händen. Ihre Handflächen waren heiß und feucht, als fieberte sie. Etwas in mir sträubte sich dagegen zu nicken. Ich würde ihr keinen Gefallen damit tun, ihr vorzulügen, es gäbe eine Welt, die wir auf ewig teilten.
Meine Schultern strafften sich, und ich hörte mich unvermittelt fragen: „Warum sprichst du nicht mit ihm?“ Es klang herausfordernd und kälter als beabsichtigt. Sie ließ mich los und begann unmerklich zu zittern. Erschrocken legte ich ihr die Hand auf die Stirn.
„Lass uns das alte Spiel spielen, ja?“, schlug ich vor, nun selbst ein wenig brüchig. Ich konnte sehen, wie sich ihr Kehlkopf auf und ab bewegte.
Dann flüsterte sie: „Es ist nicht recht.“
Sie hatte dieses Spiel immer geliebt. Am Anfang war es kein Spiel im eigentlichen Sinn gewesen. Wir hatten lediglich die Fenster unseres Zimmers – das jetzt meines war – geöffnet, in der Hoffnung, dass drunten die Kinder der Bediensteten und der Schafhirten spielten. Es war uns ein stundenlanger Zeitvertreib gewesen, ihnen zuzusehen, wie sie lachten, stritten, sich neue Spiele ausdachten. Manche Spiele übernahmen wir, und es war ein wunderbares Gefühl gewesen, in unserem Turmzimmer etwas zu tun, das die Kinder draußen genauso taten.
Ihre Ausdrucksweise anzunehmen hatte ich mir indes abgewöhnt, denn Cristina hatte mich argwöhnisch gefragt, wo ich die „Gossensprache“ aufgeschnappt hätte, und ich hatte keine Erklärung gewusst. Jeglicher Kontakt zu den Kindern des Gesindes und der Dorfbevölkerung war uns untersagt. Das Spiel bestand nun darin, dass wir den Kindern gelegentlich Geld zuwarfen, damit sie weiter unter unserem Fenster spielten. Einmal hatten sie uns nämlich bemerkt und fortan den angestammten Platz gemieden, ob aus Scham oder Bosheit oder Argwohn weiß ich nicht. Ich war auf die Idee gekommen, ihnen Münzen zuzuwerfen, um sie zum Wiederkommen und zum Bleiben zu bewegen. Es hatte funktioniert. Sie hatten die Münzen aufgesammelt und eine Weile, manchmal sogar bis Sonnenuntergang, unter unserem Fenster gespielt. Ein paar Mal hatte ich versucht, ihnen etwas zuzurufen – leise, damit Cristina nichts hörte – aber sie hatten nie darauf reagiert, fast so als seien sie taub oder sprächen eine andere Sprache.
„Gib mir ein paar Maravedíes aus unserer Kiste“, forderte ich Evita auf, während ich das Fenster entriegelte. Die Sonne stand tief, und ihr Licht fiel golden herein.
Evita wusste genau, wo ich die Kiste versteckt hatte, dennoch zögerte sie in der Mitte der Kammer. „Ist es das, was dir missfällt?“ Von unten vernahm ich Rufen und helles Lachen. Zum ersten Mal bereute ich, eine so unaufmerksame Katechismusschülerin gewesen zu sein. Mir wollte keine passende Bibelstelle einfallen, mit der ich meine Schwester von der Rechtmäßigkeit unseres Tuns hätte überzeugen können.
„Auch unser Herr Jesus Christus hat die Bedürftigen beschenkt“, sagte ich schließlich, notgedrungen vage.
„Aber der Vater hat es verboten.“ Falten krausten ihre Stirn. Der Vater? Ich konnte mich nicht einmal entsinnen, wann er uns das letzte Mal persönlich Weisungen erteilt hätte.
„Mach das Kästchen auf“, sagte ich, ohne auf ihren Einwand einzugehen, und zog sie zu mir ans Fenster. Sie behielt ihre Hand auf dem Deckel und sah hinaus.
„Er hat es verboten, weil er Angst um uns hat“, flüsterte sie. „Da draußen wütet die Pest. Sieh! Dort brennen Feuer!“ Sie nahm ihre Hand von dem Geldkästchen und zeigte in die Ferne.
Ich verengte die Augen. Tatsächlich, weit hinten, zwischen den Lehm- und Ziegelhütten, stiegen Rauchsäulen auf.
„Ich rieche weder Thymian, noch Rosmarin oder Lavendel. Du?“
Mit zusammengekniffenen Lippen schüttelte Evita den Kopf.
„Na also. Diese Feuer sind nicht entzündet worden, um die Luft zu reinigen. Sie haben nichts mit der Pest zu tun. Vielleicht verbrennen nur ein paar Bauern ihr Strauchwerk.“ Ich fand mich sehr überzeugend. „Und selbst wenn. Glaubst du, die Krankheit hat Flügel und kann bis zu uns hinauf fliegen?“
Erneutes Kopfschütteln.
„Schau hinab“, versuchte ich Evitas Aufmerksamkeit auf die Kinder zu lenken, die sich tatsächlich um die Mauern des Nordwestturms herum versammelt hatten. „Wir haben Glück.“
Sie sah hinunter, das Kästchen an die Brust gedrückt. „Ich glaube, das ist der Sohn des Stallmeisters“, sagte sie dann verhalten.
„Gut möglich“, sagte ich. Und bevor sie einen erneuten Einwand erheben konnte: „Wie viel soll ich ihnen geben?“
Evita beugte sich ein Stück vor und zählte. „Fünf für jeden“, wisperte sie. „25 Maravedíes.“
Ich mochte nicht, dass sie stets flüsterte, als redeten wir Verbotenes, oder als könne uns jemand im eigenen Haus belauschen. Aber selbst das war mir jetzt egal. Ich hatte es geschafft, sie abzulenken, vielleicht sogar, sie aufzuheitern.
Ich kramte die Münzen aus der Kiste, die Evita mir offen hielt, und ließ sie in hohem Bogen hinabregnen. Zwei der Kinder, die mit einem Stöckchen im Sand malten, sahen verdutzt hoch. Dann grinsten sie. Ich war mir nicht sicher, ob es freundlich gemeint war. Ich lächelte, in der Hoffnung, dass sie meine Miene von unten erkennen konnten. Dann geschah etwas Unerwartetes. Zwei Mädchen, die sich bis eben mit ihren Murmeln beschäftigt hatten, sammelten mit systematischer Ruhe die Münzen auf, stopften sie in die Taschen ihrer groben Leinenkleider und wandten sich zum Gehen, ohne ein einziges Mal zu uns hinaufzusehen. Ein größerer Junge erhob sich, packte eines der Mädchen am Arm und schubste es, bis es die Maravedíes, oder zumindest einen Großteil davon, herausrückte. Abgehackte Worte flogen hin und her, die ich nicht verstand. Die Mädchen zogen von dannen.
Die zwei kleineren Jungen hatten sich ebenfalls erhoben, entfernten sich ein Stück und ließen sich in der Nähe der Stallungen nieder, um weiter in den Staub zu zeichnen. Ich war sprachlos. Sie taten, als existierten wir nicht. Nur der Größte von ihnen, mit zerrauftem dunklem Haar, barfuß, in Kniehosen und einer schmutzigen Schaffellweste, war geblieben. Er verschränkte die Arme und reckte uns das Kinn entgegen. Irgendetwas an seinem Gesicht wirkte deformiert, ich glaube, es war diese Narbe, die seine Oberlippe teilte. Er grinste breit. Dann nahm er die Arme auseinander, fummelte an seiner Hose herum und holte sein Geschlecht heraus. Einige Sekunden stand er so da, sein Geschlecht in der Hand, als zeige er damit auf uns, mit unverändertem Grinsen. Ich wollte vom Fenster wegtreten, konnte mich aber vor Überraschung und Scham nicht bewegen. Nun begann er zu springen und zu lachen. Immer wieder schnellte er in die Höhe und drehte sich mit jedem Sprung halb um sich selbst, immer noch sein Geschlecht schwenkend. Sein Lachen schraubte sich höher, wie sein Körper in der Luft, als wollte er abheben.
In dieses irre Gekreisel mischte sich ein hohes feines Läuten. Zunächst hielt ich es für unser Geld, das in seinen Taschen klimperte. Ein vom Abendwind getragenes, schwingendes Echo, das von Westen herüberdrang – die Glocken von San Sebastian, jenseits der Pinienhaine, die mit dem schrill-heiseren Lachen des Springers wetteiferten.
Endlich löste ich mich aus meiner Erstarrung und zog Evita an den Schultern zurück. Hastig verriegelte ich das Fenster, und weil das nicht genug schien, warf ich auch die Holzläden zu, eilig und krachend, wie ich es Cristina hatte tun sehen, wenn ein Gewitter nahte. Das Kreischen und das Glockenläuten erreichten uns nur mehr gedämpft, dann verstummte beides.
Evita hatte sich auf der Kleiderkiste niedergelassen. Während des gesamten Schauspiels hatte sie keinen Ton von sich gegeben.
„Evita, Cielo, wir sind zu alt für dieses Spiel“, sagte ich erstickt. Evita sah mich mit leerem Blick an. „Wir werden uns etwas neues ausdenken“, fügte ich hinzu und drückte ihre Hand.
Ich ging zum Lesepult hinüber, schlug Funken mit dem Feuerstahl und entzündete zwei Kerzen. Meine Finger zitterten, als sie nach dem Gänsekiel griffen. „Hör zu, ich muss noch einige lateinische Vokabeln schreiben, für morgen“, sagte ich betont beiläufig. „Du kannst gern bis zum Essen in meinem Zimmer bleiben, wenn du magst.“
Ich war mir nicht sicher, ob sie mich gehört hatte. Reglos blieb sie auf der Truhe sitzen. Ein paar Mal holte sie Luft, um sie wortlos wieder entweichen zu lassen. Mit jedem Atemzug sank sie tiefer in sich zusammen. Als ich es leid war, sie aus den Augenwinkeln zu beobachten, sog sie plötzlich schärfer Luft ein, wie eine Ertrinkende. Ihr Kopf ruckte herum, sie fing meinen Blick und begann atemlos zu sprechen: „Ich habe in das Antlitz unseres Herrn Jesu geschaut. Es war sehr dicht über mir. Er sah mich an, die Dornenkrone auf dem Haupt, und Blut lief ihm in die Stirn. Seine Haut war gelblich, wie bemaltes Holz. Er trug einen Spitzbart, wie El Veneciano. Aber seine Miene war hart ...“
Halb nahm ich wahr, wie Tinte auf mein Papier tropfte, gleichwohl gelang es mir nicht, den Federkiel zurück in die Halterung zu stecken. Was Evita erzählte, klang wirr. Ihr Blick glitt beiseite. Sie starrte an meinem linken Ohr vorbei, so als sehe sie den Gekreuzigten leibhaftig in der Zimmerecke. Ein Seufzen drang aus ihrer Kehle, ohne dass ihre Brust sich dabei hob oder senkte. Ihre Stimme wurde schleppend: „Seine Augen waren nach oben verdreht ... Er hatte Schmerzen ... große Schmerzen ...“ Evitas Züge verzerrten sich im Schein der flackernden Kerzen, um gleich darauf zu erschlaffen. „Doch dann nicht mehr.“ Sie sank in sich zusammen. „Er sagte ...“ Evita brach ab, murmelte Unverständliches. Mich fröstelte. Sie wurde wieder lauter: „Er sagte, auch ich könne für die armen Sünder sterben ... Da hat er mich wieder angesehen ...“
„Es war nur ein Traum“, schnitt ich ihr das Wort ab.
Stille. Dann murmelte sie: „Ich möchte wieder bei dir schlafen, wie früher.“
Ich biss mir auf die Unterlippe. „Du bist jetzt groß, Cielo. Das geht nicht mehr.“ Ich tat, als schriebe ich. In Wahrheit verschmierte ich den Tintenfleck zu einem sinnlosen, spinnennetzartigen Muster.
„Du glaubst also, wir werden uns nicht wiedersehen, wenn wir tot sind?“, hörte ich nach einer Weile ihre Stimme im Rücken, hell und klar. Ich wandte mich um.
Es dauerte einige Sekunden, bis ich begriff, dass sie wieder von Pomponazzis Tractatus sprach. Fast bereute ich, mit El Veneciano darüber diskutiert zu haben. Eine Antwort suchend, betrachtete ich meine schwarzfleckigen Fingerkuppen am Rande des Papiers. Meine Hände lagen schwer auf dem Pult, wie ein Paar vergessene Handschuhe. Im vorigen Sommer waren sie breit und kräftig geworden. Sie passten nicht mehr zu den schmalen Gelenken. Ich sah an mir hinab – auch meine Füße wirkten zu groß für den Rest des Körpers. Evita hatte ihre zierliche Gestalt bewahrt. Ihre flache Brust, die eckigen Schultern, das spitze Kinn ...
Ohne nachzudenken rief ich: „Cariño, was denkst du jetzt schon an den Tod!“
So wie die Flamme hochschlägt, wenn man in ein Feuer bläst, hörte ich Evita augenblicklich antworten: „ ... die ihr nicht wisset, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit währet, darnach aber verschwindet er.“
Meine Kiefermuskeln spannten sich. Ich dachte an die Worte des Doktors. „Lass uns das jetzige nutzen“, beschied ich, um einen kategorischen Tonfall bemüht. Als die Worte heraus waren, gefiel mir ihr Klang nicht mehr. Zu sehr erinnerte er mich an die Art, wie Don Juan Varo mit uns zu sprechen pflegte, wenn wir ihn zu Gesicht bekamen. Ich hielt den Atem flach und vermied es, Evita anzusehen. Bis zum Abendessen, während ich weiter tat, als schriebe ich, verfiel sie in Schweigen.
Das Silberbesteck war neu. Ungläubig wendete ich Messer und Löffel, betrachtete die feine Blumendekoration auf den Griffen. Von schräg gegenüber spürte ich El VenecianosBlicke.