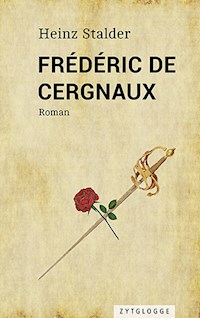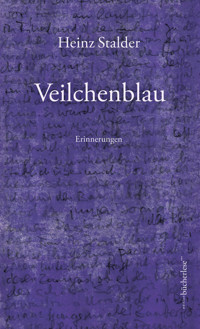
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Da lässt einer den Vorschlaghammer fürs Grobe aufs rotglühende Eisen sausen. Kann das Heinz Stalder sein, dessen Handwerkszeug nicht das Geringste mit einem Hammer zu tun hat? Der Autor, der stets Sinn fürs Feine, Differenzierte, für Treffsicherheit und ausgefeilte Stilistik bewiesen hat? Er ist tatsächlich dieser junge Mann, der – geht es nach den Plänen des Vaters – ein «zuschlagendes Handwerk» lernen soll und schliesslich mit dem Bleistift, einem Geschenk seiner Schwester, reüssiert. Zum Glück seiner Leser hat sich Heinz Stalder an deren Empfehlung «aufzuschreiben, was ihm durch den Kopf geht» gehalten. Und nun, etliche Jahrzehnte und viele Reportagen, Bücher und Theaterstücke später bewegt sich der gewitzte Autor auf den Spuren seiner an überraschenden Geschichten reichen Biografie, wendet sich mal hier-, mal dorthin, entdeckt auf dem Weg manche Besonderheit, lässt Umwege nicht ausser Acht, liebt das Mäandernde der mit Fabulierlust und Finesse vorgetragenen Miniaturen. Denkbar gross und spannend sind die Wechsel, wenn er auf Sieben-Meilen-Stiefeln die Zeiten durchreist: von den Äckern und Wiesen im Bernbiet nach London und von dort in die finnischen Wälder und zurück in die Zentralschweiz. Und überall begegnen dem Leser Menschen, die man wie diese Geschichten noch lange erinnern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz Stalder
Veilchenblau
Erinnerungen
Für Taina, Päivi und Tuuli
Inhalt
Auf die Pauke gehauen
Kein Mann fürs Grobe
Frühlingswehen auf der Pfauenbühne
Schmieden. Feilen. Bohren
Damenwahl
Familienverhältnisse
Odysseus, dräckig win e Moore oder Göttersagen auf Berndeutsch
Wer sich der Kunst zuwendet, wird für andere anders
Der amerikanische Bomber und die Kuh auf dem Schragen
Von pädagogischen und kulinarischen Irrungen
Heiss war es und windstill
Claudius von Katz, das malträtierte Jochbein und die alte Geige
Im besten Hemd des grossen Maestros
Nicht ohne die finnische Mythologie
Kulturfarbe Veilchenblau
Die Mütze oder ein mit militärischer Präzision inszenierter Einakter
Entwaffnet
Bühnenreifes Spektakel und die Theaterklaue
Wie eine Zirkusnummer
Am finnischen See die Eboli machen
Falsche Schecks, gerissene Muskeln und ein preisträchtiger Tanz
Ein Messer für Jaak
Das Chinasyndrom
Auf oder neben der Bühne
Kost und Logis auf Staatskosten? Nein, danke.
All you need is love mit der Königin der Nacht
Shut up, we are poets
Zweieinhalb Frauen tot und der Vater im Gefängnis
Fiskalisches und pädagogisches Einvernehmen
Die Plotmänner
Vom Jura ins Tessin durch Lappland wandern
Mit Erica Pedretti bis zum Morgengrauen tanzen
Dünnes Eis und filigrane Kunst
Kühe und Ratten auf der Bühne
Die Windorgel, das Rennrad und eine Nähmaschine – denke sich ein jeder, was er will
Eine Reise ins Umgekehrte
Weder Volker Schlöndorff noch Gino Paoli
Seemannsgarn
Die Männer, der Stimmbruch der Frauen
Der Todesfahrer, die Sensation des Schützenfests
Von den Lofoten nach Mühleberg und Allenlüften
In die Ohren – in den Sinn
Vom Abblättern der Unschulds-Farbanstriche
Wie Deutsch von der Kanzel einer emmentalischen Kirche
Gutdotiertes Scheitern
Romeo und Julia auf dem Ballenberg
Mit Jack the Ripper im Londoner East End
Bühne und Wirklichkeit
Eini vo üs
Cricket-Korrespondent vom Kontinent
King Richard, Henry VIII, Salieri und das Haus in Brighton
Wenn schon, dann wie eine Truppe abgehalfterter Gaukler
Flugtüchtig bis ins hohe Alter
Ungewöhnliche Methoden
In Boris Jelzin potemkinschen Kloster
Das Geständnis oder Der Tirolerhut, der gar keiner war
Ein Pferd mit einer Glocke um den Hals ist wie ein Schwingerkönig mit einem Huhn auf dem Arm
Viel mehr als Fussball
Preisverleihung
Vom Londoner East End ins East Village der Linda Geiser
Mit einer kugelsicheren Weste im richtigen Film
An extraordinary piece of art
S’isch kompliziert
Alois, der Bauer vom Sonnenberg und Quentin Crisp, der Stately Homo aus der New Yorker Bowery
Erfolgreiche Expedition ins pädagogische Hochgebirge
Well known writer
Eine Brücke über die Drina
Good night ladies
Mit Lady Evelyn Barbirolli im Schloss des Herrn Chrott
Eine kleine Kröte fährt einen Rolls Royce zu Schrott
Auf Reisen mit Johanna Spyri und Louis Chevrolet
Der Speerwerfer Urs von Wartburg
Lady Mackerras Sturz in der Berliner Philharmonie und eine Mondfinsternis
Wenn der Bauer beim Besamer ein zu langes Kalb bestellt
CASTUS AMOR – Keusche Liebe aus dem Jahr 1650
La donna e mobile
Vom Mount Everest zum Kilimandscharo
Keine Mondlandung, nur Süssigkeiten auf dem sowjetischen Dampfer
Opern in Savonlinna und Glyndebourne
Sieben Brüder und ein Autor
Schwer wie eine Streitaxt
Mit orthodoxen Mönchen die Suppe, die kurzen Nächte und den Frieden teilen
Mein New York
Blaulicht auf St. Marks und ein Hochzeitswalzer im Schneegestöber
Obsi
Die orientalische Amsel, das frivole Amulett und das Gold des Winkelruedi
Zeitreisen
Personenregister
Heinz Stalder. Bibliografie
«Wenn du lange genug Richtung Sonnenuntergang geschaut hast, schreibst du auf, was dir dabei durch den Kopf geht. Es muss nicht alles mit dem Gesehenen übereinstimmen. Erlaube dir, die Wirklichkeit auch mal zu verlassen. Vieles, was wir zu sehen vermeinen, ist ohnehin anders, als wir glauben.»
Die grosse Schwester zum kleinen Bruder
Auf die Pauke gehauen
Der Paukist schaut von den Noten zum Dirigenten, hebt den grössten Schlägel weit über seinen Kopf, wartet auf das Einsatzzeichen und schlägt wie der Gehilfe eines Schmieds mit dem Vorschlaghammer zu. Das Paukenfell platzt, der Schlägel bleibt im Paukenkessel stecken. Der Stiel rutscht dem jungen Perkussionisten aus der Hand. Aus dem Parkett kann das Malheur nicht gesehen werden. Auf den Rängen erschrecken ein paar aufmerksame Konzertgänger. Der Blitz, der nach dem dissonanten Donnerschlag vom weltbekannten Kapellmeister auf den Instrumentenschänder niederfährt, trifft auch mich.
Ich sitze auf der Orgelempore. Das Orchester spielt Smetanas Vaterland. Die Moldau hat ihr Ziel schon erreicht, die böhmische Amazonenkönigin flicht unter Getöse den Ritter Ctirad in die Speichen eines gewaltigen Rades.
Was würde mit dem jungen Mann geschehen, der das mächtigste Instrument auf der Bühne nicht absichtlich, aber eben doch demoliert, mit falsch motiviertem Eifer wohl das letzte Mal auf die barocke Pauke gehauen hat?
Kein Mann fürs Grobe
Auf rotglühendem Eisen hämmerte ich vier lange Jahre herum. Meist mit dem Vorschlaghammer fürs Grobe. Den Handhammer führten die Lehrlinge, die das mir fehlende Gespür fürs Eisen mit in den Beruf gebracht hatten. Einen Kreuzmeissel aus dem Handgelenk zurecht – und bis zum Härten der Schneidefläche fertig zu schmieden, dafür fehlte mir die nötige Sensibilität für das alte Handwerk. Mir ging die erforderliche Affinität für den Beruf von der Esse zum Amboss ab.
Es wäre mir aber auch nie eingefallen, in die Ambosspolka meiner Kameraden einzustimmen.
Das schmiedeiserne Tor zum Berner Erlacherhof, dem Sitz der Stadtregierung, und die bronzene Fenstervergitterung des früheren Konservatoriums, der heutigen Musikhochschule an der Kramgasse, beide bestehen aus Hunderten barocken Verschnörkelungen. Bei der Renovation der schützenswerten Kunstwerke wurde in den renommierten Lehrwerkstätten der Stadt Bern beim Schmieden zu zweit oder dritt die Ambosspolka des Albert Parlow, Berliner Komponist und Musikdirektor der Preussischen Armee, gebrüllt.
Einer der Meister schlug mit dem Metermass in der rechten Hand und den schnippenden linken Fingern den Takt dazu. Dass er in einer der städtischen Brassbands stellvertretender Dirigent war, konnte ich mir bei seiner pädagogischen Taktlosigkeit nicht vorstellen.
Der Meisterschmied war bloss Passivmitglied der Blasmusik unter der Fahne mit dem trompetenden Bären im Bauch des Violinschlüssels. Er war es, der mich beim Aufnahmegespräch nach meinen Freizeitbeschäftigungen, der Musik im Speziellen, gefragt hatte. Trompete, sagte ich und wunderte mich, warum die Musik zum Erlernen eines zuschlagenden Handwerks eine wichtige Rolle spielen sollte. Wenn schon das Gymnasium oder als zweitrangige Alternative das Lehrerseminar mit den finanziellen Möglichkeiten meines Vaters nicht in Einklang zu bringen waren, hätte ich mir vorstellen können, mich als Feinmechaniker an einer wie eine Sirene aus der Odyssee singenden Drehbank zu versuchen.
Nicht an einer russigen Esse mit gesundheitsschädigendem Schlackenstaub und Hammerstielen, an denen das Hautfett von anderen, grobschlächtigeren Männern klebte.
Mir grauste vor Trauerrändern unter den Fingernägeln mehr als vor dem Melkfett an den Händen meines Vaters. Oder dem Gestank von Jauche. Ob in der mit morschen Brettern gedeckten Grube vor dem Haus, im vollgepumpten Fass oder auf den Feldern verspritzt. Mein Vater führte die Gülle von Rind, Schwein und Mensch mit seinem meteorologischen Instinkt zuverlässig stets bei Westwind am Tag vor dem grossen Regen aus. Über den konkaven Verteiler am Hinterende des Jauchefasses bildete die braungelbe Flüssigkeit einen feinen Schleier aus Partikelstaub, der sich auch abseits des Tatortes in den Kleidern festsetzte und sich bis zur nächsten grossen Wäsche nicht vertreiben liess.
Frühlingswehen auf der Pfauenbühne
Ein Pestalozzi hiess mein drittes Theaterstück. Es stand 1979 auf dem Spielplan am Schauspielhaus Zürich: Pfauen. Dort kannte ich ausser Werner Düggelin noch niemanden. Dügg, wie man ihn vertraulich nannte, würde das Drama um einen fünfzigjährigen Volksschullehrer inszenieren.
An einem Donnerstag um sechs Uhr abends hatte ich im hehren Haus in Zürich einen Termin zum Kennenlernen bei Direktor Gerhard Klingenberg und dem Chefdramaturgen Herbert Meier. Ich unterrichtete als Primarlehrer im Krienser Aussenschulhaus auf dem Sonnenberg. Nach Schulschluss um zehn nach drei machte ich mich auf den Weg zur nächsten Station der Buslinie zum Luzerner Bahnhof. Es hatte längere Zeit nicht geregnet und eine Wetteränderung war angesagt. Ein starker Föhn blies über die Kuppe des Sonnenbergs. Schon in der kommenden Nacht würde der warme Südwind die Regenwolken über die Alpen getrieben haben. Höchste Zeit für die Bauern, die Jauche auf die trockenen Wiesen zu bringen. Für das wichtige, vielleicht entscheidende Treffen in Zürich, hatte ich mich besser zurechtgemacht als für die Schulstube. Der Geruch der Frühlingsjauche, die der Bauer, dessen drei Kinder ich soeben nach Hause entlassen hatte, gegen den Föhn auf seine Wiesen verspritzte, setzte sich in meinem Regenmantel, meinem Veston, meiner Sonntagshose und meinen wenigen Haaren fest. Schon im Bus rümpften die anderen Passagiere die Nasen. Im wie üblich um diese Tageszeit gut besetzten Schnellzug nach Zürich setzte sich niemand zu mir ins Abteil. Im Zürcher Tram Richtung Kunsthaus und Pfauen offerierte ich meinen Sitzplatz einer älteren Dame. Sie verzichtete, wand sich durch die feierabendmüden, von der Arbeit Heimkehrenden und liess ein Parfüm hinter sich, das ich nie mehr loswurde. Es sollte sich bald einmal als Chanel 5 herausstellen. Im Schauspielhaus führte mich Herbert Meier ins Direktionsbüro. Bevor ich dem Chefdramaturgen und Schriftsteller erklären konnte, woher der mich begleitende Geruch stammte, meinte er, die mich umwehende Landluft heimele ihn, den Solothurner an. Dem Wiener Klingenberg stieg ich fremd, wie ihm alles Schweizerische war und blieb, durch die Nase ins Bewusstsein. Immerhin trug ich eine unverwechselbar andere Duftnote auf die berühmte Pfauenbühne.
Schmieden. Feilen. Bohren
In den schweizweit besten Lehrwerkstätten war das Soll der Mechaniker schon erfüllt. Es brauche auch Schlosser und Schmiede mit Schulabschlüssen über einer Fünfeinhalb, wurde meinen Eltern nach dem Aufnahmegespräch mitgeteilt. Meine Mutter wischte sich ein paar stolzsalzene Tränen von den Wangen. Mein Vater spendierte am Sonntag der Jassrunde einen etwas teureren Rotwein. Von Musik wurde nicht mehr geredet, und ich lernte draufzuhauen. Vier Jahre lang. Nie gelang es mir, so heftig zuzuschlagen wie dem Paukisten Jahrzehnte später. Der Fehlentscheid, in einer Branche bestehen zu wollen, die meinen Begabungen so gar nicht entsprach, dafür fehlte mir der Mut. Hätte man mich bei einem Dorfschmied in die Lehre gesteckt, ich wäre nach dem ersten Fluch über meine Ungeschicklichkeit davongelaufen. Es waren die Ferien, die gleich langen wie am verpassten Gymnasium oder Lehrerseminar, die mich hinderten, zum verzweifelten Totschläger oder Deserteur zu werden.
Mein Vater bewirtschaftete seinen Hof ohne Pferde. Auf seine auch als Arbeitstiere eingesetzten Kühe gingen die Flüche und Hiebe wie die schlimmsten Unwetter nieder. Ihm, dem verschuldeten Kleinbauern, hätten die Honoratioren auf den Ämtern eine Zungensperre von der einen Mundecke zur anderen applizieren sollen. Nicht mir. Ich glaubte von klein auf zu wissen, was nicht über die Lippen durfte. Zumindest nicht für andere hörbar.
Der Meister, dem ich zugeteilt wurde, war berüchtigt für sein aufbrausendes Temperament, aber man ging davon aus, dass ich mit dem bestmöglichen Notendurchschnitt im Schulabgangszeugnis das nötige Selbstvertrauen in die Werkstatt, in das Reich des jähzornigen Herrn mitbringen würde.
Ich war der einzige erstjährige unter lauter zweit-, dritt- und vierjährigen Lehrlingen, die nichts anderes im Sinn hatten, als mir mit bisweilen bösartigen Sticheleien und Streichen das Leben, Schmieden, Feilen und Bohren schwer zu machen.
Einer – ein rothaariger Rüschegger aus dem bigotten Schangnau – hatte sich an meinem Schraubstock zu schaffen gemacht.
Ich hatte aus einem unförmigen Eisenklotz einen Würfel zu feilen. Bis beide Handflächen mit blutumrandeten aufgeplatzten Blasen versehen waren. Als ich zur Kontrolle ebendieser Blasen zum Meister gerufen wurde, löste die rotscheckige Schabracke die Backen meines Schaubstocks so weit, dass der über zwei Kilo schwere Klotz beim nächsten Einsatz meiner Feile aus der Halterung rutschte, auf meine linke grosse Zehe fiel, den Nagel samt Knochen zerquetschte. Bis heute ist der Nagel gespalten, und weder meine Fusspflegerin noch mein Arzt, denen ich von den nächtlichen Schmerzen erzählte, wollen mir die über siebzig Jahre zurückliegende Geschichte glauben.
Wegen meines Beharrens, der Verursacher meiner lädierten grossen Zehe sei der rothaarige Sohn eines Kesselflickers und einer um mehrere Ecken schielenden Wahrsagerin gewesen, musste ich mir neulich sagen lassen, ich sollte mein Vokabular dringend auf rassistische Ungereimtheiten überprüfen. Rothaarig wie ich selber war und väterlicherseits aus einer zwischen Rüschegg und Schangnau eingeklemmten Gegend stamme.
Nachdem die Winkel des zurechtgefeilten Würfels die Toleranz von plus minus einem halben Grad für passabel begutachtet worden waren, kam meine Zeit an der Bohrmaschine. Hier war die Gefahr einer hinterhältig geplanten Malträtierung gebannt. War das zu bohrende Eisen aber nicht korrekt eingespannt, konnte sich der Bohrer verheddern und zu einem weiteren Desaster führen.
So geschehen kurz vor einem Wochenendfeierabend. Kein grosses Malheur. Den zerbrochenen Bohrer musste ich dem Meister melden.
«Meister, der Bohrer ist in zwei Stücke zerbrochen.»
Der Meister griff nach einem Schmiedehammer, hob ihn wie der Paukist seinen Schlägel über meinen Kopf.
«Wenn ich dir jetzt den Schädel einschlage und danach deiner Mutter anrufe, ihr sage, du, ihr Sohn, seist soeben verstorben ...»
Als ich ihm auf seine Allegorie hin erklärte, wir hätten zu Hause kein Telefon, im ganzen Dorf gebe es nur im Wirtshaus einen Apparat, fürchtete ich zum ersten Mal um mein Leben.
Damenwahl
An einem Wochenende traf ich beim Gartenfest des örtlichen Trachtenvereins die Schulkameradin, die mir in der Nacht vor unserer Konfirmation verraten hatte, sie habe mich mit einem Strohhalm gekitzelt, damals auf der grossen Schulreise, als Buben und Mädchen, alle schon fast sechzehnjährig, in einem Heuschober in den Graubündner Bergen übernachtet hatten.
«Und du Langweiler bist nicht erwacht.»
Der Heublumenstaub hatte meine Nase verstopft, meinen Rachen verschleimt, meine Libido gelähmt und den im Hotel nebenan schlafenden Lehrer der noch unbedarften Knaben und schon viel weiter entwickelten jungen Frauen vor einer strafrechtlichen Verfolgung bewahrt.
Die Schulkameradin, die mich am Wochenende meiner definitiven Erkenntnis, weder als Schmied noch als Schlosser oder simpler Metallbearbeiter berufen zu sein, bei der von der Tanzkapelle angesagten Damenwahl auf die Bühne holte und mich während einer österreichisch-ungarischen Polka statt mit einem Strohhalm, mit aufdringlicher Körpernähe zu aphrodisieren versuchte, war aus dem Welschland angereist, um an der Abdankung ihrer ein paar Tage zuvor verstorbenen Patin teilzunehmen. Ich fand die Art, wie sich das verwaiste Patenkind in seinen viel zu schweren Halbschuhen und bis unters Knie reichenden grobgestrickten weissen Wollstrümpfen an mich drückte, wie ihr aus dünnem Fahnentuch geschnittenes Kleidchen bei jeder nicht von mir eingeleiteten Drehung ihre Oberschenkel freilegte, pietätslos.
Um ihre von mir nicht erwiderten erotischen Absichten zu verdeutlichen, stampfte sie auf den Tanzboden, als spielte die Musik eines jener nationalsozialistischen Marschlieder, die der reichste Bauer und Viehhändler trotz öffentlichem Verbot immer wieder auf seinem Grammophon spielen liess.
«Wacht auf, ihr faulen Hunde!»
Dazu lachte meine Tänzerin, zeigte ihre leicht vorstehenden Schneide- und Eckzähne, als wollte sie mir in die Finger beissen.
«Vas-y!», rief sie, als ob sie ihr Deutsch schon verlernt hätte und im weniger als ein Jahr zurückliegenden Französischunterricht nicht auf meine geschickt kaschierte Hilfe angewiesen gewesen wäre, um von der ungenügenden Drei wegzukommen.
Ich war noch keine vier aufgeweckten Jahre alt, als in der leerstehenden Remise meines Vaters internierte französische Offiziere ihre Araberhengste abstellten.
«Allez-y!», sagten sie. Nie «Vas-y!», und vermieden jeden Befehlston.
Familienverhältnisse
Meine Mutter war, bis sie ihren ersten Mann kennenlernte und heiratete, zweisprachig. Ihr Gatte, ein reiner Deutschschweizer, am Rand der schwarzen Erde des damals noch sumpfigen Grossen Mooses aufgewachsen, weigerte sich, Französisch zu verstehen und zu sprechen. Die Welschen von der Art meiner Mutter waren für ihn die Vettern meines rothaarigen Mitlehrlings und Verursacher meines gespaltenen Grosszehennagels. Schirmflicker, Scherenschleifer, Kartenlegerinnen und schielende Wahrsagerinnen hinter Nachttöpfen statt Glaskugeln. Dieser erste Mann meiner Mutter starb 1933, nachdem er auch so einem, der den Blinddarm nicht ennet der Saane, sondern lieber am Zürich- oder Vierwaldstättersee aus dem Bauch entfernen liess, für eine Bürgschaft unterschrieben hatte.
Für dreiunddreissigtausend Franken musste die Witwe und Mutter von vier Kindern geradestehen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als meinen Vater, ebenfalls Witwer, zu heiraten, um aus dem Gröbsten nicht unbeschadet, aber doch einigermassen manierlich herauszukommen.
Ihre von Venenentzündungen versehrten Beine musste sie zeitlebens mit elastischen Binden mumifizieren. Mag sein, dass ich wegen diesen fleischfarbenen, nach der dritten Wäsche nicht mehr elastischen auf- und abgerollten Wicklern in der zweiten Ehe der Mutter das Einzelkind blieb, das nach seinem sechzehnten Lebensjahr wegen eines zerbrochenen Metallbohrers mit einem Schmiedehammer totgeschlagen zu werden riskierte.
Die Kindheit? Gut war sie, um nicht von vornherein glücklich zu sagen und mich später, als alter Mann wegen aufkommenden Gedächtnisverlusts korrigieren zu müssen. Wie mein Vater, der nach aufwendigen Recherchen und den Aussagen einiger seiner dreizehn Geschwister als Zweitältester eine miserable Jugend hatte, ab siebzig aber jedes Jahr seiner Bubenzeit in ein rosigeres Bild verklärte.
Seine Mutter, meine Grossmutter, während der dritten Geburt religiös erleuchtet, war fest davon überzeugt, für die sündigen Momente vorangegangener Lust mit einer von Kind zu Kind lebensgefährlicheren Niederkunft Busse zu tun. Der Vater, mein Grossvater also, im deutsch-französischen Krieg von anno 1870/71 als Sergeant Major in der Armee des Generals Bourbaki und dann als Feldweibel der siegreichen deutschen Armee daran gewöhnt, sein Fähnchen nach dem Wind zu richten, notfalls mit aufgeblasenen Pausbacken pustend nachzuhelfen, wurde im zivilen Leben wegen seiner Sprach- und Frauenkenntnissen im Sommer Portier in einem nach Schwefel stinkenden Thermalbad in den Voralpen. Für seinen unkontrollierten Umgang mit dem anderen Geschlecht soll er mit Syphilis bestraft worden sein.
Mittels der im Winterhalbjahr gezeugten Kindern versorgte er seinen Hof mit Knechten und Mägden. Froh und dankbar für jedes weitere Kind, das im Sommer an seiner Stelle auf dem Hof arbeitete, blieb er länger als die Frömmigkeit meiner Grossmutter voraussah, aktiv.
Mein Vater dagegen begann seine soldatischen Jahre während des Ersten Weltkriegs mit den weit gefährlicheren Abenteuern des Sergeant Major und Oberfeldweibel zu verwechseln und schwärmte davon, was der aus fremden Kriegsdiensten und dem Badehotel für frigide Ehefrauen wohlhabender Bürger, aus gestürzten Monarchien geflohener Adeliger und schwerreicher Industrieller zu verheimlichen hatte. Auf einem Steckenpferd mit echter Rosshaarmähne ritt er Attacken gegen alle, die seiner Geschichtsklitterei keinen Glauben schenkten.
Ich wehrte mich gegen zahlreiche Nachbarskinder mit der unwiderruflichen Tatsache, von drei Paten zur Taufe getragen worden zu sein. Die Patin, Gattin eines Fürsprechers und Notars mit Mandaten bis hinauf ins nationale Parlament. Der eine Pate ein Grossbauer aus der katholischen Schweiz und schlussendlich der auf den Tag genau neunzehn Jahre ältere Halbbruder väterlicherseits. Er heiratete später eine Frau, die die Ausgaben für Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke auf maximal fünf Franken limitierte. Der katholische Grossbauer wurde noch vor meiner Konfirmation wegen unzüchtigen Verhaltens gegenüber Schulmädchen zu einer – allerdings erfolglosen – Therapie gezwungen. Die an sich grosszügige Patin zeigte sich nicht mehr, nachdem ihr Mann wegen massiver Veruntreuungen privater und öffentlicher Gelder mit anderen Betrügern inhaftiert wurde.
Ich war, kaum konnte ich gehen, der stolze Besitzer eines Dreiradvelos. Einem Nachbarbuben warf ich den Brausekopf einer Giesskanne ins Gesicht. Er behauptete, mein Rad sei eine Krücke. Wer ein Mann werden wolle, warte, bis er gross genug sei, auf einem Zweirad das Gleichgewicht zu finden. Die Wunde über seinem rechten Auge musste genäht werden. Die Narbe hinderte ihn, der Tradition seiner Familie folgend, ein guter Schütze zu werden.
Rechts zielen, das linke Auge schliessen.
An einem Klassentreffen machte ich ihm den Vorschlag, ich wäre durchaus bereit, ihm eine Schiessbrille zu finanzieren. Rechts entsprechend der Sehkraft angepasst und geschliffen, links schwarz abgedunkelt. Ich wusste nicht, dass er wegen mangelnder Unterstützung der Schützenlobby gerade die Wahl zum Stadtrat verpasst hatte.
Meine Halbschwestern waren alle mindestens zehn Jahre älter als ich. Sie waren, als ich eingeschult wurde, bereits aus dem Haus, geflohen vor meinem Vater, der nicht der ihre war.
Mich hatten sie gemocht. Im sonnengewärmten Wasser des Badezubers verzärtelt, in trockenen Tüchern gerubbelt und in grobleinene Windeln gewickelt. Weil ich aber nach ihren Berechnungen zu spät Herr über meine Peristaltik wurde, rümpften sie ihre von ihrem Vater vererbten spitzen Nasen.
Odysseus, dräckig win e Moore oder Göttersagen auf Berndeutsch
Das erste Jahr in der Institution, deren Exerzitien mit dem Begriff Schule verharmlost wurden, waren unter der Anleitung einer monströsen Frau ein immer wiederkehrender Alptraum, der mir bis heute in Erinnerung gerufen wird, wenn in einer Zirkusarena der dumme August vom weissen Clown drangsaliert wird.
Die Lehrerin war kein Clown wie die grosse Annie Fratellini, bei der ich fünfzig Jahre später in Paris in die Kunst des Jonglierens eingeführt wurde.
«Drei Bälle», sagte mir Annie Fratellini, «lernt jeder zu beherrschen, wer tanzen kann, kann auch das Jonglieren lernen.»
Meine erste Lehrerin geriet beim Turnunterricht, bei dem sie ein Tamburin malträtierte, regelmässig aus dem Takt, wenn die kleinste Erstklässlerin auf ihren kurzen Beinen nicht Schritt halten konnte, mehr tanzte als marschierte. Und auch ich weinte, wenn mich auf halber Höhe der Kletterstange die Kraft verliess, ich auf den Turnhallenboden zurückrutschte, das Fräulein Lehrerin mich einen Schlappschwanz schimpfte. Harte Bälle warf sie uns an die Köpfe, wenn sich unsere Tränen mit Nasenrotz vermischten.
Als ich zu Hause gefragt wurde, wie es mir in der Schule gefalle, schaute ich zur Mutter auf und sagte, das Fräulein sei viel dicker als sie. Mein Vater ass gerade seine nachmittägliche Portion Schabzieger aus dem Glarnerland, lachte laut auf, verschluckte sich, keuchte, die Mutter schlug ihm ein paarmal mit der flachen Hand auf den Rücken.
«Lach nicht, wenn dein Sohn lieber eine dünnere Lehrerin hätte.»
Meine Mutter war etwas füllig. Traditionell gebaut, wie der Schotte Alexander McCall Smith von seiner wunderbaren Heldin Mma Ramotswe sagte.
Leider gab es während meiner ganzen Schulzeit für meine Mutter keine Gelegenheit, sich wie die Romanheldin aus Botswana als Detektivin zu beweisen. Sie vermutete hinter guten wie schlechten Geschichten immer finstere Machenschaften. Als ich ihr nach einem von Heimweh dominierten Ferienlager im Berner Oberland von den Geschichten berichtete, die der Schullagerleiter uns jeden Abend erzählte, stellte sie aufgebracht Nachforschungen an, wollte wissen, was es mit dem Herrn Meyer auf sich haben könnte, der uns jeden Abend vor dem Einschlafen Geschichten von Männern und Frauen, Zauberinnen und Helden, Göttinnen und Göttern, hölzernen Riesenpferden, einäugigen Riesen erzählte. Baumstämme wurden zugespitzt, angebrannt und in das Auge des Riesen gerammt.
So etwas für noch nicht zehnjährige Kinder! Pfarrer war er ja nicht, der Herr Meyer. Seine Frau spielte in der Kirche bloss die Orgel. Klein wie sie war. Mit kürzeren Beinen als die Trettasten des Instruments auf der Empore voraussetzten. Er war ein fauler Hund. Nur Lehrer. Kein weiteres Amt. Nicht Chordirigent. Nirgends Sekretär oder Vereinskassier. Nicht einmal Revisor.
Und dann erschien kurz nach seiner Pensionierung Homer uf Bärndütsch.
Warum?
Weil im emmentalischen Krachen, wo Albert Meyer geboren wurde und aufwuchs, ohne auch nur der Spur nach manieriert zu wirken, so lautmalerisch und rhythmisch geredet wurde wie Homer seine Geschichten um den Helden Odysseus geschrieben hatte.
«Odysseus trat beschmutzt unter den Hecken hervor», konnte man in der besten deutschen Übersetzung lesen.
«Dr Odysseus, dräckig win e Moore, isch unger de Studerete vüregschnaaget.»
Meine Mutter verstand etwas von Sprache, ging am nächsten Sonntag in die Kirche, wartete nach dem Amen auf die Organistin und entschuldigte sich bei ihr.
«Wofür denn?»
«Dass ich deinen Mann verdächtigte, meinem Buben Geschichten erzählt zu haben, die keinen Sinn ergeben.»
Frau Meyer bedankte sich.
«Mein Mann hat ein Leben lang nichts anderes gemacht als Lehrer zu sein, Griechisch zu lernen und diesen Homer in eine Sprache zu übersetzten, die dem Hexameter am nächsten kommt.»
Dass meine Mutter mit den homerischen Hexametern etwas anzufangen wusste, verstand ich damals nicht, bewunderte sie aber dafür. Sie kaufte das Buch und las es mehrmals von vorne bis hinten, immer laut und trieb meinen Vater aus dem Wohn- ins Wirtshaus. Drei Flaschen vom besten Burgunder hätte er für den Preis des Buches kaufen können.
«Sie besäuft sich mit griechischen Göttern und Helden, die berndeutsch reden.»
Seine Jasspartner schüttelten die Köpfe. An den Sonntagnachmittagen waren hiesige Könige, Damen, Bauern und Asse Trumpf.
Wer sich der Kunst zuwendet, wird für andere anders
Meine jüngste Halbschwester wurde Näherin und weil sie es mit schwierigen halbwüchsigen Kindern konnte, Betreuerin in einer Anstalt für schwer erziehbare Knaben. Als ihr der Direktor der nur hinter vorgehaltener Hand anrüchig genannten Institution zu nahekam und an die Wäsche wollte, ging sie nach England, wo sie verantwortlich wurde für die drei Kinder eines aufstrebenden Mitglieds der konservativen Partei. Man sagte ihr nach, wenn man sie en face betrachte, stelle sich unweigerlich eine Ähnlichkeit mit der jungen Königin Elizabeth II ein. Das Profil stimmte weniger. Sie schickte mir zu Weihnachten ein englisch-deutsches Wörterbuch, einen kleinen roten Collins, um den mich auch der Englischlehrer geradezu schamlos beneidete. Die Mutter bekam eine Wärmflasche aus Gummi. Das rote, etwas unangenehm anzufassende Ding war mit Hotwaterbottle angeschrieben.
Mein Vater hatte wegen den moralisch etwas diffusen Geschichten um meinen Grossvater etwas gegen das Französisch meiner Mutter und weigerte sich, unumgängliche Begriffe und Wörter der Sprache entsprechend in den Mund zu nehmen. Er lachte meine Mutter respektlos aus, als sie die englische Hotwaterbottle deutsch intonierte. Ausgerechnet er, der den Namen des verehrten Generals Charles de Gaulle genauso auszusprechen pflegte wie er ihn in der Zeitung las.
Die zweite Halbschwester überlebte ihren Mann, einen ambitionierten Bauern, um viele Jahre. Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte sie mir ein schwarzes, in Leder gebundenes Notizbuch und einen Druckbleistift der Marke Caran d’Ache. Sie war befreundet mit einer Frau, die wiederum mit einem Mitglied der Schulkommission verheiratet war. Über diesen Kanal hatte sie sich kundig gemacht, dass ich mich in der Schule mit eigenwilligen Natur- und Charakterbeschreibungen meiner Familie und Nachbarschaft hervortun würde. Am Ende der Äcker und Wiesen meiner Eltern stand ein alter, verknorpelter Apfelbaum. Längst hätte man ihn fällen sollen. Weil er aber zwei Nachbarn im Wege stand, behauptete mein Vater, unterstützt von meiner Mutter, die Sorte der Äpfel sei vom Aussterben bedroht, der Baum stehe darum unter Naturschutz. Eine Behauptung ohne jegliche amtliche Beglaubigung.
Stellte ich mich unter ebendiesen Baum, sah ich weit über das Land, das weder meinem Vater noch dem ersten Mann meiner Mutter, dem Vater meiner Halbgeschwister, gehörte.
«Setz dich unter den Baum am Ende der Furchen», riet mir die Halbschwester, die nicht die geringste Ähnlichkeit mit der englischen Königin, noch sonst einer Berühmtheit hatte. Sie las keine Zeitschriften und kitschigen Heftchen, hatte keine Ahnung von den erfundenen Interna des europäischen Adels.
«Wenn du lange genug Richtung Sonnenuntergang geschaut hast, schreibst du auf, was dir dabei durch den Kopf geht. Es muss nicht alles mit dem Gesehenen übereinstimmen. Erlaube dir, die Wirklichkeit auch mal zu verlassen. Vieles, was wir zu sehen vermeinen, ist ohnehin anders, als wir glauben.»
Komisch, dachte ich. Sie, die mit Albert Meyers antiken Geschichten und Versmassen nichts anfangen konnte, wollte aus mir einen Schriftsteller machen. Einen unter einem geschützten Apfelbaum mit Aussicht. Das Notizbuch fühlte sich gut an. Den Druckbleistift brauchte ich nicht ständig zu spitzen. Die Mine war so dünn, dass der Fingerdruck auf gewöhnliche in Holz gefasste Stifte reduziert werden musste. Nebel stieg aus dem Gras, der Hosenboden wurde feucht, die Finger klamm. Zu Hause in der warmen Küche schrieb ich meine ersten Zeilen.
«Bei Nebel verlieren sich die Furchen, parallel, wie sie nun einmal sind, in der Unendlichkeit. Was Parallelen auch zu tun haben, sollte die Geometrie tatsächlich eine exakte Wissenschaft sein».
Stolz war ich auf die schriftliche Feststellung meines Aufenthalts unter dem Apfelbaum nicht. Meine Halbschwester fragte mich, ob sie die erste Seite lesen dürfe. Danach würde sie sich nie mehr in meine Gedanken einmischen.
«Denn, wer sich der Kunst zuwendet, wird für andere anders.»
«Wie anders?», fragte ich.
«Nicht mehr so, wie wir, die wir nur sehen, hören oder lesen. Du bist und wirst noch mehr nur mein Halbbruder sein. Auch wenn du mehr von deiner Mutter hast.»
«Du siehst doch auch wie Mutter aus.»
«Äusserlich ja. Aber auch sie dachte ganz anders.»
Ich wusste nicht, wie unsere Mutter dachte. Manchmal, an schönen Sonntagnachmittagen, nahm sie die abgewetzte Decke von der Küchenbank, schüttelte sie im Hof aus, breitete sie unter dem hohen Birnbaum aus, liess sich darauf nieder, löste ihre elastischen Binden von den Beinen, legte sich auf den Rücken und sah durchs Geäst zum Himmel. Als ob sie demnächst eine Erscheinung erwartete. Seit sie sich in die berndeutsche Odyssee vernarrt hatte, kam sie mir unter dem Birnbaum vor wie Kirke, die homerische Göttin Kirke, die auf der Insel Aiala Männer in Schweine verzauberte.
Noch bevor man mir bescheinigte, reif für die Schule zu sein, legte ich mich an den Sonntagnachmittagen neben sie unter den Birnbaum, sah mit ihr nach oben. Manchmal setzte sich ein Käfer, im besten Fall ein Schmetterling auf unsere Nasen.
«Jetzt könnten wir deinen Vater brauchen», sagte die Mutter dann und lachte. Mein Vater begann bei der kleinsten Anstrengung ausschliesslich durch den Mund zu atmen. Er speicherte die Luft in riesigen Pausbacken, und ich wartete angespannt, wann er sie laut pustend unter seinem grossen Schnurrbart durch den zugespitzten Mund wieder entliess.
Der amerikanische Bomber und die Kuh auf dem Schragen
Einmal fiel mein Geburtstag nach einem Schaltjahr statt auf einen Sonn- auf den Montag. Mutter legte die Decke unter den Birnbaum, gegen den mein Vater wegen der von seiner Frau darunter verbrachten Mussestunden zusehends skeptischere Gefühle hegte. Sie lud mich und meinen Vater zu einem Déjeuner sur l’herbe ein. Erdbeerkuchen, Schlagrahm, Löffelbiskuits, Kaffee, Gebranntes für den Vater, Himbeersirup für mich.
Im Stall waren die Kühe geputzt, gestriegelt und mit lauten Flüchen eingedeckt. Mir zuliebe setzte der Vater sich zu uns, machte gute Miene zu meinem Geburtstag. Ein lautes Brummen und eigenartiges Rattern erschreckte meine Mutter. Wie eine Sprungfeder aus einer durchgescheuerten Matratze sprang sie auf die Beine. Wie ein Bodenturner, wie einer der Männer, die sich neuerdings auf der Spielwiese beim Schulhaus und bei schlechtem Wetter im Theatersaal des Wirtshauses zu gemeinsamen Verrenkungen ihrer Körper trafen. Meiner Mutter widerstrebte es, einen gesunden Geist von einem funktionierenden Körper abhängig zu machen. Ihre gegen Venenentzündungen eingebundenen Beine hatten keinen Einfluss auf ihr Verhalten, wenn es darum ging, dem Gemeinderat den Vorwurf zu machen, die Politik sei nicht dazu da, die Männer von ihren Frauen fernzuhalten, wenn diese nicht mehr in der Lage seien, Kinder zu gebären. Das Rattern und Brummen stieg von hinter dem Wald über das Dorf auf und hörte sich von Sekunde zu Sekunde biblischer an. Die Trompeten von Jericho, das Einstürzen der Stadtmauern. Im dicken, durchnummerierten heiligen Buch zu lesen, löste bei der Mutter den Zwang aus, etwas zu lernen, zu begreifen und zur Vergebung ihrer Sünden als Pfand einzusetzen. Ich kann mir auch fast achtzig Jahre danach nicht vorstellen, womit sich meine Mutter hätte Schuld aufladen können. Und dann war es direkt über uns, verdunkelte für einen Augenblick die Sonne, erschütterte den windstillen Montagvormittag. Unreife Birnen fielen vom Baum. Eine traf Mutters Kopf. Mich verfehlten sie knapp.
«Ein Flugzeug! Ein verirrter Amerikaner. Ein viermotoriger Bomber mit gläserner Nase. Von Schweizer Moranen und C-36 beim Eindringen in den neutralen Luftraum abgefangen, zum Militärflugplatz in Payerne begleitet und zur Landung gezwungen. Bravo!»
Mein Vater kannte sich aus. Meine Mutter blieb stehen. Die harte grüne Birne hatte sie beim stirnseitigen Haaransatz getroffen und eine deutliche Beule hinterlassen. Eine Tasse Kaffee, ein Stück Erdbeerkuchen halfen ihr, den Schrecken und das beängstigende Herzklopfen hinter sich zu lassen. Vater hatte den Flieger, der, wäre in unserem Dorf die Kirche ein bisschen weiter links gebaut worden, den Glockenturm umgemäht hätte, nach seiner Art eingeschätzt.
«Der Amerikaner wusste genau, wo er sich befand. Der hatte einfach genug, sich von den Deutschen mit den in der Schweiz hergestellten Flab-Kanonen um die Ohren schiessen zu lassen.»
Die Geschichte mit der rücklings auf einem Schragen liegenden, alle Viere von sich streckenden Kuh, kam später dazu. Die Bruna, Vaters Lieblingskühe hiessen – auch wenn er sie mehr als die anderen mit Flüchen, Gabelstichen und Schlägen gegen die Haxen malträtierte – alle Bruna. Bruna hatte Eisen gefressen, war unter dem Birnbaum zusammengebrochen und musste quasi vor Ort notoperiert werden. Was wäre, wenn jetzt wieder ein röhrender Amerikaner von hinter dem Wald hervor geflogen gekommen wäre, mit seiner Nase auf die Kuh gezielt, das verschluckte Stück Eisen mit einem magnetischen Haken aus dem aufgeschlitzten Bauch gerissen, das Korpus delicti als baumelnde Trophäe entführt und sich einen Dreck um eine erzwungene Landung in der sich immer wieder zum neutralen Staat erklärenden Schweiz gekümmert hätte?
In meinem preisgekrönten Theaterstück Wi Unghüür us Amerika verarbeitete ich meinen Geburtstag, das Malheur mit der Kuh Bruna, den zur Landung gezwungenen amerikanischen Bomber und die von meinem Schabziger schleckenden Vater tausendmal erzählten Erlebnisse aus der glücklichen Zeit des Aktivdienstes im Ersten Weltkrieg anno 1914/18.
Als ich das Manuskript dem Verlagsdramaturgen zeigte, fragte er mich, die wievielte Version des Papierstapels dies sei.
«Die einzige», sagte ich. Es gebe auch keine Kopie.
Der Dramaturg schaute drein wie eine Sträggele, eine Sagenfigur aus dem Enziloch im Luzerner Hinterland. Nein, damals wusste ich noch nichts von den wilden Gestalten, die im Stammland des aus hohen Gläsern getrunkenen Kaffees mit viel hochprozentigem Birnentresterschnaps und höchstens zwei Stück Zucker wohnten. Im Militärdienst war mir aufgefallen, dass die Kaffee-Träsch trinkenden Kameraden im Vollrausch veitstänzig wurden, die Zunge nicht mehr beherrschten, sie aus dem Mund hängen liessen, sie blutig bissen, den Schmerz nicht lokalisieren konnten, ihre Gesichter zu Grimassen verunstalteten. Wie die in Lindenholz geschnitzten Fratzenmasken der Enzilochsträggelen.
Auch Dramaturgen verändern ihren Gesichtsausdruck von einem Wort zum andern, wenn der Autor noch lebt und dem Theatermann nicht zu folgen gewillt ist, wenn die vielleicht schon vierte Fassung zwischen den Zähnen knirschend zermalmt und erst in unverständlichen Sätzen wieder ausgespuckt wird. Ich wusste, wovon ich sprach.
Von pädagogischen und kulinarischen Irrungen
Nachdem ich den Vorschlaghammer in die Essen geschmissen hatte, setzte ich mir in den Kopf, nie mehr die Rückstände eines Handwerks unter meinen Fingernägeln wegkratzen zu müssen.
Ich schrieb mich in einem Abendgymnasium ein und übernahm die Stelle eines Freundes, der an einer Privatschule für Kinder unterrichtete, die weder die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium, noch die an die Sekundarschule geschafft hatten, dafür mit Eltern ausgestattet waren, die sich dennoch eine höhere Ausbildung ihrer Sprösslinge leisten konnten. Lehrer aber wollte ich nicht werden.
Ins Seminar wäre ich vielleicht gerne gegangen, wenn da nicht der Internatsbetrieb gewesen wäre. In einem Schlafsaal zu liegen, den Geräuschen und Ausdünstungen Gleichaltriger, an der Schwelle der Mannwerdung verzweifelnder Noch-Knaben ausgesetzt zu sein, erschien mir schlimmer, als dem Vater beim Schabzigeressen zusehen zu müssen oder einen Melkstuhl an den Hintern zu binden, sich an den Zitzen einer Bruna, Stella oder Amanda zu vergehen. Ich war und bin auch kein Milchtrinker. Was von blossen Händen oder mit der Maschine den Kühen abgewonnen, gepresst oder gesaugt wurde, grauste mich. Trauben wurden zerstampft, ausgepresst, der Saft in Fässer abgefüllt und einen Winter lang der Gärung überlassen. Auch dieser Vorgang stieg mir in die Nase, verursachte Übelkeit. Milch was Wein, gleich wie – wobei: Saure Milch und fermentierter Traubensaft machten mir während meiner Zeit in den Weinbergen am Bielersee bewusst, waren nicht zu vergleichen.
Aus Melton Mowbray in der englischen Grafschaft Leicestershire berichtete ich über die Fuchsjagd, die liebste Freizeitbeschäftigung des Landadels, und kam zum ersten Mal in den Genuss eines Urstiltons, zusammen mit altem Portwein und jungen Selleriestangen. An der Bar eines Landgasthauses nippte Prinz Charles an einem Real Ale, während ich mit den weltlichen Fuchsjägern im verrauchten Hinterzimmer zwischen Snookertischen vom Wirt bedient wurde, der 1964 als abgebrannter Student in der Pinte Vaudoise der Lausanner Expo kellnerte und sein Talent als Gastronom entdeckte. In die Geheimnisse des blau verschimmelten Käses wurde er später in Melton Mowbray eingeweiht. Die Römer, auf dem Weg zum Hadrians Wall, verjagten ein paar Bauern, die gerade dabei waren, aus einem flachen hölzernen Gefäss à la Kappeler Milchsuppe einen frugalen Lunch zuzubereiten. Die Römer, aus Angst, die schon etwas angesäuerte Milch könnte zu Durchfall führen, zogen weiter, vorsichtig kehrten die Leicestershire Bauern zurück. Vieles hatten die römischen Legionäre auf ihrem Marsch durch die von Hecken gesäumten Wiesen mitlaufen lassen, nicht aber den runden, flachen Bottich mit der verdorbenen Milch. In den Städten Englands wird genauso wie auf dem Land seit Henry VII gegessen, was auch immer auf den Tisch kommt. Wer keinen Titel im Namen trägt, kein Cricket spielt, höchstens mit Pfeilen aus kurzer Distanz auf eine über der Theke befestigte runde Scheibe wirft und in den Höflichkeitsschlangen immer weiter hintenansteht, isst auch, was gestern schon überfällig war. Der Stilton, einer der edelsten Käse, wurde von armen hungrigen Bauern der Not gehorchend zufällig erfunden. Stolz berichtete ich in einer kulinarischen Nische des einzigen Weltblattes der Schweiz über die Gewinnung des Stilton und wurde danach in sehr freundlichem Ton in Leserbriefen dahingehend belehrt, weltweit sei jeder blau verschimmelte Käse auf von fliehenden Bauern zurückgelassene Milch zurückzuführen.
Wie die frühmorgens von Bediensteten gepflückten, miteinander vermischten Erd-, Heidel-, Him- und Brombeeren zur Confiture des rois wurden, bekam der Stilton das Attribut Cheese of the King. Bei Charles Dickens und Oscar Wilde recherchierte ich über die Herkunft des Sandwichs. Auf der Zehnpfundnote war ein Cricket Match aus den Pickwick Papers dargestellt, Wilde liess in seiner genialen Gesellschaftssatire The Importance of Being Earnest die dreieckigen Brotstücke mit Wasserkresse des Lord Sandwich auftragen.
Wenn es mir in London, wo ich mich im East End unter den zugewanderten Menschen aus Bangladesch, Pakistan und Somalia wohl fühlte, im reichen und eleganten St Johns Wood unter Minderwertigkeit litt, suchte ich in der St Martins Lane beim wie aus einem Sarg sprechenden Schöpfer des Dorian Gray Trost.
«We are all in the gutter, but some of us are looking to the stars.»
Lange bevor ich mit einem sehr gut dotierten Stipendium für ein Jahr nach London fuhr, und noch in der Westschweiz zu Hause war, spottete ich über Luzern und meine Angst, dort von den Heerscharen geistlicher Würdenträger, Priestern und ihren Köchinnen, Mönchen und Nonnen nicht zur Beichte zugelassen und als armer Sünder entmannt zu werden.
Es kam anders. Mag sein, dass der schweizweit grassierende Pädagogenmangel meine mit Auszeichnung abgeschlossene Lehrerwerdung erleichterte. In den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts stand Geld aus heutiger Sicht fast ohne Limiten zur Verfügung. Auch zu zweit und bald auch für drei reichte die staatliche Unterstützung für zwei Jahre ohne besonders schmalbarten zu müssen.
Heiss war es und windstill
Meine Frau, die ich an einem heissen Julitag hoch über dem Bielersee kennengelernt hatte, schrieb mir in einem der täglichen Briefe aus Finnland, vielleicht sollten wir die Abmachung, uns zwischen Weihnachten und Neujahr zur Verlobung auf halbem Weg in Kopenhagen zu treffen, etwas modifizieren. Eine Reise meinerseits nach Finnland wäre angezeigter. In der finnischen Gesellschaft würden die Frauen eine ganz andere Rolle wahrnehmen als in der von ihr durchaus geschätzten Schweiz. Noch bevor Finnland 1917 von Lenin in die Selbstständigkeit entlassen worden sei, hätten die Frauen bereits unter dem russischen Zaren das Wahlrecht gehabt. Auf dem Land sogar schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Als unverheiratete Studentin ein Kind zur Welt zu bringen, würde sie zweifelsohne nicht zu einer Frau machen, auf die man mit dem Finger zeige, aber vielleicht könnte sie mit einem Schweizer Pass, den sie durch die Heirat ohne bürokratische Hindernisse bekäme, etwas Beschleunigung in die leidige Sache mit dem noch ausstehenden Frauen-Stimm- und Wahlrecht bringen.
An jenem heissen Julitag oberhalb der Rebberge von Twann und Ligerz stand nachmittags um drei Uhr nicht nur der Wind, auch die Zeit stand still. Die Trauben reiften vor sich hin. Das Gartenrestaurant Aux trois amis döste wie in einer mediterranen Siesta. Ich wohnte in einer kleinen Wohnung im Ferienhaus eines Spenglermeisters. Über der Strasse stand das sehr respektable Anwesen eines weitherum bekannten Weinbauern. Wenn er lachte, zitterte weit unten im See die St. Perstersinsel, auf der Jean-Jacques Rousseau retour à la nature fand. Der Spengler und der Winzer waren gute Freunde. Beste konnten sie wegen eines Kirschbaumes nicht werden. Er stand im Garten des Vigneron, war uralt, trug kaum mehr Früchte und versperrte dem Wochenendhaus des renommierten Klempners aus der Stadt die Aussicht. Tausend Franken bot der Handwerker dem Weinproduzenten für das Fällen des Baumes.
«Nicht für zehn-, nicht für zwanzigtausend», lachte der Weinbauer entrüstet.
Und dann stürzte der vom Mark her von Ameisen ausgehöhlte Baum an jenem heissen Julitag in sich zusammen. Niemand war direkt Zeuge, niemand hatte Hand angelegt. Der Spenglermeister wurde benachrichtigt, auf die gebotenen tausend Franken hingewiesen, und im Gartenrestaurant mit der zauberhaften Aussicht auf den See, die Insel Rousseaus und weit darüber hinweg auf die im ewigen Schnee glänzenden Berner Alpen, kam es zu einem spontanen feuchtfröhlichen Fest. Unter einem breitrandigen weissen Stoffhut mit hierzulande noch nie gesehenen grossen schwarzen Tupfen stand sie da. Das Sommerkleidchen endete oberhalb, weit oberhalb, der Knie und war wie der Hut getupft. Weiss und rot. Marimekko. Sie hielt ein Weinglas in der Hand, liess es sich immer wieder auffüllen. Sie vertrug den süffigen Twanner besser als alle Einheimischen. Ich war nicht mehr allzu sicher auf den Beinen und versuchte mich ihr mit meinen von früheren Anhalterreisen kreuz und quer durch Skandinavien aus Finnland mitgebrachten Sprachfetzen zu nähern. Völlig nüchtern küsste sie mich, nahm mich quasi unter ihre Arme und brachte mich nach Hause. Sie wohnte zwei Häuser weiter bei einer Basler Familie, deren Kinder sie hütete, wenn die Eltern ihren Berufen nachgingen. Als der Kirschbaum zusammenstürzte, hatte sie keinen Dienst. Die Kinder feierten mit.
Claudius von Katz, das malträtierte Jochbein und die alte Geige
In den Weinbergen war alles anders, nicht so kompliziert wie bei meinen früheren amourösen Annäherungen. Eine potentielle Schwiegermutter hatte mich mehrmals, wenn ich bei der kulturell gebildeten, wie diesbezüglich auch sehr aktiv tätigen Familie eingeladen war, mit Gesprächsthemen blossgestellt, bei denen ich als Schlosser- und Schmiedelehrling in keinster Weise mithalten konnte. Vor allem, wenn es um klassische Musik ging.
«Du musst sie, die von Dünkeln angefressenen Snobs, mit ihren eigenen Machenschaften attackieren», riet mir ein Freund und coachte mich vor der nächsten Konfrontation mit meinen mir überlegenen Fertigmachern.
Mein Freund, kaum war er des Lesens fähig, konnte den ganzen Max und Moritz auswendig. Für einen Franken pro Streich stellte er sein Talent jederzeit unter Beweis.
«Sag ihnen», hämmerte er mir ein, «du hättest anlässlich eines Konzerts die Uraufführung der ersten Sinfonie eines gewissen Claudius von Katz erlebt und die Musik sei dir unter die Haut gefahren als hätte das Orchester nicht bloss nach den Sternen gegriffen, viel mehr sei es dem Dirigenten gelungen, wie der römische Kaiser Caligula in Albert Camus’ neuestem Stück, den Mond vom Himmel zu holen. Vier Sätze lang eine einzige opulent musikalische, alle Sinne euphorisierende Orgie. Allegro alla boscaiola, Moderato poco stagionato, Andante molto dirottare, Finale agliosa.»
Die Rache des bisher musikwissenschaftlich Unwissenden gelang. Zumindest bis zu den Tempi. Als der Schwiegervater in spe sich auf die von ihm an der Universität gelehrte Etymologie besann, das berndeutsche Büssi als Katze identifizierte, Claudius zum Claude machte, ergab sich der von mir hochgelobte Claudius von Katz folgerichtig als Claude Debussy, und ich wurde des Hauses verwiesen.
Der Begegnung im Geäst des eingestürzten Kirschbaumes musste ich auch nicht erklären, wo bei einem Mann das Jochbein einzuordnen ist. Eine weit weniger nachhaltige Bekanntschaft rammte mir im bereits überbelegten Fiat cinquecento eines Freundes ihre grosse, korbähnlich Handtasche gegen den Kopf. Das veranlasste mich, die sehr schöne und auf mich fokussierte junge Frau unter Schmerzen darauf aufmerksam zu machen, dass sie mein Jochbein malträtiere, worauf sie sich genötigt sah, mich für meine obszöne Entgleisung zu ohrfeigen.