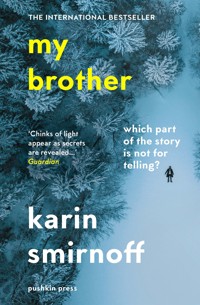10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Millennium
- Sprache: Deutsch
Der achte Band der international erfolgreichen Millennium-Reihe
Langsam kehrt die Sonne in den Norden Schwedens zurück, doch die Lage in der kleinen Stadt Gasskas ist düster: Die Bodenschätze der Region werden ohne Rücksicht auf Land und Leute ausgebeutet. Eine Gruppe von Aktivisten, denen sich auch Lisbeth Salanders Nichte Svala anschließt, will verhindern, dass der stillgelegte Tagebau zu neuem Leben erweckt wird. Doch für ihre Vision eines Bergbauimperiums scheuen gnadenlose Unternehmer auch vor Mord nicht zurück. Während Mikael Blomkvist einen neuen Job bei der Gasskaser Zeitung antritt, sucht Lisbeth mit seiner Hilfe nach ihrem verschwundenen Freund, dem Hacker Plague. Als die Fäden zusammenlaufen, erkennt Salander, dass jemand es eigentlich auf sie und Svala abgesehen hat. Und rüstet zum Kampf gegen alte und neue Gegner.
»Frisch, furchtlos, nah an den Vorgängern und trotzdem originell. Eine der weltweit erfolgreichsten Krimireihen könnte nicht in besseren Händen sein. Ich bin ein Fan.« Chris Whitaker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Autorin
Karin Smirnoff, geboren 1964 in Umeå, ist durch ihre Romane um die Figur Jana Kippo eine der bekanntesten Autorinnen Schwedens. Ihr Debüt »Mein Bruder« war für den bedeutenden August-Preis nominiert. Zuvor hat sie u. a. als Journalistin, Altenpflegerin und Karatelehrerin gearbeitet. Bereits der Auftakt zur ihrer neuen Millennium-Trilogie, die die Erfolgsreihe von Stieg Larsson fortsetzt, war in Schweden ein Nr.-1-Bestseller. Allein in Deutschland haben sich die Romane um Blomkvist und Salander 10 Millionen Mal verkauft. Smirnoff und Larsson stammen aus derselben Region in Nordschweden.
Das Buch
Langsam kehrt die Sonne in den Norden Schwedens zurück, doch die Lage in der kleinen Stadt Gasskas ist düster: Die Bodenschätze der Region werden ohne Rücksicht auf Land und Leute ausgebeutet. Eine Gruppe von Aktivisten, denen sich auch Lisbeth Salanders Nichte Svala anschließt, will verhindern, dass der stillgelegte Tagebau zu neuem Leben erweckt wird. Doch für ihre Vision eines Bergbauimperiums scheuen gnadenlose Unternehmer auch vor Mord nicht zurück. Während Mikael Blomkvist einen neuen Job bei der Gasskaser Zeitung antritt, sucht Lisbeth mit seiner Hilfe nach ihrem verschwundenen Freund, dem Hacker Plague. Als die Fäden zusammenlaufen, erkennt Salander, dass jemand es eigentlich auf sie und Svala abgesehen hat. Und rüstet zum Kampf gegen alte und neue Gegner.
»Frisch, furchtlos, nah an den Vorgängern und trotzdem originell. Eine der weltweit erfolgreichsten Krimireihen könnte nicht in besseren Händen sein. Ich bin ein Fan.« Chris Whitaker
Karin Smirnoff
Vergeltung
Roman
Aus dem Schwedischen von Leena Flegler
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel LOTKATTENSKLOR bei Polaris, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Karin Smirnoff und Moggliden AB
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angelika Lieke
Herstellung: MaGe
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design
Umschlagmotiv: Shutterstock.com (Perpis_Luchs)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31022-6V002
www.heyne.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
Millennium
Newsletter-Anmeldung
Es gehen die Mär und Kunde:
Nördlich des Fixsterns und
Westlich hinter Sonne und Mond
Sei aller Feldstein Gold und Silber,
Jeder Herdstein, jeder Senkstein
Glänzend Gold und Silberschimmer,
Fjällgebirg im Meer sich spiegelt,
Sonnen, Monde, Sterne lächeln
Auf ihre Spiegelbilder nieder.
Anders Fjellner, 1849
Aus dem samischen Epos Páiven párneh (»Söhne der Sonne«)1953 ins Schwedische übertragen von Björn Collinder
In der Hölle gibt es einen speziellen Platz für Konzernbosse und Risikokapitalisten – für Männer mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen und flugfähigen Armen.
Wie Zugvögel ziehen sie weiter, sobald das Wetter umschlägt. Trotzdem kommen stets neue, die selbst im beißenden Wind der Kälte trotzen und die Ärmel hochkrempeln.
Exploratoren mit einem Näschen für Geld, für das ganz große Geld, sonst wären sie im Warmen geblieben.
Wie Propheten legen sie das Ohr ans Gestein und verkünden: »Hier. Hier verstecken sich so enorme Reichtümer, dass niemand wird Nein sagen können.«
Wenn die Party dann aber vorbei ist, wenn die Adern geschröpft oder die Rohstoffpreise gefallen sind, stehen nicht sie in einer voll besetzten Kantine und schwurbeln von schlechten Zeiten. Für die Drecksarbeit sind ihre Personaler zuständig. Sie selbst sind da längst wieder weg – weit weg von verseuchten Flussläufen und kontaminierter Erde, von arbeitslosen Bergmännern, die Steinstaub, Asbest und Dieseldämpfe eingeatmet haben und erwartungsgemäß einen frühen Tod sterben.
Die Konzernbosse und Risikokapitalgeber sind da bereits unterwegs zu neuen Ufern, zu neuen Bergen. Unter neuen Firmennamen.
Mit neuen Vorstandsmitgliedern und einem frischen Bündel Geld, mit dem sie den Politikern vor der Nase herumwedeln, werden sie abermals als Helden begrüßt – als diejenigen, die dem Hinterland zu unverhofftem Aufschwung verhelfen, Arbeitsplätze schaffen und Zukunftsperspektiven eröffnen.
1. Kapitel
Es ist Nacht und deutlich unter null Grad, obwohl es schon Mitte Mai ist. Die Gräser knistern frostig, als er durch den Wald stapft, um ein paar Hundert Meter stromaufwärts ans Ufer des Njakaurebäcken zu kommen, an jenen Flusslauf, der an der stillgelegten Gasskas-Grube vorüberfließt, am »Loch«, wie sie hier in der Gegend sagen.
Wie eine verlassene Alpensiedlung ragen im hellen Mondlicht vor ihm Gebäude und graue Bergehalden auf. Von seinem Standort aus kann er das Loch zwar nicht sehen, aber das ist auch gar nicht sein Ziel.
Ein Hauch Nervosität macht sich in ihm breit, aber er ist kein Frischling. Er weiß genau, was er tut, will nur erst ganz kurz Luft holen. Er streift sich den Rucksack von den Schultern, klappt seinen Hocker auf und kramt eine Thermoskanne hervor.
Nach zwei Bechern ist er wieder bei Kräften. Sein Puls ist ruhig. Die Luft ist klar.
Er zieht sein Kanu unter der Fichte hervor, wo es seit dem vergangenen Jahr gelegen hat. Allzu viele Ausflüge sind es nicht geworden. Tatsächlich nur ein einziger. Er sucht die Unterseite nach Schäden ab, zieht das Kanu bis runter ans Wasser und muss es dort an einem Baum festzurren, bis er wieder zu Atem kommt.
Das Wasser gluckert gegen die Außenhaut, als er sich mit dem Paddel abstößt. Jetzt kann er sich einfach sachte ein paar Hundert Meter in Richtung Brücke treiben lassen.
Die Brücke über den Wasserlauf gab es hier angeblich schon im achtzehnten Jahrhundert. Als irgendwann Ende der 1940er-Jahre die Förderarbeiten begannen, bekam die Brücke ihr heutiges Erscheinungsbild: mit Eisenträgern verstärkt, damit sie den voll beladenen Waggons standhielt, die das Erz runter zur Küste transportierten. Von unten sieht er noch den alten Steinbogen – perfekt proportionierte Granitblöcke aus einer Zeit, als Ästhetik noch einen Wert hatte.
Er schiebt das Paddel ins Wasser und bremst. Vorsichtig, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, hängt er seinen Rucksack über einen rostigen Eisenring und sichert ihn zusätzlich mit ein paar Schlingen Draht. Zwölf Kilo sollte der wohl halten, bestimmt sogar zwölfhundert.
Heutzutage wissen selbst zehnjährige Nachwuchsgangster, wie man eine Bombe baut. Allerdings dürften sie nur unzureichend über die Wirkkraft im Verhältnis zur Menge Bescheid wissen. Die Reichweite eines Gramms Sprengstoff beträgt zwanzig Meter. Dass er seinen Sprengsatz weit überdimensioniert hat, ist der offenen Landschaft geschuldet. Die Sprengkraft wirkt innerhalb eines Raums, in einem Fahrzeug oder auf anderen geschlossenen Flächen effizienter, und er will sicherstellen, dass die Brücke auch wirklich in die Luft fliegt.
Er wünschte sich, er könnte ein Stück entfernt stehen bleiben und zusehen, aber das hat er sich schon aus dem Kopf geschlagen. Im Grunde spielt es keine Rolle, ob er mit draufgeht oder nicht. Er hat sein Leben bald ausgelebt. Allerdings gibt es noch ein paar To-dos, bevor er ins himmlische Licht blicken will.
Er hebt die Armbanduhr vor die Stirnlampe. Zwanzig nach drei. Er zieht das Paddel ein paarmal durchs Wasser, um Fahrt aufzunehmen, ehe er sich abermals vom zwei Grad kalten Frühlingswasser mitziehen lässt, bis die Brücke hinter ihm außer Sicht ist.
Auch diesmal versteckt er das Kanu unter einem Baum. Er denkt sich noch, dass ein paar Fichtenzweige zur Abdeckung nicht schaden könnten, aber er kann nicht mehr. Auf dem letzten Stück zum Auto muss er mehrmals stehen bleiben. Diesmal pfeift es nicht, wenn er atmet. Dazu reicht es nicht mehr.
Kühle Laken an verschwitzter Haut. Die Tageszeitung und noch ein Kaffee. Er klopft die Kissen in seinem Rücken auf und greift zu seinem Prepaid-Telefon.
Viertel nach vier ist eine gute Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner von Gasskas, um zum Getöse des nächsten Weltkriegs aufzuwachen, seines persönlichen Krieges. Er legt das Handy beiseite, dreht sich zur Wand um und lauscht dem entfernten Bassgrollen der Sprengung.
Schade um die gute Thermoskanne, denkt er noch und schläft wieder ein.
Aber hat er überhaupt geschlafen? Die Schmerzen sind zurück.
Für einen kurzen Moment hatte er das Gefühl, frei zu sein. Seine Aufmerksamkeit war auf etwas anderes gerichtet. Geschafft. Das Stechen im Rücken ließ nach, und sogar der Husten zog sich wie ein satter Kater zurück.
Kaum dass er wach ist, reißt der Husten neue Wunden in seinem Innern auf. Eine Viertelstunde später schafft er es zur Toilette, pinkelt, nutzt die Gelegenheit und rasiert sich – ungepflegt war er nie –, setzt frischen Kaffee auf und wartet auf die Siebenuhrnachrichten.
Vergangene Nacht um Viertel nach vier kam es zu einer Explosion, die in weiten Teilen des Gemeindebezirks Gasskas zu hören und zu spüren war. Polizeiangaben zufolge handelte es sich dabei um eine starke Detonation, die unter anderem die Brücke über den Njakaurebäcken beschädigt hat, über die früher das in der Gasskas-Grube geförderte Erz abtransportiert wurde.
»Im Augenblick versuchen wir, uns einen Überblick über die Lage zu verschaffen und sicherzustellen, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Bis auf Weiteres müssen wir die Sprengung als mutwilligen Akt der Zerstörung betrachten und können eine Bedrohungslage für die Allgemeinheit nicht ausschließen«, so Hans Faste von der Kriminalpolizei Gasskas.
Immerhin ein Anfang, denkt er sich und scrollt durch die Online-Ausgabe der Gaskassen. Allen Umständen zum Trotz wird es ein guter Tag.
2. Kapitel
Wer kommt auf so eine Idee?
Svala, und das gleich aus mehreren Gründen.
Der erste Grund wäre: Ester Södergran, die neu bei der Gaskassen ist und mal etwas anderes ausprobieren will. Der zweite: Svala selbst, die für ein paar Wochen Schülerpraktikantin in der Redaktion ist und Ester unterstützt. Der dritte: Lisbeth Salander, die ihr eine Drohne zu Weihnachten geschenkt hat.
»Kennst du irgendwo gute Häuser, die leer stehen?«, fragt Ester. »Wir könnten für die Wochenendausgabe eine Reportage über Spukhäuser machen.«
»Da gibt’s so einige, aber ob es da spukt?«, entgegnet Svala.
Sie erstellen eine Liste. Suchen die spannendsten Häuser heraus. In einem Gemeindebezirk wie Gasskas herrscht an unbewohnten Häusern kein Mangel. Bei den meisten handelt es sich um spartanische Holzhütten und ältere Häuschen, die aus unterschiedlichen Gründen leer stehen: weil der Besitzer keine Erben hatte, weil die Erben sich zerstritten haben oder das Haus an einer viel befahrenen Straße steht, was früher praktisch war, heute aber sogar Holländer vom Kauf abschreckt.
Das letzte Haus auf der Liste ist das Sanatorium.
Wie andere Sanatorien steht auch dieses Gebäude weitab vom Schuss, aber schön gelegen oberhalb eines Sees.
»Anders als das unweit gelegene Sanatorium Sandträsk, in dem über ein halbes Jahrhundert fast 30 000 Patientinnen und Patienten versorgt wurden, nimmt die Einrichtung in Gasskas in der schwedischen Medizingeschichte eine nachrangige Rolle ein«, liest Svala aus dem Internet vor. »Das Sanatorium mit dreißig Betten wurde 1945 in erster Linie eröffnet, um Sandträsk bei der Behandlung von Flüchtlingen mit Tuberkulose zu entlasten. Die letzten Patienten wurden 1963 entlassen. Später wurde das Gebäude unter anderem als Entzugsklinik für Drogenabhängige und während des Balkankriegs als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Seit Mitte der 2000er-Jahre steht das Gebäude leer. Aufgrund seiner isolierten Lage und des Renovierungsstaus wurde zwischenzeitlich der Abriss diskutiert.«
»Das muss dann aber vor Dezember 2021 gewesen sein, da ist es nämlich verkauft worden. Wir fahren sofort hin. Ist doch gut, wenn da jemand eingezogen ist. Der weiß dann ja vielleicht, ob es dort spukt«, sagt Ester, steht dann aber nicht auf, sondern tippt weiter auf ihrer Tastatur herum.
Dann starrt sie ins Nichts, als wäre ihr gerade ein Gedanke gekommen.
Die beiden haben sich während Svalas Praktikum angefreundet. Wie eine Schwester, schießt es Svala durch den Kopf, wenn es um Ester geht: eine große Schwester, mit der sie reden und Blödsinn machen kann. Die ihr zuhört und antwortet, ohne herablassend zu sein oder wie andere Erwachsene den Zeigefinger zu heben. Die ihr abends SMS schreibt und fragt, was sie gerade macht. Die ihr Dinge erklärt und beibringt.
Svala saugt alles auf, was sie kriegen kann: textet Überschriften, feilt an Artikel-Leads, befüllt streng umrissene Formate mit eigenen Worten.
»Mann, Svala«, platzt es manchmal aus Ester heraus, »ich dachte ja, ich könnte schreiben, aber du … Du bist eine Wortkünstlerin!«
Dabei sind ihr andere Sachen noch viel wichtiger. Sachen wie: »Mann, Svala, guck dir dieses Foto an, das ich von dir geschossen habe! Weißt du überhaupt, wie unfassbar toll du aussiehst?« Da erwacht etwas in der Puppe auf dem Weg zum Schmetterling.
Wenn sie genauer hinsieht – auch in die Augen der anderen –, dann hat sich tatsächlich etwas verändert. Sie ist nicht mehr unsichtbar.
Sie folgen der Navi-Route durch kleine Weiler, an Seen vorbei und über Anhöhen bis zu ihrem Ziel.
Dort steht sogar noch ein Schild. Nein, es sind zwei: ein älteres mit dem Namen und ein neueres, das Besucher davon in Kenntnis setzt, dass das Gelände in Privatbesitz und kameraüberwacht ist. Ein Schlagbaum versperrt ihnen die Durchfahrt.
»Und was machen wir jetzt?«, fragt Svala.
»Wir parken hier und gehen zu Fuß.«
Der einst prachtvolle Vorplatz mit gestutzten Vogelbeerhecken und einem Springbrunnen sieht genauso verwaist aus wie das Gebäude. Nirgends Fahrzeuge, keine Menschen. Eine alte Birke ist im Winter umgeknickt, der Fahnenmast ebenfalls. Dort, wo das Haus Schatten wirft, liegen noch Schneereste.
»Kein Schwein da«, bemerkt Svala.
»Dafür umso mehr Mücken«, murmelt Ester und schlägt bereits um sich.
Svala lässt eine Mücke auf ihrem Arm sitzen, bis sie sich satt gesaugt hat.
»Das sind die Weibchen, die überwintert haben«, erklärt sie. »Die sind bestimmt hungrig.«
»Die sollen sich mal schön an ihre tierischen Freunde halten«, brummt Ester und schlägt ein paar weitere Mücken tot.
Sie rütteln an verschlossenen Türen, drehen eine Runde um die Nebengebäude, kommen aber nirgends hinein. Hier und da meinen sie trotzdem, Geräusche zu hören, doch wenn sie stehen bleiben und lauschen, ist da nur mehr das Hintergrundrauschen der Natur.
Sie umrunden das Hauptgebäude. Die Fenster im Erdgeschoss sind mit Pressspan verbarrikadiert. An einigen Stellen bröselt der Putz.
»Wird schwierig, nach Gespenstern zu suchen, wenn man nicht zu ihnen reinkommt. Da müssen wir wohl aufgeben – oder jemanden fragen, der uns aufschließen kann.« Plötzlich bleibt Ester stehen. »Hast du das auch gehört? War das ein Auto? Vielleicht besser, wenn uns niemand erwischt. Immerhin ist das hier ja Privatgelände.«
Also laufen sie auf den Waldrand zu. Sie bleiben erst dort stehen, wo der Privatweg auf die öffentliche Straße trifft.
Zwischen den Bäumen ist der Redaktionsdienstwagen gerade so zu erkennen. Und daneben ein Mann, der telefoniert.
An der Situation ist an sich nichts komisch, deshalb springt Ester über den Straßengraben und schlendert auf den Mann am Handy zu.
»Hallo«, ruft sie aus einigem Abstand, »soll ich umparken?«
Svala hört die Antwort nicht. Sie versteckt sich hinter einem Baum, bis der Mann wieder weg ist.
3. Kapitel
»Ich verstehe immer noch nicht, warum der so unfreundlich sein musste«, sagt Ester ein paar Tage später, als sie die Aufnahmen von den anderen Spukhäusern sichten. »Wir hatten nicht mal mehr Zeit, Fotos zu machen. Vielleicht sollten wir noch mal hinfahren.«
Was Svala betrifft, liegt die Sache ein wenig anders. Unfreundlich ist nicht das richtige Wort.
Bislang hat sie nichts gesagt. Nicht, weil sie den Mann wiedererkannt hätte – wer es genau war, spielt gar keine Rolle. Ihr geht es um die Sorte Mann: eine Hierarchiestufe über Stiefpeder, diesem Loser von einem Stiefvater, den sie zum Glück los ist, der sich aber alle Mühe gegeben hatte, sich wie ein richtiger Gangster aufzuführen.
Wenn man die Analogie zu ausgestorbenen Lebensformen herstellen würde, wäre Stiefpeder ein Troglodyt, ein Höhlenbewohner, und der Mann von der Straße ein Neandertaler – die Art, die Ersteren mit Jobs versorgt. Versorgt hat, korrigiert sie sich, weil zumindest dieser Widerling ausgeschaltet ist, was nicht heißt, dass es nicht zahlreiche andere gäbe. Auf Svalas Liste stehen nach wie vor einige, bei denen sie noch nicht aktiv geworden ist, und andere, bei denen sie aktiv wurde, aber den Namen dazu nicht kennt: alles Leute, die direkt oder indirekt für den Tod ihrer Mutter verantwortlich sind. Mit dem Lineal zieht sie einen Schlussstrich nach dem anderen und hakt Spalten ab. Zwei von fünf Spalten sind dabei entscheidend: Lebt noch und Abgetreten.
Über die Neandertaler herrschen wieder andere: Menschenaffen, Lederjacken, Schlagringe und ganz oben Männer in Anzügen, die bestens in die Gesellschaft integriert sind und aufgrund ihres Vermögens auf den industriellen Zukunftszug aufspringen durften. Die in Debattensendungen sitzen oder sich in der Zeitung über den Stellenwert der Meritokratie äußern, sprich: dass Minderheiten, die Ursprungsbevölkerung, Umweltaktivisten und andere Querulanten nicht all jenen im Weg stehen dürften, die ganz genau wüssten, wie Schweden sich entwickeln muss.
Und in diesem Moment hat Svala die Idee mit der Drohne, die Lisbeth Salander ihr zu Weihnachten geschickt hat.
Von Lisbeth für Svala: Du wirst sehen, hilft beim Spähen.
Svala erzählt Ester davon. Luftaufnahmen könnten doch cool aussehen, besonders in der Dämmerung, und Ester beißt an.
»Bestimmt finde ich noch mehr Infos über das Sanatorium in anderen Artikeln. Oder ich rufe mal Elina an.«
»Elina Bång?«
»Genau, die Seherin von Ensamträsk, wie sie sich inzwischen nennt. Guter Künstlername!«
Diesmal fahren sie auf einen Forstweg ein gutes Stück westlich des Anwesens. Sie wollen das Gebäude weiträumig zu Fuß umrunden und den dahinter liegenden Berg besteigen.
»Hoffentlich ist es die Mühe wert«, keucht Ester, als sie sich bergauf quälen. »Du hast die Drohne schon mal ausprobiert, oder?«
Hat Svala, allerdings nur auf dem Hof. Ein paar Fragen hätte sie noch gehabt, aber nun soll der Artikel schon tags darauf in den Druck gehen. Vom Berg aus haben sie freie Sicht auf das Haus – eine Voraussetzung, wenn sie die Drohne fernsteuern wollen. Sie stürzt ab, sobald der Kontakt abreißt.
Ansonsten ist der Zeitpunkt gerade günstig: Die Abendsonne über dem Sanatorium sieht aus wie eine goldene Kuppel, während das dunkle Gelände ringsum auf den Fotos wie gespenstische Schatten wirken dürfte. Svala könnte jetzt von der Anwesenheit der Toten erzählen, von der Energie, die das Universum niemals verlässt, aber sie lässt es bleiben. So gut kennen sie und Ester sich nun auch wieder nicht.
Die Drohne hebt ab und fliegt wie ein surrendes Insekt auf das Zielobjekt zu.
Svala lässt sie eine schnelle Runde um das Gebäude ziehen und steuert sie zurück in Richtung des Berges.
Die Anwesenheit von Toten ist das eine. Lebende sind weit schlimmer.
Als Ester vorschlägt, noch mal runter zum Haus zu gehen, sträubt Svala sich. Unbewohnte Häuser brauchen keine Überwachungskameras und Gitter hinter verbarrikadierten Fenstern. Dort unten sind Leute.
»Ich muss nach Hause. Ich hab versprochen, die Hunde zu füttern. Meine Onkel sind heute nicht daheim.«
Also fahren sie zurück nach Gasskas und weiter nach Björkavan. Svala schlendert am Hundezwinger vorbei. Sie nimmt Kallak mit auf ihr Zimmer, den Größten, Verschmustesten, und er legt sich neben ihren Stuhl. Sie selbst setzt sich an den Rechner und überträgt die Aufnahmen auf ihren Laptop, wählt ein paar geeignete für die Zeitung aus und ruft Photoshop auf.
Was ebenerdig nicht zu erkennen war, sind die Dachfenster des Gebäudes. Die Aufnahmen sind nicht wahnsinnig scharf, doch als sie ein Foto vergrößert, kann sie die Umrisse von Menschen erahnen.
Sie klappt den Laptop zu. Sitzt noch eine Zeit lang da und starrt hinaus auf den Hof.
Svalas Leben ist in vielerlei Hinsicht besser geworden: Seit letztem Herbst wohnt sie bei ihren Onkeln im selben Haus, in dem Mamamärta aufgewachsen ist. Sie hat deren Kinderzimmer bezogen, deren Bett. Nachts geht sie manchmal nach draußen, um die Sterne zu betrachten, die Nordlichter, den Mond und die flüchtigen Schatten, die über den Hof huschen. Es gibt nichts, wovor sie Angst haben müsste, aber vieles, was ihr fehlt.
Anfangs war es ein Trost: Sie rief, und Mamamärta antwortete. Inzwischen ist es andersherum. Meist antwortet Svala nicht mehr. Mamamärta ist ein trauriges Thema, dem sie sich nur häppchenweise widmet, sonst bleibt es ihr schnell mal im Hals stecken.
Es ist schon spät, trotzdem ist Ester noch wach. Sie meldet sich sofort, als hätte sie auf den Anruf gewartet.
»Die Bildqualität ist leider zu schlecht«, teilt Svala ihr mit. »Du musst doch Agenturbilder nehmen.«
Svala hört sie tippen und erkundigt sich, was sie macht.
»Ist ja total krank«, sagt Ester. »Das Sanatorium gehört Mimer Mining?!«
Svala schreibt es sich auf und fragt, wer das sei.
Die Tastatur klappert vor sich hin, und kurze Zeit später kommt die Antwort.
»Die Konzernmutter von Sveagruv AB, die die Zulassung für die Probebohrungen am neuen Tagebau gekriegt hat. Wenn wir das Sanatorium in die Luft sprengen, wird ja vielleicht nichts daraus. Äh, kleiner Scherz. Aber spannend, findest du nicht?«
»Wo hast du die Info denn her?«, hakt Svala nach.
»Von Ante, einem Kontakt … Er studiert irgendwas Nerdiges in Luleå und ist anscheinend ein verdammt guter Hacker. Übrigens«, sagt sie dann, »du kommst doch morgen zum Treffen? Vergiss das Banner nicht, am Samstag brauchen wir das. Wenn du Lust hast, können wir anschließend ja noch Pizza essen gehen. Ich habe da eine Idee, über die ich gern mit dir sprechen würde. Wird womöglich nicht leicht, aber … Ach, darüber reden wir morgen. Schlaf erst mal gut, kleines Buschwindröschen!«
Kleines Buschwindröschen. Svala wird innerlich ganz warm.
»Du auch«, erwidert sie.
4. Kapitel
Treffen bei Petra, 18.00 Uhr, alle kommen!
So lautet die Nachricht im Gruppenchat. Erst heimzufahren, lohnt sich nicht mehr. Stattdessen setzt Svala sich in der Bibliothek in eine ruhige Ecke, nimmt ihr Heft heraus und überfliegt ihren jüngsten Text. Erst waren es nur einzelne Wörter, die dann zu Versen und am Ende zu Gedichten wurden. Inzwischen setzt sie ganze Sätze zu Erzählungen zusammen. Über jeder Erzählung steht ein Name. Keiner hat sie je gelesen und keiner wird sie wohl auch je zu lesen kriegen. Sie selbst betrachtet die Texte als Versicherung, als eine Art Zeugenaussage des Lebens.
Sie warten bis Viertel nach sechs, trinken Tee und knabbern Kekse. Außer den üblichen Verdächtigen sind zwei weitere gekommen – nur Ester Södergran nicht. Svala sieht auf ihr Handy. Auch keine SMS.
»Kann irgendwer Ester anrufen?«, fragt Petra und setzt frischen Tee auf.
Als Ester nicht rangeht, legen sie los.
»Wie ihr seht, haben wir Verstärkung bekommen. Simon und Levi habt ihr beim Kaffee ja schon kennengelernt, aber könntet ihr euch bitte noch mal kurz vorstellen?«
Levi Grundström begnügt sich mit einem Hallo und seinem Namen. Erwähnt noch, dass er ein alter Sack sei, der finde, dass sie ihre Sache echt gut machten, und dass er ja vielleicht etwas beitragen könne. Keine Ahnung, was, denn noch ehe er fertig geredet hat, steht der andere Mann auf, blickt in die Runde, als wollte er reihum Eindruck schinden, und verharrt bei Svala.
»Wie gesagt, ich heiße Simon und bin letztes Jahr wieder hergezogen, um in Luleå Energietechnik zu studieren. Ich sehe die Ausbildung als Chance, die Industrie von innen heraus zu infiltrieren. Ich hoffe, ihr könnt meine Kenntnisse gut gebrauchen. Ich persönlich finde ja, wir müssen der Zerstörung der Umwelt durch die Kapitalisten durch mehr Widerstand entgegenwirken, wenn nötig auch durch physischen Widerstand.«
Dann setzt er sich wieder, bekommt spontanen Applaus – und frischen Tee. Svala kann sie gut verstehen, Petra und die anderen: diese braunen Locken, die bewundernde Blicke auf sich ziehen. Er sieht nicht nur gut aus, er hat auch Charisma – ein geborener Anführer, der sie aus dem Kindergarten direkt in die Vorstandsetagen führen wird. Als sein Blick erneut an ihr hängen bleibt, sieht sie nicht wieder weg. Sie sieht einen Seelenverwandten.
»Punkt eins auf der Tagesordnung wäre die Demo am Wochenende«, fährt Petra fort. »Wie wir beim letzten Treffen beschlossen haben, müssen wir endlich mehr unternehmen, als uns nur an Bäume zu fesseln und Banner aufzuhängen. Nicht mal die Presse kommt noch … Und wir werden auch immer weniger.«
»Darf ich was sagen?«, unterbricht Simon sie.
Diesmal bleibt er sitzen.
»Was diesen neuen Tagebau angeht, habt ihr einen tollen Job gemacht. Eure Demos haben die Leute auf Sápmi aufmerksam gemacht, gerade was die Rentiere betrifft. Diese Schlacht ist noch nicht verloren. Aber solange mit dem Bau nicht begonnen wurde, würde ich vorschlagen, ihr konzentriert euch stattdessen erst mal auf die alte Gasskas-Grube.«
»Das Loch?«, wirft jemand ein.
»Genau. Dort ist irgendwas im Busch. Anscheinend liegen da nämlich massenhaft Rohstoffe, sowohl in den Halden als auch unter der Erde. Wenn sie dort Ernst machen, dann haben wir wirklich Grund zu demonstrieren. Die ganze Umgebung ist doch eine einzige tickende Umweltbombe!«
»Das stimmt«, pflichtet Levi Grundström ihm bei. »Jetzt muss mal Schluss sein mit diesem Irrsinn. Die Gasskas-Grube müsste zuallererst gründlich saniert werden, alles andere würde es nur noch schlimmer machen.«
Svala hört zu und legt sich Fragen zurecht. Alle anderen sind älter als sie und schon länger dabei, sie selbst lernt bei diesem Thema sozusagen gerade erst laufen.
»Aber ist das nicht gut, wenn sie erst die Ressourcen nutzen, die schon da sind?«, tastet sie sich vor. »Ich meine – statt neue Gruben zu eröffnen?«
Simon sieht sie an wie ein Vater sein naives Kind.
»Sollte man meinen, ja. Aber auch alte Bergwerke brauchen eine neue Infrastruktur. Wir sind ja heute alle davon aufgewacht, dass die Brücke hochgejagt wurde. Ohne Brücke kein Abtransport der Erze. Die müssten jetzt über Land gekarrt werden. Dafür wären aber bessere Straßen nötig – und weit mehr Straßen als bisher. Wenn die fertig werden, gilt für umso mehr Gruben freie Fahrt, oder mit anderen Worten: Das Loch wäre dann nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Insofern: War ziemlich genial, die Brücke zu sprengen, oder was meint ihr?«
Es wird still im Raum.
Sie alle – ohne Simon sind sie zu neunt – sehen einander reihum an. War er das?
»Worauf willst du hinaus?«, fragt Petra nach einer Weile.
»Das klingt jetzt vielleicht extrem, aber überlegt doch mal: Im Prinzip könnten wir alles in die Luft jagen, was direkt oder indirekt eine Bedrohung für Klima, Natur und Menschen darstellt. Solche Anschläge sind ja echt selten – das Risiko hat niemand einkalkuliert. Zum Beispiel diese Batteriefabrik in Skellefteå – glaubt ihr wirklich, die haben dort jeden Arbeiter im Blick? Jeden Schreiner, der in der Fabrik ein und aus geht, jeden Elektriker oder Dienstleister? Da sind mittlerweile doch nur noch Firmen unterwegs, die ständig ihre Belegschaft austauschen.«
»Und du meinst, jetzt müssten wir die Batteriefabrik in die Luft jagen?«, fragt Petra.
Meint er nicht. Zumindest im Augenblick nicht.
»Na, hoffentlich auch später nicht«, sagt sie und erntet von Simon einen missmutigen Blick. »Klar sollten wir die nächste Stufe zünden. Aber bei Sprengstoffgeschichten bin ich raus. Da könnten unbeteiligte Leute sterben. Wir sind doch nicht die RAF.«
Nach dem Treffen schlendern sie hinaus auf die Straße.
Svala und Levi Grundström müssen in dieselbe Richtung. Er schwankt beim Gehen und sieht aus, als hätte er schlimme Schmerzen. Kurzerhand hakt Svala sich bei ihm unter.
»Scheißglatteis«, sagt er. »Es ist immerhin schon Mai!«
Simon geht hinter ihnen her. Schließt zu ihnen auf. Er fragt Svala, ob sie auf dem Heimweg sei. An der Kreuzung muss Levi in die andere Richtung.
»Ich kann dich mitnehmen«, bietet Simon ihr an. Nichts da, denkt Svala und antwortet, sie könne auch gehen. Dann sieht sie sich ein letztes Mal nach Ester um. Die Pizza hat sie anscheinend auch vergessen.
»Na los, steig ein«, sagt Simon, und dann fahren sie in Richtung Björkavan, wie die Rückseite des Björkberget jenseits der Flussschleife und vor den Stromschnellen heißt.
Vor der Windschutzscheibe baumelt ein Duftbaum. Die Ledersitze fühlen sich kühl an. Er macht das Radio an, und draußen fliegt kontur- und scheinbar endlos die Landschaft vorbei.
»Woher weißt du überhaupt, wo ich wohne?«, fragt sie sicherheitshalber.
»Ich weiß das allermeiste.« Er zwinkert ihr zu. »Nein, Spaß beiseite. Ich hab Petra gefragt.«
Er biegt in ihre Auffahrt ab. Der Mond steht über dem Gehöft. In der Küche brennt Licht. Sie legt die Hand an den Türgriff.
Kallak kläfft, und die Hündin jault.
Dann wolle sie mal, sagt sie, und danke fürs Mitnehmen.
»Du hast was Besonderes«, sagt er.
Svala weiß nicht, was sie darauf erwidern soll.
»Du bist so erwachsen, obwohl du noch so jung bist. Wie alt bist du überhaupt? Sechzehn? Siebzehn?«
»Fast vierzehn«, sagt sie und dreht das Radio lauter.
My daddy was an astronaut.
That’s what I was often taught.
My daddy went away too soon.
Now he’s living on the moon.
»Was war denn die RAF?«, fragt sie nach einer Weile.
»Eine linksextreme Gruppierung aus Deutschland, deren Mitglieder bereit waren, sich selbst und andere für ihre Überzeugungen zu opfern. Also ganz ähnlich wie du und ich. Oder willst du vielleicht lieber nur Bäume umarmen und Fahnen schwenken?«
Er legt seine Hand auf ihre. Sie ist sich nicht sicher, ob sie ihre zurückziehen soll. Vielleicht verpasst sie dann was … oder entgeht etwas anderem.
»Egal. Wir sehen uns jedenfalls Samstag«, sagt er. »Gibt’s außer mir eigentlich noch irgendwen, der ein Auto hat?«
»Ich«, antwortet sie, ohne nachzudenken. »Oder … Doch, ich hab ein Auto.«
Im Dämmerlicht kann Svala nicht sehen, was er denkt. Wahrscheinlich dass sie sich gerade lächerlich macht. Eine kleine Fast-Vierzehnjährige, die einen erwachsenen Mann beeindrucken will.
»Gut«, sagt er, »das könnte noch nützlich werden. Ich ruf dich morgen an.«
Ein Onkel tischt Essen auf und fragt, wo sie gewesen sei.
Svala isst aufgewärmte gefüllte Klöße und antwortet in etwa wahrheitsgemäß.
Der Onkel will, dass sie Bescheid gibt, falls irgendwas ist. Und dann fragt er, wer sie heimgebracht habe.
Dieser Simon, denkt sie später und knipst das Licht aus. Wie sich seine Hände bewegen, wenn er redet, und wie er sie anguckt. Die Haare, die ihm in die Stirn fallen.
Sie knipst das Licht wieder an und schreibt ihren Text fertig. Dann reißt sie die Seite aus dem Heft und faltet sie zu einem kleinen Viereck, das sie in ihren Affen schiebt, ihren Safe aus Plüsch.
Ich ruf dich morgen an.
5. Kapitel
Sofern es noch irgendwas gibt, was das Leben des 81-jährigen Kurt Vikström erleichtert, dann allenfalls mildere Frühlingstemperaturen. Der Winter war lang und brutal, annähernd kalt genug, um zu erfrieren.
Er hat ein bisschen geschlafen. Jetzt stößt er die Fahrertür auf und schiebt sich mühsam aus dem Sitz. Der Schmerz verlagert sich, am schlimmsten tobt er derzeit in seinem rechten Bein.
In ein paar Stunden bekommt er etwas Warmes zu essen. Er lässt sich wieder in den Sitz fallen und fährt in Richtung Stadtzentrum, geht bei der OKQ8-Tankstelle auf die Toilette und parkt vor dem Stadshotellet.
Die Wahlen im Herbst werfen bereits ihre Schatten voraus und das, obwohl der Winter gerade erst ausklingt.
»Wir wollen die Steuern auf Benzin senken, damit normale Leute es sich wieder leisten können, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Der Klimawandel ist doch nur ein sozialdemokratisches Schreckgespenst. Unseren Rentnern muss es mindestens genauso gut gehen wie den Verbrechern und Ausländern. Erst mal müssen wir Schweden wieder besser versorgt werden, bevor die Flüchtlinge Beihilfen kriegen.«
Schwedenfreunde applaudieren, und Kurt flucht in sich hinein.
»Scheißnazis«, murmelt er und gerät prompt aus dem Tritt. Er bräuchte einen Gehstock. Oder besser gleich einen Rollator.
Auf der üblichen Runde an den Mülleimern in der Fußgängerzone vorbei kommt er langsamer voran als sonst, und die Ausbeute ist mager. Von acht Getränkedosen und zwei Halbliterflaschen wird keiner reich. Davon wird der Tank nicht voll und auch nicht der Magen, aber so denkt Kurt nicht.
Er packt alles in sein Rollwägelchen – Sachen, die andere Leute für Müll halten. In seinen Augen sind es Fundstücke, und die legt er behutsam in seine Tasche. Befüllt sie bis obenhin und bis es Zeit wird, zum Auto zurückzukehren.
Den Strafzettel schiebt er ins Handschuhfach zu seiner übrigen Buchhaltung. Seine Fundstücke drückt er in eine Plastiktüte, die er auf die anderen Tüten schiebt, die im Kofferraum und auf den Sitzen liegen. Nur die Delle im Fahrersitz, die gerade groß genug ist, dass er dort hinpasst, bleibt frei.
An einem normalen Tag dreht Kurt drei Runden zum Zentrum und wieder zur einstigen Mülldeponie, wo er inzwischen wohnt. Heute nicht, heute ist er müde. Es wird Abend, aber nie Nacht. Die Sonne, die sich im vergangenen halben Jahr kaum je über den Horizont bewegt hat, brennt inzwischen ordentlich. Lauert für ein paar Stunden in dunkler Rastlosigkeit und lodert dann wieder auf.
Womöglich dämmert er kurz vor sich hin, lässt sich von der behaglichen Wärme einlullen, die entsteht, wenn Bakterien und Würmer sich durch die Tüten fressen. Als sich ein Auto den Hang herauf nähert, ist er sofort wieder hellwach.
Kurt parkt hinter einer der Baracken. Früher war hier das Büro, und in dem Büro saß ein Vorarbeiter. Das ist schon lange her. Kurt Vikström kommt es vor, als wäre es gerade erst gestern gewesen.
Genau wie er selbst hat auch das Auto bereits seinen Zenit überschritten, hat die besten Tage längst hinter sich. Unterscheidet sich kaum noch von anderem Müll, den die Leute trotz der Verbotsschilder hier abladen. Eilig verriegelt er die Türen, rutscht so tief in den Sitz, wie er nur kann, und zieht sich ein paar Tüten über den Kopf.
»Coole Karre!«
Die Stimme klingt jung und selbstbewusst. Ein Tritt gegen die Karosse, ein Ruck an der Tür.
»Scheiß auf die Karre. Hol sie her, damit wir hier fertig werden.«
»Aber erst noch ein bisschen Spaß, oder?«
Erst was? In seinem Versteck haben die Brustschmerzen Kurt fest im Griff.
»Wir wollen bloß reden«, sagt der eine, als das Mädchen sich wehrt.
Und dann lachen sie. Haben jetzt erst recht Spaß, immerhin ist heute Freitag. Sie wollen ihr nur einen Schrecken einjagen. Verschreckte Weiber schmecken am besten, höhö. Machen alles mit, ohne zu mucken, und sie muckt auch nicht, ist ganz folgsam mit ihren über die Böschung schleifenden Füßen, während starke Halbwüchsigenarme sie gepackt halten.
Kurt denkt sich, dass er … vielleicht … verhindern sollte, was immer sie gerade vorhaben. Endlich Verantwortung übernehmen. Die Zeit zurückdrehen. Wiedergutmachen. Doch er tut nichts, wie üblich tut er nichts, schiebt nur eine Tüte beiseite und hört, wie sie sich entfernen. Er reckt den Hals, damit er etwas sehen kann, und ahnt, wo sie hinwollen. Bei den Räumarbeiten ist der Hang abgerutscht. An der Bruchkante haben sie einen Zaun aufgestellt.
Er sieht den Rücken hinterher und dem Mädchen, das bis an die Kante geschubst wird.
Der Sauerstoff reicht nicht mehr. Er tastet nach dem Fensterhebel und kurbelt die Scheibe einen Zentimeter nach unten.
So dringen die Geräusche wieder zu ihm durch. Die Faust um sein Herz wird jetzt zur Klinge. Er zieht die Tüten wieder über sich, taucht ab, taucht tief ab in seine Erinnerungen. Der Mann, der er einst gewesen ist. Die Familie, die er einmal hatte. Das Haus, in dem sie gewohnt haben, und dann der Brand. Er riecht den Rauch, spürt die Hitze, die Flammen. Versucht, ins obere Stockwerk zu kommen. Hört die Schreie. Brüllt hoch, dass sie springen sollen. Er selbst kehrt um. Kommt über die Terrassentür ins Freie. Stellt eine Leiter auf. Die Flammen erobern Zimmer um Zimmer. Fenster bersten, ein Kind springt. Gott, lass es den Jungen sein.
Als Kurt wieder aufwacht, ist es immer noch hell. Im ersten Moment findet er die Taste für die Verriegelung nicht und gerät in Panik, stößt die Tüten weg, bekommt schließlich die Tür auf und stürzt hinaus.
Die Luft ist klar. Er lebt. Er kann wieder atmen. Nur die Blase drückt. Er kriecht zum Vorderreifen und zieht sich vorsichtig hoch.
Aber hat er nur geträumt? Er ist sich nicht sicher.
Langsam geht er auf die Bruchkante zu. Der Zaun zieht ihn wie magisch an. Auf seinen Körper kann sich Kurt Vikström nicht mehr verlassen, aber mit seinem Gedächtnis ist meist nichts verkehrt. Er hat etwas gesehen, ist sich annähernd sicher, aber jetzt muss er wirklich pinkeln. Zieht den Reißverschluss seiner Hose auf und folgt dem Rinnsal mit dem Blick den Steilhang hinab.
Ganz unten, da liegt jemand, wie um an den ersten Frühblühern zu schnuppern.
Bald wird es Nacht, die Brustschmerzen erwachen und breiten sich bis in die Beine aus, als Kurt versucht, zurück zu seinem Auto zu rennen. Er muss immer wieder stehen bleiben, Luft holen. Vielleicht sind sie noch da, vielleicht sind sie gerade auf dem Rückweg, vielleicht haben sie ihn ja gesehen? Seine Überlegungen werden von der Angst, der Panik befeuert. Er ist Zeuge, und Zeugen müssen verschwinden, er muss verschwinden – und jetzt kommen die Tränen und die Bilder, die nie an Schärfe eingebüßt haben. Die Schuld, die Feigheit – seine Schuld am Tod von anderen. Das Mädchen im Abgrund, das verbrennende Kind und ganz am Rand – immer an der Peripherie in Sicherheit – er selbst.
Das Auto rollt im Leerlauf den Hang runter bis zur Landstraße.
Kurz vor der Abfahrt nach Gasskas geht ihm der Sprit aus. Der alte Amazon stottert noch ein paar Meter weiter zum Straßenrand.
Luft. Er braucht Luft.
Ein Mitmensch hält an. Fragt, ob er Hilfe brauche, legt ihm die Hand auf den Rücken. Zieht sie zurück, als ihm der Gestank entgegenschlägt.
»Wölfe an der Müllkippe«, japst er, »Wölfe, Wölfe, Wölfe …«
Dann fällt Kurt Vikström in Ohnmacht.
6. Kapitel
Es hat etwas Befreiendes, sich in einen Streifenwagen zu setzen und Einsätze zu fahren, die einander zwar ähneln, aber doch immer unterschiedlich sind. Die Sonne steht hoch am Himmel, sie selbst stehen noch auf dem Parkplatz, sehen nach oben und drehen die gräulich blasse Bürohaut in Richtung des brutalen Frühlingslichts.
Die Welt wird durch Kriege, Naturkatastrophen und Schwedendemokraten immer elender, aber für einen kurzen Moment ist das Leben herrlich.
»Los, fahren wir«, sagt Birna Guðmundurdottir. »Wetten, Faste steht schon mit dem Fernglas da und beobachtet uns?«
Faste, Hans Faste, Chef des Dezernats für Gewaltverbrechen. Wenn es nach Lisbeth Salander ginge, stünde etwas komplett anderes auf seiner Visitenkarte.
»Soll er doch. Nur noch zwei Minuten.« Jessica Harnesk zieht die Schultern nach unten und genießt die Sonnenstrahlen auf den verspannten Muskeln.
Pling. Scheiße, ihr Handyton ist noch an. Und noch mal Pling. Bevor sie einsteigt, kramt sie noch eine Kopfschmerztablette aus der Brusttasche und würgt sie trocken hinunter. Noch so eine Woche in diesem Drecksjob, und das war’s.
»Also, wohin?«, fragt sie, obwohl sie Fastes giftige Stimme aus der Morgenbesprechung noch im Ohr hat. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht darüber nachdenkt, das Handtuch zu werfen. Wenigstens sind die anderen noch da, Birna zum Beispiel, und hin und wieder womöglich auch Überlegungen in Sachen Zukunft.
Dieser Faste-Arsch muss doch irgendwann in Rente gehen. Oder unverhofft tot umfallen. Sie wird ihm nicht nachtrauern, nicht mal so tun, als ob. Das Autoradio krächzt los.
»Erst nach Svartluten«, sagt Birna und tippt auf ihr Handydisplay. »Virkesvägen 7b. Ein gewisser Ivar Eriksson hat bei seinen Nachbarn verdächtige Geräusche gehört.«
Sie ruft ihn an.
»Hallo«, meldet sie sich, als er rangeht. »Was genau ist denn passiert?«
»Nichts weiter, muss mich verhört haben.«
Birna hakt trotzdem nach, was er gehört haben will, doch darauf antwortet er nicht.
»Hallo?« Dann noch mal: »Hallo?«, doch Ivar Eriksson hat bereits aufgelegt.
Von der Industrigatan biegen sie in den Virkesvägen ab. Birna wirft Jessica einen flüchtigen Blick zu.
»Wohnt deine Mutter nicht hier irgendwo?«
»Hat sie mal, ja. Ist aber wohl umgezogen. Ich glaube, vor ein paar Jahren kam mal eine Karte mit einer neuen Adresse.«
»Wenn du willst, fahren wir nachher mal vorbei.«
»Warum sollte ich das wollen?« Sie stellen den Wagen vor der Hausnummer 7b ab. »Sollen wir dann auch gleich nach Island und deine Mutter besuchen?«
Sie sehen einander missmutig an und klingeln an Ivar Erikssons Tür. Gehen weiter zur 7a und klingeln dort ebenfalls. Na ja, gehen – sie klettern über den Schrott, der sich vor dem Haus türmt: Überreste eines Küchentischs, ein aufgeschlitzter Sessel, Kartons und anderer Müll, der auf schnellstem Wege nach draußen befördert und mit Reifen und Müllsäcken dekoriert wurde.
Im Gegensatz zur Nachbarstür, die entweder mal ausgetauscht oder zwischenzeitlich zumindest lackiert wurde, ist die Tür zur 7a noch immer die ursprüngliche. Sie setzt sich verbissen dem Wetter und Geschrei zur Wehr.
»Du Scheißhure, dich bring ich um!«, brüllt jemand, und jemand anderes antwortet: »Mach doch, du impotentes Arschloch!«
Birna drückt gegen die verzogene Tür. Erst als sie sich zu zweit dagegenstemmen, lässt sie sich weit genug öffnen.
Die Stimmen kommen aus dem rückwärtigen Teil des Hauses, und obwohl sie beide Hallo? und Polizei! rufen, geht der Streit unvermindert weiter.
Was das für Geräusche sind, könnten sie nicht mal sagen; ein Kopf vielleicht, der gegen eine Wand schlägt? Oder Gegenstände, die geworfen werden. Nichts Ungewöhnliches jedenfalls. Auseinandersetzungen unter Besoffenen sind Alltag, gerade an einem Lohntütenfreitag.
Die Doppelhäuser am Virkesvägen und Timmervägen wurden Anfang der Siebzigerjahre alle mit dem gleichen Grundriss erbaut: ein schmaler Flur, von dem Schlafzimmer und ein Bad abgehen. Eine Küchentheke trennt Küche und Hauswirtschaftsraum vom Wohnzimmer. Dahinter ein Gärtchen mit Blick auf die Zellstofffabrik.
Der Grund für den Siedlungsbau in Svartluten – besagte Fabrik – lässt sich vielleicht eine Zeit lang verdrängen, doch sobald man ein Fenster öffnet, weiß man es wieder. Die ganze Gegend stinkt nach verrottetem Fisch, vor allem wenn der Wind aus Westen kommt.
Es riecht nach Geld. Hat er das nicht immer gesagt? Dieser Idiot Göran, mit dem Jessicas Mutter zusammengezogen war. Und sie daraufhin: Hier, unser Gästezimmer, so kannst du mal zu Besuch kommen. Wir könnten zusammen den Garten machen, Erdbeeren pflanzen zum Beispiel. Du magst doch Erdbeeren.
Erdbeeren mochte Jessica noch nie. Sie ist gegen Erdbeeren dermaßen allergisch, dass sie mal im Krankenhaus gelandet ist, als ihre Mutter Erdbeeren in eine Geburtstagstorte geschmuggelt hatte.
In der 7a klebt immer noch die ursprüngliche Tapete mit einem grün-rosa-gelben Medaillonmuster an der Wand, auf dem Fußboden liegt dunkelbrauner Teppichboden. Im Maklerjargon hieße das wohl charmante Originaldetails.
Sie gehen auf die Stimmen zu, mäandern um Kleiderhaufen und Mülltüten herum, die es nicht bis raus zur Tonne geschafft haben.
Birna schiebt eine der Zimmertüren auf, dann die nächste, die sie genauso schnell wieder schließt.
»Puh, wie das stinkt! Irgendwas ist da verreckt! Darum kümmern wir uns später.«
Es stinkt wie bei ihrer ersten Begegnung mit Göran. In diesem Haus hab ich das Sagen, nur dass du es weißt.
Zuerst sehen sie die Eckcouch und jemanden, der darauf liegt, als Nächstes einen Mann, der steht, und dann die Frau, die mit blutüberströmtem Gesicht an der Wand kauert. Die Augen sind bloß noch Schlitze inmitten aufgeplatzter Haut. Nur das Mundwerk ist immer noch voll funktionsfähig.
»Dann schlag mich halt tot, du nutzloser Feigling! Oder schaffst du nicht mal mehr das?«
Irgendwas hält er in der Hand. Ein Werkzeug. Jessica fällt die Bezeichnung nicht mehr ein, aber die ist gerade auch nicht wesentlich. Als der Mann den Arm hebt und zielt, rammt sie ihn von der Seite. Das Werkzeug verfehlt den Kopf der Frau, geht stattdessen durchs Fenster, und jetzt scheint er nicht mehr nur wütend zu sein, sondern rasend vor Zorn. Er stößt Jessica von sich weg, setzt einen halb geglückten Tritt gegen ihr Knie und rappelt sich wieder hoch.
Voll wie eine Haubitze, aber wieselflink greift er zu einem Metallkolben, der als Aschenbecher für zig zum Teil noch qualmende Kippen dient, schwingt ihn und trifft alles, was ihm in die Quere kommt: Stehlampen, Zimmerpflanzen, Bilder. Es ist klar, worauf er es abgesehen hat. Die Frau kreischt nicht mal mehr, sie lacht nur noch, lacht wie eine Geisteskranke.
»Fallen lassen, oder ich schieße!«, schreit Birna, und er erstarrt, als hätte er sie jetzt erst bemerkt. »Fallen lassen!«, schreit sie erneut, und mit einem dumpfen Geräusch geht der Ascher zu Boden.
Der Mann dreht sich um. Hebt zwar die Arme, doch irgendwas ist mit seinen Augen, mit dem Blick. Er grient. Schaut sich um, als wollte er sich ansehen, was er geleistet hat. Sein Blick besagt: Legt euch nicht mit mir an. In diesem Haus hab ich das Sagen. Er macht einen Schritt nach vorn, dann noch einen.
»Stehen bleiben!«, schreit Birna, trotzdem steht er plötzlich so nah vor ihr, dass ihr sein Mundgeruch entgegenweht.
»Hinter dir!« Jessicas Warnung kommt zu spät. Die Person auf der Couch schnellt hoch und packt Birnas Arm. Die Waffe gleitet ihr aus der Hand, und sie kann sie gerade noch rechtzeitig unters Sofa treten.
Jessica reagiert binnen eines Sekundenbruchteils. Ein Schuss löst sich und setzt sich wie ein Paukenschlag über die Trommelfelle und durch den ganzen Körper fort. Dann schießt sie ein zweites Mal.
Einer sackt zurück aufs Sofa und kotzt. Ein anderer kauert sich in Embryonalstellung am Boden zusammen. Zwei Polizistinnen schließen Handschellen um Handgelenke, und Stimmen krächzen durchs Funkgerät. Ein Notarzt sei unterwegs, Verstärkung ebenfalls und sicher auch bald die Presse.
Als es endlich still wird, sind nur noch vereinzelte Schluchzer zu hören.
»Sind Kinder im Haus?«, will Birna wissen. Sie hat sich Latexhandschuhe übergestreift und untersucht die blutende Frau, die immerhin aufgehört hat zu lachen. Sie schüttelt den Kopf.
Jessica beugt ein paarmal ihr Knie, um sicherzustellen, dass sie es belasten kann. Aus den Einschusslöchern in der Decke rieseln Holzspäne. Sie steigt über den Mann am Boden hinweg, der mittlerweile aufgehört hat zu schluchzen und möglicherweise eingeschlafen ist.
Göran schlief auch immer irgendwann ein. Gern mit dem Blut ihrer Mutter auf den Fingerknöcheln.
»Wenn mein Knie nicht so scheiße wehtun würde, würd ich dir jetzt die Eingeweide raustreten«, knurrt sie und humpelt in Richtung Küche. Ein Geräusch, das wieder verklingt. Doch an der Tür zum Hauswirtschaftsraum ist es wieder deutlicher zu hören.
»Ich glaube, das ist ein Hund.« Sie zieht die Tür ein Stück weit auf. Dahinter ist es dunkel, bis auf einen Spalt zwischen dem Fensterrahmen und einer Decke, die zum Abdunkeln vor das Fenster gehängt wurde.
Der Urin- und Fäkalgestank treibt ihr die Tränen in die Augen.
Genau wie der Anblick des misshandelten Tieres, das kaum den Kopf anheben kann.
Sie sollte es nicht tun. Trotzdem streckt sie die Hand danach aus.
»Sooo«, sagt sie und streicht dem Welpen über das verklebte Ohr. »Dich bringen wir jetzt von hier weg.«
Die Frau wird im Rettungswagen mitgenommen, die zwei anderen im Streifenwagen.
Unterwegs kommt Jessica und Birna das Redaktionsfahrzeug der Gaskassen entgegen.
»Journalisten sind nicht alle bekloppt«, kommentiert Jessica Birnas Grimasse und tätschelt deren Knie. »Hast du mal wieder von diesem … Wie hieß er gleich wieder? Blomkvist? Mikael Blomkvist?«
»Hör bloß auf. Zwischen uns war nie was.«
»Hab ich doch gar nicht behauptet!«
»Dann frag auch nicht«, brummt Birna. Trotzdem hängt der Name weiter in der Luft, wie immer, wenn das Gespräch auf Mikael kommt. Er reiste an. Reiste ab. Mehr war da nie.
Mit heruntergelassenen Fenstern fahren sie weiter zum Tierarzt. Der Welpe stinkt zum Davonlaufen. Jessica hat ihn in eine Decke gewickelt, und jetzt liegt er still auf ihrem Schoß. Hoffentlich schläft er nur. Vielleicht ist er auch schon gestorben.
»Drecksmenschen«, sagt sie. »Sollen sie sich doch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Aber ein Welpe!«
Birna legt ihr die Hand auf den Unterarm. Lässt ihn dort liegen, wie zum Schutz gegen Bilder, Geräusche, Gerüche, Stimmen. Früher oder später werden sie diesen Vormittag mit allen möglichen Leuten und vor allem mit ihrem Chef besprechen müssen.
Hans Faste hat bereits angerufen. Birna sagte nur, sie könnten gerade nicht sprechen, deshalb ruft er erneut an und dann noch einmal. Sie haben nur kurz duschen, sich Blut und Ausscheidungen abwaschen und saubere Sachen anziehen können, als er auch schon in ihrem Dienstzimmer steht und um einen Lagebericht bittet. Im Präsens bitte.
»Wir gehen dem Anruf nach, hören einen Streit, es kommt zu einer Bedrohungslage, ein Mann wird aggressiv und schlägt mit einem Gegenstand um sich, woraufhin Birna die Waffe zieht, ihn verwarnt, aber von einer weiteren Person von hinten überrumpelt wird, die ihr die Dienstwaffe aus der Hand schlägt«, fasst Jessica zusammen.
»Hand.« Faste sieht zu Birna. »Hältst du die Waffe nicht beidhändig?«
»Öh, doch, schon. Aber der Typ von hinten überrascht mich.«
»Wer war das?«
»Irgendwer, der auf dem Sofa schläft.«
»Du bist also so überrascht, dass du deine Dienstwaffe fallen lässt?«
»Schon, aber ich kicke sie sofort unters Sofa.«
»Ah ja. Geschickt gelöst.«
Faste hat wieder diesen spöttischen Ton angeschlagen, als hätte er bereits beschlossen, dass sie die Lage falsch eingeschätzt haben. Er dreht ihnen die Worte im Mund herum und versucht, Schwachstellen zu finden. Wenn ihnen ein Dienstvergehen unterlaufen wäre, wäre er der Erste, der sich die Hände reiben würde.
»Birna macht alles richtig«, mischt sich Jessica ein, und Faste dreht sich zu ihr um. »Ich schätze die Lage als so bedrohlich ein, dass ich ebenfalls die Waffe ziehe und zwei Schüsse in die Zimmerdecke abfeuere.«
»Reicht einer nicht? Und wie kannst du wissen, dass sich oben niemand befindet?«
»Da ist kein Obergeschoss.« Dann gibt eine Zeit lang ein Wort das andere, bis Faste verkündet, dass der Einsatz weiter untersucht werde.
»Gut«, sagt Jessica, »so hört uns ja vielleicht jemand zu, der unvoreingenommen ist.«
Faste umrundet den Schreibtisch, schiebt willkürlich Unterlagen hin und her, beugt sich nach vorn und starrt ein Foto von Birnas Kater Sture an, ehe er seinen Rundgang am Fenster beendet und über den Fluss blickt.
»Es ist nur so«, sagt er, »dass jemand ausgesagt hat, du hättest eine der Personen in unterlegener Lage bedroht.«
»Wie bitte?«, fragt Jessica. »Was soll das heißen?«
»Du hast jemandem angedroht, ihm – Zitat – die Eingeweide rauszutreten.«
Jessica sieht ihm die Genugtuung an.
Mit im Rücken verschränkten Händen und mit Blick auf die am Flussufer sprießenden Narzissen suhlt er sich in dem Gefühl, Oberwasser zu haben. Eigentlich müsste er sie beruhigen, Mitgefühl zeigen, sich zumindest solidarisch mit ihnen erklären, aber nein, jetzt summt er sogar vor sich hin. Irgendeine beschwingte Melodie. Dann dreht er sich wieder zu ihnen um.
»Wie gesagt, die Interne soll klären, was da vorgefallen ist. Aber nur so als kleiner Hinweis: Lasst bloß nichts aus. Es kommt sowieso ans Licht.«
Dann geht er. Birna reißt das Fenster auf, damit der Altmännergeruch hinauszieht.
»Nur Psychos und Hausfrauen summen«, sagt sie. »Zu welcher Kategorie gehört er, was meinst du?«
»Ich pack das nicht mehr«, ächzt Jessica. »Ich glaub, ich muss kündigen.«
»Dann hat er gewonnen.«
Natürlich weiß Jessica, dass Birna recht hat. Trotzdem. Früher war ihr Job ein Ventil – der Ort, an dem sie atmen konnte. Seit Faste da ist, weiß sie nicht, was schlimmer ist: die kranken SMS, die ihr der Vater ihrer Kinder ständig schickt, oder Fastes sogenannter Führungsstil.
Das Telefon klingelt. Keine von ihnen macht Anstalten ranzugehen.
»Komm«, sagt Birna, »soll Faste doch behaupten, was er will. Wir gehen ins Stadshotellet, vielleicht kann man ja schon draußen sitzen. Ich nehme den Laptop mit, dann können wir dort den Bericht schreiben.«
»Geh schon mal vor, ich komme nach«, sagt Jessica und nimmt den Anruf entgegen.
7. Kapitel
Ein Auto am Straßenrand. Ein Mann in einer Notlage. Der Rettungswagen sei gerade gefahren, und es bestehe, soweit der Anrufer es einschätzen könne, keine Lebensgefahr.
»Und warum rufen Sie dann die Polizei an?«, fragt Jessica den 37-jährigen Fredrik Berg.
»Der Mann – Sie wissen schon, Dosen-Kurt, dieser Müllsammler … Also, wie dem auch sei, er ist ohnmächtig geworden, da hatte ich gerade angehalten. Hat sich dann aber wieder berappelt. Hat mehrmals wiederholt, dass er oben an der alten Müllkippe Wölfe gesehen hätte. Ich dachte nur, das wäre vielleicht gut zu wissen. Die Lappen … äh … Samen … überschlagen sich ja immer vor Freude, wenn’s um Raubtiere geht.«
Jessica Harnesk seufzt stumm in sich hinein. Ein Bier wäre nicht schlecht gewesen, aber Wölfe in der Nähe der Gemeinde sind nun mal nicht der Hit. Sie bedankt sich bei Fredrik für den Hinweis.
Diesmal ist Birna diejenige, die sich in Richtung Sonne dreht.
»Wenn du wüsstest, wie wenig Sonnenlicht ich im Leben abgekriegt habe! Mein Schicksal waren Aschewolken und Vulkanausbrüche.«
Wie wenig Jessica doch über die Isländerin weiß, obwohl sie schon einige Jahre zusammenarbeiten. Sie versuchen es manchmal, gehen aus oder was essen, sehen sich Filme an, sobald die Kinder im Bett liegen. Sie können sich gut unterhalten. Trotzdem landen sie am Ende immer bei Arbeitsthemen.
»Nur noch zwei Minuten.«
Jessica nutzt den Moment, um ein paar SMS zu überfliegen, um die sie nicht gebeten hat; E-Mails, die sie längst hätte beantworten müssen; die Liste der verpassten Anrufe von Leuten, mit denen sie lieber nicht reden will.
Dann fahren sie zu der alten Deponie, und Kindheitserinnerungen erwachen zum Leben. Jessica schiebt sie dorthin zurück, wo sie hingehören – überwiegend auf den Müll.
Sie setzen sich auf die Treppe zum einstigen Büro. Es ist ein friedvoller Ort, Insekten surren, Vögel zwitschern.
»Göran und ich sind manchmal hergefahren, um Ratten zu schießen.«
»Wer ist denn Göran?«
»Einer der fabelhaften Typen meiner Mutter, die Schlange gestanden haben, um unser Leben zu bereichern.«
Birna steht auf. Schlendert ein paarmal auf und ab. Nimmt ihr Handy zur Hand, packt es dann aber wieder weg.
»Okay. Wo fangen wir an, und wonach suchen wir?«
»Nach Wölfen. Nach Spuren. Nach gerissenen Rentieren und Raben.«
Reifenspuren und ziemlich zeitgenössischer Unrat wie zerdrückte Bierdosen und Hamburgerverpackungen zeugen davon, dass dieser Ort immer noch frequentiert wird. Sie drehen mehrere Runden am Zaun entlang und an den verwitterten Schildern vorbei, die vor der Abbruchkante warnen. Nirgends Spuren, nirgends Rentierkadaver oder andere Hinweise darauf, dass hier Raubtiere durchgezogen sein könnten.
Sie entdecken sie im selben Moment – die Frau, die am Fuß des Steilhangs an einer unzugänglichen Stelle kauert, als würde sie beten.
»Ach du Scheiße«, presst Jessica hervor und schlägt sich die Hand vor den Mund. Die Vorstellung, dass dort eine Frauenleiche liegt – oder vielmehr: dass jemand diese Frau umgebracht hat –, ist mehr, als sie gerade ertragen kann. Sie will nur noch weg, irgendwen anders bitten zu übernehmen, jemandem das Undenkbare erklären: dass sie es nicht mehr schafft, dass sie nicht mehr kann. Schreien, dass es reicht, dass sie nach Hause will, heim zu den Kindern. An deren Haut schnuppern, die Tür hinter ihnen abschließen, die Welt aussperren. Birna steht neben ihr und guckt, als wäre überhaupt nichts geschehen; sieht sie nicht sogar ein wenig aufgeregt aus? Jedenfalls merkwürdig energiegeladen.
»Ruf du Notarzt und Verstärkung«, sagt sie. »Ich hol schnell das Fernglas.«
Doch weil das Gesicht der Frau von ihnen abgewandt ist, könnte Birna nicht sagen, ob die Frau tot oder bloß bewusstlos ist. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass sie noch rechtzeitig gekommen sind, dürfen sie keine Sekunde verlieren. Es ist nun wirklich nicht so, als würde sie Jessicas Ängste – oder die eigenen – nicht zur Kenntnis nehmen. Trotzdem überschlägt sie kurz, wie lange was dauern würde, wägt die Risiken ab und fasst dann einen Entschluss.
»Außenherum dauert zu lange.«
Der Zaun behindert sie nur insofern, als sie einen Pfosten aus der Erde wuchten und darüber hinwegsteigen muss.
»Kommst du?«, fragt sie. »Die Höhe ist gar nicht so schlimm. Guck einfach nicht nach unten. Da sind Äste, an denen du dich festhalten kannst.«
Jessicas Beine möchten am liebsten kehrtmachen, doch dann geht sie einen Schritt auf den Abgrund zu. Ein Stein lockert sich, und sie sieht ihm auf dem Weg nach unten hinterher.
»Ich finde trotzdem, wir sollten außenherum gehen …«
»Dann mach«, sagt Birna und schlittert bereits nach unten.
Jessica nimmt all ihren Mut zusammen.
Birkenzweige geben ihnen Halt, ebenso wie Wurzeln und Felsbrocken. Das letzte Stück rutschen sie nur noch. Dann haben sie wieder festen Boden unter den Füßen.
Die Frau kauert immer noch genauso da wie zuvor. Sie ist jung. Jessica sucht nach Vitalzeichen. Ein Auge fehlt. Raben zögern nicht lange.
»Ist das nicht …« Birna bringt ihren Satz nicht zu Ende.
»Du denkst an … Wie hieß sie gleich wieder?«
»Die dich interviewen wollte, als wir zuletzt diese Baumumarmer eingesammelt haben.«
»Ja wohl eher Bergwerksgegner.«
»Ist doch egal. Aber da war sie nicht als Reporterin dabei, sondern als Demoteilnehmerin.«
»Sie hat später angerufen«, erinnert sich Jessica. »Sie hieß Södergran, glaube ich, hat bei der Gaskassen gearbeitet und wollte wissen, was ich von dem neuen Bergwerk halte.«
»Und was hast du geantwortet?«