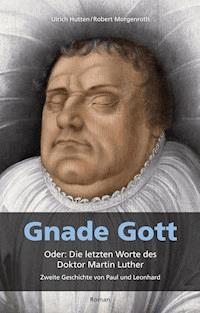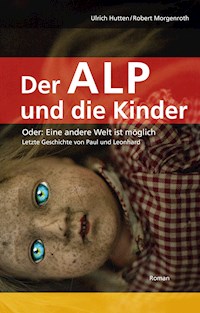14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die beiden Autoren Ulrich Hutten und Robert Morgenroth begeben sich zu zwei Freiheitskämpfern der Jahre 1848/49, zu Georg Böhning aus Wiesbaden und Max Dortu aus Potsdam. Der eine ein alter Kämpe, Uhrmacher und Badewirt. Ein junger Enthusiast aus guter Potsdamer Juristenfamilie der andere. Nicht nur ihr gemeinsames Schicksal verbindet sie: Beide sterben für ihr Land und ihre demokratischen Überzeugungen, werden nach der endgültigen Niederschlagung der Revolution durch das preußische Militär exekutiert. Die vier Protagonisten begegnen sich im Kopf der Autoren, um gemeinsam Max Dortus und Georg Böhnings Geschichten zu erzählen. Sie gehören zusammen wie die Kapitel in diesem Roman, der von zwei Menschen ihrer Zeit erzählt, ihrer Liebe zur Freiheit und ihrem Kampf um Gerechtigkeit und Demokratie. Mehr noch: Gemeinsam eignen sich die Vier die historischen Umstände ihrer Epoche an, entfalten ein vielschichtiges Panorama der Begebenheiten zwischen Preußen, Potsdam und Berlin, Heidelberg, Wiesbaden, Paris und dem badischen Land, der ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden. Auf dem Spiel steht das Land, schon damals an einem Scheideweg. Mit ihrem neuen Roman hat sich das Autorenduo Ulrich Hutten und Robert Morgenroth einmal mehr an einem historischen Stoff versucht und nach bestem Wissen auf historische Gegebenheiten geachtet. "In dichterischer Freiheit verweben wir Fakten und Fiktion, um uns Wahrheiten zu nähern, wie sie anders kaum zugänglich sind", so beschreiben sie die Vorgehensweise auch ihres neuesten Buchs. Und sie machen daraus keinen Hehl, dass sie die Figuren und den Stoff ihres Romans für hoch aktuell halten, "in Zeiten des Umbruchs, in denen der Kampf um die Demokratie auf der Kippe steht".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ulrich Hutten/Robert Morgenroth
Vergessenes Blut
ROMAN
© 2024 HuttenundMorgenroth, Potsdam
Alle Rechte liegen bei den Autoren.
Dieses Buch erscheint im Eigenverlag HuttenundMorgenroth
in Kooperation mit tredition print und publishing als
Hardcover ISBN 978-3-384-06958-0
Ebook ISBN 978-3-384-06959-7
Das eBook gibt es online auf allen wichtigen Plattformen,
das gedruckte Buch im tredition shop https://shop.tredition.com/, im guten Buchhandel, bei den Autoren und im Online-Handel
Umschlag: Klaus Armbruster, Bad Wildungen-Bergfreiheit
Textgestaltung: Dagmar Ronneburg, Wiesbaden
Autorenkontakte: [email protected]
Post: Ulrich Hutten und Robert Morgenroth
c/o Punkt und KomMa
Zeppelinstr. 123a, 14471 Potsdam
https://huttenundmorgenroth.de/
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Duftspur des Todes
Mit Röslein bedeckt
Martin und die Liebe zum Freien
Die Stimme meines Vaters
Unter freiem Himmel
Welt, so nah und weit
Ich, Max Dortu
Maikäfer, flieg
Lange lieb ich dich schon
Unter die Leute
Doppelleben
Die Nassauer proben den Aufstand
Auf Messers Schneide
Eine Revolution ist keine Revolution
Nach dem Rausch
Der Kartätschen-Prinz
Potsdamer Soldaten stehen nicht stramm
Noch ist nichts verloren
Der Putsch der Hohenzollern
Paris leuchtet
Auf zu neuen Taten
Das Déjà-vu
Mit bloßer Brust
Die Meuterei von Rastatt
Der Großherzog flieht
Halbe und Entschiedene
Die Bastille im Nerotal
Aus Liebe zu Griechenland
Die Wunden von Waghäusel
In der Falle der Festung
Die Eingeschlossenen
Die Schlinge zieht sich zu
Die Hölle von Rastatt
Beuge dich und lebe
Die Hinrichtung des Max Dortu
Georg Böhnings Ende
Der vergessene Georg Böhning
Auf ein letztes Wort
Vergessenes Blut
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Duftspur des Todes
Auf ein letztes Wort
Vergessenes Blut
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
„…dann wird Deutschland das erste politisch, gesellschaftlich und geistig freie Land sein.“
Max Dortu in seiner Todeszelle (1849)
Badisches Wiegenlied
Schlaf’, mein Kind, schlaf leis’, Dort draußen geht der Preuß’, Deinen Vater hat er umgebracht, Deine Mutter hat er arm gemacht, Und wer nicht schläft in guter Ruh’, Dem drückt der Preuß’ die Augen zu. Schlaf’, mein Kind, schlaf leis’, Dort draußen geht der Preuß’,
Schlaf’, mein Kind, schlaf leis’, Dort draußen geht der Preuß’, Zu Rastatt auf der Schanz’, Da spielt er auf zum Tanz, Da spielt er auf mit Pulver und Blei, So macht er alle Badener frei. Schlaf’, mein Kind, schlaf leis’, Dort draußen geht der Preuß’,
Schlaf’, mein Kind, schlaf leis’, Dort draußen geht der Preuß’, Der Preuß‘ hat eine blut’ge Hand, Die streckt er übers badische Land, Und alle müssen stille sein Als wie dein Vater unterm Stein Schlaf’, mein Kind, schlaf leis’, Dort draußen geht der Preuß’.
Schlaf’, mein Kind, schlaf leis‘, Dort draußen geht der Preuß’, Gott aber weiß, wie lang er geht, Bis daß die Freiheit aufersteht, Und wo dein Vater liegt, mein Schatz, Da hat noch mancher Preuße Platz. Schrei, mein Kindlein, schrei’s: Dort draußen liegt der Preuß!
Karl Ludwig Pfau (1821-1894)
Wir haben uns schon in früheren Romanen an Stoffen aus der Geschichte versucht und nach bestem Wissen auf historische Gegebenheiten geachtet. So auch dieses Mal. In dichterischer Freiheit verweben wir Fakten und Fiktion, um uns Wahrheiten zu nähern, wie sie anders kaum zugänglich sind. Max Dortu und Georg Böhning sind historische, keine erfundenen Figuren. Sie haben gelebt, sind gestorben. Sie reden mit uns, solange wir uns zu ihnen begeben. Vielleicht erzählen sie uns dann ihre Geschichte.
Ulrich Hutten und Robert Morgenroth
Duftspur des Todes
Ulrich Hutten, Max Dortu, Robert Morgenroth, Georg Böhning
Freiburg, im Juli 1849
Beginnen wir mit deinem Ende, Max. Obwohl es mirwehtut, dich so zu sehen: Du, ein blühender junger Mann, gerade 23, das Lebenszelt kaum aufgespannt. Du tigerst umher in einer Gefängniszelle. Es können nur noch Tage sein, bis sie dich holen. Dann werden sie dich töten.
Dich schaudert. Du lässt dich auf dem klobigen Hocker nieder, um nicht weggeweht zu werden in deinem Innern, stehst wieder auf, um dich zu fassen, um vorletzte Gedanken zu denken. Oder letzte vielleicht. Hockst dich erneut hin, um zu schreiben.
Draußen ist die Welt wie sie ist. Ein schwülheißer Nachmittag heizt die Stadt auf und die Weinberge und die Hänge zum Schwarzwald hin. Hier drinnen ist dir kalt. Du spürst die Lebenswärme des Hundchens an deinen Fußspitzen. Das tut gut. Sie haben es zu dir gelassen mit dem schmutzigen Stofffetzen um den Hals. Ein Wächter hatte Mitleid am Ende, nachdem es vor den Gittern deiner Zelle herumgewinselt hat Tag und Nacht.
Das Hundchen. Du massierst ihm mit den Zehen zärtlich den Rücken. Ihr seid zwei Seelen in einem Herzen, du hast es sofort gespürt, als es noch bei Georg herumhüpfte, dem es irgendwann irgendwo zugelaufen war, vielleicht seinerzeit, im Freiheitskampf für die Griechen. Und doch sprang es jedes Mal mit einem Satz auf deinen Schoß, kaum kamst du zur Tür herein, und stupste seine feuchte Schnauze gegen dein Gesicht. Du hast deine Nase hineingesteckt in das Hundefell, Max, es roch nach Erdäpfeln und Stockfeuchte. Du hast es auf dir sitzen lassen und vorsichtig an dich gedrückt. Du konntest gar nicht von ihm lassen. Du bist mit ihm herumgetollt, hast es mit Leckereien verwöhnt, hinter den Ohren und den Rücken bis zum Schwanz hinunter gekrault, bis Georg schließlich einschritt und sagte, man könnte meinen, du bist kein Kämpfer der Revolutionsarmee, sondern hast noch ein Geschwisterchen bekommen.
An diesem Tag hast du den Ärmel aus einem alten Hemd gerissen und dem Hundchen um den Hals gebunden: als Andenken, mein Kleiner. Damit du mich immer riechen kannst.
Als sich vor ein paar Wochen alles aufgelöst hat, ist es passiert. Alle suchten das Weite. Georg musste mit seinen Mannen zusehen, sich eben noch so in die Festung Rastatt zu retten. Und das Hundchen ging ihm verloren. Bis es vor deiner Zelle in Freiburg wieder auftauchte. Es war über Berg und Tal, Haus und Hof, Stadt und Land der Duftspur des Tuchs gefolgt.
Du schiebst deine Zehen unter seinen Bauch. Es antwortet ein wohliges, verschlafenes Brummen und ein leises Seufzen aus einer anderen Welt.
Und du, dein Ende vor Augen. Jetzt, da alles verloren ist, deine Sache und du selbst. Wie bitter.
Hallo, wer ist da? Wer redet so über mich?
Entschuldigung, Max, ich habe mich nicht vorgestellt. Mein Name ist Ulrich Hutten und hier ist mein Freund Robert Morgenroth. Wir sind auf einer Reise, zu dir und Georg Böhning.
Georg Böhning ist hereingekommen: Auch zu mir?
Genau, zu euch beiden. Es ist eine Reise in unseren Köpfen. Klingt vielleicht phantastisch, ist aber so wirklich wie wir jetzt vor Euch stehen. Dürfen wir uns zu Euch gesellen?
Die beiden zögern einen Augenblick, dann stimmen sie zu, Georg zuerst, dann Max. Zu viert lassen sie sich nieder.
Was wollt Ihr von uns?
Eure Geschichte erzählen. Und schreiben.
Wir sind tot. Seit 175 Jahren.
Tot ja, doch nicht gestorben. Dafür gibt es uns.
Wie bitte? Max und Georgs Gesichter stehen voller Fragezeichen.
Kein Toter kann noch bestimmen, wer er war. Wir tun es, wir, die eure Geschichten erzählen, die Künstler, Lehrer, Politiker, Kirchenleute. Und wir Schreiber. Nach unserem Gutdünken lebt Ihr weiter. Aber Ihr beide, habt Ihr nicht gekämpft für euer Recht, in eigener Sache selbst zu sprechen? Dafür sogar euer Leben gelassen?
Aber ja doch.
Wäre es also nicht angemessen, eure Geschichte gemeinsam mit euch zu erzählen? Auch wenn es unmöglich erscheint? Wo und wie sonst könnten wir es, wenn nicht in unseren Köpfen?
Die beiden Freiheitskämpfer zögern, schauen sich fragend an.
Böhning presst die Lippen zusammen, rückt seinen Schlapphut zurecht.
Schließlich nicken sie. Wieder Georg zuerst: Wenn es der
Sache dient.
Dann Max: Unmöglich, das hat etwas. Du kannst fortfahren, Hutten.
Gut, antwortet Hutten. Ich mache weiter, Max, aber nur mit dem Anfang. Du unterbrichst mich, jederzeit. Noch besser: Du übernimmst, sobald dir danach ist. Und mein Freund Morgenroth mischt sich mit Georg ein, sobald sie es für richtig halten.
Zurück also nach Freiburg, in deine Zelle, Max.
Du bist so zuversichtlich gewesen bis zuletzt, jedenfalls nach außen hin. Das, den Glauben an den Sieg, hast du dir immer abverlangt, auch in aussichtslosen Situationen, auch wenn du dir selbst nicht mehr geglaubt hast. Dir am Ende zugesehen hast, als wärst du ein anderer. Oder hast du wirklich gemeint, Ihr könntet noch etwas ausrichten aus versteckten Widerstandsnestern in den Winkeln abgelegener Schwarzwaldtäler? Das Struve-Paar, Gustav und Amalie, der unverwüstliche Becker, der dir mehr Onkelersatz als militärischer Vorgesetzter war, dein geliebter Lieblingsonkel Louis, schon als Kind dein Idol, der wackere Oberst Sigel und all die anderen Mitstreiter und Kampfgenossen, die überlebt und dir etwas bedeutet haben, alle sind sie klug genug gewesen, sich abzusetzen, sind längst hinüber in die Schweiz oder über den Rhein zu den Franzosen. Aber du, Max, Major der badischen Revolutionsarmee, doch immer noch ein Preuße aus Potsdam, pflichtbewusst bis zur Selbstaufgabe, du bist naiv und heldenhaft genug, um noch die Revolutionsflagge zu schwingen?
Ich weiß nicht. Ich habe daran geglaubt, gleichzeitig auch nicht, obwohl sich das unlogisch anhört. Das wühlt mich auf, Hutten, wenn du meine Geschichte so vom Ende her erzählst. Mein
Leben war doch mehr. Aber erzähle weiter, ich höre.
Es ist der 3. Juli. Die Stadt, eben noch für letzte Wochen Hauptstadt der freien badischen Republik, wenigstens dem Namen nach, sie ist in vorauseilendem Gehorsam bereits zu den anmarschierenden Preußen übergelaufen, das großherzogliche Amt hat schon wieder die hoheitliche Gewalt. Aber du musst, wie befohlen, vormittags auf dem Schloss derer von Andlau in Hugstetten noch eine Requirierung versuchen, für eine Armee, die sich längst verflüchtigt hat. Nur eine Meile von Freiburg entfernt. In der dir typischen Manier. Man kann dir schlecht widerstehen, deiner preußisch gnadenlosen Konsequenz nicht und auch nicht deinem hugenottischen Charme.
Morgens zwischen 2 und 3 Uhr erscheinst du in Dragoner-Uniform hoch zu Ross vor dem Schloss, begleitet von einem Haufen rheinbayerischer Freischärler, befiehlst erst einmal rücksichtsvoll Ruhe, weil alles noch schläft. Dann, gegen 9 Uhr besetzt du umsichtig die Zugänge und Ihr fordert Einlass mit erhobenen Gewehren. Der Schlossherr ist nicht da, Josef Klotz, der ehemalige Kutscher, eilt herbei und versucht euch aufzuhalten, hinter ihm aufgeregt die Tochter des Hauses.
Sie zittert ein wenig, aber sie ist mutig, stellt sich vor dich hin und vor deinen Haufen. Und du? So gewinnend wie ein Brautwerber, so ganz freundlich einnehmendes Wesen, dass sie bald nicht mehr die geladenen Gewehre und wilden Revoluzzer vor sich sieht, sondern einfach einen höflichen Mann von untadeligen Manieren und ganz offensichtlich reinem Gemüt, einen großen, schönen, eindrucksvollen, einen aufrechten und aufrichtigen jungen Kavalier.
Du schmeichelst mir, Hutten.
Du siehst sie an mit deinen ernsthaften, braunen Augen, redest sie an in deinem immer noch Brandenburgisch markierten Deutsch und erzählst ihr von eurer freien, badischen, deutschen Demokratie und davon, dass Ihr das eingeforderte Geld, die Waffen und die Pferde wahrlich nicht für euch selbst wollt, aber dass Ihr sie dringend braucht im Verteidigungskampf gegen die feindlichen preußischen Truppen.
Sie lässt dich schließlich ein, ohne Waffen.
Mutter und Tochter öffnen Keller, Schränke und Kommoden. Alles ausgeräumt, alles längst weg, aus Angst irgendwo außer Haus versteckt und in Sicherheit gebracht. Als du dich davon überzeugt hast, ziehst du mit leeren Händen ab, dir selbst ganz sicher, deinen Auftrag mit Schonung und Humanität ausgeführt zu haben, so sagst du es vor Gericht, Zeugen bestätigen es.
Das war deine revolutionäre Heldentat an diesem verhängnisvollen Tag. Dein Auftrag ist getreulich erfüllt. Nun hättest auch du dir bei klarem Verstand selbst den Befehl geben können,ja müssen, endlich das Weite zu suchen wie die anderen. Am besten auch du rasch über die Berge hinüber in die Schweiz, um wie der Hecker oder dein Mentor Struve weiter am Traum der Republik zu hängen und sei es jenseits des Ozeans. Und um dann eines Tages zu neuen Taten aufzubrechen, unter anderen Bedingungen, mit neuem Mut und heißem Herzen. Weil auf Dauer, dessen bist du dir sicher, lassen sich freie Menschen nicht knechten. Über kurz oder lang stehen sie wieder auf, immer wieder, hier in Baden und überall auf der Welt und zu allen Zeiten, und kämpfen gegen ihre Unterdrücker.
Aber ja, so war es, genau das waren meine Gedanken. Ich sah doch, was los war, dass wir für den Augenblick alles verloren hatten und keine Rettung in Sicht. Ich schickte meine Handvoll Rheinbayern nach Hause. Besorgt euch noch irgendwo ordentliche Klamotten, damit Ihr nicht auffallt, kehrt heim zu euren Lieben, sagte ich noch zu ihnen. Im Nu waren sie weg. Aber dann, dann kam ich mir hasenfüßig vor. Sich nach so einem Kampf, der aller Ehren wert war, einfach aus dem Staub machen? Wie ein geprügelter Hund, der den Schwanz einzieht? Und sich verkriecht? Einfach abhauen, nachdem es um nichts Geringeres ging als um Freiheit, Demokratie, Menschenrecht und Gerechtigkeit? Als wäre das alles nichts gewesen?
Klar, Max, aber ist es nur das? Was reitet dich an diesem Tag? Warum bloß bist du am Nachmittag noch einmal nach Freiburg zurück? In die Stadt, die sich bereits dem Feind angedient hat. Nur weil deine persönlichen Sachen noch im Hotel Engel liegen? Manche behaupten, du seist immer nur ein naiver Revoluzzer gewesen, schon seit der Märzrevolution in Berlin, seit deiner Flucht aus Potsdam, ein Jungspund, aktionistisch und leichtsinnig, einfach ein erlebnissüchtigerjunger Mann aus gutem Hause, auf der Suche nach dem nächsten aufregenden Abenteuer.
Wer behauptet denn so etwas, wehrt Max zornig ab. Übelste Nachrede! Die reden wie meine Feinde. Aber so waren sie, so redeten sie, so schwärzten sie unsereins an bei den Leuten.
Hutten bohrt weiter: Also nichts vom Überschwang eines jungen Mannes? Diesem lässigen Gefühl von Stärke und Unverwundbarkeit? Einem wie dir könne einfach nichts und niemand etwas? Willst du dich noch ein letztes Mal zeigen in aller Öffentlichkeit? Den feigen, verräterischen Freiburgern die Stirn bieten?
Doch dafür ist es zu spät, wieder einmal zu spät. Du kommst, sagt man, gerne zu spät, schon von Kindesbeinen an, weil dir Zeit wenig bedeutet hat, es sei denn, sie ist geträumt oder gelebt.
Max hört es sich an und schweigt.
Da schlendert er also, unser Max, in der Stadt, die von seinen Bürgern längst dem Feind versprochen ist, die Kaiserstraße hinunter, als wäre nichts. Lässig eben. Plötzlich schreit und wedelt einer von der anderen Straßenseite wie wild zu ihm herüber: Da ist er, haltet ihn fest, den Räuber, den Plünderer, den Dieb. Und schon stürzen sich wütende Leute wie eine Meute auf dich, begraben dich unter ihren Leibern, umklammern dich, Tentakel aus starken Armen, du strampelst und bäumst dich auf, nutzlos. Die Hauptwache erscheint, schleppt dich in das Amtsgefängnis hinüber und sperrt dich ein.
Es ist einfach Pech. Du hast schlicht Pech. Hätte sich eben jener Kutscher Josef Klotz aus deinem vormittäglichen Requirierungsversuch in Hugstetten nicht gleichfalls in die Stadt aufgemacht, in der Hoffnung, bei den Preußen neue Arbeit zu finden, und wäre er nicht rein zufällig im selben Augenblick die Kaiserstraße heruntergekommen, als du sie hinaufgehst, und hätte er dich nicht erkannt, an diesem ganz anderen Ort und obwohl er dich nur ein einziges Mal gesehen hat, wenn auch am gleichen Tag und unter sicher eindrucksvollen Umständen, du wärst wohl am Leben geblieben, Max.
Wie das dann wohl verlaufen wäre? Wie das von deinem Onkel Louis im schweizerischen Exil? Oder wärst du vielleicht mit deinem kleinen Freund Wilhelm von der Jacobs-Familie ausgewandert nach Chile, weil du es nicht mehr ausgehalten hättest in diesem reaktionären Deutschland? Oder doch brav deinem Vater gefolgt in die Potsdamer Juristerei? Oder hat dir der frühe Tod womöglich hässliche Beschmutzungen erspart, wie so manchem vor und nach dir, der seine Ideale geopfert hat auf dem Altar politischer Versuchung?
Ein paar Tage später sind die Preußen da und verlangen deine Auslieferung.
Tags darauf überstellt dich das Stadtgericht der preußischen Militärjustiz. Schon am 9. Juli verfügt der kommandierende General des ersten Armeekorps der Okkupationsarmee, von Hirschfeld, die kriegsgerichtliche Untersuchung wegen Kriegsverrats. Die Anklage: Dortu habe in verräterischer Weise die Volkswehr im badischen Gernsbach gegen die preußischen Truppen seines Landesherrn organisiert und noch am 3. Juli im Interesse der Insurgenten Requisitionen durchgeführt.
Als man dich aus der Zelle holt und dem Kriegsgericht vorführt, sitzen dir je drei Hauptleute, Leutnants, Sergeanten und Unteroffiziere des 26., 27. und 29. Infanterieregiments gegenüber. Diese Zusammenstellung verheißt nichts Gutes: Du stehst in diesem Raum nicht als Major der badischen Armee, die ihr Land gegen den äußeren Feind verteidigt hat, sondern als Verräter, als ehrloser, preußischer Landwehrunteroffizier. Es überrascht dich nicht. Du straffst deine Schultern. Schon beim ersten Verhör bestreitest du die Zuständigkeit des Gerichts, forderst deine sofortige Entlassung. Vergeblich. Das Legalitätsprinzip ist ein unsteter Geselle, besonders in revolutionären Zeiten. Es hat zu deinem Unglück wieder einmal die Pole gewechselt. Josef Klotz wird vorgeladen und als Zeuge unter Eid vernommen. Er bestätigt seine Aussagen.
Zeitzeugen erzählen, du seist in den Verhören bescheiden aufgetreten, aber auch stolz und mannhaft. Du lehnst die Hinzuziehung eines Verteidigers ab, weniger wegen deines eigenen juristischen Sachverstandes, aber es ist dir klar, was dir blüht. Hier wird kein fairer Rechtsstreit ausgetragen, sondern ein politischer Krieg, dessen Ausgang beschlossene Sache ist: preußische Siegerjustiz. So einfach willst du es ihnen nicht machen. Nicht nur moralisch, nicht nur politisch, auch juristisch fühlst du dich im Recht. Du bleibst bei deinen Aussagen und bei dir selbst.
Ja, sagt Max, und ich habe sie wissen lassen, dass es mir leidtut, dass ich nicht mehr Kämpfer für die Monarchie vernichtet habe.
Du leugnest nichts. Aber du verweist auf deine Vollmachten als badischer Offizier und auf deine geltenden Aufträge, letztlich erteilt durch das deutsche Nationalparlament und die Frankfurter Reichsverfassung als den rechtlich höchsten Instanzen auf Bundesebene. Dass demnach Bundesrecht vor Landesrecht gelten muss, auch vor preußischem, und entsprechend auch die Loyalitäten der von dir geschworenen Eide ihrem Rang entsprechend. Und haben nicht selbst die beiden preußischen Kammern für die Annahme der Frankfurter Reichsverfassung gestimmt? Mit welchem Recht hat der konterrevolutionäre Preußenkönig sie daraufhin weggejagt und sich darüber hinweggesetzt? Nicht du, sondern das alte Preußen-Regime gehört auf die Anklagebank. Von Rechts wegen.
Tags zuvor hast du deinen Eltern geschrieben, obwohl sie alles schon in den Zeitungen gelesen haben mussten. Du hast ganz den tapferen Helden gegeben, keine Spur von Selbstmitleid, du als Kind hast deinen Eltern Trost gespendet und deiner Potsdamer Lieben gedacht.
Freilich, jede Überlebenshoffnung aufgegeben hast du in diesem Moment noch nicht. Oder? Sonst hättest du an einer Stelle den Tod nicht in den Konjunktiv gesetzt. Darf ich daraus ein paar Zeilen lesen, Max?
Bitte, gern.
„Liebe Eltern! … Morgen oder übermorgen werde ich vor ein Kriegsgericht gestellt. …
Ich bin auf das Todesurtheil gefasst. Wer den Muth hat, eine Überzeugung zu bekennen und für dieselbe zu kämpfen, muss auch den Muth haben, für dieselbe zu sterben.
Ich werde gut sterben.
Nur ein Gedanke hat mich bisweilen bewegt gemacht. Was fangt Ihr, meine armen verwaisten Eltern nachher an, die Ihr nur das einzige Kind habt!
Doch ich weiß: auch Ihr werdet Euch fassen.
Ihr theilt meine Ansichten und Ihr könnt Euch dann sagen: Der Max ist für eine gute Sache gestorben
Nochmals lebt wohl, theurer Vater und theure Mutter, falls es mit mir vorbei sein sollte. Wenn ich nur Hoffnung für die Zukunft hätte. Aber mein armes, unglückliches Vaterland!
Verwundet bin ich nicht worden, obwohl ich bei Rastatt im dichten Kugelregen stand, und der letzte von meinem Bataillon auf dem Kampfplatz war. Es war gerade mein Geburtstag, der 29. Juni.
Euer gehorsamer und treuer Sohn Max Dortu“
Es ist ein Scheinprozess gewesen, von Anfang an. Am Ende der Verhandlung hat das Kriegsgericht klassenweise beraten und dich gemäß § 88 des Militärstrafgesetzbuchs für das Preußische Heer sämtlicher Anklagepunkte für schuldig befunden. Zur Strafe hat es hat dich degradiert. Seither bist du nicht einmal mehr preußischer Landwehrunteroffizier. Eine schlimme Strafe. Ach ja, und zum Tode verurteilt hat es dich auch.
Doch bis zur Hinrichtung dauert es noch. Zwanzig Tage bleiben.
Lärm an deiner Zellentür. Sie öffnet sich, die Wachen schieben eine Gestalt herein. Als du sie erkennst, flutet sie dein Herz. Einer der Männer baut sich hinter ihr auf, aber dein Vater weist ihm mit dem Kopf die Tür. Die Riegel knarren. Sie lassen euch tatsächlich allein.
Für einen Augenblick steht er einfach da.
Max richtet sich auf, nimmt seinen Mannesmut mit und sein Kindesgemüt, so wie sie ihm geblieben sind, geht auf den Vater zu, umarmt ihn. Er presst den Vaterleib fest an sich, spürt Schwere und Last, gibt ihn frei, aber nur ein wenig, drückt ihn vorsichtig, reibt ihm die Schultern, streichelt den Rücken. Ihr Halt aneinander findet kein Ende, als wäre es das letzte Mal. Dann ist es gut, sie können sich lassen.
Bist du stolz auf deinen Sohn, fragt Max und weicht zurück, um seinen Vater anzusehen.
Ja, das bin ich. Ganz gewiss.
Dann bist du nicht gekommen, um mir ein Gnadengesuch an deinen König abzunötigen?
Max tritt so dicht zu seinem Vater, dass sich die Gesichter fast berühren. Du weißt, ich werde nicht um mein Leben betteln, niemals.
Zwei Schritte zurück. Max blickt auf den Boden und dann seinem Vater trotzig in die Augen. Ich kann mich nicht beugen. Niemand wird mich umstimmen, nicht einmal du. Ja, es ist traurig, dass es so gekommen ist. Aber ein Trauerspiel wäre es, vor denen einzuknicken, die Schindluder treiben mit uns allen und mit dem Schicksal des Volkes ohnehin. Ich weiß, du wirst es nicht verlangen.
Nein, das werde ich nicht, antwortet sein Vater mit fester Stimme. Ich will nicht einmal den Versuch unternehmen. Er legt Max seine Hand auf die Schulter. Um dein Leben zu bitten ist nicht an dir. Es ist an uns, an deinen Eltern. Vaterliebe geht vor Vaterlandsliebe und Mutterliebe geht über alles. Du weißt, ich kenne den Kronprinzen aus den Tagen der Choleraepidemie. Auch damals ging es um Leben und Tod und wir standen in der Stadt zusammen. Also bin ich gleich nach deinem Brief hergekommen, um den Kronprinzen um deine Freilassung zu bitten, der alten Zeiten wegen.
Was, du warst bei ihm? Du hast womöglich einen Kotau vor ihm gemacht? Meinetwegen?
Ja, Max, das hätte ich, die Knie hinunter bis zum Boden.
Die Stimme stockt. Ich hätte es getan. Aber ich habe es nicht. Sie haben mich nicht einmal zu ihm vorgelassen.
Niedergeschlagen sackt sein Vater auf dem Hocker zusammen. Ein hartes Schweigen kommt auf.
Max verscheucht es, nimmt des Vaters Kopf in seine Hände.
Verzeih, sagt er. Ich habe es nicht so gemeint. Nichts tut mir leid, nur der Schmerz, den ich euch zufüge, Mutter und dir. Ihr habt mir so in mein Leben geholfen, wie es wenig anderen vergönnt ist, weil ich meinen eigenen Weg suchen durfte und schließlich gefunden habe. Und wenn es nun so kommen soll, dass ich sterben muss, dann ist mein Tod ein letztes Opfer, das ich euch abverlange. Nur dank euch konnte ich mutig tun, was zu tun war, und kann es noch. Es ist, wie ich euch geschrieben habe.
Während Max redet, als müsse er Abschiedsworte am eigenen Grab finden, löst sich sein Vater sanft, rafft sich, strafft sich, steht wieder gerade, so wie ihn sein Sohn kennt.
Ach Max, was für ein Mann bist du geworden und bist doch unser Kind, von deinem ersten Atemzug bis zu meinem letzten.
Er streichelt dem Sohn über den Kopf. Sie haben uns nur diese zehn Minuten gegeben. Deshalb in aller Kürze: Auch wenn es dir nicht behagt, deine Mutter und ich werden in Berlin und Potsdam alle Hebel in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass sie dich töten. Es ist blankes Unrecht, was hier geschieht. Dass hier wenigstens Gnade vor Unrecht geht, das ist vielleicht zu schaffen.
Noch einmal umarmen sie sich.
Jetzt, Max, ist es tatsächlich das letzte Mal.
Schon am nächsten Morgen um 4 Uhr wird dein Vater des Landes verwiesen. Auf die Idee, später von empfänglichen preußischen Landwehrleuten unverblümt geäußert, dass der wohlhabende Ludwig Dortu aus Potsdam die Befreiung seines einzigen Sohnes inkognito und mit ein wenig monetärer Nachhilfe bei einer Bewachungsmannschaft aus armen badischen Schluckern sehr leicht hätte erreichen können, kommt der Vater nicht: So redlich, ehrlich und anständig, wie er nun mal ist, wie sein Sohn selbst.
Wie geht es dir, Max, nachdem die Zellentür wieder ins Schloss gefallen ist? Fühlst du dich besser? Hast du dir genügt? Diese Dankesrede an deine Eltern?
Dieses Nein zu einem Gnadengesuch? Hast du dem Vater gezeigt, wie weit du über den preußischen Untertanengeist hinaus bist, selbst über den seinen? Willst du den Helden geben bis zum bitteren Ende? Oder hat er dich berührt in seinem nackten Schmerz? In seiner Vaterliebe?
Hutten, wie fragst und redest du, so distanziert. Du musst mir nah sein, wenn ich dir näher kommen soll. Sonst kann das hier nichts werden mit uns.
Ich habe mich elend gefühlt nach seinem Besuch, todtraurig und elend. Es roch noch nach ihm, nach Buttermilch. Spuren wehten noch durch die Zelle. Als er weg war, so plötzlich wieder weg, wie er kam, habe ich nur bodenlose Leere gefühlt, so als wäre mein Inneres mit ihm fortgegangen. Ich war plötzlich hilflos, als sei ich noch ein Kind und als müsste er gleich wiederkommen und mich mitnehmen.
Das wird er nicht, wie du weißt. Aber in unserer Geschichte können wir es, wir können einfach bei ihm bleiben, mit ihm weggehen aus dieser Todeszelle.
Hutten rückt dicht an Max heran. Was meinst du? Kehren wir zusammen mit deinem Vater zurück nach Potsdam, in deine Heimat? Zwanzig Jahre zurück in euer Haus in der Waisenstraße 29, in die Zeit, als du wirklich noch ein Kind bist?
Mit Röslein bedeckt
Erinnerst du dich, wie stolz dein Vater dich herumträgt, wenn er mit seiner Frau durch die Straßen spaziert, so als wolle er seinen kleinen Steppke aller Welt vorführen. Dann lässt er den Zylinder zuhause und schwingt stattdessen dich hoch über den Kopf auf seine Schultern. Und so geht Ihr hinaus auf den Bürgersteig. Die Leute schauen verwundert. Üblich ist es nicht, dass ein Potsdamer Vater mit seinem Kleinen auf der Schulter öffentlich umhergeht, von euch aus direkt über die Eiserne Brücke hinüber auf die andere Seite des Stadtkanals bis zu diesem prächtigen Gebäude, wie heißt es gleich?
Meinst du das Zivilkasino in der Waisenstraße?
Nein, schräg gegenüber von euch, direkt Am Kanal, Ihr könnt von eurem Haus aus hinübersehen, das mit den Säulen und der prächtigen Fassade.
Ach, du meinst das Brockessche Haus, ja, natürlich erinnere ich mich, es kam mir als Kind immer so riesig vor und ich dachte, als ich noch sehr klein war, das wäre das Schloss und hier wohnt der König, aber es war nur die Preußische Oberrechnungskammer. Als ich das herausfand, war ich sehr enttäuscht.
Aber was für ein herrliches Gefühl, wenn mich mein Vater hochgehoben hat, nicht nur huckepack, sondern ganz hoch auf seine Schultern. Ich hielt mich fest, umklammerte seine Stirn und er nahm eines meiner Händchen, küsste es und legte es vorsichtig zurück an seinen Platz. Dann zupfte er seinen Gehrock zurecht. Niemand sollte denken, Ludwig Wilhelm Dortu sei kein ordentlicher Potsdamer Bürger. Wenn ich mich vornüberbeugte, wehte mich aus seinem Haarschopf etwas Wohliges an. Es ließ mich fühlen, bei ihm zu sein, in Sicherheit, obwohl alles schwankte hoch da oben. Dass es der Duft von Buttermilch war, wusste ich noch nicht.
Ich habe noch die Geräusche im Ohr, die von unten bis zu meinem Thron hinaufdrangen: das zackige Klacken der Stiefel und gackernde Klicken der Schuhe auf dem Pflasterstein, das Rattern und Ächzen der Kutschen, das Schnauben der Pferde und Getrappel ihrer Hufe, die Kommandos der Militärs. Von meinem Sitz dort oben sah ich manchmal tatsächlich, was der gute Heine beschrieben hat, als er zu dieser Zeit mal in Potsdam war: nichts als Himmel und Soldaten.
Hast du so die Stadt erobert, auf den Schultern deines Vaters?
Ja, tatsächlich. Auf seinen Schultern, nicht nur in dieser, in vielerlei Hinsicht.
Ihr habt im Haus Nr. 29 in der Waisenstraße gewohnt. Dein Vater hat es ein Jahr vor deiner Geburt gekauft und später, du bist schon dreizehn, auch noch das Nachbarhaus Nr. 30. Eine großartige Straße, die Waisenstraße, diagonal durch die ganze Stadt und quer durch das Potsdamer Stadtvolk. Alle Welt will hier wohnen, Offiziere der Garnison und Beamte aus Hofstaat, Verwaltung und Justiz, die Stadthebamme Becker, der Superintendent und Prediger Derège, der Stiefelwichsfabrikant Hoffmann. Dann die vielen Handwerker, die zum Wohlergehen höfischen, militärischen und städtischen Lebens in der Waisenstraße ihren Beitrag leisten: Schuhmacher, Schneider, Tischler, Seiler, Nagelschmiede, Schiffer, Strumpfwirker, Büchsenmacher, ein Gipsfigurenfabrikant, Kaufleute, Wirte, Barbiere, Uhrmacher, Königliche Bereiter. Und schließlich Leute, die für ihr Wohlergehen gar nichts tun müssen: Rentiers, Particuliers, Privatiers, vermögend genug, um von ihren diversen Einkünften zu leben, so wie dein väterlicher Großvater in Berlin.
Stimmt es, dein Vater und du, Ihr habt daraus ein Spiel ausgeheckt, so etwas wie ein heiteres Berufe-Raten: Immer, wenn du in eurer Straße einen neuen Beruf findest, gibt es einen Entdeckerpunkt und am Ende zur Belohnung eine Einkehr bei Konditor Schlüpke?
Ja, das stimmt. Aber das war etliche Jahre später. Ich musste dafür nur auf die Fenster achten oder die Inschriften an den Hauswänden oder die Türschilder. Für schnelle Punkte fing ich natürlich im Nachbarhaus Nr. 30 an, da wohnten die Rentiers Schäfer und Tiedeke, zwei ziemlich beleibte, ältere Herren, selten zuhause, der Justizrat Sternhausen, quasi ein Kollege meines Vaters, und der stets hüstelnde Kanzlei-Secretär Uting. Ein Haus weiter, in Nr. 31 die Lehrerinnen Weber, Wendell, Krämer und Schneider, allesamt alleinstehend und strengen Blickes, alle unbeliebt, eines dieser Fräulein unterrichtete an meiner Schule. Auf der anderen Seite in Nr. 28 Carl von Treskow, ein strammer Offizier im Eliteregiment des Gardes du Corps, und in den nächsten Häusern Leutnant a.D. von Bredow, Buchbinder Pauli und der Superintendent. Es dauerte nicht lang, bis ich bei Schlüpke meine erste Schokolade bekam.
Besonders kirchlich ging es dagegen nicht zu bei uns zuhause. Aber sonntagsvormittags doch zum Gottesdienst. Nicht um die Ecke in die großmächtige Garnisonkirche. Wir mussten einen langen Weg hinunter zum Bassin, wo unsere Französische Kirche wie ein römischer Tempel zwischen das Holländische und Französische Viertel hineinplatziert war. Da saßen wir unter der Kuppel im Kreis, und es passierte manchmal mitten im Gebet, dass von oben ein Stück Putz oder ein paar Steinbrocken herunterkamen, bis Schinkel, des Königs Architekt, da war ich um die sechs, sie gründlich renovierte.
Wir Dortu waren Hugenotten und meine Eltern stolz darauf, stolz auf die Treue zu unseren Überzeugungen, denen zuliebe die Vorfahren ihre Heimat hatten verlassen müssen. Und mindestens so stolz darauf, in der neuen Heimat angekommen, jetzt Deutsch zu sein, treudeutsch und vaterländisch, gerade den französischen Besatzern zu Napoleons Zeiten gegenüber. Die Dortü wurden nun Dortu ausgesprochen. Viele unserer Namen wurden eingedeutscht. Da waren wir ein bisschen wie manche Juden. Preußischer als viele Preußen, deutscher als manche Deutschen.
Sonntagnachmittags ging es zum Hauptpostamt, ist ja auch ein mächtiger Bau, aber ich wusste schon als Kind, dass da nicht der König wohnt, sondern Opa und Oma Schlinke, die Eltern meiner Mutter. Opa war der Postmeister und hatte hier das Sagen, bis zum Ruhestand. Hier war immer etwas los, sogar sonntags. Postreiter preschten heran, es kamen Postkutschen an mit allerhand Paketen, Säcken und Reisenden. Oma Schlinke verwöhnte uns mit Kakao und Kuchen. Sie war Hugenottin wie wir und darauf ebenso stolz. In ihrem Wohnzimmer blickte ein Orden behängter Mann von der Wand herunter, eigentlich glotzte er mich ziemlich unverblümt an: ein unverstellter Blick unter hell gelockter Perücke, volle Lippen, barocke Figur, alles in allem eine imposante Erscheinung, zu der ich dauernd hinsehen musste. In das Messingschild auf dem prächtigen Goldrahmen war sein Namen eingraviert, Karl Theophil Guichard.
Das ist einer von uns, erzählte Oma Schlinke voller Familiensinn und davon, dass kein Geringerer als der Alte Fritz diesen Mann nach Potsdam holte, weil er ihn als General ebenso schätzte wie als gelehrten Gesprächspartner, ein Militär, ein Theologe und ein Philologe. Das alles passt gut zusammen hier in dieser Stadt, sagte sie, und dass der Alte Fritz ihn schließlich als Quintus Icilius in den Adelsstand erhob. Und dann musste ich auch noch das Regal mit den wunderbaren Fayencen bewundern, die dort zur Schau aufgestellt waren wie die Zinnsoldaten von Opa: Siehst du die feinen Farben, das Laubgrün und das Violett, sagte Oma und ihre Augen funkelten. Daran kannst du erkennen, dass sie von uns kommen, aus unserer Magdeburger Fabrik.
Sie war schon etwas Besonderes, meine Familie. Wenn Opa und Oma Schlinke mir beim Abschied den Kopf tätschelten und mich ermahnten, gut auf mich aufzupassen, dann konnte ich spüren, dass ich dazugehörte zu diesem Besonderen. Dazu gehörten nicht weit weg auch mein Lieblingsonkel Louis mit Frau und drei Cousins in meinem Alter. Wenn wir zu ihnen gingen, war es mir ein Fest. Wir Kinder durften durch das Haus tollen. Am liebsten spielten wir Revolution. Von der erzählte uns Onkel Louis immer wieder gern. Davon, dass es mal einen König gab in Frankreich, den die Bürger nicht mehr haben wollten, weil er sie immer drangsalierte, dass sie deshalb das Gefängnis in Paris gestürmt und alle Gefangenen freigelassen haben, dass sie den König selbst mitsamt der Königin gefangen nahmen und später köpften, zuerst den König und dann die Königin.
Herrlich, eine wunderbare Idee. Die Schlinke-Kinder hatten eine Gouvernante, deren Tochter zu ihrem Unglück Regina hieß. Sie musste die Königin spielen, Richard, der Kleinste, den König. Meine älteren Cousins Emil, Oskar und ich, wir waren die aufständischen Bürger, rannten hinter den beiden her und riefen: Kopf ab! Kopf ab! Bis Regina irgendwann anfing zu heulen und der kleine Richard auch. Dann war das Spiel aus. Oft kamen die Schlinke-Kinder auch zu uns und wir spielten dieses Spiel bei uns oder versteckten uns hinterm Haus in unserem großen Garten zwischen den Stallungen, den Geräteschuppen, den Büschen und den Apfelbäumen, die mein Vater für mich gepflanzt hatte. Da uns dann die Königin fehlte, kam sie ungeschoren davon und nur der König musste dran glauben.
Klingt nach unbeschwerter Kindheit.
War sie auch, aber nur fast. Es hieß nicht umsonst dauernd, ich solle auf mich aufpassen. Sie waren alle so besorgt um mich, nicht nur meine Großeltern, weil ich als Kind einfach schwach auf der Brust war. Kaum war ich morgens wach, hatte ich schon dieses Gefühl, als säße mir ein Troll auf der Brust. Viel später in den Revolutionstagen, als ich in Potsdam und Berlin vor erwartungsvollen Menschenmengen stand und sie meine Kraft spüren ließ, hat niemand mehr geglaubt, dass dieser starke junge Mann mal so ein kränkliches, fast schwindsüchtiges Kind gewesen ist. Aber so war es. Quälend. Was für eine Husterei und Keucherei, jahrelang, Atemnot, Husten, Fieber. Dauernd hockte meine Mutter mit mir im Sprechzimmer von Doktor Schwenke. Bis heute weiß ich nicht, was eigentlich mit mir los war. Der medizinische Fortschritt hielt sich noch in Grenzen und eine wissenschaftliche Koryphäe wie unser Rudolf Virchow, der später mit uns auf die Barrikaden ging, war damals selbst noch ein Pennäler.
Eines Tages, als sich meine Mutter gar nicht mehr zu helfen wusste, packte sie ein paar Kolonialwaren in ein Tuch und ging mit mir zu einer armen Bauersfrau hinaus, vor die Stadt, zu einem abgelegenen Gehöft. Von ihr hieß es, sie könne Krankheiten samt ihren Ursachen mit ihrer bloßen Nase riechen. Kaum waren wir dort, packte mich die Alte recht grob am Arm, zog mich weg von Mutter, hinaus ins Freie. Vor dem Haus drückte sie mich auf eine Bank. Nie vergesse ich, wie sie sich über mich beugte, ganz nah an mein Gesicht, an mir herumschnupperte, bis zu den Füßen hinunter, und mir fast schlecht wurde von ihrem Gestank. Dann schaute sie meine Mutter an und schüttelte bloß den Kopf. Wer weiß, was das zu bedeuten hatte. Das Tuch mit den Sachen durfte sie trotzdem behalten.
Dieses dauernde Gekränkel machte mich blass und schmächtig und ich durfte nicht mit den anderen zur Einschulung, sondern musste zum Privatunterricht bei Professor Kühling. Andere hätten mich dafür beneidet. So ein Privileg, privatissime bei Professor Kühling. Mir war es gar nicht recht und ich zog eine Schnute. Aber es war dann wirklich nicht so übel, weil Kühling den kleinen schwächlichen, aber hellen Knaben in sein Herz schloss, ihm geradezu fürsorglich das Lesen, Schreiben und Rechnen beibrachte und ihn in keiner Weise traktierte. Viel schlimmer war, dass ich nicht so oft raus durfte ins Freie. Ich war blass und schmächtig, aber ein Stubenhocker war ich nicht.
So blieb ich häufiger allein als mir lieb war, träumte irgendwo vor mich hin, stromerte durch unser Haus, die beiden großen, mächtigen Treppenhäuser hinauf und hinunter, hoch zu Tante Homicht, sie wohnte oben in einer Dachstube, offiziell war sie meine Gouvernante, tatsächlich gehörte sie zur Familie, ich ließ mich von ihr am Hinterkopf kraulen und mit Selbstgebackenem füttern. Oder ich verdrückte mich durch die Tore hinten hinaus auf den Hof mit den Schuppen, den Ställen und dem Garten, in dem im Frühjahr die Blüten der Apfelbäume rötlichrosaweiß leuchteten, malte mir aus, das wäre mein Königreich, die Büsche meine Untertanen, hinter den Hecken lauerten meine Feinde, die Bäume wären meine Ritter und die Blumen meine Bauern.
Am allerliebsten bin ich heimlich in mein Paradies geschlüpft, unseren Salon, den Gartensaal im Erdgeschoss, habe die Tür leise hinter mir verschlossen, damit mich niemand bemerkt und niemand stört, und mich auf das Parkett gelegt, auf den Rücken, ganz flach, sodass ich mich selbst von hinten spüren konnte, mit dem Hals, dem Rücken, dem Po, den lang gestreckten Beinen auf dem mal kühlen, mal warmen, blank polierten Holz. Dann schloss ich die Augen, um dieses Gefühl ganz auszukosten. Wenn ich sie wieder öffnete, sah ich über mir an der Decke das zarte Rosa des Himmels und die Schönheit der Welt, weiße Girlanden in eleganten Schwingungen, in der Mitte, über dem Kronleuchter im Kreis vereint und gehalten wie Schmetterlinge, an den Wänden hohe Felder, gefasst und ausgerichtet von weißen Hirtenstäben. Und aus alle dem wuchsen mir rote Rosen aus grünen Zweigen entgegen, kamen mir näher, als wollten sie mich zu sich in die Höhe ziehen.
Ich wehrte mich nicht, spürte keine Dornen, nur diesen Moment köstlicher, himmlischer Freiheit. Mehr als einmal lag ich so, wie eingefangen, und vergaß die Zeit. Wer dann etwas wollte von mir, weil irgendetwas war, für das die Zeit nicht mehr angehalten werden konnte, musste mich suchen.
Martin und die Liebe zum Freien
Martin fand mich immer. Er war mein erster und immer mein bester Freund, schon seit den Zeiten, als ich mit meinem Vater in unserer Straße das Berufe-Raten angefangen hatte. Martin war der Neffe des Schuhmachers Becker ein paar Häuser weiter. Der Onkel hatte ihn aus Mildtätigkeit bei sich aufgenommen. Seine Eltern waren in den Befreiungskriegen gegen die Franzosen umgekommen, als er noch ein Säugling war, der Vater als Soldat gefallen, die Mutter an Schwindsucht nach der Geburt gestorben. Und im Militärwaisenhaus gab es keinen Platz für ihn. So erbarmte sich der Onkel seiner, dem selbst keine Frau und keine Kinder vergönnt waren, der aber für sein Handwerk in der ganzen Stadt gefragt und anerkannt war. Als Martin ein wenig größer war, half er seinem Onkel in der Werkstatt aus und schaute ihm über die Schulter. Auch wir ließen unsere Schuhe dort machen oder reparieren und oft durfte ich mit, wenn es etwas hinzubringen oder abzuholen gab.
Dann nahm ich mir einen Schemel und setzte mich zu Martin, stupste ihn in die Seite und er klopfte mir auf die Schulter, Freunde eben. Schuhmacher Becker thronte auf einem abgesetzten Podest, seine blaue Schürze umgebunden, vor sich ein eisernes Dreibein, ein Amboss, den er nach Belieben aufstellen und einrichten konnte, um Schuhwerk darüber zu ziehen und zu bearbeiten, neben sich ein massiver Werktisch, darauf ein Wirrwarr aus Flicken, Büchsen und Schachteln, mit Ösen und Klammern und Nägeln, Hanfzeug, Fäden und Holzstiften, aus dem er blind herausfischte, was er benötigte. Entlang der Wand größere Lederlappen und die Regale mit hölzernen Leisten aller Größe und Form, darunter griffbereit seine Hämmer, die Scheren, Ahlen, Feilen, Zangen, Punziereisen und Spanner. Um ihn herum ein Sammelsurium von Schuhzeug aller Art, von groben Stiefeln bis zu feinen Damensandaletten. Auf einem kleinen Tisch an der Seite standen säuberlich die fertigen Sachen abholbereit in Reih und Glied. Im ganzen Raum hingen Gerüche und Düfte, nach frischem Leder, Kleber, Stiefelschweiß, Schuhwichse und Spuren von Parfüm.
Jedes Mal, wenn es knallte, weil Martins Onkel auf den Amboss schlug und ihn etwas tun hieß, fuhr Martin kurz zusammen und das Zucken in seinem linken Mundwinkel, das sonst kaum bemerkbar war, auch wenn er es nie ganz unterdrücken konnte, schlug für einen Augenblick heftig aus. Dann ging er ihm schnell zur Hand. Wenn wir dem Onkel zuschauten, wie er sein Handwerk verstand, wusste, was er und wie er es zu tun hatte, ruhig, aber ohne Zaudern, geschickt, sorgfältig, zügig, imponierte uns das mächtig, jedenfalls für eine Weile. Aber lieber noch schlichen wir uns leise hinaus und trollten uns auf die Straße. Dann zuckten Martins Mundwinkel kaum noch und wir rannten einfach herum, spielten Fangen oder Verstecken oder stromerten umeinander.
Oft schnitzten wir uns Angelruten aus den Weiden am Havelufer, knüpften Schnüre daran und banden deren Enden um ausgebuddelte Regenwürmer. Wir setzten uns hin, schauten den Fischreihern und Kormoranen zu, die geduldig auf Pfählen, tiefen Ästen oder in den See gestürzten Bäumen saßen, ins Wasser starrten und auf ihre Beute warteten. Wir schwenkten unser Würmer hin und her im fließenden See. Aber wenn nichts biss, nie biss etwas, verloren wir die Geduld und versuchten unser Glück schräg gegenüber von unserem Haus im Stadtkanal. Das war selten eine bessere Idee. Oft glich der Kanal eher einer trüben Kloake als einem Havelwasserfließ und der Brühe entstieg ein strenger Geruch, der uns bald vertrieb.
Dann gingen wir zu mir. Martin war ganz anders als meine Cousins, die Schlinke-Kinder. Die waren irgendwie wie ich und zugleich hatten sie sich untereinander, weil sie immer zu dritt waren. Mit Martin konnte ich nicht so einfach durch Haus und Garten fegen und Revolution spielen. Dazu war er viel zu schüchtern. Wenn ich Martin zu uns mitnahm, war es fast so, als wolle er sich hinter mir verstecken. Ich stellte ihm unser Personal vor, bis hin zu Tante Homicht oben in der Mansarde. Und ich zeigte ihm das ganze Haus mit unseren Wohnräumen, der Privatbibliothek, den Schlaf- und Gästezimmern, den Wirtschafts- und Arbeitsbereichen. Aber Martin fühlte sich nicht wohl, trippelte herum und bewegte sich, als ginge er auf Eierschalen.