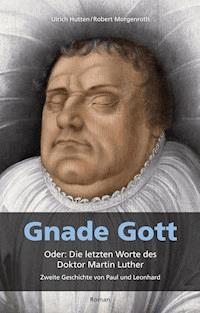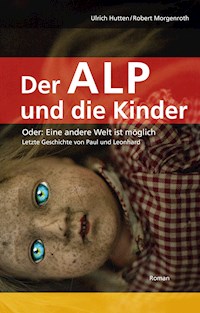Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Es macht Freude, seiner eigenen Beerdigung zuzuschauen. Wann sonst hört man soviel Gutes über sich selbst. Charles Dupont, Magnat der Lebensmittelindustrie und Pate ihrer Schattenwelt, gönnt sich dieses Vergnügen in der Kirche von Carnac. Dass er bald wirklich sterben muss, ahnt er noch nicht... Man kann diese Lektüre einfach genießen wie feine Lesekost, raffiniert komponiert, ein achtgängiges Menü voll feinster Zutaten, liebevoll abgeschmeckt. Aufgetischt werden allerdings äußerst unappetitliche Machenschaften, angerichtet von Todbringern aller Art. Eine Speisenfolge, die den beiden Journalisten-Freunden Leonhard und Paul übel aufstößt. Wer anders liest, stößt auf anderes. Zum Beispiel auf den grünen Karl Marx, das Böse im Guten, Charlie Hebdo, die Fiktion des Faktischen und auf Europa. Ein Europa, das etwas ganz anderes meint als eine Geldmaschine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Hutten, Robert Morgenroth
Die letzte Dorade von Saint Philibert oder: Leben und Sterben um jeden Preis
Pauls und Leonhards erste Geschichte
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die letzte Dorade von Saint Philibert Oder: Leben und Sterben um jeden Preis
Intro
Erstes Kapitel: Zwei Leichen, eine Beerdigung und ein toter Hund
Zweites Kapitel: Zwei Freunde und ein Besäufnis
Drittes Kapitel: Vom Stoffwechsel einer Qualle
Viertes Kapitel: Die Weltretter und der böse Fluch der guten Tat
Fünftes Kapitel: Alberts diskretes Leben. Oder: Wie sich sogar ein Jurist nützlich machen kann
Kapitel sechs: Ideen für einen Krimi, der vielleicht nie geschrieben wird
Kapitel sieben: Eine echt unterschätzte Frau, ein falscher Strohmann und ein Todbringer aus Deutschland
Kapitel acht: Die letzte Dorade
Impressum neobooks
Die letzte Dorade von Saint Philibert Oder: Leben und Sterben um jeden Preis
Ulrich Hutten/Robert Morgenroth
Pauls und Leonhards erste Geschichte
Vieles stimmt vielleicht in dieser Geschichte, manches sogar ganz bestimmt. Das meiste ist natürlich erfunden. Aber alles ist wahr. Dass jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen purer Zufall sein muss, versteht sich von selbst.
Wir haben die Freiheit sehr genossen, Phantasie und Realität, Fakten und Fiktion wild miteinander zu vermengen. Das könnten Journalisten wie Leonhard Ross und Paul Wiesensee nicht tun.
Robert Morgenroth und Ulrich Hutten
Intro
„Der Fisch stinkt immer vom Kopf“, beharrt Leonhard Ross am Telefon, „die Frage ist nur, wer oder wo ist der Kopf?“. Den seinigen schüttelt Paul Wiesensee, sein Freund, am anderen Ende der Leitung: „Schwer zu sagen, wenn es um eine Qualle geht. Aber sind Quallen überhaupt Fische?“
Erstes Kapitel: Zwei Leichen, eine Beerdigung und ein toter Hund
Die elegante Yacht lag still im Wasser wie eingeschlafener Wind. Nachtschwärze dunkelte vor sich hin und leise schimmerte die See. Auf dem Oberdeck glimmte eine Zigarette. Hüsteln verriet Wachsamkeit. Es ging auf Mitternacht zu im Golf von Mexiko. Im luxuriösen Komfort der Schlafsuite schob sich Tico ein Kissen unter den Kopf und versuchte sich ein wenig zu entspannen. Aber es war nicht nach seinem Geschmack.
„Chingada“, zischte er das Mädchen an, das sich zwischen seinen Beinen eifrig an ihm mühte. Er griff ihr hart ins Haar und zog sie brutal mit sich hoch, während er sich aufrichtete, um besser telefonieren zu können, ohne seine Beretta M9 aus dem Auge zu verlieren.
Für Tico Salvatore Ramon Flores war es normalerweise kein Problem, Verschiedenes gleichzeitig zu erledigen. Immerhin hatte er gerade auf mehr als elegante Weise Joaquín Guzmán aus dem Weg geräumt, den sie wegen seiner Körperkürze von nur anderthalb Metern „El Chapo“ nannten, den Kurzen. Der sich für unantastbar gehalten hatte. Bis dahin der mächtigste Drogenbaron der Welt, Rang 701 in der Forbes-Liste der Reichsten, mehr als eine Milliarde geschätztes Vermögen. Der Mann, der als Boss das mächtigste Sinola-Kartell und halb Mexiko regiert hatte wie ein Sonnenkönig, mit Geschäftsbeziehungen rund um den Globus. Der Mann, um den sich Mythen und Legenden rankten wie die von seinem vergoldeten Sturmgewehr, Typ AK-47, das selbst auf der Toilettenschüssel neben ihm stand. Oder die wilden Spekulationen um seine Flucht aus dem Gefängnis, vielleicht in einem Karren versteckt unter verpisster Schmutzwäsche, vielleicht aufrechten Ganges als Polizist verkleidet, vielleicht aber auch, weil er sich mit 20 Millionen Dollar beim Präsidenten der Republik einfach freigekauft hatte.
Angeblich wusste in ganz Mexico jede und jeder, in welchem der teuren Restaurants er gerade seiner Vorliebe für Schildkrötenfleisch frönte, nur die Polizei war nicht im Bilde. Und dennoch hatte diese ahnungslose Polizei „El Chapo“, den Kurzen, im Morgengrauen aus seinem Hotelbett geholt. Zusammen mit ein paar Kumpanen, ohne Schusswechsel, ohne Schwierigkeiten. Ausgerechnet ihr spektakulärster Coup gelang der mexikanischen Polizei ganz unspektakulär. Dieses Mal war sie offensichtlich bestens informiert. Allerbestens.
Eigenartigerweise war Tico, immerhin des Kurzen längster und engster Vertrauter, dem Zugriff entgangen. Man musste nicht lange spekulieren, warum.
Nun war er die Nummer Eins. Und die Geschäfte gingen weiter, als wäre es nie anders gewesen. Ihn nannte niemand einen Kurzen. Er war „El Austin“, der Angstmacher.
„Er lebt also noch? Du hast Scheiße gebaut, Nikolas Plage, beschissene Scheiße.“ Tico sprach die lauten Worte leise, fast flüsternd in den Hörer, als wolle er die Ohren am anderen Ende dazu zwingen, jede einzelne Silbe seiner Worte zu erlauschen.
„Es interessiert mich nicht, was du mir erzählst von deinen Problemen … Was? Nicht so einfach bei euch da drüben? Europa? Scheiß drauf, scheiß auf Europa. Wenn du immer noch nicht kapiert hast, wie man das regelt, kapierst du es nie. Probleme existieren nicht. Hörst du? Es gibt sie nicht … Unterbrich mich nicht. Hast du je davon gehört, wir hätten ein Problem? Mit einem arroganten Gouverneur oder aufsässigen Staatsanwalt vielleicht, oder mit wild gewordenen Studenten und heulenden Müttern, vielleicht mit einem penetranten Journalisten-Fuzzi oder irgendeinem der vielen kleinhirnigen Großkotze, die denken, sie können uns an den Karren fahren? Hast du das je gehört? Oder haben wir vielleicht ein Problem mit dir? … Nein? Siehst du. Du irrst. Der Typ ist doch schon tot. Und weiß es bloß noch nicht. Aber du weißt es. Cachái? Du hast noch einen gut bei mir, weil du es bist. Ich gebe dir noch diesen Monat. Nimm ihn, als Geschenk. Wenn du dich wieder meldest, höre ich keine Ausreden mehr.“
Tico Salvatore Ramon Flores legte das Telefon zur Seite und seufzte. Vielleicht, weil sich das Mädchen zwischen seinen Beinen inzwischen geschickter anstellte. Vielleicht aber auch, weil er sich nicht sicher war, ob sie mit Nikolas Plage ihre europäischen Geschäfte dem richtigen Mann anvertraut hatten. Immerhin, platziert hatte er ihn bestens. Er würde nicht wagen, dieses Ding noch zu vermasseln.
Tico schloss müde die Augen. Ärgerlich, dieser Rückschlag in Europa, dachte er. Aber Kleinkram. Denn ihm war klar, dass er es über kurz oder lang mit Problemen ganz anderer Dimension zu tun bekommen würde. Hier in Mexiko, vor der eigenen Haustür. Falls es nämlich „El Chapo“, dem Kurzen, je gelingen sollte, ein weiteres Mal aus seinem Hochsicherheitsgefängnis zu spazieren. Dann vielleicht durch einen anderthalb Kilometer langen Tunnel, der auf unerklärliche Weise direkt in seine Zelle gebaggert würde. Vielleicht sogar mit Hilfe alter Seilschaften. In den USA und anderswo. Tico fand keinen Schlaf.
Gleichgültig drehte sich der Globus weiter. Auf seiner dunklen Seite wanderte die Nacht über alle Probleme hinweg, die ungelösten und auch über die, die angeblich nicht existierten, glitt gen Westen, senkte sich bald auf Hawaii und begann, den asiatischen Kontinent zu unterwerfen.
*
Derweil hatte im Osten, an der bretonischen Küste jenseits des Atlantiks, die Vormittagssonne dem neuen Tag schon die Frische gestohlen. Charles Dupont musste sich zusammennehmen, um nicht laut zu schnarren, als er die schwarz gekleidete Gesellschaft in das Kirchlein Saint Cornély in Carnac einlaufen sah. Hinter dem mit orangeroter Amaryllis geschmückten Sarg schritt in festlichem Ornat der asketisch hagere Père Caneloux mit seinem Schlangengesicht. Ihm folgten, etwas linkisch die Weihrauchgefäße schwenkend, vier Messdiener. Der Père verneigte und bekreuzigte sich vor dem Altar. Dann drehte er sich um und besprengte mit einem silbernen Klöppel den Sarg mit Weihwasser, ganz im Gestus tief empfundenen Bedürfnisses, den dahingeschiedenen Charles Dupont persönlich auf dem Weg ins himmlische Paradies zu begleiten.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Cis, E, Gis. Der Atlantikwind fing das melancholische Moll der Totenglöcklein ein und trug ihr Zittern hinaus in die Weiten des Morbihan, wo es ein paar Menschen anwehte für einen Moment. Tod, Leid und Schmerz hatten eigentlich nichts verloren hier in Carnac, hier in den kleinen lebensfrohen Badeorten an der Bucht von Quiberon, der bretonischen Riviera, wo die Menschen es sich gut gehen lassen und Pinien, Villen, Hotels und nordisch atlantischer Strand fast südländisches Flair und mediterrane Lebenslust verströmen. Aber selbst hier wurde gestorben.
In gebührendem Abstand zu den Messdienern bewegte sich, den blassen Teint von einem schwarzen Netzschleier umhüllt, Gisèlle Dupont, die rechtmäßige Ehefrau des Verblichenen. Auch diese Rolle, die Rolle der fassungslosen Witwe, spielte sie bravourös. Aller Augen hefteten sich auf sie und das enge, schwarze Kostüm, das ihre Figur begrenzte. Sicher, sie war ein wenig in die Jahre gekommen, aber immer noch eine ausnehmend schöne Frau. Das würdevolle Leid, das sie ihrem bleichen Antlitz aufgetragen hatte, stand ihr gut. An Gisèlles Seite ein sonnengebräunter Mittvierziger. Zur Verblüffung der einheimischen Trauergemeinde.
Auch Charles Dupont irritierte diese Begleitung. Nun erinnerte er sich vage. „Das ist Nikolas Plage“, hatte sie ihn vor einiger Zeit vorgestellt, beiläufig. Er hatte sich den Namen nicht gemerkt, hatte Wichtigeres zu tun, als ihre zahlreichen Liebhaber im Kopf zu behalten. Aber vielleicht hatte er, dachte er sich, doch so einiges übersehen im Leben seiner Frau, zumal in der Hektik der letzten Wochen?
Dem Paar folgten Carnacs kahlköpfiger Bürgermeister Eugène-Marie le Pont, dann der pockennarbige Vorsitzende des Yachtclubs von Saint Philibert, erst danach die übrigen Clubmitglieder. Auf den hinteren Bänken saßen neugierige Alte, notorische Kirchgänger, die sich kein einziges Begräbnis entgehen ließen, waren sie doch ein fast so ergiebiger Zeitvertreib wie der Besuch öffentlicher Gerichtsverhandlungen. Zeit hätte in ihrer letzten Lebensphase eigentlich ein zu kostbares Gut sein müssen, um sie zu vertreiben. Aber hier war der Tod immerhin live zu erleben und bereitete unterhaltsam auf die eigene Endlichkeit vor.
Auch harmlose Honoratioren und Kleinbürger aus Carnac hatten Platz genommen, die bei einer derart bedeutenden Trauerfeier einfach nicht im Abseits stehen konnten. Man sollte sie hier sehen, obwohl sie in ihrer überwältigenden Mehrzahl Charles Dupont nicht ausstehen konnten, wenn nicht sogar hassten.
Sie alle, die ihn tot wähnten, vergossen nicht eine einzige Träne, auch wenn sie pflichtschuldig ihre betretenen Mienen aufgesetzt hatten. Charles wunderte das nicht. Nur die Eingeweihten schluchzten für besondere Momente oder taten so als ob. Charles hatte sie alle im Blick. Es war genau so, wie er es sich vorgestellt hatte.
Wie gut, dass ich tot bin, sagte sich Charles und beobachtete gebannt das Spektakel. Er betrachtete es als eine Art Festakt, den man für ihn veranstaltete. Gut getarnt, geschminkt und verjüngt mit einem rötlich-grau gefärbten Dreitagebart, einer sanft gekrümmten Gumminase, Sonnenbrille und einem schwarz-grau melierten Toupet verharrte er auf der Empore des neugotischen Kirchleins, nur wenige Meter von der Orgel entfernt, ein unauffälliger Trauergast in gut geschnittenem schwarzem Anzug, um den sich niemand kümmerte. Bei einem Schuhmacher in Nantes hatte er Sohlen und Absätze aufrüsten lassen. Nun würde ihn niemand am leicht hinkenden Gang erkennen. Oder an seinem vermaledeiten Schnarren. So wirkte er fast unscheinbar, so als hätte er seine frühere Präsenz einfach abgestreift. Aus diesem Grund wollte Charles Dupont abwarten, bis sich die Gäste am Ende der Trauerfeier verlaufen hatten. Hätte der Père mit dem Schlangengesicht geahnt, das Dupont so tolldreist sein würde, in Saint Cornély seiner eigenen Beerdigung beizuwohnen, er wäre sicher ins Stottern gekommen. Sogar beim Vaterunser. Das konnte er sonst im Schlaf herunterbeten.
Die Größe der Trauergemeinde war beträchtlich. Nur an Heiligabend war das Kirchlein im Herzen von Carnac besser gefüllt. Einer jedoch, den Charles erwartet hatte, fehlte. Es war Albert, der Ober des „La Mer“ im benachbarten Yachthafenstädtchen Saint Philibert. An dessen Hafenpromenade war Charles Dupont ein gern gesehener, regelmäßiger Stammgast und eines der prominenten Mitglieder des Yachtclubs. Albert war eingeweiht, aber nicht der Einzige, der wusste, dass in diesem Sarg zwar ein Leichnam, aber bestimmt nicht der Duponts seine letzte Ruhe finden sollte.
Père Caneloux verneigte sich jetzt auch mit Worten vor dem Verblichenen und rühmte dessen großzügiges finanzielles Engagement für das Musée de Préhistoire im ehemaligen Priesterseminar und für das Freilichtmuseum in Carnac. Und überhaupt für den Erhalt des megalithischen Erbes des Morbihan. Ein Reichtum an Dolmen und Menhiren wie kaum anderswo. Steinkreise, kilometerlange Reihen, verwittert, flechtenübersät, deren prähistorische Vergangenheit der Fachwelt bis heute Rätsel aufgeben.
Für diese geheimnisumwitterten Riesen aus Granit, drei-, vier-, fünftausend Jahre alt, hatte sich Charles schon in seiner Jugend brennend interessiert, als er ihnen auf Malta zum ersten Mal begegnete. Er hatte sich auf alles gestürzt, was damit zu tun hatte, hatte es als hungriger Junge in sich hineingefressen wie Reisbrei mit Rosinen, hatte bewundert, wie die einfachen Megalithsteine und die mächtigen pi-förmigen Dolmen mit ihrer waagerechten Deckplatte eine Art Freiluftkammer bilden, hatte herausgefunden, wie sich die steinernen Giganten aus dem Nahen Osten, aus der Türkei, wo man jüngst in Göbekli Tepe die mit 12.000 Jahren älteste Kultstätte der Welt ausgrub, über das Mittelmeer bis nach Stonehenge und weiter nach Irland verbreiteten. Die unbekannten Völker aus der Jungsteinzeit, ihre Kulte und Kulturen, hatten seine jungenhafte Phantasie entzündet wie alle Sagen und Mythen, die er als Kind lesend verschlang. Sie waren bis zur Pubertät seine Gegenwelt zu den intellektuellen Vernunftanforderungen aus Elternhaus und Schule, sein Rückzugsraum, seine Höhle, in der er sich lebendig und frei fühlte, ein Held, der alles tun und lassen konnte, was er wollte.
Noch als Erwachsener erfreute sich Charles geradezu kindlich an den schwergewichtigen Hinkelsteinen, die Obelix mit spielerischer Leichtigkeit zu Dolmen verarbeitete oder lieber noch in ein Knäuel römischer Legionäre kickte. Dabei war es ein solcher Hinkelstein, der beim Herumklettern sein Bein zum Hinkebein verunstaltet hatte. Er hatte ihn, den elfjährigen Jungen, fast zermalmt. Dass er überlebte, war Glück. Er hatte schon oft Glück gehabt beim Überleben. Bislang.
Obwohl er über diese gewaltigen Steinbrocken so gut wie alles wusste, genoss er es, wenn Père Caneloux in gut gelaunter Rotweinrunde die Gelegenheit nutzte, um allerlei lokale Geschichten über deren Ursprung zu erzählen. Besonders gern verbreitete der Priester die Legende des örtlichen Kirchenpatrons, des Heiligen Cornély, immerhin kein Geringerer als Cornelius, 21. Nachfolger auf dem Stuhl Petri in Rom. Der, so verkündete Caneloux es bei jeder Gelegenheit und voller lokalpatriotischem Stolz, habe sich den Caesaren zum Trotz mutig geweigert, dem heidnischen Kriegsgott Mars zu opfern. Vor seinen römischen Verfolgern habe er bis in die Bretagne fliehen müssen. Hier aber habe er die Schergen des Kaisers in das Heer mannshoher Steine verwandelt, die bis zum heutigen Tage das Wunder des Heiligen bezeugen.
An diesem Punkt pflegte der Père seine Geschichte vorerst abzubrechen, um die gehobene Rotweinstimmung seiner Zuhörer durch ihren weniger erfreulichen Ausgang nicht zu verderben. Denn am Ende vermochte das Wunder der Bretagne den wackeren Cornély nicht zu retten. Ganz offensichtlich hatte er es versäumt, oder es war ihm nicht gelungen, sämtliche Häscher zu versteinern und damit ganz und gar unschädlich zu machen. Sonst wäre er kaum von einem der Söldner enthauptet worden, im Jahr des Herrn 253, wie es heißt. Bei näherem Hinsehen kämen für seinen Märtyrertod aber auch ganz andere Todesorte und Todesarten in Frage. Möglicherweise verschied er sogar auf ganz natürliche Weise. Aber wer wollte den Père schon mit solchen Einwänden irritieren, wenn ihn der Wein beflügelte. Und überhaupt, wer weiß schon so genau, was jemals wirklich geschehen ist oder geschieht.
Hätten die Gallier und ihre Vorfahren schon damals die Schrift gekannt, wäre noch mehr aus jenem Dunkel ferner Zeiten aufgezeichnet, als sich die Menschen Unvorstellbares in Geschichten vorstellbar machten. Und sie weiter erzählten, nicht anders, als es der Père noch heute tat. Charles war inzwischen nüchtern genug, um eher an die genialen Ingenieurleistungen der Megalithiker und ihre bewundernswerten kosmologischen Kenntnisse zu glauben als an noch so wunderbare Legenden. Und er hatte sich eigentlich vorgestellt, seiner Verdienste wegen eines Tages unter einem Dolmen begraben zu werden. Aber dafür war es zu spät, daraus konnte nichts mehr werden.
„Charles Dupont hat sich um unsere Region, unsere Stadt und unsere ehrwürdige Kirche St. Cornély, ja um uns alle verdient gemacht“, predigte der Père gerade in jenem salbungsvollen Sermon, der vor allem bei älteren Gläubigen die Wirkung jedes Schlafmittels übertraf. Eine Zeit lang noch erging er sich in ähnlich abgestandenen Phrasen. Dann aber hob er die Stimme plötzlich und schlug einen gänzlich irritierenden rhetorischen Bogen von den Rätseln der Dolmen und Menhire in vorgeschichtlicher Zeit zu den Geheimnissen, die im Hier und Heute schlummern, und zu der grundsätzlichen Unmöglichkeit, die Zeichen der Zeit wirklich zu entschlüsseln. Seien sie ja doch nur diesseitige Verweise auf die menschliche Transzendenz, immer bloß Wegweiser zu Verborgenem, zu Unerkennbarem, immer nur Fingerzeige auf die Verheißung lebendiger Auferstehung nach dem Tod und auf das Paradies, das gute Christen wie Charles Dupont erwarte.
Kaum jemand außer den Eingeweihten und Charles Dupont auf seiner Empore ahnte, was damit gemeint war. Die Trauergemeinde folgte dem Père eher ratlos auf seinem etwas abstrakten Exkurs. Und der verfolgte auch gar nicht die Absicht, sich seinem gemeinen Kirchenvolk verständlich zu machen. Er wandte sich in diesem Moment an einen Anderen, ein höheres Wesen. Im Unterschied zu manchem Priester glaubte Caneloux tatsächlich an Gott. Und hier im Gotteshaus, unter den Augen des Allerhöchsten, wollte er mit seiner vielleicht etwas abseitig klingenden Anspielung dem eigenen Gewissen Genüge tun, indem er geschickt, aber doch wahrhaftig auf die verborgenen Aspekte im Hier und Jetzt dieser Trauerzeremonie verwies.
Dann aber fand er schnell wieder den Weg zurück zu dem Verstorbenen und dessen verdienstvollem Vorstoß, die vorkeltischen Altertümer endlich auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes zu setzen, nicht zuletzt, um den Tourismus im Morbihan weiter anzukurbeln. Und er vergaß keineswegs, Duponts von reiner Nächstenliebe geprägte Fürsorge zu erwähnen, die er über seine Stiftung hungernden Kindern in der Dritten Welt zuteil werden ließ.
So erschien Charles Dupont der Trauergemeinde in der Kirche wie die Inkarnation des guten Christenmenschen. Selbstverständlich unterließ der Père die entfernteste Andeutung, die einen so strahlenden Heiligenschein hätte trüben können, etwa dass der reiche Geschäftsmann aus Paris, ein gelernter Jurist, in Wirklichkeit von den Einheimischen in der ganzen Region verabscheut wurde, dass extremistische Regionalisten ihn sogar unverhüllt bedroht hatten, indem sie ihm unter anderem, aber in dieser Reihenfolge, einen Haufen abgehackter Hahnenköpfe, einen Kübel übel stinkender Fisch-Innereien und eine Fuhre undefinierbaren Kots vor die Türe setzten.
Die Bürger von Carnac fühlten und dachten bretonisch, nicht französisch. Und sie wollten nicht, dass die Pariser sich hier breitmachten und ihr Land kolonialisierten. Viele von ihnen sympathisierten offen oder versteckt mit der Protestbewegung der Rotmützen, die in der ganzen Gegend begonnen hatte, Großkundgebungen und Streiks zu organisieren, um gegen Paris und den französischen Zentralismus Front zu machen.
Charles Dupont versuchte sich ein Bild zu machen. Vorne in der dritten Reihe saß der ehrenwerte Doktor Briand, durch und durch konservativ, aber trotz des ehelichen Sakraments mit ununterdrückbarem Gefallen am anderen Geschlecht. „Aha“, dachte sich Charles. Briand trug einen Hut und, ungewöhnlich für seine Gewohnheiten, eine getönte Brille, wohl um seine inneren Regungen zu verbergen. Aber warum nur war Albert nicht hier? Der Père pries gerade die Großzügigkeit als einen von Duponts edlen Charakterzügen. Das Heucheln beherrschte er perfekt. Respekt, dachte Charles, der darin selbst eine beachtliche Routine erworben hatte. Auch der Vervollkommnung dieser Kunst, wenn auch nicht nur ihr, hatte er seinen Aufstieg und sein nicht ganz unbescheidenes Vermögen zu verdanken.
Irgendetwas Aufmunterndes muss ein Pfarrer ja sagen, dachte Charles, auch wenn hier gar niemand aufgemuntert werden wollte, schon gar nicht Gisèlle, seine Gattin, die von dieser Beerdigung in jeder Beziehung profitierte. Prüfend und wohlgelaunt lauschte Charles den klagend kümmerlichen Klängen der Orgel, die sich unter Spitzbögen verkrochen und ihn auf diese Weise wissen ließen, dass er doch noch nicht auf dem Weg ins himmlische Jerusalem war. Auf dem bunten Glasfenster am Chor des neugotischen Kirchleins ließen die Sonnenstrahlen dieses Junimorgens das Bild noch schauriger als gewöhnlich leuchten. Er glühte in ihrem Licht, der Märtyrer, der Kirchenpatron, der arme Cornély, von einem römischen Legionär ganz in der Nähe von Carnac geköpft, und erinnerte die Gläubigen so an wahre christliche Opferbereitschaft.
Albert, sinnierte Charles, wäre vielleicht der Einzige gewesen, der aufrichtig um ihn trauern würde. Nicht allein der großherzigen Trinkgelder wegen, die er ihm jedes Mal aufs Tablett gelegt hatte. Die beiden mochten sich. Charles’ feine Fünf-Gänge-Menüs, die im Hauptgang fast immer eine gegrillte „Dorade à la maison“ einschlossen, zu der Albert einen Chardonnay aus der Provence kredenzte, endeten gen Mitternacht in schöner Regelmäßigkeit mit einer Runde Calvados und einem höflich distanzierten und doch sehr mitteilsamen Geplauder. „À la votre!“, pflegte Albert zu sagen, „à la votre!“, Charles zu erwidern. Die Zeremonie war nicht weniger eingespielt als die Rituale des Priesters in der Totenmesse. Zu später Stunde durchbrach zuweilen ein Anflug von Vertraulichkeit die beiderseits sonst stets sorgfältig gewahrte Form. Dann redeten sie sich mit ihren Vornamen an, um freilich schon am nächsten Tag wieder zur gebotenen Distanz zurückzukehren. Innerlich bedankte sich Charles in diesem Moment bei Albert noch einmal, während der Organist die Tasten seines Instruments bediente. Ohne ihn, ohne seine Geistesgegenwart läge er nun wirklich in der bekränzten Eichenkiste, die der Père mit dem Schlangengesicht gerade ein weiteres Mal mit Weihwasser bespritzte. Der Choral auf der Orgel klang gespenstisch.
Auf der Empore registrierte Charles jede Bewegung unter ihm, auch wenn er die meisten Trauergäste nur von der Seite oder von hinten sehen konnte. Er hob den Kopf und glitt unmerklich in ein Grübeln hinüber, gestand sich ein Gefühl von Unsicherheit ein, das ihm neu war oder das er bisher immer verdrängen konnte. Es wäre ihm auch mehr als hinderlich gewesen in einer Branche, in der es immer härter zuging und gnadenloser. Jetzt aber hatte sich dieses Gefühl eingeschlichen, festgebissen, und er konnte es nicht mehr abschütteln. Trotz aller Abgebrühtheit und Cleverness, die er sich in vielen Jahren und äußerst brenzligen Situationen erworben hatte, belauerte es ihn, stellte Fragen, die ihm nicht mehr aus dem Kopf wollten: Wer war es, der ihn im „La Mer“ vergiften wollte? War er jetzt womöglich hier, saß unter seinen Augen? Oder hatte irgendeiner seiner Widersacher einen Mordauftrag erteilt? „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“, zitierte unter ihm das Schlangengesicht Psalm 90, Vers 12.
Seine Frau Gisèlle, die mit diesem – wie hieß er noch? – in der ersten Reihe saß, schluchzte. Meisterhaft, dachte Charles. Und hätte mit einer Spontanreaktion ums Haar eine Katastrophe ausgelöst. Denn seinem Rachen war nun doch dieses zwanghafte Schnarren entstiegen, dieser röchelnde Laut, im Muskelschlauch seines Halses von einem nur kurzen, aber heftigen Flattern des Gaumensegels und des Zäpfchens erzeugt, dieser Reflex, den er so schlecht unterdrücken konnte. Und der, wenn er zu geräuschvoll geriet, an das Grunzen eines Schweins erinnerte. So wurde sein spontanes Schnarren mit der Zeit zu einer Art akustischem Markenzeichen, das Charles bereits seit seiner Pubertät begleitete und das ihm blieb wie der eigene Körpergeruch und sein Hinkebein.
Charles hielt den Atem an. Hatte ihn die Abnormität seines Halses verraten? Erkannten sie ihn? Ein paar Trauergäste drehten ihre Köpfe zur Empore hoch. Gerade waren die letzten Töne eines Chorals verklungen. Es war mucksmäuschenstill. Neben ihm saßen zwei korpulente Frauen und ein Dutzend junger Leute. Jetzt bloß die Nerven behalten. Charles hielt dem Angriff stand. Die Trauerköpfe senkten sich wieder. Das bühnenreife Spiel konnte weitergehen.
*
Dessen erster, so kurzer wie dramatischer Akt hatte eine Woche zuvor eingesetzt. Am Pfingstmontag hatte sich Charles Dupont wie gewöhnlich im „La Mer“ eingefunden, diesmal mit einer im Lokal noch unbekannten sommerweizenblonden jungen Dame, die er mit Chantal ansprach.
„Monsieur wünschen?“, fragte Albert.
„Wie immer“, lachte Dupont, „und einen Pernod als Aperitif.“
Das Nobellokal an der Hafenpromenade von Saint Philibert war wie üblich gut besucht, das Paar unterhielt sich angeregt. Die Vorfreude auf die folgenden Genüsse und die Genüsse, die dann noch folgen würden, wärmte sie an Leib und Gliedern. Für Charles war das „La Mer“ so etwas wie ein Außenhaus seiner eigenen Villa, Speisezimmer und Salon zugleich.
Albert war ein äußerst umsichtiger Betreuer seiner Gäste. Er hielt seine Augen und Ohren stets offen. Und es entging ihm wenig, wenn sich die illustren Gäste im edlen Ambiente des Hauses einfanden, um es sich gut gehen zu lassen und zuweilen das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, das hier so beiläufig geregelt werden konnte. Das Fläschchen mit dem Totenkopf entdeckte Albert genau genommen zufällig und nur deshalb, weil er bemerkte, dass eine Kerze auf Duponts Tisch erloschen war. Auf der Suche nach Zündhölzern fand er in einer Schublade das Gift. Blitzschnell erfasste er die Situation, hastete an den Tisch, riss Charles’ Teller weg, schüttete, was ihm noch nie passiert war, die Gemüsebeilage auf den Boden, was aber wie eine Ungeschicklichkeit wirkte. Charles war irritiert und hilflos für eine Sekunde. Er durchschaute nicht sofort, dass ihm gerade das Leben gerettet worden war. Und noch weniger erkannte er in diesem Augenblick, dass die Inszenierung seines Todes nun unvermeidlich würde, dass es nun an der Zeit war, für sein eigenes Ableben, für seinen Scheintod zu sorgen.
Nur wenige Minuten später sackte am Nachbartisch Brigitte Leclerc, die Gattin von Alain Leclerc, des bedeutendsten Cidre-Herstellers im Morbihan, röchelnd auf ihrem Stuhl zusammen. Sie hatte gerade die ersten Bissen ihrer Dorade zu sich genommen. Die rasche Ankunft des Rettungsdienstes vom Croix Rouge kam für die sonst durchaus resistente Dame nicht schnell genug. Ihre Halsschlagadern waren angeschwollen, ihr heller Teint hatte sich binnen Sekunden dunkelviolett verfärbt. Dann hörte sie auf zu atmen. Monsieur Leclerc wurde leichenblass, die Gäste gerieten in höchste Aufregung.
Alberts Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Monsieur Leclerc gehörte wie Charles Dupont zu den wichtigen Stammgästen des „La Mer“. Aber wer um Himmels Willen trachtete schon seiner Frau nach dem Leben, deren Werk und Wirken sich im Wesentlichen darin erschöpfte, das Geld ihres Mannes mit vollen Händen und so protzig auszugeben, dass es ihren gesellschaftlichen Kreisen imponierte, ihren Freundinnen vor allem und deren Ehemännern? Hatte sie nur Pech, als sie zur gleichen Zeit wie Charles Dupont eine Dorade orderte? War ihr Tod reiner Zufall oder ein Kollateralschaden, den jemand in Kauf genommen hatte?
Dupont reagierte überraschend wenig überrascht, als Albert ihn noch am selben Abend über den giftigen Fund in der Küche aufgeklärte. Er wirkte schon wieder gefasst, fast kühl, fragte kaum nach, schien sich für Einzelheiten nicht zu interessieren, obwohl es für ihn um Leben und Tod gegangen war und er dank Alberts Blitzreaktion ein Übermaß an Glück gehabt hatte, das nicht unbedingt verdient war. Wie zum Beispiel war die Giftflasche in diese Schublade gekommen? Warum war sie dort so auffällig deponiert worden, als solle sie gefunden werden? Wieso durchzuckte Albert sofort die Idee, dass damit Duponts Dorade beträufelt worden war, die er gerade aufgetragen hatte? Warum konnte er Charles Dupont retten, aber Brigitte Leclerc nicht? All das schien Dupont nicht zu interessieren. Er war schon weiter, hatte bereits einen Plan, in den er Albert noch an diesem Abend einweihte. Offenbar hatte er damit gerechnet, ja in dem Bewusstsein gelebt, dass er nicht damit rechnen konnte, so einfach aus allem davon zu kommen, was sich über, hinter und neben ihm zusammengebraut hatte. Auch wenn ihm nicht klar war, von welcher Seite die Gefahr drohte. Es gab schließlich mehr als eine Möglichkeit.
Albert, der mit seiner steten Aufmerksamkeit, seinem gewinnenden Lächeln und mit seinem immer noch fast jungenhaft tänzelnden Schwung die Gäste für sich einnahm, wenn er sie bediente, war erfahren im Umgang mit schwierigen Situationen in der Gastronomie von St. Philibert. Luxussegler aus halb Europa steuerten das Nest an und spuckten ihre Ladung an Land, europäische Schickeria aller Couleurs, jede Menge Halbwelt darunter. Niemand wusste so genau, seit wann Albert im „La Mer“ bediente. Eines Tages war er dort aufgetaucht. Und binnen kürzester Zeit schien es allen, als wäre er schon immer da gewesen, hätte schon immer aus den Mänteln geholfen, Stühle näher gerückt, Kerzen entzündet und den passenden Wein zum gewählten Menü empfohlen. Bald war es, als gehöre er zum Inventar des Nobel-Restaurants, das weit über die Region hinaus berühmt war für seine exklusiv zubereiteten Meeresfrüchte, die stilvoll zelebrierten Austernmahle und die fangfrischen, goldbraun kross gebratenen oder im würzigen Salzmantel servierten Doraden. Ja, die fangfrische Dorade war zum Sinnbild von Saint Philibert aufgestiegen. Und so meisterte Albert auch an diesem Pfingstmontag all die schwierigen, ja chaotischen Umstände eines so plötzlichen und für die Lokalität so unangenehmen Todesfalls souverän, umsichtig und mit der ihm eigenen Mischung aus lässiger Nonchalance und würdevoller Eleganz.
Merkwürdig nur, dass er am Tag darauf spurlos verschwunden war, als hätte ihn der bretonische Erdboden verschluckt. Obwohl er ja Schlimmeres verhindert hatte, zählte ihn die Polizei, die wegen des Giftmordes an Brigitte Leclerc zunächst fieberhaft ermittelte, eine Zeit lang zu den Verdächtigen. Albert verschwand, wie er aufgetaucht war, so als hätte es ihn nie zuvor gegeben, als wäre er nie in Saint Philibert zugange gewesen. Die polizeiliche Suche, offiziell ausgegeben als Wunsch der Staatsanwaltschaft nach Kontaktaufnahme mit einem wichtigen Zeugen, führte nicht weiter und verlor sich wie in einem schwarzen Loch. Keine Hinterlassenschaften, keine Spuren. Albert hatte sich in vollkommenes Nichts aufgelöst.
*
Charles Duponts Blick schweifte hinunter auf die Gemeinde und blieb erneut an Doktor Briand mit seiner dunkel getönten Brille hängen. Eigentlich war es erstaunlich, dass der renommierte Arzt letzten Endes mitgespielt hatte bei seinem Trauerspiel. Aber zugleich bestätigte es seine Erfahrung, dass jeder zu kaufen war. Es kam nur auf den Preis an. Mit zitternden Händen hatte Doktor Henri Briand den Totenschein für ihn ausgefüllt: „Charles Edouard Henri Dupont, geb. am 23. Mai 1956, gest. am 4. Juni 2014.“ Darunter stand kurz und knapp: „Todesursache: Herzversagen“. Mit diesem Dokument war Charles offiziell und amtlich von dieser Welt verabschiedet. „Herzversagen“ hatten sie gewählt, weil so keine Obduktion angeordnet werden musste. Am übernächsten Morgen war im „Atlantic Libre“ in einer von Gisèlle Dupont unterschriebenen Anzeige zu lesen, dass ihr „innig geliebter Gatte“ im Alter von 58 Jahren für immer von ihr gegangen sei.
Den Plan, als Ersatz einen toten Hund und, damit das Gewicht stimmte, neunzig Kilogramm Muschelkalksteine im Sarg zu verkeilen, hatte Charles gemeinsam mit dem Père in der Gott geweihten Sakristei von Saint Cornély ausgeheckt. Charles hatte sofort nach dem Giftattentat im „La Mer“ nachgedacht und war zu Folgerungen gelangt. Das konnte er gut, scharf und präzise analysieren, daraus nüchtern die Konsequenzen ziehen und dann schnell entschlossen handeln, indem er die erforderlichen Dinge einfädelte. Möglichst ohne selbst in Erscheinung zu treten. Es war höchste Zeit, aus seinem alten Leben zu verschwinden. Und so hatten er und der Père sich schon am nächsten Tag zu einer dringlichen Beichte mit sofortigem Ablasshandel in der Sakristei des Gotteshauses verabredet, um unter dem Kreuz des Herrn seine irdische Himmelfahrt auf den rechten Weg zu bringen.
Es war nicht das erste Mal, dass man hier oder andernorts diskret, kreativ und ergebnisorientiert zusammenkam. Beide, er und der Père, hatten sich schnell in gegenseitigem Verständnis und tatkräftigem Beistand zusammengefunden, der Parvenü und das Schlangengesicht, als Neuankömmlinge und Brüder im Geiste, die fast zu gleicher Zeit in dieser ebenso herrlichen wie eigensinnigen Gegend Frankreichs begannen, sich um Gewinn an Land, Leib und Seele zu kümmern. Charles und der Père hatten nicht bloß beim Rotwein den gleichen Geschmack.
Bei der Fleischeslust allerdings unterschieden sich ihre Vorlieben. Und da Charles um die speziellen Neigungen seines geistlichen Partners wusste, verhalf er ihm über seine Verbindungen gelegentlich zu ebenso diskreter wie professioneller Erleichterung, allerdings nicht ohne sie ebenso diskret und professionell zu dokumentieren. Indem er so dazu beitrug, dass der Père die Jugendlichen seiner Gemeinde und die vier Messdiener in Ruhe ließ, tat er etwas Gutes. Und hatte den Père zugleich in der Hand. Wie manch andere. Nicht nur in Carnac.
Auf vielleicht 900 Millionen, vielleicht eine Milliarde Euro hatte Charles Dupont sein Vermögen bis dahin angehäuft. Schätzungsweise. So ganz genau wusste er selbst nicht, was es gerade wert war. Jetzt, da es Zeit geworden war, schleunigst den amtlichen Tod zu suchen, nahm seine Gattin Gisèlle diese endgültige Abwendung mit einem erstaunlichen Gleichmut. Und mit Zins und Zinseszinsen. Er schaute von der Empore auf sie hinab und verscheuchte einen sentimentalen Anflug, der ihn aus fernen Zeiten anwehte, als sie sich gegenseitig noch ineinander hineinwühlten, emotional wie körperlich, und nicht genug bekommen konnten voneinander. Sie war ihm immer noch so vertraut wie kein anderer Mensch. Aber zuletzt hatte sie doch nur noch ein gemeinsamer, als Basis einer Ehe freilich nur beschränkt tragfähiger Erfahrungshintergrund verbunden, der sich im Wesentlichen aus dem erstaunlich offenen Meinungsaustausch über ihre wechselnden außerehelichen Affären speiste. Und aus intimer gegenseitiger Kenntnis ganz anderer Aspekte ihrer Lebensführung, die besser im Dunkeln blieben.
Sie waren Mitwisser voneinander geworden. Und dies hielt sie, ganz kühl kalkuliert, gegenseitig in Schach. Ein klassisches Patt. Je seltener sie bei ihm Befriedigung suchte, umso mehr erwartete sie allerdings ihre Befriedung. Der aus Charles Sicht großzügige Ehevertrag sah vor, ihr trotz vorsorglich getrennter Vermögen im Falle seines Ablebens die glatte Summe von 100 Millionen zukommen zu lassen, gleichsam als Trost für ihr auch künftig keineswegs trostloses Witwenleben und zur Gewährleistung ihrer Diskretion für alle Zeiten. Mit seinem nicht ganz unerheblichen Vermögensrest wollte Charles Dupont endlich ein lustvolles, ganz und gar unbeschwertes, ja von allen Altlasten befreites Dasein beginnen und die Rendite seines riskanten Lebenswerks genießen. Auf der Karibikinsel Saint Martin. Natürlich in neuer Identität.
Und natürlich mit Chantal. Der Gedanke an seine Geliebte erfrischte ihn. Selbst hier in der Kirche. Bei seinem eigenen Begräbnis. Und er spürte, als er an sie dachte, eine prickelnd pulsierende Aufladung, ganz besonders an bestimmten Stellen. Ganz körperlich. Er schloss die Augen und sah sie vor sich. Mit ihren zärtlichen Händen, an deren Fingerspitzen die zartrot lackierten Nägel zu sitzen schienen wie Knospen im Frühling.
Sie hatte ihn erlöst aus seiner zwanghaften Sexsucht, den einander immer schneller folgenden Attacken und gierigeren Schüben, die er in professionell organisierten Orgien immer vulgärer hatte entladen müssen, ohne je wirklich Befriedigung zu finden oder gar Frieden. Bestenfalls ließen sich diese Sex-Partys, bei denen sich männliche Crème de la Crème aus Wirtschaft, Politik, Finanz- und Unterwelt in feinsten Hotels mit bezahlten Traumfrauen vergnügte und dabei ihre ureigenste Creme verspritzte, im Nachhinein für den einen oder anderen Deal benutzen, bei Politikern auch gerne verbunden mit einer diskreten Erpressung oder, im Falle mangelnder Kooperationsbereitschaft, mit einer unerquicklichen Indiskretion.
Chantal hingegen nahm Dupont ganz unkompliziert, einfach wie er war, trotz seines deformierten Beines und trotz seiner Deformationen nichtkörperlicher Natur, nahm ihn in sich auf, ließ ihn ein in pulsierende Öffnungen und feuchte Tiefen, glitt mit ihm, ohne ihn zu überfordern, durch sinnlich wohlige Wogen lustvoller Intimität, ohne dass er ihr irgendetwas beweisen musste, ohne dass er sich selbst irgendetwas beweisen musste.
Mit Chantal fühlte er sich unbeschwert, wie befreit, als hätte sie eine Zwangsjacke gelöst, die sein bisheriges Leben um ihn gelegt hatte. Ihre jugendfrisch unbekümmerte Fröhlichkeit ergoss sich über ihn wie ein warmer Sommerregen. Dieses große Mädchen mit seiner schonungslos frechen Offenheit pustete seinen Machismo so einfach und zwanglos weg wie Staub von einem Möbelstück. Mit ihr fühlte sich sein Verschwinden nicht an wie eine Flucht. Sondern wie eine Existenzgründung.
Einstweilen aber schaute er auf seinen Sarg hinunter. Er nahm sich zusammen, setzte sich ein wenig aufrecht und unterdrückte die spürbare Erregung, die der Gedanke an Chantal zwischen seinen Schenkeln hatte aufkommen lassen, obwohl weder der Moment noch das sakrale Ambiente dafür den passenden Rahmen bot. Ein wenig ärgerte ihn der Zeitdruck, unter dem er seinen Tod so eilig hatte organisieren müssen. Denn die Notwendigkeit, aus seinem alten Dasein zu verschwinden und ein neues Leben zu beginnen, war nicht über Nacht auf ihn gekommen. Schon eher in Gestalt dieser vergifteten Dorade, die ihm aufgetischt worden war. So ehrlich zu sich selbst war Charles, einzugestehen, dass ihn nicht nur die aphrodisierenden Lebenselixiere Chantals hinüberzogen zu seiner neuen Existenz. Er wusste aus seinen Quellen, dass sich die Pariser Staatsanwaltschaft schon eine ganze Weile mit seinen keineswegs durchgängig gesetzeskonformen Geschäften beschäftigte. Und es war im Zuge dieser Ermittlungen nicht ausgeschlossen, dass sie ihm schon dicht auf den Fersen war, ja, dass jeden Augenblick seine Verhaftung drohte.
Das war aber nur die eine Seite seiner akuten Probleme. Die andere hatte mit den existenziell unangenehmen, nachgerade lebensgefährlichen Entwicklungen in dem kriminellen Segment zu tun, in dem er seit vielen Jahren europaweit tätig war. Mittlerweile schlugen in dieser Branche ständig neue Player auf, neue Akteure, die noch skrupelloser und brutaler agierten als er selbst. Die rasante Globalisierung seit Anfang der 90er Jahre hatte längst auch sein Revier durcheinandergewirbelt. Ihm war klar, dass er zunehmend die Kontrolle über das Geschehen verlor. Und er spürte, dass ihm die rastlose Energie und dieser unstillbare Ehrgeiz verloren gingen, die ihn stets vorwärts getrieben hatten wie Wasserstoff und Sauerstoff eine Rakete. Ohne sie konnte am Ende des Tages keiner überleben in einem Dschungel, in dem es in jedem Sinn des Wortes ums Fressen ging, oder ums Gefressen werden.
Immer öfter, tageweise, fiel ihn eine Müdigkeit an, bedrückend und lähmend, als ob dichte Nebelschwaden aufkämen und sich ein klamm kalter, trüber Schleier über ihn legte. Und er war auch dieser unerfreulichen, nie auszuräumenden, oft gehässigen Stimmung gegen ihn überdrüssig, die sich trotz all seines Goodwills hier in der Gegend breitmachte, als würde sie ständig von jemand geschürt und befeuert. Sie bedrohte das gutbürgerliche Dasein, das er sich organisiert hatte.
Sicher, er hatte vorgesorgt, hatte schon lange an der Transformation seiner Existenz in ein ehrenwertes Leben gearbeitet, ein Leben, das er eigentlich hier in der Bretagne hatte beschließen wollen. In aller Ruhe. Dann kam Chantal und brachte ihn auf ganz andere Gedanken. Deshalb hatte er seine Immobilien in der Bretagne in höchst mobile Werte verwandelt und ihnen auf der Flucht vor unangemessenem Zugriff kurzfristig Asyl in der Schweiz verschafft. Von da sollten sie zu seiner Stiftung für hungernde Waisenkinder in Panama weiterwandern, um sich dort sowie in Island, dem Libanon, Hongkong und auf den Kaimaninseln seinen global diversifizierten Anlagen zuzugesellen. In der Verwandlung von Werten war er immer noch ein Meister.
*
Ein nervöses Husten lenkte seine Aufmerksamkeit noch einmal auf Doktor Briand. Es war der Père, der im rituellen Management des Trauerakts seiner geistlichen Profession so trefflich nachkam, dem die anspruchsvolle, nachgerade brisante Aufgabe zugekommen war, den ehrenwerten Doktor für dessen Mitwirkung an Charles’ amtlichem Verschwinden in die Ewigkeit zu gewinnen. Briand war immerhin ein weit über das Morbihan hinaus geachteter Internist. Seine Unterschrift auf dem Totenschein war deshalb umso kostbarer und sollte ihm mit einer satten, sechsstelligen Provision vergoldet werden.
Mit der doppelten Summe hatte Charles schon den Père abschließend für all seine Dienstleistungen vergütet, obwohl der ihm mehr als einen Freundschaftsdienst schuldig gewesen wäre. Der Geldsegen würde es dem Gottesdiener mit dem Schlangengesicht erlauben, Gutes zu tun, vor allem die marode Fassade und die kaum noch brauchbare Orgel von Saint Cornély endlich zu renovieren. Auch würde er Bedürftigen ein paar Almosen zukommen lassen, der neue Papst aus Argentinien schien tatsächlich ernst zu meinen, was er sagte. Und nebenbei wäre es sicher keine Sünde, den eigenen Weinkeller wieder aufzufüllen, da er sich auf wenig wundersame Weise stets entleerte.
Wie das Geld technisch zu verbuchen war, dafür würde der kahlköpfige Bürgermeister sorgen, der, als habe es der Herrgott selbst so vorgesehen, gleichzeitig Kämmerer von Carnac war. Eugène-Marie le Pont war seit sechsunddreißig Jahren im Amt und ein Profi in schwierigen Geldangelegenheiten. Sein Verhältnis zum Père war von wahrhafter Gottesfurcht und unerschütterlicher Kirchentreue geprägt, allerdings auch von irdischer Bodenhaftung und nahezu prophetischer Sehergabe, jedenfalls wenn es um so profane Dinge ging wie die monetäre Reinwaschung größerer Summen in den unübersichtlichen Töpfen der Gemeindefinanzen.
Doktor Briand, der aus einer ehrbaren bretonischen Gelehrtenfamilie stammte, hatte sich mit aller Macht gegen das schändliche, um nicht zu sagen schurkische Ansinnen gesträubt, das ihm der Geistliche unterbreitete.