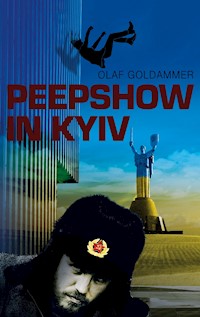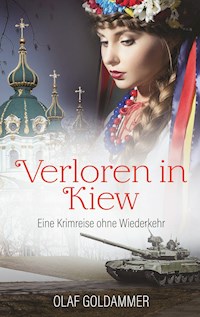
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der zu Vortragszwecken auf der Krim weilende Silbermann besucht seine alte Liebe in Kiew. Auf der Zugfahrt mischen sich seine eigenen Erinnerungen mit denen der mitunter skurrilen Mitreisenden und ihren Geschichten. Die Grenzen von Vergangenheit und Gegenwart, Realität und Phantasie verschwinden. Nach einem enttäuschenden Wiedersehen heftet sich Silbermann an die Fersen der geheimnisvollen Alina. Was zunächst nach Rettung aussieht, lässt ihn noch tiefer stürzen. Die Nylonfäden, die Silbermann fassen kann, geben ihm nur vermeintlich neuen Halt. Tatsächlich stürzen sie ihn auf seinem Fahrrad ins politische Chaos der Maidan-Unruhen. Silbermann wird zum Spielball zwischen den Fronten und zum Zeugen politischer Machtkämpfe, die dem Leser die Brutalität des Herrschaftsapparates gnadenlos vor Augen führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
1
Als ich zu meinem Koffer hinüberblickte, erbrach das kleine Mädchen gerade. Es war mit seinem Großvater, vermutlich handelte es sich jedenfalls um diesen, kurz nachdem der Trolleybus das Stadtgebiet von Jalta verlassen hatte, an der Haltestelle von Nikitsky Sad zugestiegen. Die beiden hatten ihren Platz dort gefunden, wo ich meinen Koffer hingeschoben hatte. Sie hatten eine Reservierung für diese beiden Plätze nach der Tür im hinteren Teil des wohl erst wenige Monate alten Gelenkbusses westeuropäischer Produktion bekommen. Vor ihrer Sitzreihe war eine von der Decke bis zum Boden durchgezogene Glasfront, die den Eingangsbereich abtrennte. Hinter der Glaswand und somit vor ihren Füßen war aus Stahlrohren ein Rechteck gefasst, wohl eben für Zwecke der Gepäckverstauung und -fixierung. Hier hatte mein Handgepäckkoffer wunderbar hineingepasst, während ich selbst ja auf der linken beziehungsweise Fahrerseite vor meiner eigenen Sitzreihe eine andere hatte und links von mir einen weiteren Reisenden und damit eben keinen Raum für die Bagage. Den kleinen Rucksack mit Reiseproviant hatte ich auf meinen Schoß genommen. Zu jeder Sitzreihe gehörte eine Haltestange, die in Hüfthöhe jeweils auf der Rückseite der Vordersitze angebracht war und zum Festhalten beim Aufstehen und Hinsetzen diente.
Das Mädchen erbrach still und leise. Ich hatte die beiden einsteigen sehen, sie dann vergessen und gerade in diesem Moment daran gedacht, dass mir selbst in meiner Kindheit bei längeren und auch kürzeren Busreisen regelmäßig schlecht geworden war, wenn der Bus so vor sich hin schaukelte, stoppte und wieder beschleunigte oder Kurven fuhr. Bei Reisen mit dem elterlichen Personenkraftwagen erging es mir nicht anders. Ich und besonders mein Magen waren zu sensibel für die Hektik des Straßenverkehrs. Schon wenn ich in das Auto einstieg und mir der Kunstledergeruch der Inneneinrichtung mit einer Note von kaltem Zigarettenrauch in die Nase stieg, drohte sich der Mageninhalt einen Weg nach oben zu bahnen. Wenn sich mein Vater dann während einer mehrstündigen Fahrt eine Zigarette anzündete, war es trotz des in der Regel weit heruntergekurbelten Fahrerfensters binnen Sekunden vorbei, das Frühstücksbrötchen wieder draußen und mit einigem Glück in der Tüte und nicht auf dem Boden oder auf der Mittelkonsole zwischen den beiden Vordersitzen verteilt. Mein Vater hatte bei solchen Gelegenheiten früher immer sehr schnell anhalten und eine mindestens halbstündige Pause einlegen müssen. Stets waren Plastiktüten im Auto vorrätig, eben für den nicht seltenen Fall, dass das Brötchen schneller kam als die nächste Haltemöglichkeit.
Der Großvater hatte augenblicklich, und bevor sich der würzige Mageninhalt der Kleinen über ihre Kleidung hätte ergießen können, eine dünne Plastiktüte hervorgeholt und sie dem Kind unter den Mund gehalten. Die Plastiktüte war von der Art, wie man sie in Supermärkten für kleinere Mengen Obst findet, damit die Einkaufstasche nicht verklebt, und nicht von übermäßiger Stabilität. Dort hinein hatte die Wnutschka, so heißen die russischen Enkelinnen und auch die ukrainischen im russischsprachigen Teil des Landes und auf der Krim, eine nicht geringe Menge bereits weitgehend verdauter Nahrung hineingespuckt. Jetzt war sie offensichtlich fertig, die Wnutschka, mit der Nahrungsmittelrückgewinnung. Die Kleine tat mir außerordentlich leid. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Erbrechen im Bus oder Auto und bereits der Gedanke daran zu den unangenehmsten Kindheitserinnerungen überhaupt gehören.
Die Kleine hatte – soweit ich das erkennen konnte – brav in die Tüte gezielt, aber selbst wenn im Eifer des Erbrechens kleinere oder größere Mengen danebengegangen wären, hätte ich ja nicht wirklich böse sein dürfen. Das Erbrochene bricht sich seine Bahn und lässt sich nur wenig kontrollieren. Gleich nach der Sorge um das Wohl der Kleinen rangierte bei mir demnach auch die um meinen Koffer. Der stand immer noch direkt vor den beiden. Die Gefahr, in der sich mein Koffer und mehr noch sein Inhalt befanden, hatte ich nicht rechtzeitig erkannt. Jetzt war im Grunde genommen eh alles zu spät, und ich konnte nur hoffen, dass meine Bagage unversehrt geblieben war. Ich war zutiefst beunruhigt.
Vielleicht sollte ich einfach zu meinem Koffer hinübergehen und mich von seinem Zustand überzeugen. Aber was brächte das? Wenn er vollgekotzt wäre, könnte ich die beiden kaum haftbar machen, ebenso wenig könnte ich den Koffer vor meiner Ankunft in Kiew fachgerecht säubern und den bitter-säuerlichen Geruch beseitigen. Wenn der Koffer hingegen unbeschmutzt wäre, wäre meine Sorge vollkommen unnötig, und ich erschiene wohl den Mitreisenden als kaltherzig und materialistisch gefühllos. Alle hatten ja den erbärmlichen Zustand der Kleinen mitbekommen, und auch wenn ich keinem der Anwesenden Ressentiments gegenüber reichen Westtouristen unterstellen wollte, war doch klar, dass ihre Sympathien eher auf der Seite der Wnutschka lagen als bei mir.
Ich blieb also sitzen. Außer mir konnte in dem Bus ohnehin niemand ahnen, wie wichtig es für mich ausgerechnet an diesem Tag beziehungsweise an dem darauffolgenden Morgen war, mit sauberen Klamotten und in einem gesundheitlich und optisch makellosen Zustand auf dem Kiewer Hauptbahnhof Kiev Passashirsky anzukommen. Keiner der Mitreisenden ahnte, wie lange ich diesem Moment entgegengesehnt hatte. Immer denke ich daran, wenn ich auf Reisen mein Gepäck abgebe, dass es verloren gehen könnte. Meistens kann man am Zielort eine Zahnbürste nachkaufen, eine Unterhose und ein Paar Socken vielleicht. Und alles ist wieder gut oder zumindest halbwegs. Aber diesmal hatte ich nur zwei Tage und eine Nacht und keine Zeit, auch nur eine Minute davon in einem Geschäft zu vergeuden.
Den Bus hatte ich absichtlich so gewählt, dass ich bei Verpassen desselben den nächsten hätte nehmen können oder ein deutlich teureres Taxi, um doch noch mein Ziel, den Bahnhof von Simferopol, erreichen zu können. Von hier aus wollte ich den Nachtzug nach Kiew nehmen. Den Zug musste ich also bekommen, koste es, was es wolle.
Ein Jahr zuvor hatte ich schon einmal ein Flugticket von Frankfurt nach Kiew gebucht und es dann in letzter Sekunde verfallen lassen. Eine solche Anreise wäre viel einfacher gewesen. Der Flieger wäre wahrscheinlich vorhersagbar pünktlich in der ukrainischen Hauptstadt angekommen, ich hätte mir ein Taxi genommen und wäre in die Innenstadt zum vereinbarten Treffpunkt gefahren oder wäre vom Flughafen abgeholt worden. Ich wäre erwartet worden und hätte mir um das Zustandekommen des Wiedersehens keine Gedanken machen müssen. Jetzt war alles viel komplizierter. Ich war zuvor von Frankfurt nach Jalta gereist, hatte noch im Flugzeug nicht genau gewusst, was und wer mich dort auf der Krim erwartete, wusste in Jalta dann nicht, ob ich mit dem Zug nach Kiew reisen und ein Ticket hierfür erwerben könnte, ich den Bus zum Bahnhof in Simferopol rechtzeitig erreichen und der Zug auch tatsächlich fahren würde, ob ich in Kiew wie erhofft pünktlich ankäme und abgeholt würde. Das alles und wahrscheinlich noch viel mehr wusste ich nicht. Der Ausflug nach Kiew war mit zahlreichen Unwägbarkeiten gespickt. Aber mit dem Flugzeug von Deutschland nach Kiew zu fliegen und dann direkt zum Treffpunkt zu fahren, wäre ungefähr genauso frevelhaft gewesen wie ein Flug von Frankfurt nach Santiago de Compostela mit Besuch der Kathedrale und Anbetung des heiligen Jakobus samt seinen Gebeinen und anschließender sofortiger Rückreise, statt die mühsame und anstrengende Pilgerreise über den Jakobsweg auf sich zu nehmen.
Man sagt, dass sich das Erhoffte am Wallfahrtsort umso eher einstellt, je mehr Anstrengungen der Wallfahrer auf sich genommen hat und je mehr Zeit ihm blieb, sich auf sein Ziel und die Begegnung mit der Putte, dem Schrein, dem Kreuz, den Knochen, der Asche, dem Geist, ganz allgemein dem spirituelle Kraft aussendenden Etwas, innerlich vorzubereiten.
Deshalb saß ich jetzt also im Bus und wusste nicht, ob mein Gepäck unversehrt geblieben war und ob ich am Zielort meiner Reise überhaupt plangemäß einträfe.
Auf dem Weg nach Simferopol gab es außer den drei bereits angefahrenen Haltestellen weitere 25, die sich hälftig auf die Küstenregion bis Aluschta und auf die längere Strecke im Inneren der Halbinsel aufteilten.
Als ich wieder zu dem Großvater und seiner Enkelin hinüberblickte, hing die Plastiktüte zusammengeknotet an der Haltegriffstange, die in Hüfthöhe hinter der Glaswand von links nach rechts und über meinem Gepäck verlief. Vermutlich hatte der Großvater die Tüte dort befestigt. Die Tüte mit ihrem Inhalt schaukelte nun im Rhythmus von Beschleunigen und Abbremsen hin und her. Die Straße hatte auf Anordnung von Präsident Janukowitsch in den vergangenen Jahren einen neuen Oberflächenbelag bekommen. Schlaglöcher, wie ich sie bei meinem ersten Besuch auf der Krim vor fast einem Jahrzehnt kennengelernt hatte, waren nicht zu sehen und beim Fahren auch nicht zu spüren. Der Bus glitt sozusagen über die zarte Haut der Straße nach Simferopol.
Wahrscheinlich hatte ich es dem Präsidenten höchstpersönlich zu verdanken, wenn die Tüte nicht riss. Denn unter seinem Vorgänger, dem im Westen zunächst höchst angesehenen, aber im Inland kraftlos gebliebenen Viktor Juschtschenko, hätten die Beschaffenheit der Straße und die hierdurch verursachten Stöße die Tüte mit der Süß-Sauer-Füllung vermutlich längst zum Reißen gebracht.
In diesem Moment gehörte ich zu den Profiteuren des Präsidenten, von denen es im Land und auf der Krim viele gab. Bei meiner Ankunft waren die gut ausgebaute Straße und der Präsident, der den Ausbau veranlasst hatte, hoch gepriesen worden. Für die meist russischsprachigen Krimbewohner bedeuteten die Straße und ihre Modernisierung bestimmt vierzig bis sechzig Minuten weniger Fahrzeit auf der Strecke Jalta–Simferopol. Ich konnte die Dankbarkeit dieser Menschen gut nachvollziehen. Die Krim und insbesondere das vom Krimgebirge eingefasste Jalta sind schön, aber von allen übrigen Orten der Welt fürchterlich weit weg. Nach Kiew zu fahren, war zu der Zeit meiner Reise auch ohne Schlaglöcher immer noch eine Tortur (und seit der Besetzung der Krim ohnehin bis auf weiteres unmöglich).
Irgendwo zwischen Artek und Aluschta verließen der Großvater und seine Enkelin den Bus. In Artek hatten zu Sowjetzeiten seit 1925 die Allunions-Pionierlager stattgefunden. Zunächst kamen Kinder und Jugendliche, um ihrer Tuberkulose Linderung zu verschaffen, später wurden vor allem Klassenbeste der Sowjetunion und der sozialistischen Bruderstaaten als Anerkennung für ihre Leistungen dorthin geschickt. Fidel Castro und andere Leitfiguren der kommunistischen Idee machten dem Lager ihre Aufwartung. Die Haltestelle zum Lager stammte aus diesen Zeiten. Plakate mit den alten Parolen und lebensgroße Pionierbilder, die auf zugeschnittenem Holzuntergrund klebten, zeugten vom Geist dieser Epoche und ragten zwischen den landschaftstypischen Zypressen und vereinzelten Palmen hervor. Aluschta machte von der Durchgangsstraße aus gesehen den Eindruck einer modernen postsozialistischen Bettenburg. Der Reiz der Stadt verbarg sich jenseits der Hauptstraße am Wasser, was schon Griechen und Skythen zum Siedeln veranlasst hatte.
Die Tüte aus dünnem Polyethylen hatte der Großvater zurückgelassen. An dieser Haltestelle stiegen mehrere Personen ein und aus. In Windeseile und ohne vorher Chancen und Risiken der Aktion abzuwägen, sprang ich von meinem Sitz auf und zu meinem Koffer und der darüber hängenden Tüte hin. Ich löste die Tüte vorsichtig und lief nach draußen, um sie in dem Abfalleimer der Haltestelle zu entsorgen. Als ich wieder im Bus war, klappten hinter mir die Türen zusammen. Ich war erleichtert.
Angesichts meiner nur rudimentären Russischkenntnisse und der Spontanität der Aktion hatte ich mich vorher nicht mit den übrigen Fahrgästen abgesprochen. Ich konnte nicht einschätzen, ob es Sinn gemacht hätte, andere Reisende anzusprechen und sie zu bitten, den Bus für mich entsprechend lang anzuhalten. Vermutlich sahen sie gar nicht das Problem, das ja auch nicht ihres war, sondern meins und natürlich das des Busfahrers, der den Bus am Ende hätte säubern müssen, wenn die Tüte irgendwann heruntergefallen oder gerissen wäre und mein Koffer eben nicht alles abgefangen hätte. Sonst hätten die Fahrgäste ja vorher auch den Großvater ansprechen und höflich zur Mitnahme des Kotzbeutels auffordern können. Jeder hatte wahrscheinlich genug eigene Probleme.
2
Vor zwei Wochen war ich nach Jalta gekommen, um mein Russisch zu verbessern. Das Ganze war die Idee meiner Lehrerin in Frankfurt gewesen. Sie hatte immer eine Reihe von ambitionierten, teilweise naiv wirkenden, manchmal jedoch genialen Ideen, die sie nicht nur für sich selber verfolgte, sondern die sie auch für andere Leute, wie eben für mich und solche, die danach fragten, bereithielt. Ich lernte bei ihr seit nunmehr drei Jahren Russisch, anfangs, als ich noch von einer beruflichen Verwendung meiner Sprachkenntnisse träumte, mit mehr Esprit, im Laufe der Zeit mit deutlich weniger. Die Idee der Mission war, Vokabular, Satzstrukturen und Klang in mein Sprachzentrum zu befördern und dort dauerhaft zu verankern. Dazu sollte ich eine Weile im Land verbringen, am besten in einer Familie oder – ich weiß nicht, wie meine Russischlehrerin darauf kam und wie sie sich das im Einzelnen vorstellte – bei einer jüngeren Dame, die mir Kost und Logis gewähren und mich darüber hinaus die Sprache lehren sollte gegen ein geringes Entgelt und zusätzlich das Versprechen, von mir eine Einladung nach Deutschland zu bekommen. So richtig ich die Idee fand, nach Russland zu fahren oder eben dorthin, wo die Russen in den vergangenen Jahrhunderten ihre Leute angesiedelt und die Sprache eingeführt hatten, so windig und unausgegoren erschien mir die ursprüngliche Idee, einfach ein Ticket zu kaufen und mit ausreichend textiler Wechselgarnitur und Kleingeld für drei oder mehr Wochen irgendwohin zu fliegen und dann auf das Gelingen der Aktion zu hoffen. Der jetzige Plan war oder schien zumindest durchdachter: Ich sollte in Jalta an der Universität Russisch lernen, mit oder in einer Familie leben, dort essen, trinken und wohnen, und alles sollte durch ein kulturelles Begleitprogramm eingerahmt sein. Als Gegenleistung wollte ich einige Vorträge über die Finanzkrise in Deutschland und der Welt, die Bankenlandschaft im Allgemeinen und die politische Situation in Deutschland halten. Durch dieses Tauschgeschäft sollte eine intensivere Verzahnung mit Kultur und Leben des Gastlandes sichergestellt werden, als dies durch Buchung eines üblichen Sprachprogramms zu erwarten gewesen wäre. Wir hatten, meine Russischlehrerin fungierte als eine Art Agentin, ein Vortragskonzept mit zehn verschiedenen Themen zur Universität geschickt. Die Universität hatte den Deal mündlich akzeptiert, war darüber hinaus aber zu keinen weiteren Zusicherungen bereit gewesen, wie man sich das in unseren Breitengraden bei einer Arbeitsaufnahme oder eben auch bei einer Urlaubsreise vorstellt. Vor der Flugbuchung hatte ich über meine »Agentin« um Angaben zum Auditorium gebeten, um die Vorträge entsprechend ausrichten zu können und – das war unausgesprochen der Hintergedanke meiner Nachfrage – um vor allem mehr Verbindlichkeit in das Agreement hineinzubekommen. Es wurden Studenten der höheren Semester, Professoren der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und Vertreter der örtlichen Bankenlandschaft angekündigt.
Ich hatte in den Wochen seit der Flugbuchung meine ganze Freizeit dafür verwendet, den angekündigten Vortragsreigen mit Inhalt zu füllen, die von mir vertretenen Thesen wissenschaftlich abzusichern und entsprechende deutsche und englische Foliensätze vorzubereiten. Wissenschaftlich gearbeitet hatte ich schon seit Studiumszeiten nicht mehr und Vorträge, zumal in einem solchen Umfang, waren eher die Ausnahme gewesen.
Nachdem die 737-800 der Ukrainian International Airlines sanft auf dem Flughafen von Simferopol gelandet war und ich Pass- und Gepäckkontrolle als einer der Letzten hinter mir gelassen hatte, stieg die Spannung. Jetzt sollte sich zeigen, ob der mündliche beziehungsweise per E-Mail fixierte Deal Bindungswirkung entfaltet hatte. Ich hoffte. Ich hatte keinen Plan B.
Bei meinem bisher einzigen Besuch auf der Krim kurz nach der Jahrtausendwende hatten wir in Simferopol übernachtet. Wir waren aus Kiew nachmittags oder frühabends mit dem Zug angekommen; eine Weiterreise nach Jalta war an diesem Tag nicht mehr möglich. Wir übernachteten in einem Hotel, das vom Abriss nicht mehr weit entfernt zu sein schien. Immerhin war das Zimmer zu kalt und das Klima der Steppe zu trocken für Kakerlaken, so dass wir die Unterkunft nicht mit ihnen teilen mussten wie die Tage zuvor bei meinem Aufenthalt in der auch unter den Krabbeltieren mit dem massiven Chitinpanzer beliebten Dniprmetropole. Außer uns war hier niemand abgestiegen. Der Taxifahrer hatte uns in das Hotel chauffiert, das mit seiner Ausstattung an ein Landjugendheim in den frühen sechziger Jahren erinnerte. Als wir am nächsten Morgen den Frühstückssaal betraten, waren wir die einzigen Gäste. Aber das würde sich vielleicht in der Hauptsaison ändern, die noch bevorstand. Es gab eine Art Frikadelle und Kartoffelpüree, dazu Muckefuck. Die Hauptstadt der damals noch autonomen Teilrepublik Krim machte auf Touristen keinen einladenden Eindruck. Man kam hier an oder flog von hier weg oder nahm den Zug. Wahrscheinlich konnte man aber inzwischen für 300 Dollar aufwärts die Nacht in einem Hotel der Spitzenklasse verbringen. Simferopol, das mitten in die Steppe gebaut war, war damals Ende Mai schon extrem trocken gewesen, für eine ausreichende Bewässerung von Grünflächen fehlten wahrscheinlich nicht nur das Geld, sondern auch nachhaltige Wasservorräte. Abends waren wir noch in einer Nachbarschaftsdiskothek unweit des Hotels gelandet. Hier aß ich meinen ersten Kaviar. Alles wirkte sehr unwirtlich. Simferopol war nicht Krakau, war nicht Leipzig oder Salamanca.
Ich trat aus dem Kontrollbereich in die Empfangshalle. Die meisten Reisenden waren schon abgeholt worden oder standen weiter hinten in der Empfangshalle in Gruppen zusammen und warteten auf Instruktionen ihrer Reiseleiter. Ein Schild mit der Aufschrift »Universität Jalta – Herr Silbermann« war unübersehbar. Erleichtert steuerte ich auf den Herrn zu, der das Schild hielt. Evgenij Leonidowitsch Slovianski. Evgenij, ein leicht untersetzter verschmitzt lächelnder Mittfünfziger mit grau meliertem, kurz geschnittenem Haar und Schnauzbart, begrüßte mich noch über das Absperrgitter hinweg und stellte mir die Zwillingsbrüder Vitalij und Vassilij vor.
Vitalij und Vassilij wusste ich später fast nie auseinanderzuhalten, es sei denn, sie übten gerade ihre Profession aus oder eine Tätigkeit, die der eine besser, der andere schlechter oder gar nicht konnte. An diesem Tag war das nicht anders. Beide trugen sie weiße Jeans und weiße Polo-Shirts, dieselbe Art von Turnschuhen (weiß), die gleiche Sonnenbrille, die gleiche Goldkette, die sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hatten und in die wahrscheinlich ihre Namen eingraviert waren. Daran hätte man sie dann unterscheiden können. Beide Brüder lehrten an der Universität. Der eine als Professor, der andere war als Dozent in derselben Bildungseinrichtung tätig. Die Geschwister hatten Evgenij begleitet, um mich vom Flughafen abzuholen, weil Evgenij zwar der Chef der Fakultät und ein anerkannter Wissenschaftler, aber ein vermutlich weniger überzeugender Autofahrer war. Vitalij besaß zwei Autos, wie er während der Fahrt nach Jalta berichtete, traute sich aber nicht, längere Strecken selbst zu steuern. Zu den größeren Distanzen zählte er auch die 90 Kilometer von Jalta nach Simferopol, für die man selbst bei guter Fahrweise und auch nach der erfolgten Generalsanierung immer noch annähernd zwei Stunden benötigte. Dafür war nun wiederum Vassilij, der Universitätsprofessor, mitgekommen. Vassilij saß gerne am Steuer. Je größer der Schlitten, desto lieber. Wir fuhren jetzt in einem BMW X5. Ich wollte nicht fragen, ob es der Wagen von Vassilij war oder eben der von Vitalij, den der sich nicht zu fahren traute. Gut möglich, dass sich beide je einen X5 zugelegt hatten. Ich fragte nicht nach. Stattdessen lobte ich die Nobelkarosse, die deutsche Ingenieurskunst im Allgemeinen und die Automobiltechnik im Besonderen. Nichts anderes wurde von mir erwartet. Jetzt auf die Pannenstatistik des ADAC und die bekannt gewordenen Manipulationen hinzuweisen, die Überlegenheit japanischer Zuverlässigkeit, das gute Preis-Leistungsverhältnis anderer europäischer Marken, wäre unter Umständen als zu kleinkariert interpretiert worden und – schlimmer noch – als vollkommen unpatriotisch. Wie ich später erfuhr, fanden es die Zwillinge sehr wichtig, mit dem Auto ihren sozialen Status zu unterstreichen. Man musste das Spiel der Neureichen und real weiter existierenden Apparatschiks mitspielen, wenn man anerkannt und ernst genommen werden wollte. Ein wenig so, wie in Deutschland dem Bankangestellten oder Investmentbanker eher geglaubt und ein sich anbahnender Betrug ignoriert wird, wenn der Banker im Nadelstreifenanzug auftritt anstatt in einer abgewetzten Jeans. So machten der X5 und sein Fahrer eben Eindruck auf die Studenten, die Universitätsleitung, die zuständige Regierungsbehörde der damals noch autonomen Teilrepublik Krim und möglicherweise auch im fernen, aber wichtigen Kiew. Also lobte ich den Fahrkomfort und fühlte mich auch aufgrund Vassilijs umsichtiger Fahrweise sicher.
Vassilij sprach während der Fahrt nur wenig. Das lag daran, dass er sich auf das Fahren konzentrieren wollte, aber auch an seinen weniger ausgeprägten Englischkenntnissen. Die Unterhaltung übernahm weitgehend Vitalij, der an der Fakultät Wirtschaftskurse in englischer Sprache gab. Evgenij hatte zwar vermutlich in der Vergangenheit ebenso Englisch gelernt, allerdings zu einer Zeit, als es zumindest jenseits des Eisernen Vorhangs unvorstellbar war, dass es dem Russischen einmal den Rang ablaufen könnte. Jetzt wollte er sich keine Blöße geben. Immerhin trug Evgenij die Gesamtverantwortung für das wissenschaftliche Tauschgeschäft. Dass man mir am Flughafen mit drei Leuten die Aufwartung gemacht hatte, lag folglich nicht ausschließlich an der Wertschätzung meiner Person, sondern eben auch an der real praktizierten Arbeitsteilung.
Wir schwebten über den Asphalt des Präsidenten. Zwischendurch tauchten am Straßenrand Frauen mit Kopftüchern auf. Ich sah ein Minarett. »Это Татары1«, sagte Evgenij. Ich hatte die Geschichte der Krimtataren nicht parat. Glücklicherweise war es ja weder für sie noch für die Russen oder Ukrainer auf der Krim ein Problem gewesen, dass sie alle verschiedenen Ethnien angehörten. Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, dürfte sich das Zusammenleben der Krimbewohner wahrscheinlich zum Schlechten verändert haben. Der Konflikt auf der Krim ist aus den Nachrichten verschwunden. Überschattet wird die Annexion der Krim durch die schon Jahre andauernden Kämpfe in der Ostukraine. Wenn ich anrufe, höre ich, dass sich die Jungen, wenn sie können, auf den Weg in die Hauptstadt machen oder weiter nach Westen, nach Lviv in den freien Teil der Ukraine. Auch die, die ihre Lehre und ihr Denken nicht dem Diktat des Autokraten in Moskau unterwerfen wollen, verlassen die besetzte Halbinsel. Was mit den Tataren ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich verhalten sie sich ruhig, um nicht unnötig aufzufallen. Man möchte hoffen, dass sich Geschichte2 nicht wiederholt.
Evgenij war mir mit seinem verschmitzten Lächeln sofort sympathisch gewesen. Er war einer, der immer wusste, was er sagte, aber nicht immer alles sagte, was er wusste. Einer, der Ironie verstand und bei dem ich später manchmal selbst nach reiflichem Abwägen der einen oder anderen Interpretationsmöglichkeit nicht wusste, wie er etwas genau meinte und ob er das, was er sagte, auch wirklich dachte. Einer, der Sachen andeutete, dem aber übertriebene Offenheit fremd war. Vielleicht war es einfach Unbekümmertheit, die ihm fehlte und mir im Gegensatz dazu meistens anhaftete. Jetzt während der Fahrt mühte ich mich, den Eindruck von Seriosität zu vermitteln, nicht zu viel zu sagen und vor allem nicht das Falsche. Schließlich war ich kein praktizierender Dozent, sondern Praktiker mit gelegentlicher Vortragserfahrung. Die Sprachbarrieren verhinderten, dass wir allzu viele Informationen austauschen konnten.
Vitalij erkundigte sich nach meinem akademischen Werdegang und lobte die Studenten für ihr hohes Niveau, ihre Internationalität und intellektuelle Reife. Ich hoffte mit meinen beschränkten Englischkenntnissen nicht zu hemdsärmelig daherzukommen und die Erwartungen an mich, die in diesem Moment noch höhergeschraubt wurden, nicht zu enttäuschen.
Dann fragte Vitalij, ob wir noch am Strand vorbeifahren sollten. Ich konnte ihn und seinen Bruder nicht einschätzen. Ich tat ihnen in diesem Moment womöglich Unrecht, vielleicht hätten sie sich auch durch einen Vergleich geehrt gefühlt. Sie erinnerten mich ein wenig an Playboys. Gunter Sachs, Alain Delon und russische Oligarchen wie Michail Prochorow und Boris Beresowski erschienen vor meinem geistigen Auge. Schillernd, zwielichtig, korrupt. Ich wusste ja, dass sich Jalta mittlerweile zu einer Art Saint Tropez des Ostens entwickelt hatte. Reiche Russen kamen en masse. Es wurde geprotzt und gefeiert. Koks und Nutten waren bestimmt keine Mangelware, bei denen, die es sich leisten konnten. Gorbatschow und alle sowjetischen Präsidenten vor ihm hatten hier ihre Sommerresidenz gehabt. Jetzt waren es ukrainische Präsidenten und Minister, die lieber das mediterrane Klima von Jalta genossen und mit russischen Oligarchen feierten, anstatt sich mit den schwierigen Geschäften des Regierungsalltags in Kiew herumzuquälen und dort mit schusssicherer Weste herumzulaufen.
Mit ihren weißen Jeans, der Sonnenbrille, den Edelsneakern, dem Goldkettchen und natürlich dem X5 kamen mir die Zwillinge in diesem Augenblick viel cooler und abgebrühter vor, als sie tatsächlich waren. Sie waren ganz in Ordnung, wie ich später feststellte.
Aber in diesem Augenblick wollte ich nicht mit ihnen in eine Bar an den Strand. In der Retrospektive weiß ich nicht, was mir derart widerstrebte. Irgendwie wartete schon genug Ungewissheit auf mich. Ich wusste nicht, wo ich die kommenden Wochen untergebracht werden sollte, wie die Vorträge ankommen würden. Immerhin schloss ich die Variante nicht aus, dass sie sagten: Kennen wir alles schon, das ist nichts Neues für uns, Dankeschön, auf Wiedersehen. So erging es mir manchmal bei meinen Reisen nach Polen. Da hatte ich drei Stunden schön mit einer meist jüngeren Dame getanzt, und dann verschwand sie plötzlich, weil zu Hause noch der Freund wartete oder mein Deo plötzlich versagte. Ich stand dann allein da und überlegte, wie der angefangene Abend sinnvoll zu Ende zu bringen wäre. Mein Rückflug ging in drei Wochen. Auf der Arbeit hatte ich nur einer Hand voll Leuten erzählt, was ich auf der Krim vorhatte. Zu peinlich, wenn der Plan scheiterte. Ich wollte die Sache langsam anlaufen lassen.
Oder die Sache mit Masha. Die hatte ich, kurz nachdem ich nach Frankfurt gezogen war, bei einer Internetkontaktbörse kennengelernt. Wir hatten uns ziemlich schnell zum gemeinsamen Joggen verabredet. Ich erzählte – vollkommen unprofessionell – total viel von mir, anstatt ihr den aktiveren Part zu überlassen. Als die große Runde im Huthpark geschafft war, ging sie zu ihrem Fahrrad, sagte: »Dankeschön, Wiedersehen, aber ich weiß noch nicht, ob wir uns wiedersehen.« Das Ch wie bei lachen und sehen wie säen. Ich war damals etwas bedröppelt nach Hause gefahren, denn ich hatte mir den ganzen Samstagabend in Erwartung einer spannenden Begegnung freigehalten. Ähnliches sollte mir jetzt nicht mit meiner Vortragstätigkeit widerfahren. Zum einen natürlich der Sache selbst wegen, aber auch, weil ich ja schon eingeplant hatte, wenn irgend möglich, an einem Wochenende nach Kiew zu fahren.