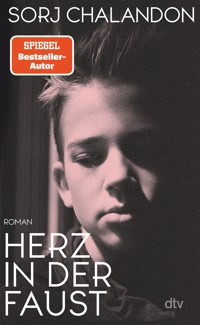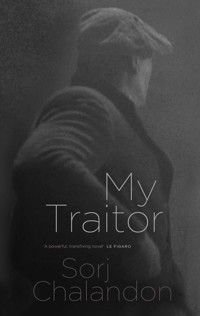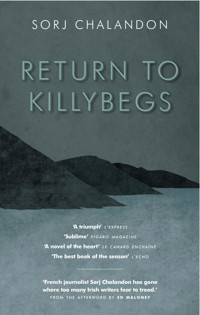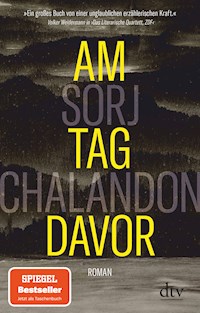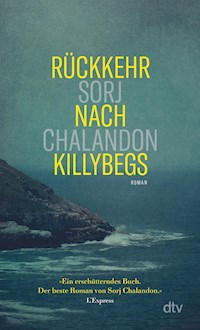11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine kraftvolle literarische Konfrontation mit der Schuld der Väter »Dein Vater stand auf der falschen Seite.« – ein Satz, der die Familie zerreißt. Seit seiner Kindheit quält den Erzähler eine Frage: Was hat der Vater während der Besatzungszeit gemacht? Doch er traut sich nie, ihn zu fragen, zu unberechenbar, zu gewalttätig ist dieser Vater. Im Mai 1987, als in Lyon der Prozess gegen den NS-Verbrecher Klaus Barbie eröffnet wird, berichtet der Sohn als Journalist einer großen französischen Tageszeitung. Und erfährt am selben Tag, dass die Gerichtsakte seines Vaters im Archiv schlummert. Und so ist es nicht ein Prozess, der gerade begonnen hat, es sind zwei. Die sprachgewaltige, schmerzhafte Auseinandersetzung Chalandons mit der Wunde seines Lebens und Schreibens, dem Vater als Verräter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sorj Chalandon
Verräterkind
Roman
Aus dem Französischen von Brigitte Große
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für meine Lektorin Martine Boutang,
die mich seit 2005 von Roman zu Roman auf dem steinigen Weg zu meinem Vater, meinem ersten Verräter, begleitete
»Dieses Individuum ist ein Lügner von erstaunlichem Einfallsreichtum. … Es muss als höchst gefährlich betrachtet und entsprechend behandelt werden.«
Vertrauliche Notiz von Kommissar Victor Harbonnier, Chef des Inlandsgeheimdienstes der Region Lille, über meinen Vater (19. Dezember 1944)
»Verzeihen Sie meinen schlechten Stil, Herr Richter, aber ich bin Soldat und kein Romanschriftsteller.«
Aus einem Brief meines Vaters an den Untersuchungsrichter Henri Vulliet, geschrieben im Gefängnis von Loos (21. Juni 1945)
1
Sonntag, 5. April 1987
»Da ist es«, hörte ich mich selbst murmeln.
Da, am Ende der Départementale.
Einer Straße, die sich in Serpentinen durch die friedlichen Weinberge und Felder des Ain schlängelt und dann zwischen Trockenmauern und den ersten Bäumen des Waldes einen Hügel hinan stürmt. Lyon ist weit, im Westen, hinter den Bergen. Auf der anderen Seite liegt Chambéry. Aber hier ist nichts. Nur ein paar Höfe aus großen, grob behauenen Steinen verschanzen sich am Fuß der ersten Felsausläufer des Jura.
Ich setzte mich auf eine Böschung. Widerwillig nahm ich meinen Stift heraus. Ich hatte hier nichts zu tun. Ohne den Blick von der Straße zu lösen, schlug ich mein Heft auf.
»Da war es«, vor dreiundvierzig Jahren und einem Tag.
Dieselbe Landstraße in der Ferne unter dem gleichen kalten Frühlingslicht.
Am Donnerstag, dem 6. April 1944, tauchten sie im Morgengrauen an dieser Biegung auf. Ein Auto der Gestapo, dahinter zwei zivile Lastwagen mit Männern aus der Gegend am Steuer. Einer von ihnen hieß Godani. Zurück in Brens, bei seinem Arbeitgeber, sagte er:
»Das war Drecksarbeit.«
Aber an diesem Morgen hörte ich nur den Wind. Und einen Traktor auf einem Feld rumoren.
Ich setzte mich langsam in Gang, um den Moment hinauszuzögern, in dem das Haus auftauchte.
Links ein Weg, ein langer, schmiedeeiserner Zaun, eine Hummel streifte mich, ein schlecht gelaunter Hund kläffte hinter einer Scheune.
Dann das Haus. Ein massiges, geducktes, von runden Ziegeln gedecktes Gebäude mit Dachgaube. Zwei Stockwerke mit grünen Fensterläden hoch über dem Tal, weiße Fliederdolden über der Hecke, Löwenzahn auf der Wiese und ein großer Brunnen mit ausgetrockneten Wasserspeiern im Zentrum eines unkrautbewachsenen Hofs.
Da ist es.
Madame Thibaudet erwartete mich an den drei Stufen zur Terrasse.
»Sind Sie der Journalist?«
Ja, genau. Der Journalist. Ich antwortete mit einem Lächeln und einer ausgestreckten Hand.
Die Frau ging voran. Sie öffnete die Tür zum Esszimmer, blieb wie angewurzelt in einem Winkel stehen. Mit hängenden Armen und gesenktem Blick. Sie wirkte befangen. Ihre Augen wanderten die Wände entlang, an meiner Anwesenheit vorbei.
Ich störte ihren friedlichen Tag.
Diese höfliche Verlegenheit, das Verstummen am Ende der Sätze, begegnete mir im ganzen Dorf. Bei den Jüngsten wie bei den Ältesten. Ein Fremder, der zu Fuß auf der Straße zum Haus wandert? Wen sucht er denn da? Was will er hier finden, nach all den Jahren?
Izieu hatte genug davon, als das Dorf zu gelten, das vor den Deutschen gekuscht hatte. Wo vermutlich irgendein Mistkerl die jüdischen Kinder verraten hatte.
Wer das war? Na, vielleicht Lucien Bourdon, ein Bauer aus Lothringen, der bei der Gestapo-Aktion dabei war und zwei Tage später nach Metz zurückkehrte. Er wurde zur Wehrmacht eingezogen und schließlich als Aufseher eines Gefangenenlagers in Saarbrücken von der amerikanischen Armee verhaftet. Ja, das könnte der Verräter gewesen sein. Doch wurde er mangels Beweisen nicht für das Martyrium der Kinder von Izieu belangt.
Aber wer sonst? Père Wucher vielleicht, der Konditor von La Bruyère, der seinen achtjährigen Sohn René-Michel angeblich wegen seiner Wildheit ins Kinderheim von Izieu gegeben hatte? Der Junge wurde am 6. April mit den anderen verschleppt, sprang aber während der Fahrt nach Lyon vom Lastwagen und wurde von den Deutschen vor dem Geschäft seines Vaters freigelassen, da er kein Jude war. Die Résistance hatte Wucher bald im Verdacht, sein Kind unter einem Vorwand ins Heim geschickt zu haben, damit es die anderen ausspionierte. Ein paar Tage später holten ihn die Partisanen ab und erschossen ihn im Wald von Murs. Ohne Geständnis.
Wer hatte die Kinder verkauft? Waren sie denn überhaupt verraten worden? Das Dorf war der Fragen müde. Wenn es 1944 einen Spitzel gegeben haben sollte, hätte es jeder sein können. Ein Weiler mit 146 Verdächtigen. Und womöglich lebte der Kotzbrocken immer noch dort, verkrochen hinter seinen Fensterläden.
*
Die Kinder stammten von überallher. Polnische Juden, die vor dem Krieg Pariser Jungs geworden waren. Aus Baden und der Pfalz vertriebene Deutsche. Österreicher auf der Flucht vor dem Anschluss. Kinder aus Brüssel und kinderen aus Antwerpen. Kleine Franzosen aus Algerien, die 1939 im Mutterland Zuflucht gesucht hatten. Manche waren in den Lagern von Agde, Gurs oder Rivesaltes interniert, bevor Sabine Zlatin sie herausschmuggelte, eine Krankenschwester, der, weil Jüdin, von einem Lyoneser Krankenhaus gekündigt worden war. Die Eltern trennten sich freiwillig von ihren Kindern, um sie nach dem Ende des Krieges wieder in die Arme schließen zu können. Das war ihre letzte Hoffnung. Niemand würde den Kindern Böses antun können. Madame Zlatin hatte ein Haus auf dem Land gefunden, mit Blick auf die Chartreuse und den nördlichen Vercors. Ein Ferienheim. Einen friedlichen Hafen.
Das in einem Weiler außerhalb von Izieu versteckte Haus wurde im Mai 1943 zum Kinderheim. Durchgangsort und Stützpunkt auf dem rettenden Weg zu Pflegefamilien und der Schweizer Grenze. Diesen Zufluchtsort vorgeschlagen hatte Pierre-Marcel Wiltzer, der patriotische Unterpräfekt von Belley.
»Dort wird man Sie in Ruhe lassen«, versprach der hohe Beamte der polnischen Krankenschwester und ihrem Mann Miron.
Und das wurden sie auch, fast ein Jahr lang.
Das Haus hatte keine Heizung und kein fließendes Wasser, aber Holzöfen. Im Winter wärmten die Erzieher das Waschwasser in einem Kessel auf. Im Sommer wuschen sich die Kinder im großen Brunnen. Badeten in der Rhône. Spielten auf der Terrasse und sangen abends Lieder. Sie hatten genug zu essen. Von der Unterpräfektur bekamen sie Essensmarken, und die Größeren betreuten einen Gemüsegarten.
In der Colonie d’enfants réfugiés de l’Hérault, so der offizielle Name auf dem Briefkopf, gab es keine deutsche Uniform, keinen gelben Stern. Nur nachts fürchteten sich die Kleinen, so ganz ohne ihre Eltern. Auf den Hügeln über Bugey und Dauphiné konnte ihnen nichts passieren. Sie versteckten sich nicht einmal. Das Gras war hoch, die Bäume waren buschig, ihre Stimmen hell. Und der Krieg war weit weg.
Eine Handvoll Erwachsene unterstützte Sabine und Miron Zlatin.
»Was für ein Paradies!«, sagte Léon Reifman lächelnd, als er dort ankam.
Der Medizinstudent war an der Gründung des Hauses beteiligt, er kümmerte sich um die Kranken. Im September 1943 löste ihn seine Schwester Sarah, eine Ärztin, ab, weil er vom Pflichtarbeitsdienst STO gesucht wurde und das Heim nicht in Gefahr bringen wollte.
Die Zlatins stellten auch die einundzwanzigjährige Gabrielle Perrier ein, die vom akademischen Inspektorat zur Lehrerin für das Kinderhaus ernannt wurde. Noch ein Geschenk von Unterpräfekt Wiltzer. Die Schüler seien »Flüchtlinge«, hieß es. Offiziell war nie von Juden die Rede. Man vermied dieses Wort. Vor der Trennung hatten die Eltern ihren Kindern eingeschärft, dass es gefährlich sei, ihre Herkunft zu gestehen. Von den Überlebenden, die am 6. April nicht im Haus waren, erzählten einige später, jeder hätte sich für den einzigen Juden im Haus gehalten. Aber alle wussten, dass die Lehrerin Bescheid wusste.
Während des Schuljahrs gingen vier Jugendliche als Internatsschüler ans Collège in Belley. Sie kamen nur in den Ferien zurück. Für die Jüngeren wurde ein Klassenraum im ersten Stock eingerichtet. Mit von den Nachbargemeinden gespendeten Pulten, Büchern, Schreibtafeln und einer Weltkarte an der Wand. Die Lehrerin, die immer eine Trillerpfeife dabeihatte, nahm die Kinder unter ihre Fittiche. Das ging vom Trost für den kleinen Albert Bulka, der erst vier war und von allen Coco genannt wurde, bis zum Unterricht für den zwölfjährigen Max Tetelbaum.
*
»Hier wurden sie unterrichtet«, sagte Madame Thibaudet.
Eine Treppe aus Holz und Terrakottafliesen führte zu einer Art Speicher. An den weißen Wänden verblichene, rissige Fotos. Friedliche Bilder von Kühen, Pferden, Bergen. Eine patriotische Zeichnung mit einem Hahn und einem Kind.
Es war kalt.
Madame Thibaudet drückte sich wieder an der Wand entlang. Mit dem Kinn deutete sie auf drei Pulte in einer dunklen Ecke.
Schweigen.
»Sonst ist nichts mehr übrig?«
»Nein. Wir haben nur diese Bänke behalten.«
Ich schaute sie an, sie senkte den Blick. Wie ertappt.
»Als wir ankamen, war alles vermodert, weil das Dach undicht war. Kleider und Matratzen haben wir im Hof auf einen großen Haufen geworfen. Und alles verbrannt.«
Es gelang mir nicht, ihr in die Augen zu schauen.
»Alles verbrannt?«
Sie zuckte mit den Schultern.
»Was hätten wir denn sonst damit machen sollen?«, fragte sie in weinerlichem Ton.
Ich näherte mich dem ersten Tisch mit anhängender Bank. Auf dem Holz waren verblasste Spuren von schwarzer Tinte.
»Darf ich?«
Sie gab keine Antwort. Ließ nur müde die Schultern hängen. Ich durfte.
Mit angehaltenem Atem klappte ich das Pult auf. Meine Hand zitterte. Innen an der Schreibplatte klebte ein Blatt Papier, der Anfang eines vergilbten Kalenders, mit violetter Tinte in Schönschrift beschrieben: Sonntag, 5. März 1944, Montag, 6. März, Dienstag, 7. März. Ein ganzer Monat in Reih und Glied.
»Und das?«
Die Besitzerin beugte sich über das holzgerahmte schwarze Rechteck.
»Eine Tafel?«
Ja. Eine Schiefertafel, die ein Schüler in den Tiefen seines Pults vergessen hatte. Nie entdeckt, nie gesehen. Für niemanden von Interesse. Eine ungeschickte Hand hatte »Apfel« darauf gekrakelt.
Ich schaute zu der Frau auf. Sie sah unbeteiligt drein. Als wäre sie ganz woanders. Strich mit beiden Händen über ihre Schürze.
Ich drehte mich um, das Gesicht zur Wand.
Nur kurz, für einen Augenblick. Ein tränenloses Schluchzen. Die Zeit, die ich brauchte, um mir diese fünf Buchstaben auf ewig einzuprägen. Ich hörte die Kreide auf der Tafel quietschen. Wer von euch hat das hier wohl geschrieben?
Als ich mich wieder der Frau zuwandte, sah ich, dass sie mich peinlich berührt beobachtete.
Meine Erschütterung brachte sie in Verlegenheit.
*
Als am 6. April 1944 der deutsche Konvoi vorfuhr, hatte gerade die Glocke zum Frühstück gerufen.
Es war der erste Tag der Osterferien. Alle Kinder waren im Haus. Auch die Feriengäste. Kakao dampfte in den Schalen, was selten vorkam, ein Geschenk von Père Wucher, dem Inhaber der Confiserie Bilbor.
Nach all den Jahren lag der große Speisesaal im Halbdunkel, Madame Thibaudet war an der Schwelle erstarrt. Die Fensterläden geschlossen, leuchtende Stäubchen in den Lichtstrahlen. Das Parkett erneuert, die Decke frisch gestrichen. Ranziger Modergeruch. In einer Ecke war ein Gipsplacken von der Wand gefallen. Am Tag der Razzia hatte Madame Thibaudet in der Dichtungsfabrik in Belley gearbeitet, 25 Kilometer entfernt. 1950 wurde sie zur Besitzerin des Gebäudes.
Die gleiche vage Kinnbewegung in den großen Saal hinein.
»Der Tisch stand in der Mitte, und alle saßen drumrum.«
*
Plötzlich sprangen Soldaten aus den Lastwagen. Zehn, fünfzehn? Das Gedächtnis der Zeugen hatte gelitten. Sie gehörten dem Flakbataillon 958 und der 272. Infanteriedivision an. Einfache Soldaten, Wehrmacht, keine SS. Die wenigen Zeugen erinnerten sich, dass drei Gestapo-Männer in Zivil den Trupp befehligten. Einer von ihnen schien der Chef zu sein. Er lehnte mit Schlapphut und Gabardinemantel am Brunnenrad, während seine Leute brüllend ins Haus stürmten.
»Hau ab, die Deutschen sind da!«
Das waren die letzten Worte von Sarah, der Ärztin, an ihren Bruder Léon.
Der junge Mann kam gerade die Treppe herunter. Rannte sofort wieder nach oben. Sprang aus einem Fenster im ersten Stock an der Rückseite des Hauses. Lief in die Felder. Versteckte sich in einem Brombeergestrüpp. Ein Soldat machte sich auf die Suche nach dem Flüchtigen. Suchte überall, schlug mit dem Gewehrkolben auf das Dickicht.
»Er war so nah bei mir. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er mich nicht gesehen hat«, sagte Dr. Léon Reifman viele Jahre danach aus.
Als Wehrmachtsoffiziere später das Kinderhaus von Izieu in Besitz nahmen, bezeichneten sie die Gestapo-Leute als »Saubande«. Andere sagten offen, es tue ihnen leid, dass Soldaten in diese Operation verwickelt gewesen seien.
Alles ging sehr schnell. Es war das Grauen. Die Soldaten traten die Türen ein, rissen die Kinder vom Frühstückstisch, durchsuchten den Klassenraum, die Dachböden, schauten unter die Betten, die Tische, in jeden Winkel, jagten die Nachzügler die Treppen hinunter und trieben das zitternde Häuflein auf der Terrasse zusammen. Keine Kleidung zum Wechseln, keine Koffer, keine Taschen, nichts. In ihren Morgensachen wurden sie aus dem Haus getrieben und auf der großen Terrasse umzingelt. In Angst und Schrecken. Die Größeren nahmen die Kleinen in den Arm, damit sie zu schreien aufhörten.
Julien Favet hat die Kinder weinen gesehen.
Der Bauernbursche war auf dem Feld. Aber anders als sonst kam an diesem Morgen keines von den Kindern, um ihm etwas zu essen zu bringen. Er machte sich Sorgen. Deshalb beschloss er, auf dem Weg zum Hof seiner »Herrschaft«, wie er sagte, beim Kinderhaus vorbeizuschauen. In kurzen Hosen, mit nacktem Oberkörper, voller Erde. Er sah Lucien Bourdon, der sich als »vertriebenen Lothringer« bezeichnete, zwischen den deutschen Lastwagen umhergehen.
Ein Soldat hielt Favet an.
»Sie Fenster gehupft?«, radebrechte er auf Französisch.
Die Deutschen suchten noch immer nach dem flüchtigen Léon.
Julien Favet verstand nicht, was sie von ihm wollten. Er war ein schlichtes Gemüt. Ein Knecht, wie er selbst sagte. Der Mann im Gabardinemantel, der am Brunnen lehnte, ging auf ihn zu, den Hut tief in die Stirn gezogen. Blieb vor ihm stehen. Musterte ihn lange schweigend.
Jahre später erkannte Favet das Gesicht und den Blick auf Zeitungsfotos wieder. Und versicherte, ja, dieser Mann war es, der ihm am 6. April 1944 in Izieu befohlen habe, nach Hause zu gehen. Nein, er habe keinerlei Zweifel. Er habe sich sogar dessen Namen gemerkt.
»Und dann sagt Klaus Barbie zu mir so was wie: Geh!«
Favet beobachtete, wie die verschreckten Kinder mit Tritten auf die Lastwagen getrieben wurden. Zwei Jugendliche versuchten zu fliehen. Sie sprangen von der Ladefläche. Théo Reis wurde wieder eingefangen. Dann auch sein Leidensgenosse. Die beiden wurden geschlagen, über den Boden geschleift und auf ihre schreienden Kameraden geworfen.
»Wie Kartoffelsäcke«, sagte Lucien Favet später aus.
Der Bauer Eusèbe Perticoz wollte zu ihm, wurde aber von den Soldaten daran gehindert.
»Monsieur Perticoz, verlassen Sie nicht das Haus, bleiben Sie, wo Sie sind!«, rief ihm Miron Zlatin vom Lastwagen aus zu.
Ein Deutscher brachte ihn zum Schweigen. Rammte ihm den Gewehrkolben in den Bauch, trat ihm mit dem Stiefel gegen das Schienbein, berichtete Julien Favet.
»Der Stoß mit dem Gewehr hat ihn zu Boden geworfen, er musste sich in den Lastwagen legen, und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
Gemeinsam mit den vierundvierzig Kindern wurden sieben Erwachsene deportiert. Neben Miron Zlatin befanden sich noch Lucie Feiger und Mina Friedler auf den Lastwagen. Und die Überlebenden der Familie Reifmann: Sarah, die Ärztin, die ihrem Bruder zur Flucht verholfen hatte, Eva, ihre Mutter, und Moshé, ihr Vater. Die siebte, Marie-Louise Decoste, war Putzfrau im Kinderhaus. Auch sie wurde mitgenommen.
Am Tag davor war die Lehrerin, nachdem sie den Kindern ein paar Lektionen über die Ferien aufgegeben hatte, zu ihrer ein paar Kilometer entfernt lebenden Familie heimgekehrt. Bevor sie losfuhr, begegnete sie den Jugendlichen, die aus dem Internat kamen. Und Léon Reifman, der mit seiner Schwester, der Ärztin, den Eltern und seinem zehnjährigen Neffen Claude, die sich alle hier versteckt hielten, Ostern im »Paradies« verbringen wollte.
Auch die Direktorin war nicht im Haus. Sabine Zlatin war unterwegs nach Montpellier. Die Gestapo führte überall Razzien durch, in Savoyen, Isère, der ganzen Gegend. Die Deutschen und die französische Miliz hatten in Chambéry »Flüchtlinge« verhaftet. Jüdische Kinder aus Voiron verschleppt. Unterpräfekt Wiltzer war nach Châtellerault versetzt worden. Das Kinderhaus in Izieu war nicht mehr sicher. Deshalb suchte Sabine Zlatin eine neue Zuflucht für ihre Schützlinge. Eine Sekretärin der Unterpräfektur von Belley informierte sie per Telegramm von dem Unglück: »Familie krank – Krankheit ansteckend.«
Die Unglücklichen kamen noch am selben Tag ins Gefängnis im Fort Montluc in Lyon. Die Kinder saßen in der Zelle auf dem Boden. Die Erwachsenen wurden nach dem Verhör stehend an die Wand gekettet.
Am nächsten Tag wurden alle mit einer Straßenbahn der Transports lyonnais zum Bahnhof von Perrache gebracht, dann mit einem Zug der SNCF nach Paris und von dort in Bussen der RATP quer durch die Stadt ins Lager Drancy, wo sie am 8. April 1944 ankamen.
Dort wurden sie von der französischen Polizei unter den Nummern 19185 bis 19235 registriert.
Am 13. April, als vom Bahnhof Bobigny der Transport Nr. 71 nach Ausschwitz-Birkenau abgehen sollte, bekam Marie-Louise Decoste die Erlaubnis, das Lager zu verlassen. Da gestand sie, dass ihr französischer Ausweis gefälscht war. Dass sie eine polnische Jüdin war. Und dass ihr wahrer Name Léa Feldblum lautete. Sie wollte die Kinder nicht im Stich lassen.
Vierunddreißig Kinder waren bei diesem ersten Transport dabei, auch der vierjährige Coco. Die anderen wurden in Zweier- oder Dreiergruppen bis zum 30. Juni 1944 nach Polen deportiert. Nach zwei entsetzlichen Nächten, zusammengepfercht im Zug, wurden Kinder, Kranke, Alte und Schwache sofort bei der Ankunft im Lager von den arbeitsfähigen Erwachsenen getrennt.
Léa Feldblum, die Französin mit den gefälschten Papieren, erzählte später, dass sie und die Ärztin Sarah den Arbeitskommandos zugeteilt waren. Sie standen in der Reihe jener Deportierten, die auf Baustellen schuften sollten. Doch als Sarah sah, wie ihr zehnjähriger Sohn Claude von einem Soldaten zu den Schwächsten gestoßen wurde, und ihn ihren Namen schluchzen hörte, wechselte sie abrupt die Seite. Und eilte zu ihrem Sohn, um ihn in die Arme zu schließen.
Ein SSler fragte die Betreuerinnen, die den Kindern von Izieu beistanden, auf Deutsch: »Sind Sie ihre Mütter?« Edith Klebinder, eine deportierte österreichische Jüdin, wurde zur Übersetzerin bestimmt. Sie überlebte. Und erzählte später:
»Ich habe die Frage ins Französische übersetzt. Und die Frauen haben geantwortet: ›Nein. Aber wir sind fast ihre Adoptivmütter.‹«
Derselbe Soldat fragte die Frauen dann, ob sie die Kinder begleiten wollten.
»Natürlich haben sie Ja gesagt.«
Dann stiegen die Betreuerinnen und die Kinder zu Sarah und Claude in den Lastwagen.
Einen Monat später wurden der Direktor des Kinderheims von Izieu, Miron Zlatin, sowie Théo Reis und Arnold Hirsch, zwei jugendliche Feriengäste vom Collège in Belley, aus Drancy mit einer Gruppe arbeitsfähiger Männer nach Estland deportiert.
Dort wurden sie in einem Steinbruch verschlissen und im Juli 1944 von der SS in der Festung von Tallinn erschossen.
Von allen aus Izieu Verschleppten hat nur Léa Feldblum überlebt, sie wurde im Januar 1945 von der Roten Armee befreit. Während ihrer Gefangenschaft diente sie den Naziärzten als Versuchskaninchen. In ihren Unterarm war die Nummer 78620 eintätowiert. Ihr Körper war gezeichnet. Sie wog nur noch 30 Kilo.
Léon Reifman, der sich mit einem Sprung durchs offene Fenster gerettet hatte, fand ganz in der Nähe Unterschlupf. Er wurde vom Bauern Perticos und dessen Knecht Favet versteckt und dann von einer französischen Familie in Belley aufgenommen. Auch er hat überlebt.
Wie Yvette Benguigui, ein zweijähriges Mädchen, das von der Familie Héritier vor der Razzia aus dem Heim geholt und mitten in Izieu versteckt gehalten wurde.
*
Madame Thibaudet wurde langsam ungeduldig. Sie sagte nichts, aber ich spürte an ihren Bewegungen, dass der Besuch beendet war. Sie beobachtete mich beim Schreiben von Sätzen, von deren Inhalt sie nichts ahnte. Auf die rechten Seiten kam alles, was ich für meine Reportage brauchen könnte. Auf die linken meine Gefühle. Die Tafel mit dem Wort »Apfel« rechts, der Stein im Magen links.
»Verwandle deine Tränen in Tinte«, hatte mir mein Freund François Luizet geraten, ein Reporter des Figaro, als er mich vor ein paar Jahren im Süden Beiruts ohne Stift und Papier orientierungslos auf einem Bürgersteig sitzen sah, wo ich über die eben entdeckten Massaker in Sabra und Schatila weinte.
Also schrieb ich alles auf. Jede Lichtpartikel, jeden Flügelschlag des Schweigens, jede Spur, die die Kinder hinterlassen hatten. Auf einem Balken im Speicher stand: »Paulette liebt Théo, 27. August 1943«. Paulette Pallarès war ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das manchmal im Heim aushalf. Théo Reis wurde mit sechzehn in Tallinn erschossen. Die Liebeserklärung kam auf eine rechte Seite. Meine Trauer auf eine linke. Ich schrieb alles auf. Beschrieb das Klassenzimmer, den Schlafsaal, die Treppen nach draußen. Lehnte mich an den Brunnenrand und schilderte den Gesang einer Lerche, die Schönheit der Gegend, das Schweigen der Berge, die Ruhe, die das Haus umgab. Setzte mich auf die Terrasse. Legte meine Hände auf alles, was die Kinderhände berührt hatten. Das Treppengeländer, das raue Holz eines Schreibtischs, eine kühle, nach Salpeter riechende Mauer, ein Fensterbrett, den Kopf eines Wasserspeiers, die Rinde eines Baumes, hinter dem sie gespielt hatten. Rupfte ein bisschen Unkraut aus.
Ich hoffte, dass dieser Ort eines Tages geheiligt würde. Durch den Prozess gegen Klaus Barbie würde das Haus wieder ins Rampenlicht kommen. Aber ich fürchtete auch, dass nichts bliebe außer der Kälte, dem Schweigen, dem alten Geruch. Nicht die Pulte, nicht die Tafel mit dem Apfel, nicht die Liebe zwischen Paulette und Théo, nichts von den lebenden Kindern, außer einem Denkmal für ihr Martyrium. Eine Totenstadt für ihr verklungenes Lachen.
Ich ertappte Madame Thibaudet dabei, dass sie verstohlen auf die Uhr sah. Wie eine Büroangestellte, wenn es Zeit ist, den Mantel vom Haken zu nehmen und nach Hause zu gehen.
Als ich kam, war ich ihr zu viel. Jetzt fiel sie mir auf die Nerven. Ich wäre lieber mit Max, mit Renate und dem kleinen Albert allein geblieben. Warum vertrat sie sich nicht neben der Scheune ein wenig die Füße? Dieses ewige Zaudern, diese fliehenden Blicke, ihr verlegenes, ärgerliches Gehüstel!
Ich war ungerecht. Das war mir klar. Madame Thibaudet hatte mir die Tür zu den Kindern geöffnet und mich freundlich überallhin begleitet. Jetzt wollte sie, dass ich zum Ende käme. Dass ich Heft und Stift wegsteckte. Und dahin zurückkehrte, wo ich hergekommen war.
Also klappte ich mein Heft zu. Und schob den Stift in die Spiralbindung.
Sie konnte sich einen Seufzer nicht verkneifen. Ich war fertig. Wir waren quitt.
Als ich ihr auf der Terrasse die Hand gab, fragte sie:
»Wann läuft das im Fernsehen?«
Ich lächelte. Es gab kein Team, keine Kamera, kein Mikro. Wieso Fernsehen?
Sie war verblüfft.
»Ich dachte, Sie sind Journalist?«
»Ja, bei einer Zeitung.«
Ihr leicht enttäuschter Blick.
»Ach so, bei einer Zeitung …«
Dann wandte sie mir den Rücken zu. Stieg die drei Stufen hinauf. Kehrte zurück zu den Kindern wie in ihr eigenes Heim.
*
Ich ging an dem schwarzen Schmiedeeisenzaun entlang und über den gleichen Weg zurück. Das massige, geduckte, von runden Ziegeln gedeckte Gebäude mit seiner Dachgaube. Immer noch kläffte der Hund hinter der Scheune. Unterwegs pflückte ich zwei Fliederdolden und einen Löwenzahn. Erreichte die Landstraße. Die Départementale, die sich in Serpentinen durch Weinberge und friedliche Felder schlängelt. Setzte mich auf die Böschung. Ließ meinen Blick über den Hügel schweifen, die Steinmauern, die ersten Bäume des Waldes. Die Berge.
Dann legte ich meine Blumen da hin, an den Rand der Landstraße, auf das Grab, das man hier nicht erwartete.
Und drehte mich ein letztes Mal um. Das Licht war zu schön.
Da war es.
Ich habe geträumt, dass du mit mir dort bist, Papa.
Nein, ich wollte dich nicht in die Ecke des großen Speisesaals treiben und dich zwingen, die Wahrheit zu sagen oder deine Taten zu bereuen. Sondern mit dir die Straße entlanggehen. Unsere Hände nebeneinander auf den Brunnenrand legen. Dich zittern sehen in der Kälte, in der auch ich fror. Das Parkett unter deinen Schritten seufzen hören. Deinen Atem auf der Treppe zum Klassenraum. Dir die Tafel mit dem Apfel reichen und deinen Vaterblick auf dieses Kindergekrakel beobachten. Ich wollte, dass du dich an den Rand eines Bettes setzt. Dass du den Betreuerinnen zuhörst, die den Kindern im Halbdunkel eine Gutenachtgeschichte erzählen. Eine einzige für die Mädchen, verschiedene für die Jungen. Die waren schwieriger. Vor allem Émile Zuckerberg, der kleine fünfjährige Belgier aus Antwerpen. Er hatte tagsüber Angst und fürchtete sich nachts. Er brauchte immer eine erwachsene Person an seiner Seite. Eine zweite Mutter, nur für ihn. Ich wollte dir erzählen, dass Dr. Mengele ihn von Léa Feldblums Hand fortgerissen hat.
Und vielleicht, wenn wir beide wieder gegangen wären und die Thibaudet in den Fängen ihrer Gespenster zurückgelassen hätten, wären wir am Rand des Weges stehen geblieben. Du hättest es dir so gewünscht. Eine Pause vor unserer Rückkehr in die Welt der Lebenden. Und vielleicht hättest du mit mir gesprochen. Ohne mich anzusehen, den Blick über die Berge. Nein, gestanden hättest du nicht. Du hast deinem Sohn nichts zu beichten. Aber du hättest mir helfen können, zu erkennen und zu verstehen. Mir erklären, warum du mir so viele Jahre nach dem Krieg die Frage stelltest, ob die Frau, die ich kennengelernt hatte, obwohl Südländerin, wenigstens arische Augen hätte wie wir. Ich hätte gehofft, dass sich alles aufklärt und niemand dich verurteilt. Und ein herzzerreißendes Wort das andere gibt. Dass du mir sagst, wo du warst mit zweiundzwanzig, als Barbie und seine Meute die Kinder aus dem Haus holten.
Und davor? Was hast du im November 1942 getan, nach der Invasion der freien Zone, als die Deutschen nach Lyon zurückkehrten? Was hast du von ihnen mitgekriegt? Ihre gewichsten Stiefel? Die Siegeruniform? Ihre durch die Rue de la Republique dröhnenden Schritte? Ihre Panzer auf dem Pflaster der Cours Gambetta? Was hast du von ihnen verstanden? Was hast du an ihnen geliebt? Was hat dich dazu getrieben, dich ihnen anzuschließen, statt gegen sie zu kämpfen? Oder hast du dich wie so viele andere einfach verkrochen, während ein paar Tapfere unsere Geschichte prägten?
Warum wurdest du zum Verräter, Papa?
2
Es hat mich Jahre gekostet, darauf zu kommen, und ein ganzes Leben, um es in seiner Tragweite zu erfassen: Während des Krieges stand mein Vater »auf der falschen Seite«.
Mit diesen Worten hat mein Großvater mir sein Geheimnis hinterlassen. Und seine Bürde. Ich saß an seinem Tisch. Wie jeden Donnerstag bekam ich nach dem Mittagessen ein Pfefferminz.
»Du kannst dir dein Vichy-Bonbon holen«, sagte meine Tante, als sie das Geschirr spülte.
Die Mutter meines Vaters kannte ich nicht. Sie hatte sich vor dem Krieg umgebracht. Wenig später zog mein Großvater wieder mit einer Frau zusammen, meiner »Tante«. Einer Köchin bei einer großen Lyoneser Familie, die mir jede Woche eine von diesen achteckigen Pastillen anbot.
Ich nahm sie mir aus der Blechdose unterm Radio.
»Der kann ja erzählen, was er will, dein Vater …«
Ich erinnere mich an die Worte meines Großvaters. Und wie er sich, als er sie aussprach, umdrehte, als fürchtete er, dass sein Sohn hinter ihm stehen könnte. Er hatte Angst vor meinem Vater. Dabei hatten sie einander seit Jahren nicht gesehen.
Er hatte gerade mit dem Schürhaken die gusseiserne Herdabdeckung aufgehoben. Über den Kohleneimer gebeugt, kratzte er mit seiner Eisenschaufel rabiat die letzten Eierbriketts zusammen.
An diesem Tag war er wütend. Ich weiß nicht, warum. Er ärgerte sich selten. Solche Aufwallungen waren für seine Frau reserviert. Dass er sie auch misshandelte, erfuhr ich erst lange nach seinem Tod.
Er hatte die Kohlen in die Flammen geschoben und klopfte mit der Schaufel auf den Rand. Daran erinnere ich mich. An das klirrende Eisen, an die aus dem Kohlenstaub hochschießende Funkengarbe und den furchtsamen Blick über die Schulter, als er diesen Satz sagte.
»… Dein Vater stand im Krieg auf der falschen Seite.«
»Lass den Kleinen damit in Ruhe!«, protestierte seine Frau schwach. »Das geht ihn doch nichts an.«
Er leerte die Aschelade des Herdes aus, stocherte mit dem Schürhaken in der Glut.
»Natürlich geht ihn das was an!«
Er wischte sich die grauschwarz verschmierten Hände ab.
»Auf der Place Bellecour hab ich deinen Vater sogar mal in deutscher Kluft gesehen …«
In der Grundschule hatte mein Vater mich ein Trimester lang gezwungen, eine Lederhose und bis zu den Kniekehlen hochgezogene braune Kniestrümpfe zu tragen. Hieß das »deutsche Kluft«?
»Hör auf damit!«, fiel meine Tante ihm ins Wort.
Schulterzuckend hängte mein Großvater die Schaufel an den Herd.
»Wieso? Einmal muss er es doch erfahren!«
»Was denn, mein Gott, er ist doch noch ein Kind!«
»Genau! Ein Verräterkind, das sollte er wissen.«
1962 war das, da war ich zehn.
*
Von jeher hat mein Vater Soldatengeschichten erzählt. Nach all den Jahren stänkerte er immer noch gegen das, was im Frieden über den Krieg gesagt wurde. Schimpfte auf eine Radiosendung, mokierte sich über eine Fernsehdiskussion, fluchte über die »Lügen« der Journalisten. Aber eigentlich sprach er, wenn er gegen die Dauerbeschallung protestierte, nicht mit mir, sondern mit sich selbst. Antwort erwartete er keine. Weder von meiner Mutter, die ihm gar nicht zuhörte, noch von seinem Sohn, der nichts davon verstand.
1965 ging er mit mir in den Film Dünkirchen, 2. Juni 1940 mit Jean-Paul Belmondo. Mein erster Kriegsfilm. Ich begriff nicht allzu viel, nur dass die Guten Französisch sprachen. Und dass Belmondo die Bösen »Fridolins« nannte.
Danach stellte ich meinem Vater Fragen, zum Beispiel, warum die französischen Soldaten immer nur zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad unterwegs waren.
»Weil Frankreich ein Nichts war!«, brüllte mein Vater auf offener Straße.
Der Film hatte ihn in Rage gebracht. Ich schaute mich um. Eine Frau hatte sich nach ihm umgedreht. Und ein Mann, auf dem Bürgersteig gegenüber. Er sah sie drohend an.
»Scheiß auf die Leute!«
Ich schämte mich oft für ihn.
An diesem Abend kam mein Vater zu mir ins Zimmer. Schaltete die Deckenlampe aus und meinen Globus an. Ich lag bäuchlings auf meinem Bett, er saß auf dem Hocker. Rückte näher heran. Flüsterte, dass auch er dort gewesen sei mit den anderen Soldaten, am Strand von Zuydcoote. Im seidigen Globuslicht erzählte er, dass es überhaupt nicht so war wie im Kino. Irgendwann würde er mir die wahre Geschichte des 2. Juni 1940 erzählen. Das wäre dann unser Geheimnis. Aber heute Abend sei es zu spät, mir fielen ja schon die Augen zu.
Er stand auf, um mich schlafen zu lassen. Wer denn diese Fridolins waren, über die Belmondo immer gespottet hatte, fragte ich. Er sah mich an. Setzte sich wieder hin, mit verzogenem Mund.
»Hast du überhaupt nichts begriffen im Kino, oder was?«
Er ärgerte sich. Erklärte es mir. Die Fridolins waren die in den Flugzeugen. Die auf Belmondo Bomben warfen. So wie die beiden als Klosterschwestern verkleideten Spione.
»Die Fridolins waren also die Deutschen?«
Mein Vater nickte stumm. Er war fassungslos. Durch die halb offene Tür betrachtete er das Licht im Flur. Erhob sich schließlich mit verschränkten Armen.
»Kannst du mir jetzt auch sagen, wer die Engländer waren?«
»Welche Engländer?«, fragte ich.
Er war erschüttert. Sein Blick wurde hart. Diese Ungeduld kannte ich.
»Du hast keinen Engländer in dem Film gesehen?«
Ich gab keine Antwort. Ich hatte Angst, so wie mein Großvater Angst vor ihm hatte.
»Weißt du nicht, dass im Mai 1940 in Dünkirchen Engländer waren?«
Er kam näher. Ich machte mich ganz klein. Verbarg mein Gesicht in der Armbeuge. Er schien davon überrascht zu sein. Und schlug mich nicht. Es war nicht der Tag dafür.
»Die mit dem flachen Helm, hast du die gesehen? Das waren die Engländer!«
Ich wandte mich ihm wieder zu.
»Die, die Belmondo nicht auf ihr Schiff lassen wollten?«
»Genau die!«, erklärte er mit triumphierendem Lächeln.
»Dann waren die Engländer also keine Guten?«
Er zuckte mit den Schultern. Stand auf.
»Frag mal Jeanne d’Arc!«
Er ging. Und machte die Tür zu.
Am nächsten Tag kam mein Vater wieder, um über die Schlacht von Dünkirchen zu reden. Und an allen folgenden Abenden, um mir von der Zeit damals zu erzählen. Er sagte mir nicht alles, behielt ein paar Geheimnisse für sich. Aber 1940, mit achtzehn, war er als Freiwilliger in den Krieg gezogen, allein, von seinem Regiment getrennt, über den Strand geirrt wie Belmondo, von den Deutschen verhaftet worden, geflohen und nach Lyon zurückgekehrt, wo seine Eltern lebten. Er war zwanzig, als er sich dem französischen Widerstand anschloss. Manchmal machte er sich auch darüber lustig.
»Ich gehörte zur Legion. Zur Ehrenlegion!«
Deshalb trage er ein rotes Band im Knopfloch. Und die Rosette am Mantelrevers. Deshalb sei ich auch Lyoneser. Weil er mich in den Jahren danach in der Stadt seiner größten Triumphe großziehen wollte. Ich ging aufs Collège von Notre Dame des Minimes, das damals nach Jean Moulin benannt wurde. André Malraux’ Rede im Panthéon wurde uns im Hof vorgelesen. Ich erinnere mich, dass es regnete. Abends erzählte mir mein Vater von dem toten Helden.
»Ich kannte ihn gut.«
Das war alles. Mehr wollte er nicht darüber sagen.
Ein anderes Mal erwähnte er den Namen von Klaus Barbie.
»Ich kannte ihn gut.«
Das war alles. Ich habe nie nachgefragt.
»Hast du auch Fridolins getötet wie Belmondo?«
Er lachte. Im Krieg, erklärte er, gehe es etwas komplizierter zu als im Kino. Einmal würden die einen erschossen, am nächsten Tag vielleicht die anderen. Man müsse aufpassen mit den Wörtern »Freund« und »Feind«, Geschichte würde nämlich von den Siegern geschrieben. Immer wieder sagte er auch, dass man Büchern, Filmen oder Zeitungen keinen Glauben schenken dürfe. Das wisse niemand besser als er.
»Niemand weiß das besser als ich!«
Das war sein Lieblingssatz. Zu Hause, in der Öffentlichkeit, auf der Straße, gegenüber ihm unbekannten Personen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagte mein Vater, dass niemand es besser wisse als er.
Er sagte auch:
»Ich hatte mehrere Leben und mehrere Kriege.«
Das war noch rätselhafter. Wenn ich ihn fragte, welche Leben und welche Kriege, lächelte er.
»Irgendwann werde ich dir das alles erklären.«
Abends, wenn er mir von seinen Schlachten erzählte, beobachtete er mich. Lauerte bei jeder Wendung auf meine Angst oder meinen Stolz. Er schilderte, wie er mit seinen Freunden zunächst Hinweisschilder in der Sprache des Feindes abriss oder beschmierte. Dann Handgranaten auf ein den deutschen Soldaten vorbehaltenes Kino in Lyon warf. Mit einem Maschinengewehr den Wagen eines Offiziers, der die Rue de la République entlangfuhr, und eine Militärkapelle in einem Musikpavillon beschoss. Das Feuer auf die Wachposten vor dem Sitz der Gestapo eröffnete, auf Soldatinnen, die er »graue Mäuse« nannte, oder auf Nachtpatrouillen während der Ausgangssperre. Wie sie Transformatoren, Straßenbahnen, Züge sabotierten. Wie sie ständig den Feind attackierten, überall, wo er sich in Sicherheit wähnte. Nach jeder Geschichte versprach er mir eine Fortsetzung am nächsten Tag. Und jeden Abend wartete ich darauf.
*
Eines Tages fragte er mich, ob meine Großeltern etwas über ihn im Krieg gesagt hätten. Ja, vor langer Zeit, erwiderte ich. Mein Großvater. So einen Satz, bei dem man sich abwendet, weil es unangenehm ist vor den Kindern.
»Er hat gesagt, dass du auf der falschen Seite warst.«
Ich hätte ihm das nicht erzählen sollen. Das wurde mir klar, als ich ihn blass werden sah.
»Was hat er gesagt?«
Mein Vater pflanzte sich mitten im Wohnzimmer auf.
Ich wiederholte es.
»Und dass er dich in deutscher Kluft auf der Place Bellecour gesehen hat.«
Dass mein Großvater mich außerdem »Verräterkind« genannt hatte, verschwieg ich lieber.
Mein Vater steigerte sich in einen ungeheuren Wutausbruch hinein. Meine Großeltern seien Lügner, brüllte er. Aber damit sei jetzt Schluss. Ich dürfe nie wieder donnerstags zu ihnen gehen. Und meine Mutter sollte schwören, dass auch sie sie nie wieder besuchen würde.
»Es sind immerhin deine Eltern«, widersprach sie.
»Eine Drecksbande ist das!«
Ich habe meinen Großvater nie wiedergesehen. Er starb ein paar Jahre später, bevor der Mittwoch den Kinderdonnerstag ersetzte. Dann besuchte ich heimlich meine Tante, aber es gab keine Pfefferminzpastillen mehr unterm Radio. Bis zu ihrem Tod schickte ich ihr Postkarten aus der Ferne. Es gefiel mir, ihre Lyoner Adresse unter die ausländischen Briefmarken zu schreiben. Und ich stellte mir das exotische Bild auf ihrem Buffet vor, an die Kaffeemühle gelehnt, im Geruch von Kohle und Morchelsoße.
*
Als ich erwachsen war, erzählte mein Vater mir nichts mehr von der Résistance. Sein Sohn, Zuschauer und Gefangener, hatte das von ihm regierte Theater verlassen. Es fehlten die kleinen Hände, die seine Tollkühnheit beklatschten. Während meiner gesamten Kindheit hatte ich leidenschaftlich an alles geglaubt, was er mir erzählte, und während meines restlichen Lebens musste ich erkennen, dass nichts von alldem stimmte. Er hatte mich ständig belogen. Und gequält. Also ließ ich sein Leben hinter meinem zurück.
Eines Abends sah ich im Filmclub Dünkirchen, 2. Juni 1940 wieder und musste lächeln. Da wurde mir klar, dass mein Vater nie dort gewesen war. Aber vielleicht hatte er es am Ende selbst geglaubt. Nachdem wir den Film gesehen hatten, rauchte er ein paar Tage lang wie Belmondo. Und übernahm all seine Ticks. Genauso wie sein Französisch mit dem Zungenschlag des Pariser Straßenjungen. Auf dem Flohmarkt erstand er einen Helm der französischen Armee, den er lange auf der Hutablage unseres Autos liegen ließ.
»Adrianhelm nennt man den«, sagte er oft bedeutungsschwer.
Ich bemitleidete ihn und betrauerte uns. Irgendwann war mein Zorn verflogen. Wie viele Leben er erfunden hatte, um seinem eigenen Glanz zu verleihen! Wie viele Lügen über seine Kindheit, seine Jugend, seinen Krieg, seine Tage und Nächte, wie viele berühmte Freunde und fantasierte Feinde, wie viele Berufe, die er nur aus Filmen kannte, wie viel Heldenmut! Jahrelang hatte ich seine entsetzliche Einsamkeit, seine klägliche Existenz vor Augen. Das machte mich selbst unglücklich. Als meine Wunden vernarbt waren, fragte ich mich, wie viele Fälscher er in sich trug. Wie viele Betrüger ihm von innen den Bauch zerkratzten. Ob dieser Scharlatan auch nur ein einziges Mal, eine Minute lang die Wahrheit gesagt hatte. Ob er sich irgendwann einmal ins Gesicht gesehen hatte. Doch mit der Zeit verflüchtigten sich diese Fragen. Sie ihm zu stellen habe ich nie gewagt. Er hätte ohnehin nicht geantwortet. Die Worte meines Großvaters waren die einzige Wahrheit, die mir blieb. Alles andere war Hochstapelei.
»Dein Vater stand im Krieg auf der falschen Seite.«
Mein Großvater hatte mich mit dieser Enthüllung allein gelassen. Wie mein Vater mit seinen Märchen. Und ich, das Verräterkind, betrat meinen Lebensweg ohne Spur, ohne Hinterlassenschaft, ohne irgendein Erbe. In mir war nur sein Schweigen und meine Verwirrung.
Unter der »falschen Seite« konnte ich mir nur das Schlimmste vorstellen. Einen Franzosen, der andere Franzosen ermordet. Einen Schweinehund, der mit graugrüner Trillerpfeife und braunem Schlagstock in der Hand den Schergen abgibt. Einen ungebildeten, stumpfen Zwanzigjährigen ohne Plan oder Moral, der sich von den Siegern blenden lässt und in ihrem Gefolge die Hacken zusammenknallt. Ein kleines Licht, dessen einzige Bettlektüre der Hass ist. Einen fehlgeleiteten Franzosen, der sich für sein Volk schämt und sich daher ein anderes erfindet, das besser zu seiner Eitelkeit passt. Einen frechen Lümmel, der mit einer Pistole am Gürtel oder einer Reitgerte in der Hand Leute verjagt, um sich in der Warteschlange vorzudrängeln. Einen kleinen Spitzbuben, der sich dank schwarzem Gabardinemantel oder blauer Mütze groß fühlt. Milizionär? Oder Gestapo-Mann? Solche Fragen wälzte ich lange heimlich.
Bis zu jenem Frühjahr, als ich dachte, mein Vater hätte sich endlich entschlossen zu reden.
*
Am 21. März 1983 wäre er fast gestorben. Meine Mutter rief mich an. Er habe »irgendwas« im Bauch und sei vom Krankenwagen abgeholt worden. Mehr sagte sie nicht. Gequält von Fieber und Schmerz, versuchte mein Vater mich vom Krankenbett aus zu erreichen. Ich war nicht in Paris. Am Vormittag probierte er es dreimal und legte jedes Mal auf, wenn er den Anrufbeantworter hörte. Beim vierten Mal hinterließ er mir mit einer atemlosen, blechernen Stimme, die ich nicht von ihm kannte, eine verstörende Nachricht. Abends, als ich heimkam, hörte ich sie ab. Dutzende Male, um ihren Sinn zu begreifen. Gestöhnte Sätze. Zerrissen und schwer von Schweigen. Die letzten Worte eines Sterbenden.
»Da oder dort … Wenn du mal in Paris bist, will ich ein Lied hören … Ich weiß, es ist viel verlangt … Lili Marleen … Zur Erinnerung an die Kameraden …, die unter tragischen Umständen ums Leben gekommen sind … Weit verstreut auf ukrainischen oder russischen Ebenen … Meine Kameraden … Ich sehe sie alle noch vor mir … In den letzten Tagen von Berlin … Es war schrecklich … schrecklich … Und ich bereue nichts … jawohl … gar nichts … Ich werde es wohl nicht mehr hören, dieses Lied … Aber wer weiß … Was ist der Tod? …
Leb wohl, mein Sohn … Leb wohl … Ich liebe dich … Mein Gott, ist das hart … Zu wissen, dass wir uns nie wiedersehen werden …«
Mein Vater. Nach all den Jahren meldete er sich. Mit einem Abschied wie einem Schlag in die Magengrube. Er wusste, dass mich meine Ohnmacht ersticken würde. Es war viel zu spät, um im Krankenhaus anzurufen. Also rief ich meine Mutter an. Riss sie aus dem Schlaf.
»Papa liegt im Sterben!«
Schweigen. Dann lachte sie.
»Was redest du da, mein Sohn?«
Nein, alles in Ordnung, das könne nicht stimmen. Sie habe am späten Nachmittag mit dem Arzt gesprochen und am frühen Abend mit ihrem Mann. Er habe große Angst gehabt, sich aber wieder beruhigt.
»Er hat sich sogar ganz gut angehört.«
Ich starrte den Hörer an.
»Hallo? Mein Sohn?«