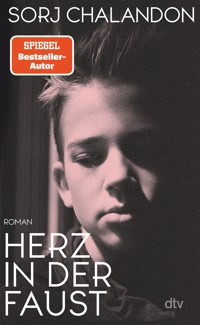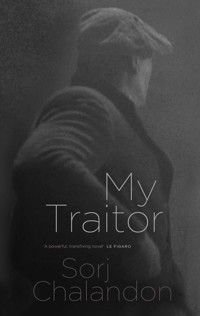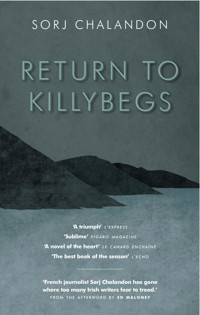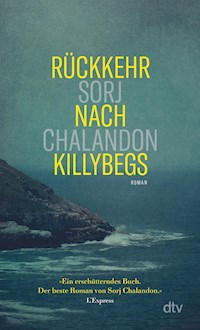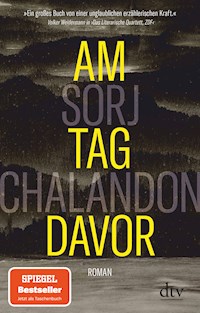
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein großes Buch von einer unglaublichen erzählerischen Kraft.« Volker Weidermann in ›Das Literarische Quartett‹ (ZDF) Der Tag vor der Katastrophe: Der 16-jährige Michel fährt gemeinsam mit seinem geliebten großen Bruder Joseph auf dem Moped durch die Straßen seiner französischen Heimatstadt. Gemeinsam fühlen sie sich unbesiegbar. Am Tag darauf kommen bei einem Grubenunglück 42 Bergmänner ums Leben, aufgrund eines fatalen Fehlers der Werksleitung. Joseph erliegt seinen Verletzungen. Michel flüchtet sich nach Paris, auch um die Worte des Vaters zu vergessen: »Du musst uns rächen!« Doch der Schmerz vergeht nicht, und so beginnt Michel Jahre später seinen Rachefeldzug. Noch weiß er nicht, dass die Nacht vor dem Unglück anders war, als er sie in Erinnerung hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sorj Chalandon
Am Tag davor
Roman
Aus dem Französischen von Brigitte Große
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Zum Gedenken an die 42 Bergleute, die am 27. Dezember 1974 auf der Zeche Saint-Amé in Liévin-Lens ums Leben gekommen sind
1Joseph, mein Bruder
(Liévin, Donnerstag, 26. Dezember 1974)
Joseph, eng an mich geschmiegt. Er auf dem Gepäckträger, breitbeinig über den Satteltaschen wie ein Cowboy beim Rodeo. Ich über den Lenker gebeugt, die rechte Hand auf dem Gashebel. Er wirft die Arme hoch. Singt laut. Eigene Lieder ohne Text und Melodie, schräge, bierselige Worte.
Der röhrende Motor weckt die schlafende Stadt.
»So ist das Leben!«, schreit mein Bruder.
Noch nie war ich so stolz.
*
Vor dieser Nacht hatte ich Jojos Moped nur ein einziges Mal gefahren. Immer rundherum bei uns auf dem Bauernhof, wie ein Zirkuspferd an der Longe. Er hatte das Motobécane gekauft, um den alten Renault zu ersetzen, den er nicht mehr benutzte. Das Auto war nicht mehr zu reparieren, nur noch zu reanimieren. Irgendwann ließ er es am Straßenrand stehen.
»Das fahren wir sonntags.«
Mit siebenundzwanzig gab mein Bruder auch sein altes Fahrrad für das Moped auf.
Den »Rolls der Anständigen« nannte er es.
Für ein paar Münzen polierte ich die Chromteile, machte den Dreck weg, der an der Gabel klebte, putzte die Scheinwerfer und schmierte das Radlager. Ich durfte auch das Werkzeug unter dem Sattel verstauen. Allgemein hieß es »das Blaue«. Mein Bruder sagte auch »Gulf« dazu, weil es die gleiche Farbe hatte wie Steve McQueens Porsche in »Le Mans«, einem Film, den ich mit Jojo auf Französisch im »Majestic« gesehen hatte.
Steve McQueen spielt darin den Rennfahrer Michael Delaney.
»Bei uns spricht man das Michel Delanet aus«, erklärte mein Bruder.
Ich war verblüfft: Delanet und ich hatten denselben Vornamen.
Steve McQueen war der amerikanische Held meiner Kindheit. Ich hatte ihn in den »Glorreichen Sieben« gesehen, in »Gesprengte Ketten« und in »Bullit«. Vor dem Spiegel übte ich sein Lächeln und sein Stirnrunzeln. Wenn mich einer in der Schule provozierte, presste ich die Lippen zusammen wie er. Ich borgte mir ein bisschen was von seinem Schmollen. Mein Bruder schwor, dass ich die gleichen Schatten im Gesicht hätte. Und das gleiche Schweigen.
»Verrückt«, murmelte er, »der hat deine Augen.«
»Le Mans« ist ein merkwürdiger Film. Kein Drehbuch, nervige Musik. Wirkt gar nicht wie Kino. Außer am Anfang. Diese eine Minute Stille vor dem Rennen.
Der Wagen mit der Nummer 20 stand am Start. Die Tür fiel zu. Kein Geräusch drang in die Kabine. Die Menge brodelte, aber wir hörten nichts. Michel Delanet zog sein weißes Tuch über Mund und Nase. Setzte den Helm auf, legte den Gurt an, verschloss seinen Blick. Die rechte Hand lag auf dem Lenkrad. Langsam entspannte er die Finger. Sein Herz klopfte. Wir hörten es. Zuerst weit entfernt, wie eine Marschtrommel. Dann immer stärker, immer näher, es hämmerte fast an unsere Schläfen. Ich hielt im Dunkeln die Hand meines Bruders. Daran erinnere ich mich. Diese Schreie des Herzens glichen meinen nächtlichen Schrecken.
In den Bergarbeitersiedlungen hatte »Le Mans« nicht eingeschlagen. Eine Woche nach dem Anlaufen des Films nahm ihn das »Majestic« wieder aus dem Programm. Als die Platzanweiserin das Plakat aus dem Schaufenster holte, fragte mein Bruder, ob es zu verkaufen sei. Sie zögerte. Er lächelte. Ich pinnte es mit Reißzwecken über mein Bett. Bevor ich abends meine Lampe ausknipste, sah ich Michel Delanet mit seinem Helm in der Hand, meinen Lippen und meinen Augen. Ich schrieb »Gulf« auf ein Klebeband, das ich am Schutzblech des Mopeds befestigte.
*
Als Kind hatte Joseph davon geträumt, Rennfahrer zu werden. Erst Mechaniker in der Boxengasse, als Teil des Reifenwechslerballets. Dann Fahrer in einem großen Team. Und schließlich würde er uns als Champion vom Siegerpodest eine Champagnerdusche verpassen.
Aber mein Vater hatte nie daran geglaubt.
»Rennwagen haben in einem Stall nichts verloren, da gehört nur das Vieh rein«, sagte er gern.
In unserer Gegend wurde über den Boden und die Kohle geredet, nicht über Motorsport. Wie die anderen Bauern hoffte mein Vater, dass sein Sohn einmal den Hof übernehmen würde, und fürchtete, dass die Mine ihn entführen könnte.
Also absolvierte mein Bruder die Grundschule und ging nach der mittleren Reife auf eine Berufsschule, reparierte nachts unseren Traktor und stoppte dabei seine Zeit, als ob er in einer Boxengasse der Formel 1 arbeitete. Dann machte er eine Mechanikerlehre in einer Autowerkstatt in Lens. Ein verlorenes Jahr, wie er später sagen würde. Er setzte nie einen Fuß auf den Asphalt einer Rennstrecke. Und kam nicht einmal in die Nähe des Siegertreppchens. Unser Vater sollte recht behalten.
Am Ende wurde auch mein Bruder vom Schacht verschluckt, wie alle hier.
Tag für Tag kam mein Bruder an der Zeche Saint-Amé vorbei. Auf dem Weg zur Werkstatt sah er Männer zu den Metalltoren der Grube eilen, hineingehen, herauskommen, schweigend nebeneinanderher marschieren. Wie ein eigenes Volk, dachte er. Eine Armee einfacher Menschen. Er baute Luftfilter aus und stellte Vergaser ein. Sie schürften in der Erde, um das Land zu beleuchten, für die Familien zu heizen, Zement und Beton zu produzieren und unsere Straßen zu asphaltieren. Er dichtete Öllecks ab, sie schufteten für unseren Komfort. Er hatte von Autorennen geträumt, stattdessen reparierte er Motoren. Das glorreiche Kind war tot. Der Held hatte abgedankt. Nicht einmal mehr beim Bremsscheibenwechseln spielte er den Mechaniker aus »Grand Prix«.
Abends stellte er mit ölbeschämten Händen sein Fahrrad vor dem Werkstor von Schacht 3b ab und hob den Blick zum Himmel. Die Seilscheiben in den Fördergerüsten drehten sich langsam. Sie erzählten vom Erz, das zu Tage gefördert wird, und von den Menschen, die in die Teufe fahren. Er hatte gelernt, das Singen der stählernen Türme nachzuahmen. Das hatte er geübt, den Blick auf die Räder geheftet. Dieses Geräusch, behauptete er, sei eines der am schwersten zu imitierenden. Und eines der schönsten.
»Das Lied des Hahns kann jeder krähen. Aber das Lied der Arbeit ist eine andere Geschichte«, sagte Jojo.
Monate vergingen, und seine Darbietung wurde immer vollkommener. Das war nicht das Stampfen, das man am Fuß der Maschinen hören konnte, sondern der Odem, der über der Stadt lag. So wie die Zeche von fern klang. Nicht ihr Ruf, sondern ihr Rumoren. Das dumpfe Grummeln über den Dächern, das zur Essenszeit, wenn der Mann heimkam, durch die geschlossenen Türen bis in die Küche drang. Es war die Melodie der geschichtslosen Tage, die an der Oberfläche summte, wenn unten alles gut lief. Das Schweigen der Seilscheiben war das Zeichen der Katastrophe, des Streiks. Es ging den Sirenen voraus, die die Nacht gefrieren ließen.
Jojo brachte mir seinen Trick bei. Geduldig zeigte er mir, wie man ein Kikeriki überbietet. Zuerst die Augen schließen. Ein wenig die Backen aufblasen. Dann mit Gurgel und Zähnen knarzen, um ein metallisches Jaulen, ein mechanisches Röcheln zu erzeugen. Es machte ihm Spaß, zwischen zwei Bierchen am Tresen von »Chez Madeleine« das Lied des Förderturms zum Besten zu geben wie einen guten Witz. Die Leute am Tresen applaudierten. Allmählich wurde seine Nummer zu einem Hit, sogar unter Bergleuten. Darauf war ich stolz.
Eines Sonntags fragten zwei Kumpel meinen Bruder, ob er auch anderes nachmachen könnte: das Rumpeln des Förderkorbs bei der Seilfahrt, das Knirschen der Zahngestänge, das Klirren der Keilhaue, das Dröhnen des Abbauhammers oder wie der Strebmeister sie anschreit, dass sie vor Schichtende noch einen Meter schaffen müssen.
Ich war dabei, zwischen den Beinen meines Bruders. Spielte mit den anderen Jungs, während die Väter würfelten. Jojo war gerade zwanzig geworden, ich sechs. Die Arbeiter machten sich nicht über ihn lustig. Sie kamen in seine Werkstatt und lachten am Tresen über seine Nummer. Sie verstanden nur nicht, warum ein solcher Kerl ihnen nicht dabei half, die Kohle aus dem Berg zu holen.
»So ist das Leben«, sagte mein Bruder.
Er wisse nichts von der Zeche, außer dass ein Verwandter vor sieben Jahren dort seine Jugend verloren habe. Gestorben am 16. März 1957 in Schacht 3 von Lens. In ihrer Grube. Gleich um die Ecke. Liévin, Lens, unser aller Grab.
»Ein Seemann kann auch im Meer ertrinken«, sagte der Ältere lächelnd.
Die Zeche brauche seine Arbeitskraft. Die Ausbildung könne er in seiner freien Zeit an der Bergschule machen. Dort würde ihm alles beigebracht: hobeln, schrämen, fördern. Ob das nichts für ihn wäre, Facharbeiter zu werden? Aufzusteigen? Dem Land nützlich zu sein?
Mein Bruder beobachtete den Bergmann. Und beaufsichtigte mich. Wir tobten über Straßen und Bürgersteige und mischten Kartenrunden auf. Störten die Dartspieler mit unserem kindischen Gekreisch. Mit einer Handbewegung rief er mich zu sich.
»Gehen wir?«, fragte ich.
Er trug seinen Sonntagsanzug und seine Montagsstirn.
Er legte mir die Hand auf die Schulter.
»Wir gehen.«
Dem alten Bergmann erklärte er, er habe nicht den Mumm, noch einmal ganz von vorn anzufangen. Den Gesang des Fördergerüsts nachzumachen sei etwas anderes als in den Schacht einzufahren. Außerdem wisse er nicht einmal, was man dort unten tue.
»Es ist schon spät«, sagte er schließlich.
Und dann sei ja auch ich noch da und warte auf ihn. Sein jüngerer Bruder, der sich bei einem Rest Pfefferminzsirup langweilte. Sein »Kleiner«, Michel, der bestimmt noch eine Partie Tischfußball gespielt hätte, wenn nicht der Sohn des Wirts, ein blonder Kotzbrocken, alle anderen, die durch die Tür kamen, angeschrien hätte: »Das ist mein Zuhause, nicht eures!«
Er mopste ihnen auch immer die Holzkugel, um sie am Siegen zu hindern.
Wir verabschiedeten uns. Joseph bedankte sich bei den zwei Hauern. Ehrlich. Nett, dass sie sich so viel Zeit für ihn genommen hätten.
»Recht hast du, mein Sohn. Hör nicht auf die!«, bemerkte einer im Anzug.
Sein Tresenkumpan blickte uns lachend an.
»Und haut schnell ab, bevor die heilige Barbara euch holt!«
Joseph kannte die beiden nicht.
»Lucien Dravelle«, stellte der Krawattenmann sich lächelnd vor.
»Man nennt mich Beo«, sagte der andere, der am Tresen hing.
Den Namen hatte ich schon in der Siedlung gehört. Beo – ein Sperlingsvogel, der die menschliche Stimme imitiert. Und einer von hier, der zu viel quatscht.
Beo war Maurer. Und Dravelle Vorarbeiter im Schacht 3b der Zeche Liévin-Lens. Zwei Freunde. Einer vom Seewind gegerbt. Der andere grau.
Ein Leben unter Tage, eins an der frischen Luft.
Lucien Dravelle wollte Jojo noch auf ein letztes Bier einladen.
»Hoch die Tassen«, schrie Beo.
Jojo winkte lächelnd ab. Dann beugte er sich zu mir.
»Komm, wir gehen!«
Wir näherten uns der Tür.
Der junge Bergmann stellte sich uns in den Weg.
»Wie war noch mal dein Name?«
»Joseph.«
Das Glas in der Hand, neigte der andere den Kopf zur Seite.
»Du hast doch einen Getriebezug im Auto?«
Mein Bruder lächelte. Das war seine Spezialität.
»Und Ritzel, Zahnstangen, Nockenwelle sagen dir auch was?«
»Was hat das mit eurem Beruf zu tun?«
Der junge Arbeiter ließ mit seinem Walzenschrämlader den Berg zur Ader. Der Ältere überwachte die Körbe der Fördermaschinen.
»Heutzutage ist jeder Kumpel Mechaniker«, antwortete der Ältere.
»›Germinal‹ ist jetzt vollautomatisch«, grinste sein Freund und öffnete uns die Tür.
Jojo drückte ihnen lange die ausgestreckten Hände. Wie man einen Pakt schließt.
Als wir das Lokal verließen, erhob Beo mit triumphierender Geste sein Glas.
»Willkommen bei den Charbonnages de France! Wieder ein Neuer für den französischen Kohlebergbau!«
Ein paar Tage später entschied sich Joseph für die Zeche.
*
Unsere ganze Kindheit hindurch hatte mein Vater uns immer wieder erklärt, dass es mit der Kohle vorbei sei und die Schächte Geschichte seien. Sie würden einer nach dem andern zugeschüttet werden. Mein Bruder hatte erwidert, dass auch die Scholle tot sei. Sie würde von den Städten eingekreist und ausgelaugt, und die Menschen bauten nur noch Backstein an. Bauern würde es bald gar nicht mehr geben. Er, Jean Flavent, und seine Frau mit all ihren Onkeln und Cousins, die den Boden beackerten, würden der Reihe nach sterben. Und dann würden die Rüben, Zichorien, Kartoffeln eben von irgendwoher importiert. Und mit ihren Kühen und Hühnern könnten sie die Familie sowieso nicht mehr ernähren.
Mein Bruder kam, um sich von uns zu verabschieden. Abends. Nach dem Essen.
Bei uns wurde nie gestritten. Nicht einmal Braf, der Malinois, unser Belgischer Schäferhund, fletschte je seine Zähne. Zorn und Bestürzung zeigten sich im Schweigen und in den Blicken. Meine Mutter hatte mir erlaubt, am Tisch sitzen zu bleiben. Die Fragen meines Vaters und die Antworten meines Bruders sollten mir eine Lehre sein. In meinem Alter könnte ich alles verstehen. Der andere Mann im Haus verließ uns. Mein Vater verlor damit zwei Arme und die Schulter, auf die er sich gern gestützt hätte. Sein großer Sohn hatte sich alles gut überlegt. Kohlenstaub im Gesicht sei ihm lieber als Lehm oder Schmieröl an den Händen. Keiner von uns wurde laut.
Papa sah von seinem Zichorienkaffee auf. Deutete mit dem Löffel auf das Porträt Philippe Flavents, seines Bruders, der in Schacht 3 ums Leben gekommen war. Bei einem Grubengasunglück, mit zehn anderen Kumpeln, weil die Arschlöcher da oben ständig das Arbeitstempo erhöhten.
Seit Tagen hatten er und seine Kumpel sich über den Staub beklagt. Aber die Ingenieure drängten darauf, die Ausbeute zu steigern. Pro Schicht sollten sie 2,50 Meter abbauen. Das hieß längere Arbeitszeiten. Und weniger Sicherheit. Der Schießmeister hatte den Sprengstoff gezündet, ohne die Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
»Das hat deinen Onkel das Leben gekostet.«
Mein Vater sah seinen großen Sohn an. Machte lange Pausen, um die Erschütterung wirken zu lassen. Trank seinen Wurzelsaft und fuhr zwischen zwei lauwarmen Schlucken fort: »Ist es das, was du willst, Jojo? Sterben für den Profit der staatlichen Kohleindustrie? Krepieren mit einundzwanzig, wie dein Onkel, dem von der Hitze die Brille im Gesicht zerlaufen und dem die Finger miteinander verschmolzen sind? In den Eingeweiden der Erde schwitzen, um die Faulpelze des Reviers zu mästen? Ist das dein Traum, mein Sohn? Und was hast du davon, wenn es dich erwischt? Wer wird es dir vergelten? Da kommen dann zwei Trikolorenschärpen aus der nächsten Stadt, und ein stellvertretender Minister aus Paris murmelt verschämt was von tragischem Schicksal, die Gewerkschaft bezahlt drei Blumen, und die Ehrenwache halten ein paar Kumpel, die sich nicht trauen, eurer armen Mutter ins Gesicht zu sehen.«
»Eurer Mutter«, hatte mein Vater gesagt. Ich war also mitgemeint.
Durch meinen Bruder sprach er zu mir. Seine Söhne waren seine Welt. Eines Tages, das wusste er, würde auch sein Jüngster den Wunsch verspüren, wegzugehen. Und hätte die gleiche Wahl zwischen Scholle und Kohle.
»Und soll ich dir noch was sagen?«, fuhr mein Vater, an meinen Bruder gewandt, fort. »Die Kohle wird dir nur Kummer machen. Auch wenn du nicht dabei draufgehst. Auch wenn du das alles überlebst, den Staub, die unsicheren Ausbauten, die entgleisenden Hunte, das Wüten des Abbauhammers, die Eiseskälte bei der Ausfahrt. Auch wenn du auf beiden Beinen in Rente gehst, wirst du die Dreckskohle doch nie loswerden. Ein Teil von dir wird unten bleiben. Du wirst eine Staublunge kriegen, Joseph. Die kann man dann höchstens noch in den Ofen schmeißen, um Feuer zu machen. Du bist dann vergiftet. Halb taub und halb tot. Wie Mamas Cousins, wie die Alten, die sich im Schatten der Halden dahinschleppen und sich die Kohle aus dem Leib husten, die sie von innen zerfrisst. Und weißt du was, Jojo? Niemand wird deine Krankheit anerkennen. Hast du eine Ahnung, was die Ärzte hustenden Minenarbeitern bei der Visite raten? Dass sie zu rauchen aufhören sollen! Und sie fälschen sogar die Ergebnisse. Wenn deine Lunge zu 20 Prozent befallen ist, schreiben sie nur 10 Prozent hin. Und weißt du, warum sie das machen?«
Jojo schüttelte den Kopf. Nein, wusste er nicht.
»Damit du gleich wieder einfahren kannst, darum. Halb tot, aber arbeitsfähig!«
Meine Mutter stand auf. Braf, der Hund, lag unter dem Tisch und streckte sich. Mama goss ihren Männern nach. Dann zog sie ihren Stuhl an meinen heran und umarmte mich. Ich fiel fast um vor Müdigkeit. Legte den Kopf auf ihre Schulter. Sie streichelte meinen Hals.
»Und wenn einer stirbt, muss man erst mal beweisen, dass es die Staublunge war. Dann wird er ausgebuddelt. Und aufgeschnitten. Dann quälen sie ihn ein letztes Mal, bis seine Lunge die Wahrheit auskotzt. Und das alles nur, damit die Zeche gnädigerweise drei Franc Rente an seine Witwe ausschüttet.«
Mein Vater betrachtete unseren Onkel in Festtagskleidung mit weißem Helm und gebügeltem Blaumann im Trauerrahmen.
»Hast du den Kohlenstaub gesehen, der über der Stadt liegt, Jojo?«
Jojo nickte.
»Weißt du, dass man einen Salat aus dem Garten fünfmal waschen muss, bis das Wasser klar bleibt?«
Ja, das wusste er.
»Ist dir aufgefallen, dass sogar die Tauben der Bergleute voll Ruß sind?«
Jojo spielte mit seiner Gabel.
»Hast du die alten Bergleute gesehen?«
Mein Bruder antwortete nicht.
»Erkennst du sie?«
Jojo hatte den Kopf gesenkt, mein Vater neigte sich zu ihm. Ein Sünder und sein Beichtvater.
»Sag mir, dass du sie erkennst, wenn du ihnen auf der Straße begegnest. Sag es!«
Mein Bruder zuckte mit den Schultern. Ja, natürlich erkenne er sie. Das sieht ja jeder an diesem schweren Gang, dass einer sein Leben im Schacht verbracht hat. Man erkennt es daran, dass einer wie ein an Land gestrandeter Fisch nach Luft schnappt, an seinem Zittern, den schleppenden Bewegungen, dem kaputten Rücken, den trostlosen Augen, den tauben Ohren.
»Und an seinem Stolz«, fügte mein Bruder leise hinzu.
Unser Vater war überrumpelt. Schmerzerfüllt blickte er seinen Sohn an. Da stand Stolz gegen Stolz. Er hatte verloren. Das wusste er. Als Joseph in meinem Alter war, war er mit ihm auf die Felder gefahren wie zur Besichtigung einer Kathedrale. Die frisch gezogenen Furchen, die Wurzeln tief in der Erde, die zarten Triebe, wenn der Regen auf sich warten ließ. Und dann die Bäume, die Blumen, die Schmetterlinge im Frühling. Das alles zu schützen, sagte er, mache die Würde des Menschen aus. Aber an diesem Abend stand er wortlos vom Tisch auf. Schwerfällig wie ein von einem Grubenstempel getroffener Bergmann. Mit dem gleichen gequälten Schritt. Er fuhr meiner Mutter über den Rücken. Trat hinter mich und legte mir die Hände auf die Schultern. Das hatte er immer schon so gemacht bei seinen Söhnen. Dann strich er meinem Bruder übers Haar, als wollte er ihn vor künftigen Verletzungen bewahren.
»Ein Kumpel sieht jeden Tag sein Blut«, sagte er noch.
Dann ging er hinaus. Aufs Feld, und Braf, der Hund, hinterher. Jeden Abend vorm Schlafengehen schaute mein Vater nach seinem Werk, als ob er ein Kind hütete.
Ein paar Wochen später packte mein Bruder seinen Koffer. Er wollte nicht von einem Vater durchgefüttert werden, dem er nicht mehr unter die Arme griff. Wir verabschiedeten uns im Hof. Er umarmte mich, dann unsere Mutter, dann unseren Vater. Als ob es nur für einen Tag wäre.
»So ist das Leben«, lachte Jojo.
»Nein«, erwiderte mein Vater. Für Jojo fange jetzt ein ganz neues an.
Mein Bruder schwang sich auf sein altes Fahrrad. Er wich Braf aus, fuhr Slalom zwischen den Hühnern und pfiff »Auld Lang Syne«. Am nächsten Montag wollte er mich nach der Schule besuchen.
Er fuhr aus Saint-Vaast-les-Mines hinaus, auf die Zwillingshalde von Loos zu, unseren Kinderhorizont. Heimlich hatte er schon Sylwia gefunden, seine Fastfrau, und eine Wohnung: zwei Zimmer unterm Dach, die ihm die Zeche fast umsonst vermietete. So hatte er nicht weit zu seinem Arbeitsplatz. Das war praktisch für den Arbeiter und machte sich für die Firma bezahlt. Sie nahm diesen Bauernsohn auf. Die Kohle hatte gesiegt, die Scholle verloren. Joseph Flavent, mein Bruder, wurde mit zwanzig Bergmann.
*
In diesem Jahr, 1974, feierten Sylwia und Joseph Weihnachten bei uns auf dem Bauernhof. Außerdem hatte meine Mutter mir erlaubt, zu Neujahr ein paar Tage bei ihnen in Liévin zu verbringen. Ich bekam ein Zimmer in ihrer neuen Wohnung.
»Willkommen in deinem Palast, kleiner Pochjunge«, sagte Joseph.
Pochjungen – so wurden früher, vor dem Krieg, die Kinder genannt, die im Bergwerk arbeiteten.
Vom 21. bis zum 26. Dezember, dem Stephanstag und Fest der Polen, mussten die Bergleute von Schacht 3 und 3b nicht arbeiten. Mein Bruder hatte frei.
Am Abend des 26. kamen nach dem Essen zwei seiner Kumpel, um mit ihm eine Flasche zu leeren.
»Auf den heiligen Stephan!«, schrien sie und schlugen mit den Fäusten an die Fensterläden.
Das waren Söhne von Bergleuten aus dem Kohlebecken von Katowice, die nach Pas-de-Calais gekommen waren, um hier zu schürfen. Meine Schwägerin protestierte. Sie kannte die Männer aus ihrer Heimat nur zu gut. Kommen rein, machen sich breit und vergessen dann das Nach-Hause-Gehen. Oder schlafen zusammengerollt auf einem vereisten Gehweg. Dabei musste ihr Mann am nächsten Tag um 4.30 Uhr aufstehen, um anzufahren. Und hatte schon zum Essen Bier getrunken, das sei doch Unsinn.
»Nur mal auf den heiligen Stephan anstoßen«, sagte mein Bruder entschuldigend und ließ die beiden herein.
Auch sie hätten am nächsten Tag Dienst auf Saint-Amé. Sie würden nicht lang machen, versprochen!
Seufzend ging Sylwia in die Küche, um die Pulle und die Stullen für das Frühstück ihres Mannes in seine Tasche zu packen. Dann ging sie nach oben schlafen.
Ich wollte auch in mein Zimmer.
Aber Jojo legte lächelnd einen Finger auf die Lippen und sagte: »Bleib doch noch ein bisschen!«
Die Kumpel kamen herein, setzten sich aber nicht. Mein Bruder nahm vier kleine Gläser aus der Anrichte. Einer von den Polen schenkte Kirschlikör ein. Trank ein Glas halb aus und reichte es mir. Wir bildeten einen Kreis, vier Männer in der Nacht des 26. Dezember 1974, um den ersten Märtyrer der Christenheit würdig zu feiern.
»Na zdrowie«, sagten die Gäste.
»Auf euers«, antwortete mein Bruder.
Wir legten den Kopf in den Nacken und tranken auf ex, ohne ein Wort zu viel, so wie die Armen im Park versteckt ihre Flasche leeren.
Dann gingen die Polen wieder und torkelten über das nasse Pflaster.
Ich stellte mich neben meinen Bruder, der an der Tür stand und ihnen nachsah, bis der Nebel sie verschluckte.
Die Kälte packte mich im Nacken wie einen Welpen.
»Machen wir vor dem Schlafengehen noch eine kleine Spritztour?«, fragte er.
Das kam unverhofft. Ein nächtlicher Ausflug mit dem Moped? Ich hüpfte vor Freude. Joseph hatte schon den Mantel an.
»Du nimmst meinen Helm«, sagte er.
Sein Helm war ein weißer Bell Jet 500 ohne Visier, den er mit einer von einem schwarzen Gummi gehaltenen Stirnlampe in einen Bergmannshelm verwandelt hatte; die Batterie steckte im Gürtel.
»Da ist ja unser Lampenwärter!«, scherzten seine Kumpel im Winter, wenn er mit seiner blassgelben Lampe, die im Dunkeln blinkte, zum Schacht 3b in Liévin kam.
An diesem Abend war ich der Lampenwärter. Der Helm war mir zu groß. Mein Bruder setzte mir eine alte Haube auf, bevor er ihn mir überstülpte. Außerdem gab er mir seine Motorradbrille und band mir ein weißes Tuch vor Mund und Nase. Bevor wir gingen, betrachtete ich mich im Flurspiegel. Der Helm, die Brille, das weiße Halstuch …
»Michael Delaney!«, lachte Jojo.
»Michel Delanet!«, erwiderte ich.
Der Bund zwischen Rennfahrer und Bergmann.
Er schaltete die Stirnlampe ein.
»Einmal zum Schacht und zurück und dann in die Heia.«
Ich wollte mich auf den Gepäckträger setzen, aber Joseph nahm mich am Arm.
»Nein, heute Abend fährt Michael Delaney«, flüsterte er.
Von der Straße konnte man im Schlafzimmer alles hören, und er wollte Sylwia nicht wecken. Ich war glücklich. Nie war mein Stolz größer gewesen als in dieser Nacht. Ich würde meinen Bruder fahren. Ihn durch die Stadt kutschieren. Er würde seine starken Arme um meine Taille legen, sich an mich drücken, seine Stirn an meinen Rücken lehnen. Wenn er wollte, könnte er sogar die Augen schließen, ein bisschen schlafen, vielleicht träumen. Diese Nachtfahrt würde ein Davor und ein Danach haben.
Mein Bruder schob das Moped bis zur Kreuzung, um die Leute in der Straße nicht aufzuscheuchen. Er trug weder Helm noch Handschuhe. Nur seinen grauen Stoffblouson über einem Hemd mit feinen Streifen, einen Rolli und einen schwarzen Schal. Ich startete den Motor. Er ließ sich hinter mir auf den Sitz fallen. Dann fuhren wir Richtung Zeche. Der weihnachtliche Sturm hatte nachgelassen, aber immer noch gab es heftige Böen. Eis glitzerte auf dem Boden. Ich versuchte, um die Schlaglöcher herumzukurven. Liévin schlief. Weit weg ein Schrei, das Hupen eines sich entfernenden Autos. Die Fenster schwarz. Niemand sah meinen Triumph. Ich schrammte am Bürgersteig entlang, fuhr durch eine Pfütze, wagte kurz zu hupen. Die Siedlung warf den Motorensound zurück. Das war nicht das Knattern eines Zweitakters, sondern das Brabbeln eines V8. Er heulte auf. Ich war Michel Delanet. An der Spitze des Grand Prix von Monaco, in der Kurve von Beau Rivage. Die Gässchen, die Höfchen, die kläglichen Gärtchen, die Wurmfortsätze der Sackgassen, die endlosen Backsteinmauern, Palisaden, Zäune, geschlossenen Fensterläden, alles hallte wider von unserer Kraft.
Vor der Kirche von Saint-Amé, wo ich als Kind zur Schule gegangen war, bog ich ab und ließ die hohen Mauern, das rostige Gitter, die Zeche hinter uns. Mein Bruder drehte sich um. Betrachtete das Eisentor, den Förderturm. Erstarrte. Hörte zu singen auf. Einen Moment lang dachte ich, dass er Angst hatte, wieder in den Bauch der Erde hinabzufahren. Nach all den Jahren bin ich mir dessen sicher. Ihn schauderte. Er umarmte mich fester, steckte die Hände unter meine Achseln.
Ich machte mich los.
»Nein, nicht kitzeln!«
»Du schau auf die Straße, Pochjungchen!«
Dann lachte er. Sein schönes Großer-Bruder-Lachen.
2Die Halle der Gehenkten
Nach dem Ausfahren gingen Joseph und seine Kumpel, bevor sie ihre Zivilkleidung anlegten, ins Bad. So hatte er das genannt, ohne es genauer zu beschreiben.
»Die Pariser Journalisten sagen dazu ›Halle der Gehenkten‹.«
An einem Frühlingssonntag durfte ich sie besichtigen. Ich hatte mir einen Raum mit weißen Waschbecken, Badewannen und Handtuchhaltern vorgestellt, aber es war bloß ein Schuppen voller Klamotten. Die Duschen? Nicht zu vergleichen mit denen der Steiger. Sie nahmen drei Seiten der riesigen Halle ein, deren Ziegelwände bis zu den Fenstern schmutzig weiß gefliest waren. Dutzende schwanenhalsförmige Messinghähne, die durch Hebel zu öffnen waren, standen in Reih und Glied heraus. Es gab keine Drehknöpfe, keine Schläuche, keine Vorhänge. Nur Wasser im Strahl. Und Lattenroste, um die Bodenfliesen zu schützen.
»Und wo sind die Seifen?«, fragte ich.
Jojo lachte. Er gehörte zu den Bergleuten, die Schülerführungen machten. Ein paar Jungen grinsten, und ich war sauer. Ihre Väter erzählten zu Hause davon, nur ich wusste von nichts.
»Sehr gute Frage, Pochjungchen«, lobte mein Bruder und wandte sich an die anderen: »Wer kann mir sagen, wo die Seifen sind?«
Dutzende Finger reckten sich zum Plafond.
»Bei den Gehenkten! Die Seifen sind bei den Gehenkten!«
Hunderte Kleidungsstücke hingen an Haken vom Gebälk der Decke. Arbeitsdrilliche, Straßenhosen, leere Hüllen an Ketten, die auf ihre Besitzer warteten. Blaumänner und Jacketts Seite an Seite wie eine Gespensterarmee.
Mein Bruder nahm eine blaue Marke aus seiner Tasche und hielt sie uns hin.
»Weitergeben!«
»Das ist eine Lampenmarke«, sagte ein Junge.
Ich ärgerte mich. Die kannte ich natürlich. Jeden Abend nach der Schicht legte Joseph sie zusammen mit dem Geld aus seinen Taschen in den Aschenbecher im Flur. »1916« war darin eingraviert. Das war seine Kennnummer, die er bei der Anstellung geerbt hatte und die er an dem Tag verlieren würde, an dem das Bergwerk ihn nicht mehr brauchte. Diese Nummer war zum zweiten Namen meines Bruders geworden.
»Ein Junge zu mir!«
Dreißig Hände hoben sich. Netterweise zeigte er auf mich.
Wir gingen an den Bänken entlang, zwischen Hunderten Ketten und Seilen, die von der Decke hingen wie Schiffswanten und in Menschenhöhe von nummerierten Klampen gehalten wurden. Mein Bruder zeigte auf die Nummer 1916. Wir standen unter seiner Garderobe. Mit einer geübten Bewegung machte er die Kette los und legte sie in meine Hände.
»Los, Kleiner, hol meine Klamotten runter!«
Ich ließ das Seil ein bisschen schießen. Das war nicht schwer. Wie eine Fahne an ihrem Mast zu hissen. Beim Herabsinken wiegte sich der Gehenkte meines Bruders sacht. Es quietschte. Die Kinder verfolgten das Manöver mit in den Nacken gelegtem Kopf.
»Durch das Hinaufziehen spart man Platz«, erläuterte mein Bruder.
Wie seine Kollegen hatte er zu unserem Empfang seine Bergmannskluft angelegt: Blaumann, Stiefel, Halstuch, Helm. Ich ließ seine Zivilkleidung herunter.
Sie war auf vier Haken verteilt, in der Mitte zusammengehalten von einer verbeulten Ablageschale. Kamm, Spiegel und Seife lagen darin.
»Da ist die Seife!«
Ich schwenkte das Seifenstück, das glänzte wie ein Schatz.
»Das macht man als Erstes, wenn man heraufkommt: alles ausziehen und sich waschen.«
Dann suchte man Mütze, Kappe, das saubere Hemd und die Lederschuhe zusammen, bevor man hinausging. Und wenn man wieder in Zivil war, schickte man die Arbeitskleidung zur Decke. An den aufgehängten Kleidungsstücken konnte man erkennen, ob einer im Schacht war oder frei hatte.
Nach acht Stunden Schicht gab der Hauer seine Grubenlampe ab und nahm seine Marke wieder an sich. Die tauschte er am nächsten Tag gegen eine geladene Batterie. Eine Marke zu viel in der Lampenstube bedeutete, dass ein Mann unten geblieben war.
*
Einmal pro Woche säuberte ich meinem Bruder die Nägel und verdiente mir damit ein Taschengeld. Bei uns auf dem Hof, mit einer Bürste und schwarzer Seife. An die Wand gelehnt, saß er auf der steinernen Bank. Rauchte mit geschlossenen Augen. Ich nahm meinen Hocker. Danach wienerte ich sein Gulf. Manchmal, wenn er durch den Matsch gefahren war, putzte ich auch Rückstrahler und Speichen.
Einmal fragte ich ihn abends nach der Maniküre, wie er sich unter der Dusche den Rücken wasche.
»Das macht ein Kumpel«, sagte er. »So ist das Leben.«
Im Ferienlager der Zechen in Nouvion-en-Thiérache wusch man sich im Slip. Manche seiften sogar ihr Unterhemd ein. Aber wenn die Bergleute duschten, waren sie nackt, standen aufgereiht in der Abflussrinne, und jeder schrubbte seinem Vordermann den Rücken. Als mein Bruder mir diese Szene schilderte, lachte er. In meinen offenen Mund, scherzte er, hätten locker alle Fliegen des Landes gepasst.
»Wirklich ganz nackt?«, bohrte ich nach.
»Nein, nicht ganz. Wir behalten die Helme auf!«
Das Lachen meiner Mutter machte mir klar, dass sie auch den Helm ablegten.
*
Mit sechzehn ging ich vom Lycée ab. Die Werkstatt in Liévin, in der mein Bruder vor dem Bergwerk gearbeitet hatte, nahm mich als Lehrling, aus Mitleid und in Gedenken an ihn. Wie beim Autorennen musste ich Reifen wechseln und Motoren inspizieren, aber mein Kinderherz schlug nicht mehr. Ich war an Josephs Tod verwelkt. Meine Jugend war alt geworden.
Ein Jahr nach seinem Sohn verließ uns mein Vater. Mit ihrer verbliebenen Kraft zog meine Mutter mich groß. An der Wand hingen drei schwarz umflorte Fotos: das meines Onkels, das meines Bruders und das meines Vaters. Bei Tisch waren wir nur noch zu zweit, die Minderheit der Lebenden. Das war kein Bauernhof mehr, sondern ein Friedhof. Mit zwei leeren Rahmen, die darauf warteten, dass auch unsere Zeit ablief.
Mama ließ sich bei der Arbeit helfen, dann übergab sie den Hof ihren Cousins. Sie wollte nicht mehr unter Gespenstern leben. Also zog sie zu ihrer großen Schwester, um in Cucq alt zu werden. Zwei schwarze Witwen, die durch Stella-Plage schlurften und seufzend der Zeit gedachten, als sie noch durch die Dünen tobten: Mädchen, die in Schilf und Sand zwischen auslaufenden Wellen spielten. Die am Strand nach dem rotgesichtigen Lolliverkäufer mit dem Bauchladen Ausschau hielten. Meine Tante hatte mir vorgeschlagen nachzukommen. Ihr Haus sei groß genug, um drei Trauernde aufzunehmen. Ich mietete mich lieber bei dem alten Automechaniker ein, bei dem ich arbeitete.
Seine Tochter lebte in England. Sie hatte in Newcastle eine französische Bäckerei eröffnet. Ihr Kinderzimmer stand leer, und er hatte mir angeboten, bei ihm einzuziehen. Er stellte für mich ein Zahnputzglas aufs Waschbecken. Und räumte mir am Tisch Platz für ein Besteck, Teller und Serviette ein, damit ich mit ihnen essen konnte. Er hieß Carlier, seinen Vornamen habe ich nie erfahren. Sogar seine Frau nannte ihn so. Wenn ich einen anständigen Mann kennenlerne, muss ich immer an ihn denken.
Nach dem Tod meines Vaters, mit siebzehn, wurde ich unabhängig.
Und blieb bei Carlier, bis ich erwachsen war.
Irgendwann verkündete ich beim Abendessen, dass ich nach Paris gehen wolle, um dort zu arbeiten. Carlier schüttelte den Kopf. Ihm missfiel die Vorstellung, dass ich unter die Räder der Metro geraten könnte.
»Gefällt’s dir hier nicht?«
Er redete wenig, und man sah ihm nichts an. In der Werkstatt führten seine Hände die meinen. Ihm fehlten die Worte, aber er kannte jede Bewegung.
»Schämst du dich für uns?«
Wir saßen am Esstisch. Mit seinem alten Messer schälte er mir einen Apfel. Er war so traurig, als verlöre er einen Sohn. Ich sollte mir die Hände nicht anders schmutzig machen als mit Schmieröl. Ich zuckte zusammen. Schämen? Dann tat ich etwas, das ich noch nie mit jemand anderem gemacht hatte als mit meinem Vater: Ich stand auf, stellte mich hinter ihn und legte meine Hände auf seine Schultern. Er schälte weiter den Apfel. Ließ die Frucht um sich selbst und um seinen Daumen kreisen, damit die rote Spirale der Schale vollständig und vollkommen fiele.
»Schämen? Für euch?«
Seine Frau lächelte.
»Weil wir Arbeiter sind.«
Carlier war Mechaniker, nannte sich aber schlicht Arbeiter. In jungen Jahren hatte er die Zeche kennengelernt, dann nach seinem Unfall die Fabrik und hatte nie etwas anderes getragen als einen Blaumann.
Er drehte sich um und hielt mir den Apfel hin.
»Wie Adam und Eva«, spottete seine Frau.
Nein, ich schämte mich nicht. Auch ich war Arbeiter. Für immer. Daran würde Paris nichts ändern, das wusste ich. Aber ich musste raus aus dem Revier. Den Horizont der Bergehalden und die beißende Luft aus den Schornsteinen hinter mir lassen. Ich ertrug es nicht mehr, am Tor der Zeche vorbeizugehen und den Jungs auf ihren Mopeds über den Weg zu laufen. Den Blick zu senken vor den Überlebenden. Das Lied der Fördertürme zu hören, das nur Jojo nachmachen durfte. Ich war der Männer mit den Kohlemasken müde. Ich konnte ihre aufgeschürften Hände mit den Schmarren nicht mehr sehen, diese auf Lebenszeit von schwarzen Splittern durchbohrte Haut. Ihre erschöpften Blicke taten mir weh. Auch am Sonntag, nach zehnmal Schrubben, erzählten die Hälse, die Stirnen, die Ohren vom Staub in der Grube.
Und meinem toten Bruder.
3Cécile, meine Frau
(Paris, Freitag, 21. März 2014)
Im Morgengrauen ist Cécile von mir gegangen, ohne dass ich ihr alles gesagt hätte.
Vor drei Monaten hatte meine Frau um ihre Entlassung gebeten. Sie wollte aus dem Krankenhaus raus und zu Hause sterben. Ihr Hausarzt protestierte. Die häusliche Betreuung störte seine Routine. Er sprach nur von sich.
»Als ob er Angst hätte«, sagte meine Frau mit einem Lächeln.
Der Arzt war jung. Es war das erste Mal, dass eine Patientin ihn darum bat, ihr beim Sterben beizustehen. Ein Jahr lang hatte er sie begleitet und getröstet, ohne je etwas zu versprechen. Dann hatte er sie überredet, ins Krankenhaus zu gehen. Dass sie zu Weihnachten nach Hause wollte, verstand er natürlich. Als es dunkel wurde, hoffte Cécile nicht mehr. Sie wollte den Geruch von Äther und Chlor vergessen. Die Geräusche im Flur, das Husten in den Zimmern, das Röcheln morgens, das Klappern der Clogs, das Klopfen einer Putzfrau, die dann die Tür aufriss, ohne eine Antwort abzuwarten. Sie wollte diese Wände ohne Bilder, diese Fenster ohne Nachbarn und das Bettzeug, das ihr nicht gehörte, hinter sich lassen. Sie wollte raus aus diesem Garten der Sterbenden, durch den wir mit kleinen Schritten gingen. Sie verlangte ihre Intimität zurück, ihre Bezugspunkte, ihre Rituale, unsere Spuren. Sie wollte mit geschlossenen Augen ihren Namen murmeln können.
»Aber wirst du dafür stark genug sein?«, fragte sie mich.
Ich sagte Ja.
Seit Monaten war ich morgens ins Krankenhaus gekommen und abends wieder gegangen, voller Schuldgefühle, dass ich sie allein ließ. Wenn sie gepflegt und gewaschen wurde, verließ ich ihr Zimmer. Am Fußende ihres Bettes sitzend, aß ich mit ihr zu Mittag. Nachmittags döste ich in einem Sessel, während sie schlief. Manchmal setzte ich meine Brille ab und legte mich neben sie, um den Fernseher flüstern zu sehen. Sie war nicht mehr meine Frau, sondern Zimmer 306. Ich war nicht mehr ihr Mann, sondern ein Besucher. Ich durfte gerade noch ihre Kissen aufschütteln und ihr ein Glas Wasser an die Lippen führen.
Ich störte den geordneten Ablauf ihrer Krankheit.
*
Ihr ganzes Leben hatte Cécile mit meiner Furcht verbracht. Michel Flavent, die Katastrophe. Winzige Dramen raubten mir den Atem. Überall nur Sorgen. Ständig stieg Angst in mir auf wie ein Galle-Reflux. April erschien mir wie November, und der Freitagabend verpestete mir den Montag. Auf all unseren Fotos hatte ich denselben herzzerreißenden Blick. Meine Frau strahlte, und meine Lippen waren nur ein Schatten. Die letzten Male hatte ich als Kind gelächelt. Nach Jojo lachte ich nicht mehr. Mit Fußtritten und Fausthieben vertrieb ich jede Freude. Überall und ständig forderte ich den Tod heraus. Ich trotzte dem Aas, das um mich herumschlich.
Als Cécile erkrankte, wurde meine tierische Angst zur Qual.
»Mir tut das alles so leid«, murmelte sie.
»So ist das Leben«, antwortete ich.
Ich hätte kein Talent zum Glücklichsein, behauptete sie. Sie hatte begriffen, dass ich nur zum Kampf taugte. Vom Besiegten war ich zum Krieger geworden. In der Morgenröte dieses Unglücks zu zweit begleitete ich den Kampf meiner Frau. Ich hatte nur noch sie, die ich beschützen konnte. Dafür sperrte ich mein Gedächtnis, meine Erinnerungen, meinen Groll aus. Ich flehte Jojo an, mich in Frieden zu lassen. Er sollte mich nicht mehr verfolgen, bis meine Frau ihre Ruhe gefunden hätte. Ich hatte beschlossen, für etwas anderes als die Trauer zu leben. Den Tod meines Bruder zu vergessen und dass wir nie ein Kind haben würden. Ich versprach auch, meine Gewissensbisse abzulegen.
Mein Wille würde stark genug für uns beide sein. Das sagte ich zu Cécile. Ihre Entlassung wäre ein Geschenk für mich.
Im Frühjahr würde ich die Fenster aufreißen, als ob ich Mauern einrisse. Die Sonne würde ihr Bett mit Licht fluten. Sie wollte sich wieder dem Aquarell widmen. Ich versprach, ihre Lieblingspigmente eigenhändig zu mahlen. Einen Rotmarder zu züchten, um einen Pinsel daraus zu machen. China zu durchstreifen, wo heimlich die Baumwolle reife für das Papier. Sie lachte noch über diesen Quatsch. Ich war pathetisch, sie fand mich magisch und applaudierte.
Ich hatte mich entschieden, den Rhythmus meiner Frau anzunehmen wie die Mutter eines Neugeborenen. Zu schlafen, wenn sie schlief, zu essen, wenn sie aß, und ihrem Atem zu lauschen, um ihren Schlaf zu verstehen. Aber ich würde auch an mich denken. Das müsste sein. Um das alles zu überleben, um meine Kraft, meinen Kopf zu schonen und ihr die Kraft wiederzugeben, die sie mir jahrelang geschenkt hatte. Ich würde mir eine Stunde pro Tag genehmigen. Um an die frische Luft zu kommen, spazieren zu gehen, Zeitung zu lesen, auf einer Café-Terrasse ein Bier zu trinken und ein paar Blumen zu kaufen, die ihr sagten, ich liebe dich. Ich würde mich über nichts beschweren. Ich würde das Leid zum Schweigen bringen.
Sie sah mich an, ein Lächeln in den Augen.
»Das würdest du tun?«
»Na klar.«
Klar würde ich das tun.
»So ist das Leben«, hätte Joseph gesagt.
*
Die ersten Wochen waren schwierig. Das ganze medizinische Material, die Visiten, all diese Fremden hatten aus unserem Zuhause eine Krankenstation gemacht. Cécile beklagte sich nicht, sie beklagte sich über nichts. Lächelnd stellte sie fest, dass der Tropfständer und der Medikamentenspender sich schlecht mit dem Blau unserer Vorhänge vertrügen.
Ich war zum »Helfer« geworden. Ich mochte das Wort nicht. Oft verstand ich mich als Lebenshelfer. Manchmal auch als Sterbehelfer. Wir hatten Weihnachten zu zweit gefeiert, sie in ihrem Bett, ich in meinem Sessel. Es gab keinen Unterschied mehr zwischen dem Zimmer 306 und unserer Wohnung. Ich hatte eine Tanne gekauft, über die sie sich freute wie ein Kind.
In einer Nacht voller Angst rief ich den Notarzt. Cécile fieberte, und ihre Lunge machte beunruhigende Geräusche. Bei jedem Atemzug stiegen Klagen aus ihrer Brust, Knurrlaute, höhnische Stimmen wie von einer Dämonenversammlung, die mich das Schlimmste befürchten ließen. Ich versuchte, ihre Nase, ihren Hals zu spülen, aber die Luft kam nicht durch.
Drei Nächte später zog eine Frau bei uns ein. Ich schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer, sie im Gästezimmer.
Cécile starb nicht. Sie erlosch, wie eine Blume verwelkt. Schwindelanfälle und Übelkeit quälten sie. Der Hausarzt riet ihr, viel zu schlafen, also schlief sie viel. Morgens zog ich die Vorhänge zu, um den Tag am Eindringen zu hindern. In den Nächten sah ich ihre Augen unter den geschlossenen Lidern tanzen. Ich hielt ihre Hand. Ich hatte die Wände mit unseren Fotos, mit Tourismuswerbung und friedlichen Landschaften tapeziert. Sie hatte sich Meeresstrände und dunkle Wälder gewünscht und das Licht, das morgens die Berge ausstanzt. Sie hatte mich gebeten, die Souvenirs aus ihrer Zeit als Lehrerin zu holen und die schönsten Kinderzeichnungen auszusuchen. An die Decke hatte ich auch Tiere eingeladen: Vögel, eine Hirschkuh, eine Hasenfamilie, die zu ihrem Bau hoppelt. Schweigend betrachtete sie diese Splitter von Leben. In eine Ecke des Zimmers hatte ich ein Foto mit einem Makaken geklebt, der gähnte wie ein Kind beim Aufwachen. Als meine Frau ihn entdeckte, lachte sie.
»Er ist unwiderstehlich.«
Sonst sagte sie nichts mehr.
Aber wenn ihr Blick durch den Raum schweifte, ließ der gähnende Affe sie lächeln. Cécile bot diesem Aas von Tod die Stirn. Ich wusste nicht mehr, wo sie war. Sie reagierte nicht, antwortete nicht mehr. An manchen Abenden hatte sie Probleme, den Kopf aufrechtzuhalten und meinen Bewegungen zu folgen. Aber wenn ihre Blicke meine fixierten, war das wie eine Umarmung. Wie wenn unsere Hände sich trafen. Ihr Körper an meinem, ihre Finger an meinen Lippen, meine Finger an ihrem Nacken. Dieser