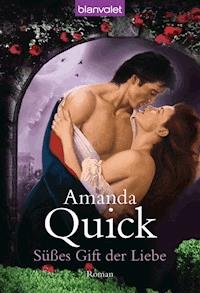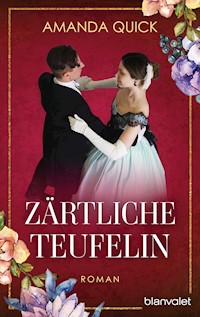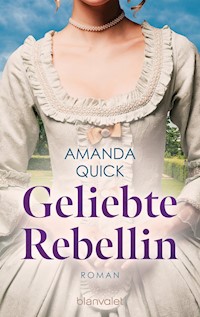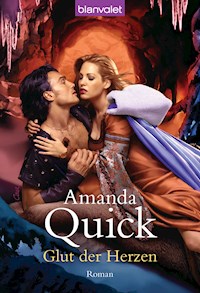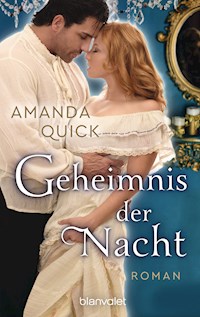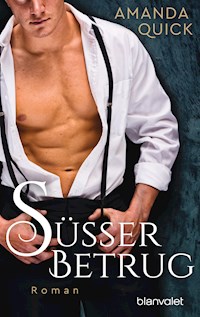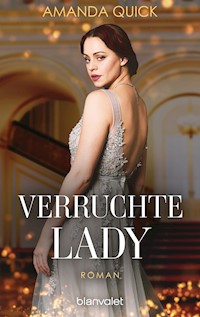
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Er nimmt sich, was er will. Und er will sie.
England, 19. Jahrundert: Schon als junges Mädchen träumte Phoebe Layton von Gabriel Banner. In ihren Fantasien war er der edle Ritter, der mit ihr auf seinem Pferd davonritt und um ihre Hand anhielt. Acht Jahre später begegnet sie Gabriel wieder – bei einem Rendezvous, das sie eingefädelt hat, um seine Hilfe zu erbitten. Doch aus dem edlen Märchenritter ist ein draufgängerischer Gentleman geworden, der sich nimmt, was er will. Und zwar ohne zu fackeln. Phoebe ahnt, dass es ein Fehler war, Gabriel in ihre Pläne einzuweihen. Sie fühlt, dass mit dem ersten heißen Kuss ihr Schicksal besiegelt ist. Denn nach und nach kommt sie dem Geheimnis auf die Spur, warum Gabriel ihr so überaus hilfreich zur Seite steht ...
Leidenschaftlich, atmosphärisch und spannend bis zur letzten Seite – perfekter Schmökerstoff für alle Fans der Erfolgsserie »Bridgerton«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
England, 19. Jahrundert: Schon als junges Mädchen träumte Phoebe Layton von Gabriel Banner. In ihren Fantasien war er der edle Ritter, der mit ihr auf seinem Pferd davonritt und um ihre Hand anhielt. Acht Jahre später begegnet sie Gabriel wieder – bei einem Rendezvous, das sie eingefädelt hat, um seine Hilfe zu erbitten. Doch aus dem edlen Märchenritter ist ein draufgängerischer Gentleman geworden, der sich nimmt, was er will. Und zwar ohne zu fackeln. Phoebe ahnt, dass es ein Fehler war, Gabriel in ihre Pläne einzuweihen. Sie fühlt, dass mit dem ersten heißen Kuss ihr Schicksal besiegelt ist. Denn nach und nach kommt sie dem Geheimnis auf die Spur, warum Gabriel ihr so überaus hilfreich zur Seite steht ...
Autorin
Amanda Quick ist das Pseudonym der erfolgreichen, vielfach preisgekrönten Autorin Jayne Ann Krentz. Krentz hat Geschichte und Literaturwissenschaften studiert und lange als Bibliothekarin gearbeitet, bevor sie ihr Talent zum Schreiben entdeckte. Sie ist verheiratet und lebt in Seattle.
Von Amanda Quick bereits erschienen (Auswahl)
Süßer Betrug · Geheimnis der Nacht · Liebe um Mitternacht · Verführung im Mondlicht · Verzaubertes Verlangen · Riskante Nächte · Dieb meines Herzens · Süßes Gift der Liebe · Glut der Herzen · Ungezähmte Leidenschaft · Gefährliche Küsse · Zärtliche Teufelin · Geliebte Rebellin · Liebe Ohne Skrupel · Verführung · Verlangen · Verruchte Lady
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
Amanda Quick
Verruchte Lady
Roman
Deutsch von Uta Hege
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Reckless« bei bei Bantam Books, a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright dieser Ausgabe © 2021 by Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 1992 by Jane A. Krentz
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 by Goldmann Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Buchgewand Coverdesign | www.buch-gewand.de
unter Verwendung von Motiven von depositphotos.com: © faestock, © PhaisarnWong, © id1974
DK · Herstellung: at
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-29122-8V001
www.blanvalet.de
Für Yook Louie, deren künstlerische Talente und Visionen mich immer wieder verblüffen.
Ich bin ihr wirklich dankbar.
Kapitel 1
Das fahle Leuchten des Mondes passte zu ihm.
In dem silbernen Licht, das die Wiese erhellte, wirkte Gabriel Banner, Graf von Wylde, so geheimnisvoll und gefährlich wie der zum Leben erweckte Held einer Legende.
Phoebe Layton brachte ihre Stute am Rand des Wäldchens zum Stehen und beobachtete mit angehaltenem Atem, wie Wylde auf sie zugeritten kam. Sie versuchte, ihre zitternden Hände zur Ruhe zu bringen, als sie die Zügel anzog. Dies war nicht der richtige Augenblick, um die Nerven zu verlieren. Sie war eine Lady auf einer heiligen Mission.
Sie brauchte einen Ritter, der ihr zur Seite stünde, und die Zahl der geeigneten Kandidaten war nicht gerade groß. Tatsächlich war Wylde der Einzige, der ihres Wissens nach über die erforderlichen Qualitäten verfügte. Aber erst einmal musste sie ihn dazu überreden, diese Rolle zu übernehmen.
Seit Wochen hatte sie daran gearbeitet. Bis jetzt hatte der eigenbrötlerische, zurückgezogen lebende Graf sämtliche ihrer geheimnisvollen Briefe ignoriert, mit denen sie versucht hatte, sein Interesse zu wecken. Also hatte sie verzweifelt beschlossen, eine andere Taktik anzuwenden. In dem Versuch, ihn endlich aus der Reserve zu locken, hatte sie den einzigen Köder ausgelegt, dem er garantiert nicht widerstehen konnte.
Die Tatsache, dass er heute Abend hier auf diesem einsamen Feldweg mitten in Sussex war, zeigte ihr, dass es ihr endlich gelungen war, ihn zu einem Treffen zu bewegen.
Wylde wusste nicht, wer sie war. Ihre Briefe hatte sie als die »verschleierte Lady« unterzeichnet. Phoebe bedauerte diese kleine Täuschung, aber sie war unumgänglich gewesen. Hätte Wylde gleich zu Beginn des Unternehmens ihre wahre Identität gekannt, hätte er sich mit größter Wahrscheinlichkeit geweigert, ihr zu helfen. Sie musste ihn zu dieser Mission überreden, ehe sie es wagen durfte, ihm ihren Namen zu nennen. Phoebe war sicher, dass er die Gründe für die anfänglichen Heimlichkeiten verstehen würde, wenn er erst einmal die ganze Geschichte erfuhr.
Nein, Wylde kannte sie nicht, aber Phoebe kannte ihn.
Sie hatte ihn seit fast acht Jahren nicht mehr gesehen. Mit sechzehn hatte sie ihn für eine lebende Legende gehalten, für einen edlen, tapferen Ritter aus einer mittelalterlichen Liebesgeschichte. In ihren jungen Augen hatten ihm nur die schimmernde Rüstung und das Schwert gefehlt.
Obwohl Phoebe sich deutlich an ihre letzte Begegnung erinnerte, wusste sie, dass Gabriel ganz bestimmt nichts mehr davon wusste. Er war damals viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, die Flucht mit ihrer Schwester Meredith zu planen.
Phoebe beobachtete neugierig, wie er näher kam. Dummerweise machten der dichte Schleier, den sie trug, und das fahle Mondlicht es unmöglich, genau zu erkennen, inwieweit er sich in all den Jahren verändert hatte.
Ihr erster Gedanke war, dass er noch imposanter war, als sie ihn in Erinnerung gehabt hatte. Größer. Schlanker. Irgendwie härter. Seine Schultern wirkten breiter unter dem Mantel, den er trug. Die enganliegenden Reithosen betonten die starken, muskulösen Umrisse seiner Schenkel. Der geschwungene Rand seines Hutes warf einen bedrohlichen, undurchdringlichen Schatten auf sein Gesicht.
Einen beunruhigenden Moment lang fragte sich Phoebe, ob dies vielleicht der falsche Mann war. Vielleicht sah sie sich auch gerade einem echten Bösewicht gegenüber, einem Straßenräuber oder Schlimmerem. Sie rutschte nervös in ihrem Sattel hin und her. Wenn ihr diese Nacht etwas passierte, hätte ihre arme, geplagte Familie bestimmt das Gefühl, es sei durchaus gerechtfertigt, folgende Worte in ihren Grabstein eingravieren zu lassen: Schließlich zahlte sie den Preis für ihren Leichtsinn, ja das wäre passend. In den Augen ihrer überfürsorglichen Sippe hatte Phoebe ihr gesamtes Leben damit zugebracht, von einer Klemme in die nächste zu rutschen. Und dieses Mal war sie vielleicht tatsächlich ein zu großes Risiko eingegangen.
»Die geheimnisvolle verschleierte Lady, wie ich annehme?«, fragte Gabriel kühl.
Phoebe atmete erleichtert auf. Ihre Zweifel an der Identität des Mannes waren wie ausgelöscht. Diese dunkle, feste Stimme erkannte sie auch nach acht Jahren wieder. Was sie überraschte, war die Freude, die sie bei ihrem Klang verspürte. Sie runzelte die Stirn.
»Guten Abend, Mylord«, sagte sie.
Gabriel brachte seinen schwarzen Hengst nur wenige Fuß vor ihrer Stute zum Stehen. »Ich habe Ihre letzte Nachricht erhalten, Madam. Ich fand sie höchst ärgerlich, ebenso wie die anderen Schreiben.«
Phoebe schluckte, als ihr klar wurde, dass er nicht gerade bester Stimmung war. »Ich hatte eigentlich gehofft, Ihr Interesse zu wecken, Sir.«
»Ich habe eine starke Abneigung gegen Täuschungsmanöver jeglicher Art.«
»Ich verstehe.« Phoebes Mut sank. Eine starke Abneigung gegen Täuschungsmanöver jeglicher Art. Plötzlich fragte sie sich, ob es nicht vielleicht ein ernsthafter taktischer Fehler gewesen war, sich mit Wylde einzulassen. Umso besser, dass sie sich heute Abend verschleiert hatte. Auf keinen Fall sollte er wissen, wer sie war, falls ihre Verhandlungen scheiterten. »Trotzdem freue ich mich, dass Sie beschlossen haben, meine Einladung anzunehmen.«
»Meine Neugier hat mich getrieben.« Gabriel lächelte schwach im Mondlicht, aber sein Lächeln enthielt keine Wärme, und seine dunkle Miene verriet keine Regung. »Sie sind mir seit zwei Monaten ein Dorn im Auge, Madam. Ich nehme an, das ist Ihnen durchaus bewusst.«
»Das tut mir leid«, sagte Phoebe mit ernster Stimme. »Aber ich war wirklich verzweifelt, Mylord. Es ist recht schwierig, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie haben meine ersten Briefe nicht beantwortet, und da Sie nur selten in der Öffentlichkeit auftauchen, wusste ich nicht, wie ich sonst Ihre Aufmerksamkeit erregen sollte.«
»Also haben Sie beschlossen, mich derart zu provozieren, dass ich mich schließlich doch dazu entschied, Sie zu treffen?«
Phoebe atmete tief ein. »So in etwa.«
»Es gilt allgemein als gefährlich, mich zu verärgern, meine geheimnisvolle verschleierte Lady.«
Daran zweifelte sie nicht einen Augenblick, aber jetzt war es zu spät, um einen Rückzieher zu machen. Sie war bereits zu weit gegangen, um nun das nächtliche Unternehmen abzublasen. Sie war eine Lady auf einer heiligen Mission, und sie musste Mut beweisen.
»Ach ja, Mylord?« Phoebe bemühte sich um einen kühlen, amüsierten Ton. »Die Sache ist die, dass Sie mir einfach keine Wahl gelassen haben. Aber keine Angst, ich bin sicher, dass Sie froh sein werden, meiner Einladung Folge geleistet zu haben, wenn Sie erst einmal gehört haben, was ich zu sagen habe, und ich weiß, dass Sie mir dann auch mein kleines Täuschungsmanöver verzeihen werden.«
»Falls Sie mich hierherbestellt haben, um zu triumphieren, dann kann ich Sie nur warnen. Ich bin kein guter Verlierer.«
»Triumphieren?« Sie blinzelte hinter dem Schleier, doch dann wurde ihr klar, dass er von dem Köder sprach, den sie benutzt hatte, um ihn heute Abend hierherzulocken. »Oh ja, das Buch. Also bitte, Mylord. Sie sind ebenso versessen darauf, das Manuskript zu sehen, wie ich es bin. Offensichtlich konnten Sie meiner Einladung, es sich anzusehen, nicht widerstehen, auch wenn ich die neue Besitzerin bin.«
Gabriel tätschelte den Hals seines Hengstes. »Anscheinend haben wir ein gemeinsames Interesse für mittelalterliche Manuskripte.«
»Stimmt. Und wie ich sehe, sind Sie verärgert, dass ich es war, die Der Ritter und der Zauberer entdeckt hat«, sagte Phoebe. »Aber Sie sind doch sicher großmütig genug, um einzugestehen, dass ich meine Nachforschungen mit großer Geschicklichkeit durchgeführt habe. Das Manuskript befand sich schließlich hier in Sussex, praktisch direkt vor Ihrer Nase.«
Gabriel nickte anerkennend. »Sie scheinen bei solchen Dingen ziemliches Glück zu haben. Dies ist bereits das dritte Manuskript, das Sie in den letzten Wochen vor mir in die Hände bekommen haben. Darf ich fragen, warum Sie es nicht einfach abholen und mitnehmen, so wie Sie es mit den anderen Büchern gemacht haben?«
»Wie ich in meinen Briefen bereits angedeutet habe, möchte ich mit Ihnen sprechen, Sir.« Phoebe zögerte und fuhr dann eilig fort: »Und um ehrlich zu sein, dachte ich, es sei vielleicht ganz vernünftig, heute Abend einen Begleiter zu haben.«
»Ah.«
»Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Mr. Nash ein sehr eigenartiger Mann ist, selbst für einen Buchsammler. Als er die Zeit nannte, um die er mir das Manuskript aushändigen würde, hatte ich ein höchst ungutes Gefühl. Es missfällt mir, um Mitternacht Geschäfte zu tätigen.«
»Nash scheint wirklich mehr als nur leicht exzentrisch zu sein«, stimmte ihr Gabriel nachdenklich zu.
»Er behauptet, er sei ein Nachtmensch. In seinen Briefen schreibt er, dass sein Haushalt einem der normalen Welt entgegengesetzten Rhythmus folgt. Er schläft, wenn andere wach sind, und arbeitet, wenn andere schlafen. Sehr seltsam, finden Sie nicht?«
»Zweifelsohne würde er sehr gut in die bessere Gesellschaft passen«, erwiderte Gabriel trocken. »Die meisten Menschen in diesen Kreisen sind die ganze Nacht unterwegs und schlafen dann tagsüber. Aber trotzdem hatten Sie wahrscheinlich recht, als Sie beschlossen, ihn nicht allein um Mitternacht aufzusuchen.«
Phoebe lächelte. »Es freut mich, dass Sie meinen Plan, einen Begleiter mitzunehmen, gutheißen.«
»Ich heiße ihn gut, aber ich muss gestehen, dass Ihre Vorsicht mich überrascht«, sagte Gabriel mit der Präzision eines Fechters, der einen Treffer landet. »Bisher haben Sie keinen großen Hang zur Vorsicht gezeigt.«
Gabriels Sarkasmus ließ Phoebe erröten. »Wenn man auf einer heiligen Mission ist, dann muss man Mut beweisen, Mylord.«
»Sie sind also auf einer heiligen Mission?«
»Ja, Mylord, das bin ich.«
»Ich verstehe. Da wir gerade davon sprechen, ich bin heute Abend ebenfalls hier, weil ich gewisse Nachforschungen anstellen möchte.«
Ein leichter Schauer durchlief Phoebe. »Ja, Mylord? Und was für Nachforschungen, wenn ich fragen darf?«
»Es war nicht allein die Aussicht darauf, Nashs Manuskript zu sehen, bevor Sie es an sich nehmen, die mich hierhergeführt hat, meine verschleierte Lady.«
»Tatsächlich, Mylord?« Vielleicht hatte ihr Plan funktioniert. Vielleicht hatte sie wirklich sein Interesse geweckt, genau wie sie gehofft hatte. »Sie sind also interessiert zu erfahren, was ich Ihnen zu sagen habe?«
»Nicht besonders. Aber ich bin daran interessiert, die Bekanntschaft meiner neuen Gegenspielerin zu machen. Ich glaube, man sollte seine Feinde immer kennen.« Gabriel musterte sie kalt. »Ich weiß nicht, wer Sie sind, Madam, aber Sie haben mich lange genug an der Nase herumgeführt. Ich habe genug von Ihren Spielchen.«
Phoebes aufkommendes Hochgefühl erhielt einen neuen Dämpfer. Sie war noch weit davon entfernt, ihre heilige Mission erfolgreich zu beenden. »Ich nehme an, dass wir uns noch häufiger begegnen werden. Wie Sie bereits sagten, sind wir schließlich hinter denselben Büchern und Manuskripten her.«
Das Leder von Gabriels Sattel knirschte leise, als er seinen Hengst ein paar Schritte näher führte. »Und, haben Sie Ihre kleinen Siege über mich genossen, meine verschleierte Lady?«
»Sehr sogar.« Trotz ihrer Nervosität musste sie lächeln. »Ich bin mit meinen jüngsten Errungenschaften sehr zufrieden. Sie erweitern hervorragend meine Bibliothek.«
»Ich verstehe.« Es folgte eine kurze Pause. »Halten Sie es nicht für gewagt, mich zu bitten, Ihnen bei Ihrem jüngsten Coup behilflich zu sein?«
Es war viel gewagter, als er wusste, dachte Phoebe besorgt. »Die Sache ist die, Mylord. Sie sind einer der wenigen Menschen in ganz England, der meine erst kürzlich gemachte Entdeckung zu würdigen weiß.«
»Ich weiß sie gewiss zu würdigen. Sehr sogar. Und eben darin liegt die Gefahr.«
Phoebes Hände zitterten leicht. »Gefahr?«
»Was, wenn ich beschließe, Ihnen das Manuskript gewaltsam zu entreißen, nachdem Sie es bei Mr. Nash abgeholt haben?«, fragte Gabriel tödlich leise.
Phoebe erstarrte. Diese Möglichkeit hatte sie nicht bedacht. Wylde war schließlich ein Graf. »Seien Sie nicht lächerlich. Sie sind ein Gentleman. So etwas würden Sie nicht tun.«
»Geheimnisvolle verschleierte Ladys, die Gentlemen wie mir Gegenstände vor der Nase wegschnappen, die diese unbedingt haben möchten, sollten nicht allzu überrascht sein, wenn eben diese Gentlemen ungeduldig werden.« Gabriels Stimme wurde hart. »Wenn es sich bei Nashs Manuskript tatsächlich um eine echte Legende von der Tafelrunde aus dem vierzehnten Jahrhundert handelt, so wie er behauptet, dann will ich es haben, Madam. Nennen Sie mir Ihren Preis.«
Spannung ließ die Luft zwischen ihnen knistern. Phoebe sank kurz der Mut. Sie musste sich zusammennehmen, um nicht ihre Stute herumzuwirbeln und im gestreckten Galopp zum Landsitz der Amesburys zurückzureiten, wo sie zu Gast war. Sie fragte sich, ob Ritter im Mittelalter wohl auch so verdammt schwierig gewesen waren.
»Ich bezweifle, dass Sie meinen Preis bezahlen könnten, Sir«, flüsterte sie.
»Nennen Sie ihn, und wir werden sehen.«
Phoebe fuhr sich mit der Zunge über ihre trockenen Lippen. »Die Sache ist die, Sir. Ich habe nicht die Absicht, das Manuskript zu verkaufen.«
»Sind Sie sich da sicher?« Gabriel führte seinen Hengst noch etwas näher. Das riesige Tier neigte den Kopf und schnaubte laut, als es sich gegen Phoebes Stute drängte.
»Ganz sicher«, beeilte Phoebe sich zu sagen. Sie machte eine effektvolle Pause. »Aber vielleicht überlege ich mir, es Ihnen zu schenken.«
»Es mir zu schenken?« Gabriel war sichtlich verwirrt. »Wovon zum Teufel sprechen Sie?«
»Das werde ich Ihnen später erklären, Sir.« Phoebe bemühte sich, ihr nervöses Pferd zu beruhigen. »Darf ich Sie vielleicht daran erinnern, dass beinahe Mitternacht ist? Ich werde in ein paar Minuten von Mr. Nash erwartet. Kommen Sie nun mit oder nicht?«
»Selbstverständlich werde ich heute Abend meine Pflicht als Ihr Begleiter erfüllen«, sagte Gabriel grimmig. »Es ist zu spät, um mich jetzt noch loszuwerden.«
»Ja, nun, sollen wir dann vielleicht losreiten?« Phoebe bedeutete ihrer Stute, den mondbeschienenen Weg hinabzutraben. »Das Cottage von Mr. Nash müsste ganz in der Nähe sein, wenn die Beschreibung stimmt, die er in seinem letzten Brief mitgeschickt hat.«
»Gut, wir wollen ihn nicht warten lassen.« Gabriel wandte seinen Hengst und folgte ihr.
Das schlanke Pferd fiel in Gleichschritt mit Phoebes Pferd. Phoebe fragte sich, ob ihre Stute wohl ebenso nervös war wie sie selbst. Gabriel und ihr Hengst wirkten in dem fahlen Mondlicht riesig und bedrohlich.
»Nachdem wir uns endlich einmal begegnet sind, meine verschleierte Lady, habe ich ein paar Fragen an Sie«, sagte Gabriel.
Phoebe bedachte ihn mit einem argwöhnischen Blick. »Nachdem Sie meine Briefe zwei Monate lang ignoriert haben, überrascht mich das. Ich hatte den Eindruck, dass ich für Sie nicht gerade von großem Interesse bin.«
»Sie wissen verdammt gut, dass mein Interesse jetzt geweckt ist. Sagen Sie, haben Sie die Absicht, mir weiterhin jedes geheimnisvolle mittelalterliche Buch vor der Nase wegzuschnappen, das ich zufällig haben möchte?«
»Wahrscheinlich. Wie Sie bemerkt haben dürften, haben wir einen ähnlichen Geschmack in solchen Dingen.«
»Das könnte ziemlich teuer für uns beide werden. Wenn es sich erst einmal herumspricht, dass es zwei rivalisierende Interessenten für jedes alte Buch gibt, das irgendwo auftaucht, werden die Preise sehr schnell in die Höhe schießen.«
»Ja, ich glaube, das werden sie«, sagte Phoebe mit einstudierter Gleichgültigkeit. »Aber ich kann es mir leisten. Ich erhalte ein sehr großzügiges Taschengeld.«
Gabriel bedachte sie mit einem fragenden Seitenblick. »Und Ihr Ehemann hat nichts gegen dieses teure Hobby?«
»Ich habe keinen Ehemann, Sir. Und ich habe auch nicht vor, einen zu bekommen. Soweit ich beobachtet habe, neigen Ehemänner dazu, ihre Frauen ziemlich einzuschränken.«
»Ich gebe zu, dass wohl nur wenige Ehemänner die Art von Unsinn dulden würden, wie Sie ihn heute Abend vorhaben«, murmelte Gabriel. »Kein vernünftiger Mann würde seiner Frau gestatten, um diese Zeit allein in der Gegend herumzuspazieren.«
Neil hätte es ihr erlaubt, dachte Phoebe wehmütig. Aber ihr blonder Lancelot war tot, und sie hatte die Aufgabe, seinen Mörder zu finden. Sie schob die Erinnerung beiseite und versuchte, die Schuldgefühle zu unterdrücken, die sie jedes Mal überkamen, wenn sie an Neil Baxter dachte.
Wenn es sie nicht gegeben hätte, wäre Neil nicht in die Südsee gegangen, um dort sein Glück zu machen. Und wenn er nicht in die Südsee gegangen wäre, wäre er nicht von einem Piraten ermordet worden.
»Ich bin nicht allein«, erinnerte Phoebe Gabriel. Sie versuchte verzweifelt, ihrer Stimme einen fröhlichen Klang zu verleihen. »Ich habe schließlich einen Ritter an meiner Seite. Ich fühle mich vollkommen sicher.«
»Sprechen Sie zufällig von mir?«
»Natürlich.«
»Dann sollten Sie wissen, dass Ritter es gewohnt sind, für ihre Taten reich belohnt zu werden«, sagte Gabriel. »Im Mittelalter gewährte eine Lady ihrem Favoriten ihre Gunst. Sagen Sie, Madam, haben Sie die Absicht, mich für die Mühe heute Nacht in ähnlicher Weise zu entlohnen?«
Phoebe riss die Augen hinter dem Schleier auf. Sie war entsetzt. Sicher hatte er damit nicht sagen wollen, dass sie ihm ihre Gunst auf eine vertrauliche Art und Weise gewähren sollte. Auch wenn er ein Eigenbrötler geworden war und sich nicht länger an die Regeln der besseren Gesellschaft gebunden fühlte, so konnte sie doch einfach nicht glauben, dass Gabriels Wesen sich derart verändert haben sollte.
Der edle Ritter, der ihre Schwester vor Jahren vor einer arrangierten Ehe hatte retten wollen, war im Grunde seines Herzens ein ritterlicher Gentleman. In der Tat wäre er in den Augen des sechzehnjährigen Mädchens, das sie damals gewesen war, würdig gewesen, höchstpersönlich an der Tafelrunde Platz zu nehmen. Auf keinen Fall würde er einer Lady so offenkundig unritterliche Avancen machen.
Oder vielleicht doch?
Sie musste ihn falsch verstanden haben. Vielleicht zog er sie nur auf.
»Erinnern Sie mich daran, Ihnen ein Seidenband oder etwas Ähnliches als Lohn für Ihre Bemühungen zu geben, Mylord«, sagte Phoebe. Sie wusste nicht, ob ihre Antwort weltklug genug klang oder nicht. Sie war beinahe fünfundzwanzig, aber das hieß nicht, dass sie besondere Erfahrung im Umgang mit rüpelhaften Gentlemen besaß. Als die jüngste Tochter des Grafen von Clarington war sie immer wohlbehütet gewesen. Ihrer Meinung nach manchmal sogar allzu behütet.
»Ich glaube nicht, dass ein Seidenband ausreichen wird«, sagte Gabriel nachdenklich.
Phoebe verlor die Geduld. »Nun, das ist alles, was Sie bekommen werden, also hören Sie auf, mich zu provozieren, Mylord.« Erleichtert sah sie, dass sie direkt auf ein Häuschen zuritten. »Das muss Mr. Nashs Cottage sein.«
Sie musterte das kleine, windschiefe Gebäude, das vor ihnen lag. Selbst bei Nacht war deutlich zu erkennen, dass das Cottage äußerst reparaturbedürftig war. Der ganze Platz wirkte irgendwie vernachlässigt. Ein windschiefes Tor versperrte den Zutritt zu einem wild überwucherten Gartenweg. Das schwache Licht aus dem Inneren des Hauses fiel durch Fensterrahmen, die dringend gestrichen werden mussten, und auch das Dach hatte eine Reparatur nötig.
»Nash scheint nicht besonders erfolgreich zu sein beim Verkauf von Manuskripten.« Gabriel brachte seinen Hengst zum Stehen und schwang sich aus dem Sattel.
»Ich glaube nicht, dass er viele Manuskripte verkauft. Seine Briefe haben in mir den Eindruck geweckt, dass er eine große Bibliothek besitzt, aber dass es ihm äußerst schwerfällt, einzelne Bücher zu verkaufen.« Phoebe hielt ihre Stute an. »Er verkauft mir Der Ritter und der Zauberer auch nur, weil er dringend Geld braucht für den Kauf eines Buches, das ihm wichtiger erscheint als eine frivole mittelalterliche Liebesgeschichte.«
»Was, bitte, könnte wichtiger sein als eine frivole Liebesgeschichte?« Gabriel verzog den Mund zu einem schwachen Lächeln, als er die Hände ausstreckte und Phoebes Taille umfasste.
Sie hielt den Atem an, als er sie aus dem Damensattel hob. Er stellte sie nicht auf die Füße, sondern hielt sie vor sich, die Spitzen ihrer Stiefel einen Zentimeter über dem Boden. Es war das erste Mal, dass er sie berührte, das erste Mal, dass sie ihm so nahe war. Phoebe war von ihrer eigenen Reaktion überrascht - es verschlug ihr den Atem.
Er roch gut, wie sie überrascht feststellte. Der Duft, den er verströmte, war eine unbeschreibliche Mischung aus Leder und Wolle, durch und durch männlich. Plötzlich wusste sie, dass sie diesen Geruch niemals vergessen würde.
Aus irgendeinem Grund schwächte sie die Stärke seiner Hände. Sie war sich bewusst, wie klein und zerbrechlich sie im Vergleich zu ihm war. Nein, es war keine Einbildung. Er war größer, als sie ihn in Erinnerung gehabt hatte.
Vor acht Jahren hatte Phoebe für den tapferen Retter ihrer Schwester die unschuldige, idealistische Bewunderung eines jungen Mädchens empfunden.
Heute Abend war sie verblüfft, als sie feststellte, dass sie sich durchaus in einer Weise zu ihm hingezogen fühlen könnte, in der eine Frau einen Mann begehrte. Nie zuvor hatte sie für einen Mann derartige Gefühle entwickelt, nicht einmal für Neil. Nie zuvor hatte sie dieses alles erschütternde Gefühl verspürt.
Vielleicht ging wieder einmal ihre Phantasie mit ihr durch. Es lag am Mondschein und an der Spannung. Ihre Familie warnte sie immer davor, ihrer Phantasie allzu freien Lauf zu lassen.
Gabriel stellte sie auf die Füße. Verwirrt durch den Schwindel, den er bei ihr verursachte, vergaß Phoebe, ihr Gewicht auf das rechte Bein zu verlagern, ehe sie den linken Fuß aufsetzte. Sie stolperte und klammerte sich an Gabriels Arm.
Gabriel zog die Brauen hoch. »Mache ich Sie etwa nervös, Mylady?«
»Nein, natürlich nicht.« Phoebe ließ seinen Arm los und schüttelte eilig die Röcke ihrer Reitkleidung aus. Entschlossen wandte sie sich in Richtung des schiefen Gartentors. Das leichte Hinken, das sie behinderte, konnte sie nicht verbergen. Sie hatte sich bereits daran gewöhnt, aber anderen fiel es immer auf.
»Sind Sie umgeknickt, als ich Sie auf den Boden gestellt habe?« Gabriel klang ehrlich besorgt. »Das tut mir leid, Madam. Lassen Sie mich Ihnen helfen.«
»Nein, ich bin nicht umgeknickt«, sagte Phoebe ungeduldig. »Mein linkes Bein ist etwas schwach, das ist alles. Ein Kutschenunfall.«
»Ich verstehe«, sagte Gabriel. Er klang nachdenklich.
Phoebe fragte sich, ob dieser Makel ihn wohl störte. Auf jeden Fall hatte er schon andere abgeschreckt. Nur wenige Männer forderten eine Frau, die hinkte, auf, mit ihnen Walzer zu tanzen. Normalerweise war ihr das egal. Sie war es gewohnt. Aber sie stellte fest, dass sie der Gedanke schmerzte, Gabriel könnte einer dieser Männer sein, für die eine Frau perfekt sein musste.
»Wenn ich den Eindruck erwecke, etwas nervös zu sein«, sagte Phoebe mit brummiger Stimme, »dann liegt das daran, dass ich Sie schließlich nicht besonders gut kenne, Sir.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte Gabriel mit leicht amüsierter Stimme. »Sie sind gerade im Begriff, mir das dritte Manuskript zu stehlen. Sie scheinen mich demnach recht gut zu kennen.«
»Ich stehle es Ihnen nicht, Mylord.« Phoebe hob die Hand und zog den zweiten dunklen Schleier über den Rand ihres kleinen Huts. Einer reichte vielleicht nicht, um ihr Gesicht im Licht des Cottages zu verbergen. »Ich betrachte uns als Rivalen, nicht als Feinde.«
»Da ist kein großer Unterschied, wenn es um solche Dinge geht. Aber seien Sie gewarnt, Madam. Vielleicht haben Sie Ihr Glück heute zu sehr herausgefordert.«
Phoebe klopfte eilig. »Machen Sie sich keine Sorgen, Wylde. Ich bin sicher, dass sich Ihnen noch genügend Möglichkeiten bieten werden, dieses Spiel zu gewinnen.«
»Zweifellos.« Gabriels Augen ruhten auf Phoebes dicht verschleiertem Gesicht, als hinter der Tür Fußtritte hallten. »Auf jeden Fall werde ich in Zukunft alles daransetzen, Ihre Herausforderung anzunehmen.«
»Ich war bis jetzt ganz zufrieden mit dem Wettstreit«, sagte Phoebe. Sich auf ein Wortgefecht mit Wylde einzulassen war, als würde man ein Stück rohes Fleisch an einem Tiger vorbeischleifen. Auf jeden Fall war es alles andere als ungefährlich. Aber sie musste unbedingt sein Interesse wachhalten, sonst verschwände er vielleicht einfach wieder in der Nacht. Wieder einmal bedauerte sie, dass es kaum noch Ritter gab. Die Auswahl war wirklich begrenzt.
»Wenn Ihnen der Wettstreit bis jetzt gefällt«, sagte Gabriel, »dann liegt das nur daran, dass Sie bisher immer gewonnen haben. Aber das wird sich ändern.«
Kapitel 2
Die Tür zu Nashs Cottage öffnete sich, und eine kräftige Haushälterin mittleren Alters mit schmuddeliger Haube und Schürze spähte hinaus.
»Wer sin’ Sie?«, fragte die Frau misstrauisch.
»Sei’n Sie so freundlich und sagen Sie Ihrem Herrn, dass die Person, der er kürzlich ein mittelalterliches Manuskript verkauft hat, hier ist, um es abzuholen«, sagte Phoebe. Sie warf einen Blick in den Flur hinter der Frau. Die Wände waren mit Regalen vollgestellt, die bis zur Decke reichten und die unter den zahllosen ledergebundenen Büchern zusammenzubrechen drohten. Weitere alte Schriften türmten sich auf dem Boden.
»Also hat er noch eins von den Dingern verkauft, he?« Die Haushälterin nickte zufrieden. »Das is’ ein Segen. Er muss mir noch meinen Lohn zahl’n. Schuldet mir inzwischen ’n ganz schönes Sümmchen. Aber diesmal werde ich dafür sorgen, dass er mich bezahlt, bevor er den Händlern ihr Geld gibt. Letztes Mal war nichts mehr übrig, als die Reihe an mir war.«
»Nash hat ein Buch aus dieser Sammlung verkauft, um seine Rechnungen zu begleichen?«, fragte Gabriel, als er hinter Phoebe den engen Flur betrat. Sein schwerer Mantel wirbelte um seine spiegelblank polierten Lederstiefel.
»Egan hat ihn schließlich dazu überredet. Man hätte denken können, dass Mr. Nash ’n Zahn gezogen worden wäre.« Die Haushälterin seufzte, als sie die Tür schloss. »Er erträgt es einfach nich’, sich von irgendeinem seiner alten Bücher zu trennen. Sie sin’ alles, wofür er sich interessiert.«
»Wer ist Egan?«, fragte Phoebe.
»Sein Sohn. Gott sei Dank kommt er ab un’ zu vorbei, um nach dem Rechten zu sehn. Wenn er das nich’ täte, würde hier alles drunter un’ drüber gehn.« Die Haushälterin führte sie ans Ende des Flures. »Keine Ahnung, was wir gemacht hätten, wenn Egan Mr. Nash nich’ überredet hätte, ein oder zwei von den verstaubten alten Dingern zu verkaufen. Wahrscheinlich wär’n wir verhungert.«
Phoebe warf einen Blick auf Gabriel, der den schäbigen Flur mit all den Büchern musterte. Er hatte seinen Hut abgenommen. Als sie ihn anblickte, spürte sie erneut beinahe übermächtig seine Gegenwart. Im dämmrigen Schein der flackernden Kerze stellte sie fest, dass sein Haar noch genauso mitternachtsschwarz war, wie sie es in Erinnerung gehabt hatte. An den Schläfen hatte er ein paar silberne Strähnen. Aber schließlich war er inzwischen auch schon vierunddreißig. Und das Silber war nicht unattraktiv.
Vor acht Jahren hatte er sehr alt auf sie gewirkt. Jetzt hatte sie den Eindruck, als habe er gerade das richtige Alter. Ihre Finger schlossen sich um eine Falte ihres purpurfarbenen Reitkleides. Sie hob die kleine Schleppe an, um über einen Stapel Bücher zu steigen. Die Freude, die in ihrem Inneren aufwallte, hatte nichts mit dem Manuskript, das sie abholte, zu tun oder damit, dass Gabriel ihr vielleicht bei ihrer Suche nach Neils Mörder helfen würde.
Sie hatte einzig und allein mit Gabriel zu tun.
Gütiger Himmel, die Sache wurde wirklich gefährlich. Irgendwelche Gefühlsanwandlungen waren das Letzte, was sie im Moment brauchen konnte. Sie musste einen klaren Kopf behalten und daran denken, dass Gabriel keinen Grund hatte, irgendeine Zuneigung für ein Mitglied ihrer Familie zu empfinden.
Gabriel hatte das Gesicht halb abgewandt. Er las die Titel auf den Rücken der Bücher, die in wirrem Durcheinander in die Regale gestopft waren. Phoebe starrte auf seinen harten Kiefer und auf seine arrogant geschwungenen Wangenknochen. Aus irgendeinem Grund überraschte es sie, dass er immer noch das Gesicht eines Raubvogels hatte.
Ihr Magen zog sich nervös zusammen. Sie hatte nicht erwartet, dass die letzten acht Jahre seine grimmigen Züge weicher gemacht hatten. Trotzdem war es beunruhigend zu sehen, dass sie härter und unnachgiebiger als je zuvor waren.
Als könne er ihre Gedanken lesen, wandte Gabriel plötzlich den Kopf. Er sah sie direkt an, als wolle er sie mit seinen grünen Augen hypnotisieren. Einen schrecklichen Augenblick lang hatte Phoebe den Eindruck, als könne er durch ihren dichten Schleier hindurchsehen. Sie hatte vergessen, was für Augen er hatte.
Als junges Mädchen hatte sie nicht verstanden, welche Wirkung dieser intensive Blick aus seinen strahlend grünen Augen hatte. Natürlich hatte sie ihn auch immer nur für kurze Zeit angesehen, wenn er mit all den anderen jungen Leuten der besseren Gesellschaft in das Stadthaus ihres Vaters gekommen war, um ihrer reizenden Schwester Meredith den Hof zu machen.
Der einzige Mann, der Phoebe interessiert hatte, war Gabriel gewesen. Er hatte sie von Anfang an mit den Büchern und Gedichten neugierig gemacht, die er ihrer Schwester gegeben hatte. Gabriel hatte Meredith mit Artussagen statt mit Blumen umworben. Meredith hatte sich für die alten Rittergeschichten nicht interessiert, aber Phoebe hatte sie verschlungen.
Jedes Mal wenn Gabriel zu Besuch gekommen war, hatte Phoebe ihn von ihrem Versteck oberhalb der Treppe aus beobachtet. In ihrer Naivität hatte sie die Blicke, mit denen er Meredith bedacht hatte, für wunderbar romantisch gehalten.
Jetzt wurde ihr klar, dass romantisch ein viel zu sanftes und frivoles Wort war, um Gabriels funkelnden Blick zu beschreiben. Kein Wunder, dass ihre Schwester sich vor ihm gefürchtet hatte. Meredith verfügte zwar über einen scharfen Verstand, aber sie war damals ein freundliches, schüchternes Geschöpf gewesen.
Zum ersten Mal, seit sie den leichtsinnigen Versuch gestartet hatte, Gabriel dazu zu bringen, ihr zu helfen, hatte Phoebe das Gefühl, die Herausforderung sei vielleicht doch zu groß für sie. Er hatte recht. Er war kein Mann, mit dem eine intelligente Frau spielen konnte. Vielleicht würde ihr Plan überhaupt nicht funktionieren. Sie schickte ein stummes Dankgebet gen Himmel, dass er sie unter ihrem dichten Schleier noch nicht erkannt hatte.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Gabriel leise. Sein Blick glitt über ihr leuchtendes, purpurfarbenes Kleid. Er wirkte amüsiert.
»Nein. Alles in Ordnung.« Phoebe reckte das Kinn, als sie sich von ihm abwandte, um der Haushälterin zu folgen. Was machte es schon, wenn das Purpur ihres Kleides vielleicht etwas zu grell war? Ihr war durchaus bewusst, dass ihr Geschmack nicht gerade von vielen geteilt wurde. Ihre Mutter und ihre Schwester machten ihr immer Vorwürfe wegen ihrer Liebe zu allzu »flammenden Farben«, wie sie es nannten.
Die Haushälterin führte sie in ein kleines Zimmer, das noch voller war als der Flur. Sämtliche Wände waren mit Regalen zugestellt, die alle überzuquellen schienen. Auf dem Boden lagen hüfthohe Bücherstapel herum, an denen man sich mühsam vorbeiquetschen musste. Links und rechts des Ofens standen schwere Truhen, deren offene Deckel noch mehr Bücher und Zeitungen zum Vorschein brachten.
Ein wohlbeleibter Mann in viel zu engen Reithosen und einer verblichenen kastanienbraunen Jacke saß hinter einem Schreibtisch, auf dem sich ebenfalls zahlreiche Bücher stapelten. Sein kahler Kopf und sein dichter grauer Schnurrbart glänzten im Schein einer Kerze. Er sprach, ohne auch nur von dem Buch vor sich aufzublicken.
»Was is’, Mrs. Stiles? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nich’ gestört werden will, ehe ich mit der Übersetzung dieses Textes fertig bin.«
»Die Lady ist gekommen, um ihr Manuskript abzuholen, Sir.« Mrs. Stiles schien die brummige Art ihres Herren nicht zu stören. »Sie hat ’n Freund mitgebracht. Soll ich Tee machen?«
»Wie? Sie sind zu zweit?« Nash warf seine Feder beiseite und erhob sich. Er wandte sich zur Tür und starrte seine Besucher durch eine silbergerahmte Brille an.
»Guten Abend, Mr. Nash«, sagte Phoebe höflich, während sie einen Schritt nach vorne machte.
Nash blickte einen Augenblick stirnrunzelnd auf Phoebes linkes Bein. Er hielt sich jedoch zurück und sagte nichts. Sein bereits rotes Gesicht wurde noch eine Spur dunkler, als er Gabriel ansah. »Also. Ich verkaufe heute Nacht nur das eine Manuskript. Wieso sin’ Sie zu zweit hier?«
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Nash«, sagte Phoebe besänftigend. »Dieser Gentleman ist nur mitgekommen, weil mir der Gedanke nicht behagt, um diese Zeit allein zu kommen.«
»Warum?« Nash bedachte Gabriel mit einem wütenden Blick. »In dieser Gegend geschieht Ihnen schon nichts. In diesem Teil von Sussex is’ noch nie was passiert.«
»Ja, nun, ich kenne mich hier nicht so gut aus wie Sie«, murmelte Phoebe. »Wie Sie sich sicher erinnern, komme ich aus London.«
»Was is’ nun mit dem Tee?«, fragte Mrs. Stiles.
»Vergessen Sie den verdammten Tee«, knurrte Nash. »Die beiden werden nich’ lange genug bleiben, um was zu trinken. Gehn Sie, Mrs. Stiles. Ich hab zu tun.«
»Ja, Sir.« Mrs. Stiles verschwand.
Gabriel sah sich nachdenklich in dem Raum voller Bücher um. »Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer großartigen Bibliothek, Nash.«
»Danke, Sir.« Nash folgte Gabriels Blick.
In seinen Augen flackerte Stolz auf. »Bin ganz zufrieden damit, wenn ich so sagen darf.«
»Sie sind nicht zufällig im Besitz einer ganz bestimmten Ausgabe von Malorys Morte D’Arthur, oder?«
»Welche Ausgabe?«, fragte Nash argwöhnisch.
»Aus dem Jahr 1634. In recht schlechtem Zustand. In rotes marokkanisches Leder gebunden. Sie hat eine Widmung auf dem Vorsatzblatt, die mit ›Für meinen Sohn‹ anfängt.«
Nash runzelte die Stirn. »Nein. Meine Ausgabe is’ älter. Un’ außerdem in allerbestem Zustand.«
»Ich verstehe.« Gabriel sah ihn an. »Dann kommen wir jetzt besser zum Geschäft.«
»Sicher.« Nash öffnete eine Schublade in seinem Schreibtisch. »Ich nehme an, Sie woll’n das Ding sehn, bevor Sie’s mitnehmen, oder?«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht.« Phoebe warf Gabriel einen Blick zu.
Er hatte ein dickes Buch von einem der Tische genommen, aber er legte es sofort zurück, als er sah, dass Nash einen Holzkasten aus der Schublade nahm.
Nash öffnete den Deckel des Kastens und nahm ehrfürchtig das Buch heraus. Der Goldschnitt an den Seitenrändern glänzte im Schein der Kerze. Gabriels Augen leuchteten in einem strahlenden Grün.
Phoebe musste trotz ihrer neuen Ängste beinahe lächeln. Sie wusste genau, was er empfand. Sie spürte, wie die vertraute Erregung auch sie packte, als Nash das Manuskript auf den Tisch legte und vorsichtig den dicken Ledereinband öffnete, um die erste Seite zu zeigen.
»Mein Gott«, flüsterte Phoebe. All ihre Sorgen, ob es vernünftig gewesen war, Gabriel um Hilfe zu bitten, waren verschwunden, als sie das herrliche Manuskript ansah.
Sie trat einen Schritt näher, um die vier Miniaturen besser sehen zu können, die auf der oberen Hälfte des Blattes gezeichnet waren. Eine verschlungene Efeuranke wand sich um die alten Illustrationen. Selbst aus dieser Entfernung glänzten die Buchmalereien wie seltene Juwelen.
»Eine echte Schönheit«, sagte Nash mit Sammlerstolz. »Ich hab’s vor einem Jahr bei einem Buchhändler in London gekauft, der es von irgendeinem Franzosen hatte, der wegen der Revolution nach England geflohen war. Mir wird richtig schlecht, wenn ich an all die schönen Bücher denke, die in den letzten Jahren auf dem Kontinent zerstört wurden.«
»Ja«, stimmte ihm Gabriel leise zu. »Der Krieg ist weder für Bücher noch für sonst etwas gut.« Er ging hinüber zum Schreibtisch, um sich das reichverzierte Manuskript näher anzusehen. »Verdammt. Es ist wirklich außerordentlich schön.«
»Wunderbar.« Phoebe betrachtete die glitzernden Miniaturen. »Absolut phantastisch.« Sie strahlte Nash an. »Darf ich es wohl etwas genauer ansehen?«
Nash zögerte und zuckte dann resigniert mit den Schultern. »Sie ham dafür bezahlt. Es gehört Ihnen. Machen Sie, was Sie woll’n.«
»Danke.« Phoebe merkte, dass Gabriel über ihre Schulter blickte, als sie in ihre Rocktasche griff und ein sauberes Spitzentaschentuch herauszog. Seine spürbare, mühsam beherrschte Begeisterung amüsierte sie, da sie ihren eigenen Gefühlen so ähnlich war.
Sie und Gabriel teilten dieselbe Leidenschaft. Nur ein anderer Buchsammler wusste einen Augenblick wie diesen zu würdigen.
Sie benutzte das Taschentuch, um die Seiten umzublättern. Der Ritter und der Zauberer war ein reichverziertes Manuskript. Offenbar war es im Mittelalter von einem wohlhabenden französischen Aristokraten in Auftrag gegeben worden, der die Kunst der Buchmalerei ebenso zu schätzen gewusst hatte wie die Geschichte, die der Schreiber festgehalten hatte.
Phoebe hielt inne, um ein paar Worte des altfranzösischen Textes zu entziffern, der in herrlich geschwungenen Buchstaben niedergeschrieben worden war. Als sie die letzte Seite umblätterte, konzentrierte sie sich einen Augenblick darauf, die Schlussinschrift zu übersetzen.
»Hier endet die Geschichte von dem Ritter und dem Zauberer«, las Phoebe laut. »Ich, Philip von Blois, habe nichts als die Wahrheit erzählt. Dieses Buch wurde für meine Lady gemacht, und es gehört ihr. Nimmt irgendjemand dieses Buch, so sei er verflucht. Er soll von Dieben und Mördern heimgesucht werden. Er soll hängen. Er soll verdammt sein, in den Feuern der Hölle zu schmoren.«
»Ich würde sagen, damit ist alles abgedeckt«, sagte Gabriel. »Es geht doch nichts über einen guten, altmodischen Fluch, wenn man die Leute abschrecken will, ein Buch zu stehlen.«
»Man kann es den Schreibern wohl kaum zum Vorwurf machen, wenn sie alles Mögliche versuchen, diese wunderbaren Kunstwerke davor zu bewahren, gestohlen zu werden.« Vorsichtig klappte Phoebe das Buch wieder zu. Sie blickte Mr. Nash an und lächelte. »Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf, Sir.«
»Es is’ bloß ’ne alte Liebesgeschichte von der Tafelrunde«, murmelte Nash. »Eine närrische Geschichte, die für irgend ’ne verwöhnte Hofdame erdichtet worden is’. Natürlich nich’ halb so wichtig wie die Ausgabe der Historia Scholastica, die ich gefunden hab. Aber trotzdem ’n ganz hübsches Teil, nich’?«
»Es ist außerordentlich schön.« Phoebe legte das Manuskript vorsichtig in den Kasten zurück. »Ich werde gut darauf aufpassen, Mr. Nash.«
»Tja, am besten nehmen Sie es und verschwinden.« Nash wandte den Blick von dem Kasten ab. »Ich hab heut Nacht noch zu tun.«
»Ich verstehe.« Phoebe nahm den schweren Kasten.
»Ich werde das für Sie tragen.« Gabriel nahm ihr den Behälter mit dem Manuskript aus den Händen. »Es dürfte etwas zu schwer für Sie sein, meinen Sie nicht?«
»Ich kann es sehr gut tragen, danke.«
»Trotzdem. Ich nehme es Ihnen gerne ab.« Gabriel bedachte sie mit einem rätselhaften Lächeln. »Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Sie mich heute Abend als Begleiter engagiert haben. Ich betrachte es demnach als meine Pflicht, Ihnen behilflich zu sein. Gehen wir?«
»Ja, ja, verschwinden Sie«, brummte Nash. Er setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch und griff nach der Feder. »Mrs. Stiles wird Sie zur Tür bringen.«
Phoebe blieb nichts anderes übrig, als an Gabriel vorbei in den engen Flur hinauszutreten. Sein spöttischer Blick gefiel ihr nicht.
Sicher würde er nicht versuchen, ihr das Manuskript gewaltsam zu entreißen. Sie weigerte sich, auch nur eine Sekunde zu glauben, dass ihr edler Ritter sich in einen gemeinen Schuft verwandelt hatte. Er machte sich nur über sie lustig.
Mrs. Stiles erwartete sie an der Haustür. Sie beäugte den Kasten in Gabriels Händen. »Tja, ein Kasten weniger zum Abstauben. Obwohl er wahrscheinlich losgehn wird, um zehn neue Bücher dafür zu kauf’n. Ich muss schon Glück ham, wenn ich diesmal mein Geld kriege.«
»Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Mrs. Stiles«, sagte Gabriel. Er nahm Phoebes Arm und führte sie hinaus in die Nacht.
»Sobald ich auf dem Pferd sitze, kann ich das Manuskript nehmen«, beeilte Phoebe sich zu sagen.
»Vertrauen Sie mir etwa nicht?«
»Das ist keine Frage des Vertrauens.« Sie weigerte sich, sich von ihm noch mehr aufregen zu lassen. »Schließlich weiß ich, dass Sie ein Gentleman sind.«
»Das sagten Sie bereits.« Er stellte den Kasten auf einen Stein, umfasste Phoebes Taille und schwang sie hinauf in den Sattel. Ohne sie loszulassen, blickte er in ihr verschleiertes Gesicht. »Sie scheinen zu denken, dass Sie eine Menge über mich wissen.«
»Das tue ich auch.« Sie bemerkte, dass sie seine Schultern umklammerte. Eilig zog sie die Hände zurück und ergriff die Zügel ihrer Stute.
»Wie viel genau wissen Sie über mich, Madam?« Gabriel ließ sie los und packte die Zügel seines Hengstes. Er stieg mühelos in den Sattel und steckte den Kasten mit dem Manuskript unter die schweren Falten seines Mantels.
Es war an der Zeit zu sprechen. Phoebe wählte ihre Worte sehr sorgsam, als sie langsam den Weg hinabritten. Sie hatte ihren einsamen Ritter aus der Reserve gelockt, aber sie hatte ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie wollte ihn neugierig machen, damit er sich bereit erklärte, ihr zu helfen, ehe sie ihre Identität verriet.
»Ich weiß, dass Sie nach einem verlängerten Auslandsaufenthalt erst kürzlich nach England zurückgekehrt sind«, sagte sie vorsichtig.
»Nach einem verlängerten Auslandsaufenthalt«, wiederholte Gabriel. »So kann man es sicher auch nennen. Ich war acht verdammte Jahre fort. Was wissen Sie sonst noch über mich?«
Sein neuer Ton gefiel ihr nicht. »Nun, ich habe gehört, dass Sie Ihren Titel recht unerwartet bekommen haben.«
»Höchst unerwartet. Wenn mein Onkel und seine Söhne nicht vor einem Jahr auf See verloren gegangen wären, hätte ich den Grafentitel niemals bekommen. Und wissen Sie sonst noch etwas, meine verschleierte Lady?«
»Ich weiß, dass Sie großes Interesse an Rittergeschichten und alten Legenden haben.«
»Offensichtlich.« Gabriel blickte sie an. Seine grünen Augen wirkten farblos im Licht des Mondes, aber die Herausforderung in seinem Blick blieb ihr nicht verborgen. »Sonst noch was?«
Phoebe atmete tief ein. Sie musste härtere Geschütze auffahren. »Ich weiß, was die meisten Mitglieder der besseren Gesellschaft nur allzu gern wüssten. Ich weiß, dass Sie der anonyme Autor des Ritterzugs sind.«
Diese Aussage verfehlte ihre Wirkung nicht. Gabriels Verärgerung war offensichtlich. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Verdammt. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Woher wissen Sie das?«
»Oh, ich habe so meine Quellen«, versuchte Phoebe mit fröhlicher Stimme zu sagen. Sie konnte ihm schwerlich die ganze Wahrheit sagen. Noch nicht einmal ihre Familie kannte ihr größtes, dunkelstes Geheimnis.
Gabriel brachte seinen Hengst abrupt zum Stehen. Eine seiner Hände schoss vor und umklammerte Phoebes Handgelenk. »Ich habe gefragt, woher Sie das wissen. Ich erwarte eine Antwort, Madam.«
Phoebe erschauderte. Seine Finger gruben sich tief in ihr Handgelenk, und sein Gesicht war starr in der Dunkelheit. Sie wusste, dass er meinte, was er sagte. Er erwartete eine Antwort.
»Ist Ihnen das so peinlich?«, fragte sie atemlos. »Alle Welt fragt sich, wer wohl der Autor des populärsten Buches der Saison ist.«
»Hat Ihnen mein Verleger gesagt, dass ich es war? Verdammt, Madam, haben Sie Lacey bestochen?«
»Nein, das habe ich nicht getan. Das schwöre ich.« Sie konnte ihm wohl kaum erzählen, dass sie die geheimnisvolle Person im Hintergrund war, die Josiah Laceys beinahe bankrotten Verlag letztes Jahr gerettet hatte. Mit dem Geld, das sie von dem großzügigen Taschengeld gespart hatte, das ihr Vater ihr ausbezahlte, und mit den Gewinnen aus dem Verkauf einiger ihrer wertvollen Bücher an andere Sammler. Niemand wusste etwas davon, und so musste es auch bleiben. Ihre Familie wäre entsetzt, wenn sie erführe, dass Phoebe selbständig Geschäfte machte, auch wenn sie noch so anständig und ehrenvoll waren.
Das Abkommen, das sie mit Lacey getroffen hatte, funktionierte hervorragend, zumindest meistens. Phoebe wählte die Manuskripte aus, und Lacey kümmerte sich um den Druck. Dank ihrer beider Tatkraft und mit Hilfe eines jungen Anwalts und einiger Angestellter florierte Laceys Buchgeschäft. Ihr erster großer Erfolg war Der Ritterzug gewesen, auf dessen Veröffentlichung Phoebe bestanden hatte, nachdem sie das Manuskript gelesen hatte.
»Sie müssen Lacey bestochen haben«, sagte Gabriel. »Aber ich hätte nicht gedacht, dass der alte Trunkenbold ein solcher Narr ist. Er sollte wissen, dass er mich nicht derart hintergehen darf. Er kann doch nicht so dumm sein und die Gewinne aufs Spiel setzen, die er mit meinem nächsten Buch erzielen kann.«
Phoebe blickte auf die Finger in den Lederhandschuhen, die ihr Handgelenk umklammerten. Vielleicht war wirklich alles ein entsetzlicher Fehler gewesen. Gabriel benahm sich keineswegs wie ein edler Ritter. Die Hand, die sie festhielt, fühlte sich an wie eine stählerne Handschelle. »Es war nicht seine Schuld. Sie dürfen Mr. Lacey deswegen nicht böse sein.«
»Wie sind Sie dahintergekommen, dass ich der Autor des Ritterzuges bin?«
Phoebe zermarterte ihr Hirn auf der Suche nach einer plausiblen Antwort. »Ich habe meinen Anwalt mit Nachforschungen beauftragt, wenn Sie es unbedingt wissen müssen.« Vergeblich versuchte sie, ihre Hand aus seiner Umklammerung zu befreien. »Er ist wirklich clever.« Das wenigstens stimmte. Mr. Peak war ein äußerst intelligenter und höchst entgegenkommender junger Mann, der versessen darauf war, sich einen Platz in der besseren Gesellschaft zu sichern. Aus diesem Grund war er sogar bereit, mit der jüngsten Tochter des Grafen von Clarington Geschäfte zu machen, ohne ihren Vater davon in Kenntnis zu setzen.
»Ihren Anwalt.« Mit einem Fluch ließ Gabriel sie los. »Ich habe allmählich genug von Ihren Spielchen, Madam. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Täuschungen und Betrug nicht mag. Wer sind Sie?«
Phoebe fuhr sich mit der Zunge über die Unterlippe. »Ich kann es Ihnen nicht sagen, Sir. Noch nicht. Dafür ist es noch zu früh. Außerdem, sollte mein Plan fehlschlagen – und das beginne ich zu befürchten -, dann möchte ich meinen Ruf nicht mehr aufs Spiel setzen, als ich es bereits getan habe. Ich bin sicher, dass Sie das verstehen?«
»Was für ein Plan? Ich soll mir Ihren Plan anhören und mich damit einverstanden erklären, bevor ich erfahre, wer Sie sind? Für was für einen Idioten halten Sie mich eigentlich?«
»Ich halte Sie bestimmt nicht für einen Idioten. Ich denke lediglich, dass Sie ein äußerst schwieriger Mensch sind«, erwiderte Phoebe. »Und es ist mir lieber, Sie wissen nicht, wer ich bin, ehe Sie sich bereit erklären, mir zu helfen. Sobald Sie mir versprochen haben, dass Sie mir helfen wollen, werde ich Ihnen sagen, wer ich bin. Sie können meinen Wunsch nach Geheimhaltung sicher verstehen.«
»Wovon in aller Welt reden Sie?« Gabriel war eindeutig am Ende seiner Geduld. »Von was für einem dummen Plan sprechen Sie?«
Phoebe atmete tief ein. »Ich bin auf einer ernsten und wichtigen Mission, Sir.«
»Sind Sie einem anderen Manuskript auf der Spur?«, fragte er verächtlich.
»Nein, es geht nicht um die Suche nach einem Manuskript. Es geht um die Suche nach Gerechtigkeit. Ihr Hintergrund gibt mir Grund zu der Annahme, dass Sie mir behilflich sein könnten.«
»Gerechtigkeit? Großer Gott, was soll das Geschwätz? Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, dass ich kein Interesse daran habe, dieses Spielchen fortzuführen.«
»Es ist kein Spiel«, erklärte sie verzweifelt. »Ich versuche, einen Mörder zu finden.«
»Einen Mörder.« Verblüfftes Schweigen. »Verdammt. Ich reite hier mitten in der Nacht neben einer Verrückten durch die Gegend.«
»Ich bin nicht verrückt. Bitte, hören Sie mir zu. Das ist alles, worum ich Sie bitte. Ich versuche seit zwei Monaten Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Und nun, da Sie endlich aus Ihrer Höhle gekrochen sind, könnten Sie mir wenigstens zuhören.«
»Ich lebe nicht in einer Höhle.« Er klang beleidigt.
»Was mich betrifft, so könnten Sie das ruhig tun. Nach allem, was ich herausgefunden habe, ziehen Sie sich die meiste Zeit wie ein Einsiedler auf Ihr Gut zurück. Sie weigern sich, irgendjemanden zu empfangen oder selbst einmal auszugehen.«
»Das ist übertrieben«, murmelte Gabriel. »Ich sehe die Menschen, die ich sehen will. Nur zufällig bin ich gern allein, und ich habe eine Abneigung gegen die sogenannte bessere Gesellschaft. Aber ich wüsste nicht, weshalb ich Sie über meine Gewohnheiten aufklären sollte.«
»Bitte, Sir, ich brauche Ihre Hilfe, um Gerechtigkeit für einen Menschen zu erwirken, der mir einst sehr nahe stand.«
»Wie nahe?«
Phoebe schluckte. »Nun, um genau zu sein, er wollte mich einmal heiraten. Meine Familie war jedoch gegen die Verbindung, weil er kein Vermögen besaß.«
»Das ist durchaus nicht ungewöhnlich«, bemerkte Gabriel grimmig.
»Das ist mir bewusst. Mein Freund ging in die Südsee, um dort sein Glück zu machen, damit er anschließend um meine Hand anhalten konnte. Aber er kam nie zurück. Schließlich erfuhr ich, dass er von einem Piraten ermordet worden war.«
»Himmel. Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, einen verdammten Piraten ausfindig zu machen? Ich habe Neuigkeiten für Sie. Das ist unmöglich. Ich habe den Großteil der letzten acht Jahre in der Südsee verbracht, und ich kann Ihnen versichern, dass es in dem Teil der Welt mehr als genug Mörder gibt.«
»Sie verstehen mich nicht«, sagte Phoebe. »Ich habe Grund zu der Annahme, dass der Mörder nach England zurückgekehrt ist. Oder zumindest ist jemand, der den Mörder kennen könnte, hierher zurückgekehrt.«
»Großer Gott. Wie kommen Sie auf die Idee?«
»Ehe mein Freund aufbrach, um sein Glück zu machen, gab ich ihm mein Lieblingsmanuskript als Andenken. Ich weiß, dass er es niemals verkauft oder verschenkt hätte. Es war das Einzige, was ihn an mich erinnerte.«
Gabriel erstarrte. »Ein Manuskript?«
»Eine schöne Ausgabe der Die Lady im Turm. Kennen Sie das Buch?«
»Verflucht.«
»Sie kennen es.« Phoebe war ganz aufgeregt.
»Ich weiß, dass es verschiedene Ausgaben gibt«, gab Gabriel zu. »War Ihre französisch, englisch oder italienisch?«
»Französisch. Mit wunderbaren Malereien. Noch schöner als Der Ritter und der Zauberer. Die Sache ist die, Mylord – ich habe gerüchteweise gehört, dass das Buch wieder in England ist. Offensichtlich steht es in der Privatbibliothek eines Sammlers.«
Gabriel musterte sie aufmerksam. »Wo haben Sie das gehört?«
»Ein Buchhändler in der Bond Street hat es mir erzählt. Und er wusste es von einem seiner besten Kunden, der es wiederum von einem verrückten Sammler in Yorkshire hatte.«
»Und weshalb glauben Sie, dass es sich um Ihre Ausgabe handelt?«
»Der Buchhändler sagte mir, dass es sich um die französische Ausgabe handelt und dass die Schlussinschrift den Namen des Schreibers nennt. Wilhelm von Anjou. Meine Ausgabe wurde von ihm geschrieben, Sir. Ich muss das Manuskript unbedingt finden.«
»Und Sie glauben, wenn Sie das Buch finden, finden Sie auch den Mann, der Ihren Geliebten ermordet hat?«, fragte Gabriel leise.
»Ja.« Phoebe errötete heftig, als er Neil als ihren Geliebten bezeichnete. Aber dies war nicht der richtige Augenblick, um zu erklären, dass Neil nicht ihr Geliebter gewesen war, sondern ihr tugendhafter, ergebener Lancelot. Seine Liebe war rein und edel gewesen. Er hatte sich immer in ritterlicher Entfernung gehalten und nur darum gebeten, seiner Lady in der Art eines wahren Ritters dienen zu dürfen.
Die Tatsache, dass sie niemals mehr als ehrliche Zuneigung für Neil empfunden hatte, war einer der Gründe, weshalb sie sich für seinen Tod verantwortlich fühlte. Wenn sie ihn wirklich geliebt hätte, hätte sie ihrer Familie getrotzt und ihn geheiratet. Aber sie hatte Neil nicht geliebt, und der Gedanke an eine Ehe, die nicht in wahrer Liebe begründet war, war Phoebe unerträglich.
»Wie hieß dieser Mann, der Ihnen so viel bedeutet hat?«
»Neil Baxter.«
Gabriel verharrte einige Sekunden vollkommen reglos. »Vielleicht hat der jetzige Besitzer das Buch rein zufällig irgendwo unterwegs erworben«, schlug er dann kühl vor. »Vielleicht weiß er gar nichts vom Schicksal Ihres Geliebten.«
Phoebe schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich nicht. Wissen Sie, Neil hat mir hin und wieder geschrieben, nachdem er England verlassen hatte. In einem seiner Briefe erwähnte er einen Piraten, der die Schiffe vor den Inseln verfolgte. Er sagte, der Mann sei kein gewöhnlicher Schurke, sondern ein englischer Gentleman, der sich der Seeräuberei verschrieben habe und eine wahre Plage sei.«
»Da wäre er nicht der Erste gewesen, der so etwas getan hat«, bemerkte Gabriel trocken.
»Mylord, ich glaube, dass ein solcher Schuft Die Lady im Turm bestimmt als Beute an sich genommen hätte, nachdem er Neil ermordet hat.«
»Und nun nehmen Sie wegen eines Gerüchts, das lediglich besagt, dass das Buch wieder hier sein soll, an, dass dieser Pirat wieder in die Maske des Gentleman geschlüpft und ebenfalls nach England zurückgekehrt ist?«
»Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Vielleicht ist er mit genug Beute heimgekehrt, um jetzt in den besseren Kreisen verkehren zu können. Vielleicht gehört er ja sogar selbst zum Adel. Denken Sie nur, Sir – wer würde schon wissen, dass er vorher ein Pirat war? Alle Welt würde annehmen, dass er einfach sein Glück in der Südsee gemacht hat wie andere auch, um als reicher Mann zurückzukommen.«
»Sie verfügen über eine lebhafte Phantasie, Madam.«
Phoebe knirschte mit den Zähnen. »Mir scheint, Sir, dass Sie hingegen keinerlei Phantasie besitzen. Ich finde, dass meine Gedanken durchaus plausibel sind. Und selbst wenn Sie recht haben und der Besitzer des Buches nicht der Pirat ist, dann weiß er vielleicht zumindest, wer dieser Pirat ist. Auf jeden Fall muss ich den Menschen finden.«
Ein lautes Krachen im Gebüsch am Rande des Weges unterbrach sie.
»Was in aller Welt …« Gabriel beruhigte seinen Hengst, als plötzlich ein Reiter aus den Bäumen brach und auf die Straße sprengte.
»Hände hoch und her mit den Wertsachen«, dröhnte der Neuankömmling unter einer Maske. Ein schwarzer Umhang verbarg seine Gestalt, und das Mondlicht fiel auf die Pistole in seiner Hand.
»Verdammt«, sagte Gabriel resigniert. »Ich wusste, dass ich heute Nacht besser im Bett geblieben wäre.«
Kapitel 3
Gabriel bemerkte, dass die verschleierte Lady nicht sofort verstand, was ihnen gerade passierte. Doch dann sah sie offensichtlich den schimmernden Pistolenlauf in der Hand des Straßenräubers.
»Was, um Himmels willen, haben Sie vor?«, fragte sie, als habe sie es mit einem etwas ungeschickten Bediensteten zu tun.
Gabriel konnte ein leichtes Grinsen nicht unterdrücken. Die Lady hatte Mut. Er kannte nicht viele Frauen, die einen Straßenräuber mit einer solchen Geringschätzung behandelt hätten. Aber schließlich kannte er keine Frau, die auch nur die geringste Ähnlichkeit mit seiner impertinenten verschleierten Lady aufwies.
»Geld oder Leben.« Der Straßenräuber fuchtelte mit der Pistole zwischen Gabriel und seiner Begleiterin hin und her. »Un’ zwar schnell. Sonst schieße ich, un’ dann kriege ich ganz einfach, was ich will.«
»Ich habe nur ein paar Münzen bei mir«, verkündete die verschleierte Lady. »Und Schmuck trage ich auch nicht.«
»Ich nehme alles, was Sie dabei ham.« Der Straßenräuber blickte über den Rand seiner Maske zu Gabriel. »Nehme an, Sie ham ’ne Pistole dabei. Zieh’n Sie den Mantel aus un’ werfen Sie ihn auf den Boden.«
»Wie Sie wünschen.« Gabriel zuckte mit den Schultern und begann, seinen Mantel aufzuknöpfen.
Die verschleierte Lady war höchst beunruhigt. »Nein, Sie dürfen Ihren Mantel nicht ablegen, Mylord. Bei der Kälte werden Sie sich den Tod holen.« Sie wandte sich erneut an den Straßenräuber. »Ich bitte Sie, Sir. Zwingen Sie meinen Freund nicht, seinen Mantel auszuziehen. Er hat eine äußerst schwache Brust. Sein Arzt hat ihm gesagt, dass er niemals ohne Mantel herumlaufen soll.«
Gabriel warf ihr einen amüsierten Blick zu. »Wie freundlich von Ihnen, in dieser doch etwas angespannten Situation an meine Gesundheit zu denken, Madam.«
»Seine Brust wird noch wesentlich schwächer, wenn ich erst eine Kugel reingejagt hab«, schnauzte der Straßenräuber. »Un’ jetz’ beeil’n Sie sich ’n bisschen.«
»Warten Sie. Sie dürfen Ihren Mantel nicht ausziehen, Mylord«, beharrte die Lady verzweifelt.
Aber es war bereits zu spät. Gabriel hatte seinen Mantel bereits geöffnet, und der Kasten mit dem Manuskript war deutlich zu sehen.
»Tja, was ham wir denn da?« Der Straßenräuber führte sein Pferd näher an Gabriels Hengst heran. »Sieht interessant aus.«
»Es ist nur ein alter Kasten«, sagte die Lady abwertend. »Nichts Wertvolles. Nicht wahr, Mylord?«
»In der Tat, ein alter Kasten«, pflichtete Gabriel ihr bei.
»Her damit.« Der Straßenräuber streckte eine Hand danach aus.
»Wagen Sie ja nicht, ihm den Kasten zu geben, Wylde«, befahl die Lady. »Hören Sie?«
»Ich höre.« Gabriel legte ein paar Münzen auf die Box und gab sie dem Angreifer.
Außer sich vor Zorn wirbelte die verschleierte Lady herum. »Rühren Sie den Kasten nicht an. Ich verlange, dass Sie ihn auf der Stelle zurückgeben. Er gehört mir.«
»Tja, nun, das kann ich nich’«, sagte der Straßenräuber.
»Halten Sie ihn auf, Wylde«, befahl die verschleierte Lady. »Ich werde Ihnen nie verzeihen, wenn Sie ihn damit durchkommen lassen.«
»Sie tun mir leid«, sagte der Straßenräuber mitfühlend zu Gabriel. »Mit so ’ner Frau.«
»Man gewöhnt sich an alles«, sagte Gabriel.
»Wenn Sie meinen. Tja, vielen Dank und guten Abend. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen.«
Der maskierte Mann wendete sein Pferd, trat ihm kräftig in die Flanken und galoppierte den Weg hinab.
Die verschleierte Lady beobachtete, wie der Straßenräuber verschwand. Dann wandte sie sich an Gabriel, der sich bereits für ihre Schimpftirade wappnete. Es war ganz offensichtlich, dass sie mit seiner Leistung als Ritter nicht zufrieden war.
»Ich kann es einfach nicht glauben, Sir«, sagte sie wütend. »Wie konnten Sie ihm einfach mein Manuskript geben, ohne auch nur den geringsten Versuch zu unternehmen, es vor ihm zu verteidigen?«
Gabriel warf ihr einen bedeutungsvollen Blick zu, während er von seinem Pferd stieg, um seinen Mantel aufzuheben. »Wäre es Ihnen etwa lieber gewesen, er hätte mir eine Kugel in meine bereits schwache Brust gejagt?«
»Natürlich nicht. Aber sicher wären Sie mit ihm fertiggeworden. Sie sind ein Gentleman. Sie müssen sich doch mit Pistolen und ähnlichen Dingen auskennen. Er war schließlich nichts weiter als ein dummer Straßenräuber.«
»Dumme Straßenräuber können genauso den Abzug einer Pistole betätigen wie ein Gentleman, der bei Mantons trainiert hat.« Gabriel schwang sich wieder in den Sattel und griff nach den Zügeln.
Die verschleierte Lady stöhnte frustriert. Gabriel meinte sogar, einen unterdrückten Fluch zu hören.
»Wie konnten Sie ihm den Kasten nur einfach so geben?«, fragte sie. »Ich habe Sie mitgenommen, damit Sie mich beschützen. Sie sollten heute Nacht als meine Eskorte fungieren.«
»Mir scheint, ich habe meine Aufgabe durchaus erfüllt. Ihnen ist nicht das Geringste passiert.«
»Aber er hat mein Manuskript mitgenommen.«
»Genau. Ihr Manuskript. Nicht meins.« Gabriel führte sein Pferd den Weg hinab. »Ich habe bereits vor langer Zeit gelernt, dass es sich nicht lohnt, meinen Hals für etwas zu riskieren, das nicht mir gehört.«
»Wie können Sie es wagen, Sir? Sie sind nicht der Mann, für den ich Sie gehalten habe.«
»Für wen haben Sie mich denn gehalten?«, rief Gabriel über die Schulter zurück.
Die Lady trieb ihre Stute hinter seinem Hengst her. »Ich dachte, der Mann, der den Ritterzug geschrieben hat, sei mindestens so edel und tapfer wie der Held in seinem Buch«, schrie sie.
»Dann sind Sie eine Närrin. Ritterlichkeit gibt es nur in Romanen. Ich gebe zu, dass sie sich gut verkaufen lässt, aber in der Wirklichkeit nützt sie einem nichts.«
»Ich bin wirklich enttäuscht von Ihnen, Mylord«, verkündete sie lautstark, während sie ihre Stute neben sein Pferd lenkte. »Offensichtlich war meine Vorstellung von Ihnen nichts weiter als eine Illusion. Sie haben alles verdorben. Alles.«
Er blickte sie an. »Was haben Sie denn von mir erwartet, meine verschleierte Lady?«
»Ich habe erwartet, dass Sie kämpfen würden. Ich habe erwartet, dass Sie das Manuskript beschützen. Ich habe nicht gedacht, dass Sie den Kasten einfach abgeben würden. Wie konnten Sie nur so feige sein?«
»Wie viel ist es Ihnen wert, das Manuskript zurückzubekommen, Madam?«
»Sehr viel. Ich habe eine Menge Geld dafür bezahlt. Aber das ist im Augenblick meine geringste Sorge. Was ich wirklich brauche, ist ein wahrer Ritter.«
»Also gut, ich werde Ihnen das Manuskript zurückholen. Wenn ich es Ihnen bringe, werde ich Ihnen sagen, ob ich die Nachforschungen anstellen werde, um die Sie mich gebeten haben.«
»Was?« Sie war ehrlich verblüfft. Doch zugleich spürte Gabriel, wie neue Hoffnung in ihr erwachte. »Sie meinen, Sie werden mir helfen, den Piraten zu finden, der meine Ausgabe von Die Lady im Turm hat?«
»Ich werde darüber nachdenken. Aber ich warne Sie, meine verschleierte Lady. Wenn ich die Aufgabe übernehme und erfolgreich bin, wird das teuer für Sie werden.«
Diese Neuigkeit schien sie zu überraschen. »Teuer?«
»Ja.«
Sie wirkte verärgert. »Wie bereits gesagt, hatte ich rein zufällig die Absicht gehabt, Ihnen das Buch zu geben, das Sie soeben dem Straßenräuber ausgehändigt haben. Es sollte eine Art Erinnerung an Ihre Mission sein. Das heißt, falls Sie überhaupt Erfolg haben.«
»Ich fürchte, mein Preis ist wesentlich höher, Madam.«
»Sie erwarten allen Ernstes, dass ich Sie dafür bezahle, dass Sie diesen Schurken überführen?«, fragte sie.
»Warum nicht? Wenn Sie einen Mann mit einer Aufgabe betrauen, dann ist es nur fair, ihn entsprechend zu belohnen.«