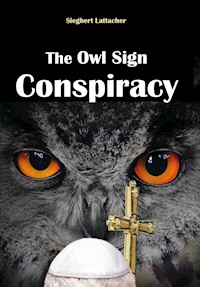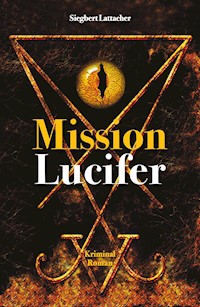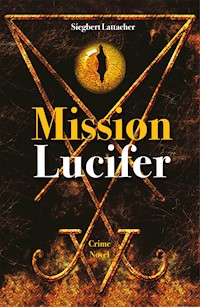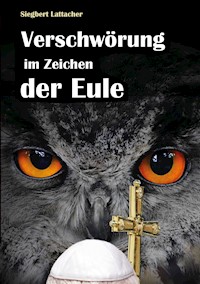
7,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Magnus Lorenzi erbt von seinem längst verstorbenen Großvater 70 Jahre alte Schriften religiösen Inhalts: Botschaften von den Aposteln Christi aus dem Jenseits, die er in nächtelanger Schreibarbeit zu Papier brachte. Das schriftliche Vermächtnis seines Großvaters enthält die Wahrheit über Jesus Christus, sein Leben und Wirken, und die Original-Offenbarung, die Christus Johannes den Seher auf Patmos schauen ließ. Doch Anhänger der Gemeinschaft im Zeichen der Eule wollen die Endzeit inszenieren, wie sie in der biblischen Apokalypse beschrieben wird. Sie trachten danach, alles zu vernichten, was ihrem Plan im Wege steht. Gemälde von Hieronymus Bosch werden zerstört und der Besitzer der Original-Offenbarung von Johannes dem Seher wird verfolgt. Attentatspläne auf den Papst werden ruchbar. Schließlich verfolgen die Verschwörer gar die verwegene Idee, Christus auf Erden erscheinen zu lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
www.tredition.de
Magnus Lorenzi erbt von seinem längst verstorbenen Großvater 70 Jahre alte Schriften religiösen Inhalts: Botschaften von den Aposteln Christi aus dem Jenseits, die er in nächtelanger Schreibarbeit zu Papier brachte. Das schriftliche Vermächtnis seines Großvaters enthält die Wahrheit über Jesus Christus, sein Leben und Wirken, und die Original-Offenbarung, die Christus Johannes den Seher auf Patmos schauen ließ. Doch Anhänger der Gemeinschaft im Zeichen der Eule wollen die Endzeit inszenieren, wie sie in der biblischen Apokalypse beschrieben wird. Sie trachten danach, alles zu vernichten, was ihrem Plan im Wege steht. Gemälde von Hieronymus Bosch werden zerstört und der Besitzer der Original-Offenbarung von Johannes dem Seher wird verfolgt. Attentatspläne auf den Papst werden ruchbar. Schließlich verfolgen die Verschwörer gar die verwegene Idee, Christus auf Erden erscheinen zu lassen.
Siegbert Lattacher hat bisher vier Sachbücher und zwei Kriminalromane veröffentlicht. Bei Tredition erschien von ihm der Kärnten-Krimi „Vishnupurans Rache“.
Der Mensch ist ein dunkles Wesen,
er weiß nicht, woher er kommt, noch wohin er geht,
er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von sich selbst.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Siegbert Lattacher
Verschwörung im Zeichen der Eule
Kriminalroman
www.tredition.de
© 2013 Siegbert Lattacher
Umschlaggestaltung, Illustration: Siegbert Lattacher
Lektorat: Erika Stiller
Coverfoto: Fotolia
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-4471-3
Die Handlung ist frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit Menschen, Orten und Geschehnissen sind möglich.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Prolog
Dank einem Blatt auf einem dürren Ast wird die aus dem Dornröschenschlaf befreite Wahrheit in der Wüste an den ewigen Quellen aus der Wurzel nach oben ins Licht treten.
Ephesus, 103 nach Christus
Wie geht es dir, Johannes? Du siehst schlecht aus. Deine Tage sind gezählt, der Herr wird dich bald zu sich rufen“, sagte Johannes der Presbyter, der am Bett des fast 100-jährigen Apostels Christi stand.
Johannes Theologos der Presbyter, Großbischof und Vertreter von Bischof Clemens Flavius Romanus im Orient, hatte Johannes den letzten Apostel Christi unter seine Obhut genommen, um sicherzustellen, dass die letzte lebende Autorität im Wissen um die Wahrheit von niemandem mehr darüber befragt werden konnte, was in der Ewigkeit vor dem Anfang, im Anfang und nach dem Anfang in der Schöpfung geschah.
Der von Altersschwäche gezeichnete Apostel Johannes murmelte einige Worte und schlief ein.
Der Presbyter lächelte überlegen. Bald wirst du die Augen für immer schließen, dachte er und verließ das Zimmer. Er war erfahren darin, wie man unliebsame Konkurrenten aus dem Weg schaffte. Wie Asser ben Kipas, der im November 78 nach Christus als Gesandter des Bischofs von Rom Clemens Flavius Romanus zu dem Presbyter nach Thapsacus am Euphrat gekommen war. Großbischof Johannes gab für ihn ein Festmahl, in dessen Verlauf der falsche Petrus von einer heftigen Übelkeit befallen wurde und noch in derselben Nacht verstarb.
Johannes der Evangelist spürte, wie das Gift in seinem Körper arbeitete, er spürte sein Ende nahen. Doch bevor er in den Armen des herbeigeeilten Marcion die Augen für immer schloss, konnte er ihm, dem Sohn des Bischofs von Sinope, noch zwölf Handschriften-Rollen sowie eine Abschrift des Briefes, den Johannes nach seiner Rückkehr aus der Verbannung nach Patmos an Bischof Clemens Flavius Romanus in Rom geschrieben hatte, heimlich übergeben.
Marcion hatte zu Hause bei seinem Vater in der Hafenstadt Sinope am Schwarzen Meer Schriften der Apostel über Christus entdeckt und erkannt, dass sie der Wahrheit näher standen, als jenes Wissen, das sein Vater als judenchristlicher Bischof verbreitete. Der Bischofssohn hatte erfahren, dass Johannes, der letzte wahre Apostel Christi, sich in Ephesus aufhielt und wollte ihn unbedingt noch sehen, bevor er starb. Er kam gerade noch zur rechten Zeit. Die erschütternde Begegnung mit dem sterbenden, größten Seher aller Zeiten im Kerker zu Ephesus war prägend für ihn. Die Schriften, die Johannes ihm übergab, fügten sich, zusammen mit anderen schon aufgefundenen, zu einem Ganzen. Mit einem Mal sah Marcion klar über die wahre Lehre Gottes Christi und dem Werk ihrer Leugner. Vor allem der Brief von Johannes an Clemens Flavius Romanus hatte Marcion die Augen geöffnet über jenes Christentum, das sein Vater vertrat.
Allein, er konnte der wahren Lehre Christi nicht mehr zum Durchbruch verhelfen. Die Schriften wurden bei der Kirchenversammlung 302 in Elvira von den Konzilsvätern als ein gegen den Gott der Bibel gerichtetes Satanswerk erkannt und dem Scheiterhaufen übergeben.
1
London, City
Die 25 Männer waren eilig aus allen Teilen der Welt angereist. Sie trafen sich in einem Hinterzimmer des OWL-Clubs, eines verschwiegenen Zirkels, in der Londoner Innenstadt. Der fensterlose Raum war ausschließlich für diese Treffen vorgesehen. Er durfte ohne Erlaubnis des Ersten von niemandem betreten werden, nicht einmal von einer Putzfrau. Die Reinigung wurde von einem der Novizen erledigt. In dem finsteren Raum, nur erhellt vom flackernden Licht schwarzer Kerzen, roch es nach Wachs und teuren Aftershaves. Die Dunkelheit sollte die Verschwiegenheit der Männer unterstreichen, die zu ihrem Zeremoniell schwarze Anzüge und schwarz gefärbte Hermelinfelle um die Schulter trugen.
Zwölf Männer saßen in einem Halbkreis, in der Mitte des Raumes der Dreizehnte, er war der Erste. Sein Gesicht war von einer schwarzen Maske bedeckt. Hinter den zwölf Männern, die zusammen auf ungefähr 900 Jahre kamen, standen zwölf mittleren Alters, die Novizen. Sie waren für würdig befunden worden, in die erste Reihe der Wissenden aufgenommen zu werden und sollten nach und nach die durch den Tod hinweggerafften Mitglieder ersetzen.
Das Gemurmel verebbte sofort, als der Erste seine Stimme erhob und die Anwesenden begrüßte. Er sprach die Gelöbnisformel, die alle wiederholten.
„Liebe Mitwissende, ich habe diese Versammlung einberufen, weil erneut Umtriebe aufgetreten sind, die wir abstellen müssen. Ich habe von der Sache in Wien gehört. Es war eine gute und richtige Entscheidung. Ist man auch um die Frau bemüht?“, fragte der Erste.
„Ja, Erster, wir sind an ihr dran“, erschallte eine Stimme aus dem Kreis der Zwölf.
„Ihr Werk fristet ein Mauerblümchendasein, wie ich gehört habe. Die Wenigen, die es lesen, stellen keine Gefahr dar. Sollte sich daran etwas ändern, bitte ich um entsprechend diskrete Maßnahmen. Neu zu Ohren gekommen ist uns, dass ein Österreicher Dinge erzählt, die mir nicht gefallen. Offensichtlich trägt er sich mit der Absicht, diesen Unsinn unters Volk zu bringen. Was wir bei der Frau verabsäumt haben, muss uns bei ihm gelingen. Gibt es dazu noch Fragen?“
Die Männer signalisierten ein Nein.
„Gut so. Frage an die Wissenschaft: Wie läuft es mit unserem Projekt?“
Einer der Zwölf räusperte sich und sagte: „Es geht voran.“
„Wir haben nicht mehr viel Zeit, denkt daran“, sagte der Erste und löste die Versammlung auf.
Die Männer erhoben sich, murmelten rhythmisch unverständliche Worte und verließen den Raum. Sie verstreuten sich in alle Winde.
Einer von ihnen trug ein Kreuz auf dem Revers seines Jacketts. Er winkte ein Taxi heran und nahm ein Mobiltelefon aus der Tasche. Das Taxi blieb stehen, der Mann stieg hinten ein und nannte dem Fahrer das Ziel der Fahrt. Dann wählte er eine Nummer.
Der Mann im Zimmer des Hotels Wandl in der Wiener Innenstadt hatte sich gerade hingelegt, als sein Telefon läutete. Er nahm das Gespräch entgegen und sagte einige Male: „Yes Mister, yes Mister, I understand.“ Dann schleuderte er das Gerät gegen die Wand und fluchte in einer slawischen Sprache.
Der Mann im Taxi lächelte zufrieden und verstaute sein Telefon in seiner schwarzen Ledertasche. Das Taxi hielt vor der Abflughalle des Flughafens Stansted.
Wien, einen Monat vorher
Sturmböen ballten garstig-graue Wolken am Himmel zusammen. Zuckende Lichtstreifen durchzogen den bleigrauen Himmel. Von Donnerschlägen begleitet, prasselte Regen auf die Stadt, der in Hagel überging. Die gefrorenen Wasserkugeln trommelten auf das Blechdach der Dachgeschoßwohnung.
Magnus Lorenzi stand hinter dem Dachgaubenfenster und beobachtete das Naturschauspiel, an einer Tasse Lapachotee nippend. Ein greller Lichtblitz blendete seine Augen wie einen Schweißer, der ohne Schutzschild arbeitete. Dem grellen Schein folgte ein dumpfes Vibrieren, das Lorenzi als leichtes Kribbeln am Körper spürte. Er war jedes Mal aufs Neue fasziniert, wenn sich das spannungsgeladene Gemisch aus Wasser, Wärme und Luft explosionsartig entlud. Sein Traum kam ihm wieder in den Sinn. Der Himmel verfinsterte sich, Wassermassen strömten über die Ufer und überfluteten das Land. In der gischtend-braunen Flut trieben Eisschollen und Baumstämme. Er sah weder Menschen noch Tiere.
Immer öfter träumte er von Katastrophen. Bevor der Bruderkrieg in Europa begann, wachte er mit Bildern von Soldaten im Kopf auf, die sich bereit machten, das zu tun, wofür sie ausgebildet wurden. Seit Tagen schon spukten wieder düstere Gedanken in seinem Kopf herum. Er behielt sie für sich, denn er hatte Zweifel, dass die Menschen ihm glauben würden. Wer bin ich denn schon, dachte er. Ein abgehalfterter Schauspieler, kein Wissenschaftler, ein Charakterdarsteller, kein Gelehrter, ein Hobbymaler, kein Prophet. Er öffnete die Fensterflügel, streckte den Kopf hinaus in die rein gewaschene Luft, die er gierig in die Nasenlöcher saugte. Sein Blick fiel auf das Blech an der Dachgaube. Es sah aus, als sei es mit einem Kugelhammer bearbeitet worden, so einem, wie ihn die Kupferschmiede benutzten, um aus Blech kunstvolle Formen zu treiben. Er schloss die Fensterflügel, legte sich auf die Chaiselongue und nahm die Schrift zur Hand, die er dort abgelegt hatte. In dem Moment, als das Unwetter losbrach, hatte er von einem galaktischen Ereignis gelesen, das alle Menschen in seinen Bann ziehen würde.
Fast 40 Jahre lang spielte Magnus Lorenzi Reiche und Arme, Dumme, Habgierige und Hartherzige vor Menschen, die Stuhl an Stuhl in Reihen saßen und klatschten, wenn er ihnen den Spiegel der gesellschaftlichen Verworfenheit vorhielt. Er war dieser Kunst gerne nachgegangen, doch mit der Zeit kamen Andere, die den Theaterbetrieb übernahmen und den modernen Stücken den Vorzug gaben. Es war ihm nicht leichtgefallen, den Hut zu nehmen und zu gehen. Vor sechs Monaten war dann auch noch sein Vater, gestorben, den er seit Jahren nicht gesehen, den er aus seinem Gedächtnis verbannt hatte. Erst am Sterbebett war es zu der seit Langem ausstehenden Aussprache gekommen, wie in einem kitschigen Film, in dem der verlorene Sohn ans Bett des sterbenden Vaters eilt und beiden Tränen über die Wangen kullern.
Magnus Lorenzi warf sich nichts vor, er hatte sein Leben so gewählt, wie er es wollte. Er hatte gegen den Wunsch seines Vaters den brotlosen Beruf eines Schauspielers ergriffen und sich danach mit der nicht weniger brotlosen Kunst der Malerei beschäftigt. Der Vater hatte ihm, bevor er die Augen für immer schloss, noch ein Kuvert zugesteckt. Erst nach der Beerdigung seines Vaters öffnete Magnus den Umschlag und zog, zu seinem Erstaunen, einen Brief seines Großvaters hervor. Es war Großvaters Vermächtnis.
Er hatte eine leichte Erregung gespürt, als er das Schreiben aus dem Kuvert nahm. Beim Tode seines Großvaters war er fünf Jahre alt gewesen. Er erinnerte sich an dessen gütige Augen, die durch die runde Drahtbrille schauten. Er erinnerte sich an Großvaters sonderbare Aussprache, er böhmakelte, wie die Wiener das nannten, wenn jemand Deutsch mit böhmischem Akzent sprach. Er wusste wenig über seinen Großvater. Sein Vater hatte das Gespräch immer abgewürgt, wenn es auf ihn kam. Zudem hatte er den Namen seiner Frau angenommen. Deshalb hießen sie Lorenzi und nicht Karnos, wie sein Großvater. Magnus Lorenzi konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass der Großvater seinem Vater peinlich gewesen war. Sein Vater hatte aber nie gesagt warum. Dann, dieser Brief, sein Vermächtnis.
Lorenzi hatte das Papier in die Hand genommen und zu lesen begonnen. Es war mit dem 19. April 1944 datiert. Zuerst schrieb sein Großvater, dass er seinem Sohn die Wohnung vermachte mitsamt der Einrichtung und der Barschaft von 5.000 Reichsmark. Dann, im zweiten Absatz, stand, dass sein geistiges Erbe seinem Enkelsohn Magnus zukommen sollte. Sein Vater sollte es hüten, bis Magnus erwachsen war, und es ihm dann übergeben. Lorenzi war verblüfft, sein Vater hatte nie erwähnt, dass Großvater ihm etwas hinterlassen hatte. Was dann zutage kam, war ein Haufen Schriften, die in mehreren Kartons aufbewahrt waren.
Beim Anblick der Schachteln voller Papier war er enttäuscht. Er wollte sie ungelesen in den Altpapier-Container befördern. Doch als er den Inhalt der ersten Schachtel in den Container kippen wollte, fielen einzelne Blätter zu Boden. Er hob sie auf und warf einen flüchtigen Blick darauf. Alles war fein säuberlich mit der Hand geschrieben. Er nahm ein weiteres Blatt auf und las. Ein Mann kam und räusperte sich. Lorenzi hockte am Boden, das Blatt in der Hand, und schaute erschrocken auf. Er entschuldigte sich und legte die Blätter zurück in die Schachtel.
Von da an las Lorenzi wie ein geistig Dürstender, der endlich auf die Quelle der Erkenntnis gestoßen war. Abertausende Seiten hatte der Mann mit der Hand geschrieben, der sein Großvater gewesen war. Er las von historischen Ereignissen, von denen er noch nie gehört hatte, von Menschen, deren Namen in keinem Geschichtsbuch aufschienen. Und er bekam eine Wut auf seinen kürzlich verstorbenen Vater, der ihm diesen Schatz all die Jahre vorenthalten hatte. Seit er sich in die Schriften seines Großvaters vertieft hatte, war er wie ausgewechselt. Er erkannte Zusammenhänge, Begebenheiten, Begegnungen und Ereignisse in seinem Leben, die zuvor keinen Sinn ergeben hatten – wie seine Reise nach Indien, mit all ihren Folgen. Beim Lesen der Schriften trat ihm alles plastisch vor Augen. Er sah Menschen in Aufruhr, sah religiöse Führer, die sich das Leben nahmen.
Lorenzi vibrierte innerlich bei dem Gedanken, dass er Beweise über den größten Betrug an der Menschheit in der Hand hielt, die fast 70 Jahre unbeachtet auf dem Dachboden seines Elternhauses rumgelegen hatten. Gerne hätte er mehr über seinen Großvater gewusst, der in einer Zeit des Umbruchs lebte und die Gabe besaß, mit dem Jenseits zu kommunizieren. In den Schriften stand, er sei der letzte wahre Prophet nach Johannes dem Täufer gewesen.
2
Wien, 1923
Karel Karnos betrachtete das Treiben seiner Kollegen mit Argwohn. Das ist doch blanker Unsinn, dachte er, mit so einem Apparat mit Geistern in Kontakt zu treten. Karels Kollegen benutzten ein Skriptoskop, um Antworten von Verstorbenen zu bekommen. Das war ein Apparat, dessen Zeiger mechanisch bewegt werden konnte und dessen Spitze an je einem Buchstaben des Alphabetes zum Stehen kam. Medial begabte Menschen konnten damit Wörter und Sätze empfangen, indem sie die Buchstaben der Reihe nach notierten. Karels Kollegen waren nicht die einzigen Menschen, die sich spiritistischen Handlungen hingaben. Spiritismus war zu jener Zeit in Mode. Selbst rational Denkende waren davor nicht gefeit. Karel schenkte dem seltsamen Gebaren seiner Kollegen zunächst wenig Beachtung, es erweckte sein Interesse erst, als er einen Ausdruck hörte, der auf einem Segelschiff gebräuchlich war, zu dessen Besatzung er einst gehörte.
Als junger Mann bereiste Karel als Matrose der österreichischungarischen Kriegsmarine die Weltmeere. Dabei geriet er einige Male in Lebensgefahr. Im Schwarzen Meer trieb er, an eine Schiffsplanke geklammert, fast zwei Tage lang im Wasser, ehe ihn ein zufällig vorüberfahrendes Schiff auffischte. Vor Japan konnten er und die Besatzung seines hölzernen Segelschiffes buchstäblich in letzter Minute aus einem Taifun in Sicherheit gebracht werden. Im Indischen Ozean sprang er einem aus der Takelage gestürzten Hindu ins Meer nach, um ihn vor einem Hai zu retten. Auf einer Südseeinsel verhalf er einem jungen Mädchen, das geopfert werden sollte, zur Flucht. Er verschenkte sein letztes Hemd, wenn er dadurch Menschen in Not helfen konnte.
Seine Tapferkeit und seine Hilfsbereitschaft hatten schließlich dazu geführt, dass Karel Karnos auf dem Schiff der Kaiserin Elisabeth dienen durfte. Doch nach einigen Jahren auf hoher See verließ er die Marine und begann bei der Sicherheitswache der Polizei in Wien. Nach einigen Jahren Dienst auf der Straße nahm er den Posten eines Polizeifotografen an und gehörte von nun an zur Film- und Lichtbildstelle in der Marokkaner Kaserne im dritten Wiener Gemeindebezirk.
Als Karel aus Jux einmal an das Skriptoskop trat, vermochte er mühelos Verbindung zu einem bereits verstorbenen Gefährten aus seiner Seemannszeit herzustellen. Das erstaunte ihn und erweckte seine Neugierde. Er nahm nun öfter an den Skriptoskop-Sitzungen im Büro teil und seine medialen Fähigkeiten festigten sich. Er sah Bilder aus der Vergangenheit und hörte Stimmen, die nicht von dieser Welt waren. Die Bilder und Szenen, anfangs noch verwirrend, wurden immer konkreter und er erkannte in ihnen Szenen aus der Bibel. Karel war kein religiöser Mensch, er besuchte auch nie eine Messe. Doch jetzt, mit 50 Jahren, zog es ihn hin und wieder in eine Kirche, vor allem die Franziskanerkirche in der Wiener Innenstadt übte eine geradezu magische Anziehungskraft auf ihn aus.
Es war im Mai 1923, Karel hatte sich nach Dienstschluss in der Innenstadt verabredet, als er sein Büro verließ, den Heumarkt und die Ringstraße überquerte und die Weihburggasse entlangging. Auf dem Weg lag die besagte Franziskanerkirche. Er wollte erst vorbeigehen, als er plötzlich den unwiderstehlichen Drang verspürte einzutreten. Er gab dem Impuls nach, öffnete das große hölzerne Tor und ging Richtung Hauptaltar. Es war sonst kein Mensch in der Kirche. Er blieb bei einem Seitenaltar stehen, er war der Muttergottes gewidmet. Wie von Geisterhand geführt, fiel Karel vor diesem Altar auf die Knie. Da erfasste ihn eine ungeheure Energie, die in seinen Körper drang. Er fühlte, wie sein Bewusstsein seinen Körper allmählich verließ.
Und wie aus dem Nichts ertönte eine Stimme: „Siehe!“
Vor seinem Auge bildete sich ein Raum ab, angefüllt mit Menschen, die inbrünstig beteten. Sie nannten sich „Aschai“. Aus ihren Reden erfuhr er, dass Wesen aus dem Jenseits sie angewiesen hatten, sich zu dieser Zeit in dem Haus des Nikodemus in Nazareth einzufinden. Auf einmal war der Raum von einem überirdischen Licht erfüllt, einem Licht, in dem menschenähnliche Wesen sichtbar wurden. Eines von ihnen trat vor, ließ sich auf die Knie nieder vor einer jungen Frau. Es begrüßte sie in tiefster Ehrfurcht – „Ave Maria“ – und verkündete ihr, was geschehen würde. Ein noch wunderbareres Licht erfüllte erneut den Raum. Es machte eine erhabene Gestalt, selbst reinstes Licht, sichtbar, die auf Maria zuschwebte. Die junge Frau war zutiefst ergriffen und ging in der Lichtgestalt auf.
Dann sah er Herodes in den Schwefelbädern bei Jericho, umgeben von seinen Beratern. Er hörte, wie die Berater dem Herodes kundtaten: „Du Herr, du wirst zugrunde gehen, und das ist das Werk derer, die mit den Toten in Verbindung stehen. Sie haben dir diese Krankheit angezaubert. Die Römer haben sie aus Italien ausgewiesen und auf die Insel Pandeteria verbannt. Sie haben die Pest aus den Gräbern verbreitet. Die Römer haben sie von dort nach Galiläa ausgewiesen. Und dessen sei gewiss, diese Brut hat dir diese Krankheit angehängt. Aber nicht genug an dem, es wird auch dein Haus nicht länger die Macht halten; denn aus ihnen wird jetzt geboren der König, der Herr dieser Welt. Und da er der Herr dieser Welt wird, und König der Könige, wird er auch König der Juden sein und dein Haus wird zusammenbrechen.“
Er sah und hörte, wie Herodes anordnete, seine Männer sollten alle Aschai in seinem Hoheitsgebiet ausrotten, und wie er sie strikt anwies, niemanden über die Grenze entkommen zu lassen. Eine große Flucht setzte ein. Jasen Alphäus, der Nährvater der Jungfrau Maria, nahm einen Esel und durchquerte mit Maria Galiläa, Samaria und Judäa.
Er sah, wie Maria in einem halb verfallenen Felsenstall ein Kindlein gebar. Sieben junge Hirten, die auf dem Feld schliefen, wurden durch Gesang aus der Höhe geweckt. In einem reinen, klaren Licht wurden Engel sichtbar, die ihnen das Wunder der Gottesgeburt verkündeten und sie – selbst dabei im Lichte hoch schwebend – zum Stall geleiteten. Im Stall fanden sie Maria, den alten Vater Jasen und das neugeborene Gotteskindlein in wunderbar verklärtem Licht auf dem Stroh liegen. Das Kindlein breitete seine Arme aus und sprach: „Mein Friede sei mit euch!“
Dann sah er drei Männer in den Felsenstall treten. Der eine sagte, er heiße Kaspion und komme vom Kaspischen Meer, der andere nannte sich Melchior aus Arjavartha. Der dritte war dunkelhäutig, er stellte sich als Baljesar aus Äthiopien vor. Die drei Männer brachten dem Neugeborenen kleine Geschenke – Kaspion einige Körnchen Gold, Melchior einige Körnchen Weihrauch, Baljesar etwas Myrrhe. Sie sagten, sie brächten diese Geschenke zum Zeugnis dafür, dass die Menschen von nun ab nicht mehr nach diesen Dingen trachten sollten, sondern vielmehr nach der Erkenntnis in Christo Jesu und der Selbsterkenntnis.
Die Bilder verblassten und Karel kam wieder zu Sinnen. Es schien ihm, als ob er alles nur geträumt hätte. Er rieb sich die Augen, stand auf und verließ die Kirche.
Karel hatte ab nun an öfter visionäre Zustände. Oft überkam ihn des Nachts ein eigenartiges Gefühl. Es war ihm, als ob jemand im Schlafzimmer neben seinem Bett stehen würde. Immer öfter kamen diese Erscheinungen, immer konkreter nahmen sie Formen an. Habe ich Halluzinationen, fragte er sich selbst. Dann, eines Abends, sah er wieder eine Gestalt neben sich stehen. Seine Frau schlief tief und fest, er dagegen fühlte sich hellwach und ganz bei Sinnen. Er war schon nahe dran, an seinem Verstand zu zweifeln, als die Gestalt plötzlich zu sprechen begann.
„Keine Angst, mein Bruder, ich tue dir nichts“.
„Wer bist du?“
„Ich bin Paulus, der Apostel Christi.“
„Das kann nicht sein, du bist ein Trugbild.“ Was wollte diese seltsame Erscheinung, die behauptete der Apostel Paulus zu sein?
„Wir sind schon lange bei dir und um dich herum. Wir haben dich auch auf deinen langen Schiffsreisen begleitet.“
„Wer ist wir?“
„Wir, die Brüder und Schwestern des Lichtes, der ewigen Wahrheit.“
„Aber … ihr seid doch Geister? Ich weiß von den indischen Yogis, dass es Erscheinungen gibt, die behaupten, mit Menschen in Kontakt treten zu können.“
„Ja gewiss sind wir nicht von dieser Welt, aber wir sind aus den Sphären des Ewigen, Wahren und Einzigen Gottes, der in Christus Mensch geworden ist auf Erden. Du hast vieles bereits in Gesichten gesehen, die wahre Begebenheit. Wir haben fast 2000 Jahre lang auf diese Gelegenheit gewartet.“
Karel Karnos war nach diesem Erlebnis wie verwandelt. Fast jeden Abend setzte er sich nach dem Nachtmahl an seinen Schreibtisch und diente seinen geistigen Führern als Schreiber, bis in den grauen Morgen hinein. Auf seinem Schreibtisch hatte er unter einer Glasplatte auf großen Bogen Papier das Alphabet installiert, daneben ein Stapel Papier und Bleistifte, die an beiden Enden angespitzt waren. Zehn und mehr Bleistifte schrieb er oft bis zum Morgen stumpf. Der Ablauf war immer derselbe: Er legte die linke Hand auf die Glasplatte. Die Berührung des Glases sollte den Kontakt zu den Jenseitigen erleichtern. Dann fing er an zu beten. Seine Hand zuckte, wie von einem Stromschlag berührt. Schließlich schrieb er schwungvoll das ihm Diktierte nieder. Ihm wurde meist erst nach der Sitzung gewahr, was er geschrieben hatte. Über Stunden mit der Hand zu schreiben, war äußerst anstrengend für ihn, doch er tat es gern, weil diejenigen, die sich seiner als Medium bedienten, die Geschehnisse, über die sie berichteten, als Augenzeugen miterlebt hatten.
So waren einige tausend Seiten zusammengekommen. Darunter die Wahrheit über Christus, das Jenseits, die Apostel, ihr Leben und Wirken, Beschreibungen von dem geologischen Aufbau der Erde, Berichte über archäologische Ausgrabungen, Wiedergaben von Texten wie dem Originalevangelium, der Originaloffenbarung von Johannes dem Seher und Evangelisten und weitere bislang unbekannte historische und geisteswissenschaftliche Aufzeichnungen wie Indiens Geschichte im 20. Jahrtausend vor Christus. Obgleich er, am vertrautesten mit dem Tschechischen, nur gebrochen Deutsch sprach, waren seine Texte in exzellentem Deutsch verfasst.
Karel Karnos hegte an der Wahrheit des ihm übermittelten Wissens keinerlei Zweifel, weil seine Führer ihm erklärt hatten, dass seine Gabe der Prophetie als seelisch-geistige Eigenschaft eines Menschen in tausenden von Jahren nur einmal vorkomme und der Wissenschaft deshalb fremd sei. Sie sei vergleichbar der geistvollen Schöpferkraft des Genies. Der seelische Körper eines Propheten rage über den irdisch-leiblichen hinaus und sei halb diesseitig und halb jenseitig. Deshalb konnten sie sich durch ihn kundtun. Einen Propheten erkenne man daran, dass er der Menschheit wahres Wissen, bisher unbekannte Zusammenhänge und Erkenntnisse vermittle. Ein Prophet der Wahrheit müsse den reinen Wesen seinen freien Willen anvertrauen, ihnen seine Seele, seinen Geist und seinen Körper zur Verfügung stellen. Als Prophet des 20. Jahrhunderts erfülle Karel alle diese Notwendigkeiten, sagten sie. Es offenbarten sich durch ihn die 28 Apostel, die mit Gott Christus auf Erden gewandelt waren, reine Wesen aus Gottes Reich und Seelen des Jenseits, um den Menschen zu zeigen, in welcher seelisch-geistigen Verfassung und Erkenntnis die Seelen in den vielen Welten des Jenseits lebten.
Auch tagsüber stand Karel ganz im Banne seiner Aufgabe. Er gewann immer mehr Anhänger aus der Kollegenschaft. Sie schlugen vor, das Wissen zu veröffentlichen, in einem selbst gegründeten Verein. Ihm gefiel das alles nicht. Aber er wusste, dass er eingedenk der Worte Christi: „Gehet hin und lehret alle Völker, was ich euch gelehrt habe“, das Wissen unter die Menschen bringen musste. Vieles an Wissen hatte er schon zu Papier gebracht, und mit jedem Mal wurden ihm neue Tatsachen über das Leben und Wirken Gottes Christi auf Erden übermittelt. Erst mit dem Wissen um die Wahrheit erkannte er, wie raffiniert die Fälscher bei ihren Bearbeitungen der Heiligen Schrift vorgegangen waren.
So gingen 21 Jahre ins Land. Er hatte fast jede Nacht schreibend verbracht, dann den ganzen Tag im Dienst, das hinterließ Spuren. Dann, im Jahr 1944, gab es einen sehr kalten Winter. Die Menschen hatten nichts zum Heizen und froren, denn dem Krieg wurden alle Ressourcen geopfert, obwohl er verloren schien. Das nächtelange Schreiben hatte Karel geschwächt. Eine Lungenentzündung warf ihn nieder. Er wies jede ärztliche Hilfe ab, denn er spürte, dass seine Zeit gekommen war und er heimkehren würde in das wahre, ewige Reich.
3
Wien, Gegenwart
Hunderte Menschen drängten sich an diesem schwülen Maitag im Kunsthistorischen Museum in Wien. Besucher aus der ganzen Welt strömten täglich in Österreichs größtes Museum, um einige der wertvollsten Kunstschätze der Welt zu besichtigen, oder weil ein Besuch des Museums vom Reiseveranstalter vorgesehen war. Unentwegt gingen Menschen an den Werken der Alten Meister vorbei, ohne sich deren Schönheit, Perfektion und Ausdruckskraft bewusst zu werden. Die Kunstschätze wurden von den meisten Besuchern wie Burger in einem Fast-Food-Restaurant konsumiert.
Magnus Lorenzi stieg die Stufen hinauf zum Haupteingang. Ehrengäste, Journalisten und Kamerateams drängten an ihm vorbei ins Museum. Lorenzi kam in den Sinn, umzudrehen und ein anderes Mal zu kommen, wenn der Spuk vorbei sein und normaler Betrieb herrschen würde. Er zog die Ehreneinladung aus der Tasche und las den handschriftlichen Vermerk auf der Einladung: Freue mich auf dein Kommen.
„Schätze im Museum allen Menschen zugänglich zu machen, ist Perlen vor die Säue werfen“, hatte Ehrenfried Grabherr einmal zu Lorenzi gesagt. Er war der Kurator der Apokalypse-Ausstellung, die als Sonderschau im Museum zu sehen war und an diesem Tag eröffnet wurde. Die wichtigsten Werke zur Apokalypse waren zum ersten Mal im KHM, wie das Kunsthistorische Museum in Kurzform genannt wurde, zu bestaunen. 115 Exponate illustrierten die künstlerische Umsetzung der „Offenbarung“, vom 4. bis ins 20. Jahrhundert. Für die Ausstellung stellten internationale Museen wie die Nationalgalerie Berlin, der Pariser Louvre, das Centre Pompidou, das Museo del Prado und das Madrider Thyssen-Bornemisza-Museum unter anderem Werke von Bosch, Dürer, El-Greco, Matisse, Dali und Reni zur Verfügung. Ein bisschen war es schon auch die Neugierde, die Lorenzi bleiben ließ. Er war insbesondere darauf gespannt, was der Vertreter des Vatikans sagen würde, der die Ausstellung eröffnen sollte.
Lorenzi zeigte dem Personal am Tor seine Einladung und ging in das Gebäude hinein. Die aufgetakelten Ehrengäste tranken Sekt und warteten voll Ungeduld auf die offizielle Zeremonie. Lorenzi nahm ein Glas Orangensaft vom Tablett, das ihm der Kellner unter die Nase hielt, und stellte sich in die Nähe des Ausgangs. Bei solchen Ansammlungen überkam ihn immer die Angst, dass eine Massenpanik ausbrechen könnte und dann alle Menschen gleichzeitig aus dem Gebäude drängen würden. Das Getuschel der Menschen verebbte, als der Museumsdirektor und der Vertreter des Vatikans samt Gefolge die Vorhalle betraten, begleitet vom Blitzlicht der Kameras.
Als das Schweinwerferlicht auf den Kopf des ersten Redners fiel, wurde es allmählich still im Raum. Direktor Gustav von Schönau begrüßte die Ehrengäste. Lorenzi hörte nicht wirklich hin, weil die Lobhudelei des Direktors ihn nicht interessierte. Wieder und wieder betonte der, wie bedeutend und wichtig diese Ausstellung für das Museum sei, die der Welt, zum ersten Mal vereint, die Kunstwerke zur Apokalypse zeige.
Lorenzi war erstaunt ob dieser dreisten Behauptung des Direktors. Offensichtlich ist an dem guten Mann vorübergegangen, dass die Ausstellung bereits in einem 400-Seelen-Dorf in Friaul in Norditalien zu sehen war, dachte er. Von Schönau übergab nun das Wort an den Ehrengast. Die Gäste klatschten, als Kardinalstaatssekretär Philippe Bortanio ans Rednerpult trat. Der grauhaarige Mann mit den dicken runden Brillengläsern erweckte in seinem schwarzen Anzug den Anschein eines einfachen Priesters. Doch Direktor von Schönau hatte den Mann und seinen würdevollen Status in der vatikanischen Hierarchie so überschwänglich geschildert, dass jedem die Bedeutung seines Amtes bewusst geworden war.
Der Kardinal begrüßte die Anwesenden auf Deutsch. Er erzählte, dass er Wien und die Österreicher liebe und die Zeit als Nuntius in diesem Land sehr genossen habe. Er betonte die Einzigartigkeit dieser Schau und unterstrich die Bedeutung des Buches der Apokalypse.
„Sie werden über 100 Meisterwerke aus einigen der wichtigsten Museen der Welt sehen. Die Meisterwerke werden den Besucher anregen, das letzte Buch der Heiligen Schrift erneut zu lesen und sich ihm zu nähern. In diesem Buch wendet sich der Seher Johannes an die Gemeinden Asiens – Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodizea – und im Geiste an die gesamte Kirche. Er ruft die Jünger Jesu auf, im Glauben treu zu bleiben und sich weder verführen noch erschrecken zu lassen von den bösen Mächten dieser Welt, die scheinbar überlegen, aber in Wirklichkeit zum Scheitern verurteilt sind“, sagte der Vertreter des Papstes.
Der Kardinal rückte seine Brille zurecht, einige Menschen räusperten sich. Dann fuhr er fort mit seiner Redeunterlage.
„Die Apokalypse ist nicht, wie oft gemeint wird, die beunruhigende Ankündigung eines katastrophalen Endes für die Menschheit, sondern die Erklärung des Scheiterns der höllischen Mächte und die großartige Verkündigung des Geheimnisses Christi, der zur Rettung der Geschichte und des Kosmos gestorben und auferstanden ist. Dieser Text und die Kunstwerke erschrecken uns nicht, wenn sie uns Szenen der Ewigkeit vor Augen führen. Allenfalls wollen sie uns daran erinnern, dass das Leben hier auf der Erde vergänglich ist und wir es jeden Tag durch die Qualität unseres Handelns prägen. In der Apokalypse die Ankündigung der Auferstehung am Jüngsten Tag zu lesen, ist an sich ein Trost und in gewisser Weise Gerechtigkeit. Man darf nicht vergessen, dass nur eine Welt gerecht sein wird, nämlich die, in der die Toten auferstehen und jede Wunde geheilt, jede Träne getrocknet, alle abgebrochenen Gespräche wieder aufgenommen und jede Sehnsucht nach dem Guten erfüllt wird. Gott ist Alpha und Omega, er umschließt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Welt, er ist Herr der Schöpfung, er leitet die Geschichte und bewahrt durch alle Katastrophen, durch alles Grauen hindurch, die Seinen. So ist die Johannesapokalypse Hoffnungsliteratur. Die Vision des himmlischen Jerusalems füllt in dieser Hinsicht nicht nur den letzten Teil der Apokalypse und der Ausstellung aus, sondern ist auch eine logische Notwendigkeit, eine moralische Pflicht und eine unerlässliche Voraussetzung, damit das Reden von Gerechtigkeit überhaupt einen Sinn erhält. Das Thema des Buches der Apokalypse ist nach den Worten des Heiligen Vaters wahrhaftig die Enthüllung des Sinns der Menschheitsgeschichte, ausgehend vom Tod und der Auferstehung Christi. Die Offenbarung des Johannes stellt für den Papst vor allem die Erwartung des endgültigen Sieges des Herrn dar; des Herrn, der kommt und die Welt verwandelt.“
Was für ein salbungsvolles Geschwafel, dachte Lorenzi. Der Kardinal hörte auf zu reden und blickte in das Publikum. Sein Blick verharrte auf Lorenzi. Der spürte einen Stich, als habe der Kardinal seine Gedanken erraten. Der Kardinal setzte fort und sagte: „Ich darf Ihnen vom Heiligen Vater in Rom die besten Wünsche und Gottes Segen übermitteln und wünsche Ihnen einen inspirierenden Rundgang durch die Ausstellung.“
Nachdem das Klatschen geendet hatte, meldete sich noch der Kurator der Ausstellung zu Wort. Intention der Ausstellung sei nicht, Katastrophen zu zeigen, man wolle die Besucher vielmehr einladen, das letzte Buch des Neuen Testaments mithilfe zahlreicher Meisterwerke zu überdenken, sagte er. Die elf Ausstellungsabschnitte folgten dem biblischen Text, den der heilige Johannes der Überlieferung nach auf der griechischen Insel Patmos zwischen 70 und 95 nach Christus verfasst hatte.
Der Kurator lud nun die Anwesenden dazu ein, die Ausstellung zu besichtigen. Der Direktor, der Kardinalstaatssekretär und dessen Entourage gingen voran, die Gäste folgten ihnen wie die Lämmer. Der Rundgang begann mit Darstellungen des Johannes auf Patmos vom spanischen Maler und Bildhauer Alonso Cano, dem italienischen Renaissance-Künstler Cosme Tura und dem niederländischen Meister Hieronymus Bosch. Zu sehen war auch Albrecht Dürers berühmter Holzschnitt-Zyklus Apocalipsis cum figuris.
Magnus Lorenzi ging mit einem eigenartigen Gefühl durch die Ausstellung. Gewiss, die Bilder der großen Künstler waren Kunstwerke, aber die Geschichte dahinter die biblische Version des Ereignisses auf Patmos. Sie ist in der frühen Kirche der ersten Jahrhunderte nach Christus oft als Fälschung bezeichnet worden, dachte Lorenzi. In den Ostkirchen hatte sie keinen Platz gefunden. Eigenartig, dachte er, als er das Museum verließ, der Kardinalstaatssekretär erinnert mich im Aussehen an meinen Großvater.
4
Das Kunsthistorische Museum schloss um 21 Uhr seine Pforten. Die 1,5 Millionen Objekte, die das KHM beherbergte, verkörperten einen unschätzbaren Wert. Die Wärter waren froh, dass der Spuk für diesen Tag bald vorbei sein würde. Es herrschte immer eine angespannte Atmosphäre, wenn sich Menschenmassen durch die Ausstellungsräume wälzten. Die Sicherheitsleute des Museums wechselten um 19 Uhr die Schicht. Seit dem dreisten Einbruch im Mai 2003 waren die Sicherheitsvorkehrungen im Haus erhöht worden. Damals, zur Langen Nacht der Musik, war ein Mann nach Mitternacht auf das Baugerüst vor der Fassade des Kunsthistorischen Museums geklettert und durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Die Kameras waren ausgeschaltet gewesen. Eine Goldskulptur des florentinischen Renaissancekünstlers Benvenuto Cellini war entwendet worden. Ihr Versicherungswert war mit 50 Millionen Euro beziffert.
An den Monitoren in der Sicherheitszentrale war an dem Abend nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Die Wachmänner scherzten und tranken Kaffee. Sie bemerkten nicht, dass eine dunkel gekleidete Gestalt in der Gemäldegalerie vor einem Werk von Hieronymus Bosch stehen blieb und es sich genauer betrachtete. Sie trug einen schwarzen Hut mit breiter Krempe. Ehe einer der Wachleute wieder auf den Monitor schaute, war der Mann verschwunden.
Die Apokalypse-Ausstellung hatte Magnus Lorenzi die ganze Nacht über im Schlaf beschäftigt. Immer wieder sah er vor sich die Bilder im Museum, die Johannes auf Patmos zeigten, wie er nach der Vorstellung der Künstler von Gott die tiefen Erkenntnisse empfangen haben soll. Lorenzi war entsetzt, hören zu müssen, wie die biblische Offenbarung als Buch der Hoffnung gepriesen wurde. Wie man die grauenvollen Szenen als unbedeutend ausklammerte. Die Kirche hat es immer schon verstanden, schreckliche Begebenheiten in der Bibel schönzufärben. Sie kann nicht anders, dachte er, sie darf kein Jota von der Schrift abweichen und muss ergo auch die grauenvollen Ereignisse als heilsbringend verkaufen. Im Museum hatte er versucht, mit seinem Freund Ehrenfried Grabherr zu reden. Aber es war unmöglich gewesen an einem solchen Tag, wenn alle wichtigen Leute zugegen sind. Besser so, dachte er. Wahrscheinlich hätte ich ihm etwas gesagt, was mich nachher gereut hätte.
Die Besprechungen in der Presse am nächsten Morgen waren voll des Lobes. Welch’ ein Segen es für die Stadt, für das Land sei, solch bedeutende Werke zur Schau zu stellen, im Herzen Mitteleuropas. Der Schreiber erwähnte die ruhmreiche katholische Vergangenheit Europas unter den Habsburgern. Unklarheit herrsche nach wie vor über den Verfasser der Apokalypse. Er rangiere zwischen Johannes dem Evangelisten, Johannes dem Presbyter von Ephesus und einem Wanderpropheten aus Palästina namens Johannes. Lorenzi legte die Zeitung zur Seite und trank einen Schluck Kaffee. Sein Blick fiel auf die rote Kaffeedose, Caffè di Venezia. Das Bild eines Mannes stieg vor seinem geistigen Auge auf. Er fragte sich, ob dies ein Zeichen war.
5
Olga Ludovika führte eine Gruppe italienischer Touristen durchs Kunsthistorische Museum. Es war ihre erste Führung an diesem Tag. Die blonde Tschechin hatte Kunstgeschichte und Romanistik studiert und arbeitete seit zwei Jahren für das Museum. Das Herumführen der Besucher war für sie Routine, sie spulte ihre Erklärungen herunter wie ein Tonband. Die Kunstwerke und Bilder an den Wänden sah sie jeden Tag und beachtete sie kaum mehr. Bilder waren für sie Objekte, mit denen sie Geld verdiente, indem sie den Besuchern die Werke erklärte, über deren Schöpfer und ihre Epochen berichtete. Es war ein gut bezahlter Job. Am liebsten waren ihr die Touristengruppen, die von einer Sehenswürdigkeit zur anderen gekarrt wurden und die Führung im Museum wie einen Schnellimbiss zu sich nahmen. Gestohlen bleiben konnten ihr die Mitglieder von Studienreisen-Gruppen, die mit ihren Kunstreiseführern in der Hand antanzten und sie mit stumpfsinnigen Fragen quälten.
Olga Ludovika führte ihre Gruppe durch die Schatzkammer im Schweizerhof in der Hofburg, in der die prunkvolle Epoche der Kaiserzeit gezeigt wurde. Die Besucher betrachteten mit großen Augen und offenem Mund die Reichskrone und den Krönungsmantel des österreichischen Kaisers, den Reichsapfel, das Szepter, das Reichskreuz und die Heilige Lanze – die Insignien der Herrscher des Heiligen Römischen Reichs. Sie sehen nur den Schatz und nicht das Leid, das sich dahinter verbirgt, dachte Olga, die Besuchern schon hunderte Male die Kleinodien der Kaiserzeit erklärt hatte, und all diesen übertriebenen Spuk, der die Herrschaft Einzelner über ganze Völker symbolisierte. Olga führte die Gruppe von der Schatzkammer zur Apokalypse-Ausstellung in die Gemäldegalerie im Haupthaus des Museums am Maria-Theresien-Platz.
Die Luft war stickig in der Gemäldegalerie und das Licht duster. Olga Ludovika hatte sich mehr schlecht als recht mit dem Apokalypsezyklus vertraut gemacht. Die Darstellung von angeblich heiligen Szenen in der Kirche, wie die Opferung Isaaks, hatte ihr schon als Kind Angst gemacht. Die Kirche und ihre Machtdemonstration waren ihr ebenso zuwider wie all der Prunk und Pomp der Kaiserzeit. Aber als Museumsführerin durfte sie darauf keine Rücksicht nehmen.
Olga begann, den Besuchern die Szenerie zu erklären. Einige hörten ihr zu, andere sahen sich weitere Werke an. Ein Mann mit hellblauem T-Shirt und auf die Stirn geschobener Sonnenbrille deutete auf das Bild von Hieronymus Bosch, das Johannes auf Patmos zeigte, und fragte sie in gebrochenem Deutsch, ob der graue Streifen ein Fehler sei. Ludovika verstand nicht recht, was er meinte, und richtete ihren Blick auf die Stelle.
6
Magnus Lorenzi nahm Bargeld aus dem Wandsafe, rief seine Nichte Sandra an und hinterließ ihr auf dem Anrufbeantworter die Nachricht, er sei für einige Tage verreist und werde sich nach seiner Rückkehr bei ihr melden. Das letzte Mal war er vor neun Jahren in dieser Stadt gewesen, die trotz stinkender Kanäle und horrender Preise die Menschen anzog wie Kuhfladen die Fliegen. Er hätte fliegen können, doch Lorenzi schätzte die Bequemlichkeit einer Bahnfahrt, bei der er Zeit hatte zu lesen und sich auf das Gespräch mit dem Mann vorzubereiten, von dem er hoffte, dass er ihn noch lebend antreffen würde. Wenn nicht, mach ich mir ein paar schöne Tage und fahr’ wieder zurück, dachte er.
Lorenzi fuhr mit einem Taxi zum Hauptbahnhof, drückte dem Fahrer 15 Euro in die Hand und ging in die Bahnhofshalle. Vor den Schaltern standen Menschen, ordentlich aufgereiht in Schlangen. Es ist wie verhext, dachte er. Auch im Supermarkt erwischte er immer die Kassa, an der nichts weiterging. Lorenzi kaufte sich eine Jause und Zeitungen am Kiosk und erwischte den Nachtzug gerade noch so in letzter Minute. Er ging durch mehrere Waggons, doch in jedem der Nichtraucherabteile saßen einer wenn nicht gar mehrere Erwachsene und Kinder.
Es war eine besondere Eigenart von ihm, alleine in einem Abteil sitzen zu wollen. Doch der Nachtzug nach Venedig erfüllte ihm diesen Wunsch nicht. Da stieß er doch noch auf ein freies Abteil. Wenn er nicht die ganze Fahrt im Gang verbringen wollte, musste er nun schnell handeln, obgleich die Luft von kaltem, abgestandenem Rauch geschwängert war. Als der Zug nach wenigen Minuten in der Station Wien-Meidling hielt, überlegte er nicht lange, hievte seine Tasche auf die Gepäckablage und setzte sich auf einen Platz neben dem Fenster. Wenigstens bin ich allein, dachte er. Die Klimaanlage surrte leise, brachte aber keine frische Luft ins Abteil. Wie im Flugzeug, dachte er, zog seine Schuhe aus, legte die Füße auf die gegenüberliegende Bank, öffnete die beiden oberen Knöpfe seines Hemdes und blätterte die Abendausgaben einiger Zeitungen durch. Das dominierende Thema war die im Juni beginnende Fußballeuropameisterschaft, die von Polen und der Ukraine gemeinsam austragen wird. Brot und Spiele, dachte er, packte ein mit Wurst und Käse belegtes Brötchen aus und biss herzhaft hinein.
Der Zug setzte sich mit einem Ruck in Bewegung und rollte langsam aus dem Bahnhof Meidling. Das Geräusch auf- und zugehender Schiebetüren im Gang nervte ihn. Unerwartet wurde die Schiebetür zu seinem Abteil geöffnet, der Schaffner schaute herein. Lorenzi blieb fast der Bissen im Hals stecken, als zwei Nonnen das Abteil betraten. Er lächelte und presste ein gezwungenes „Ja“ über die Lippen, als der Bahnbeamte ihn fragte, ob zwei Plätze frei wären. Die beiden Frauen lächelten zurück und fragten, ob er rauche. Lorenzi deutete ein Nein an. Der Schaffner verstaute das Gepäck der Frauen auf der Ablage. So ein Pech, dachte Lorenzi. Sie sind bestimmt nach Rom unterwegs und sitzen die ganze Zeit neben mir. Er schraubte den Drehverschluss der Colaflasche auf und trank direkt aus der Flasche. Mit Mühe konnte er das typische Geräusch entweichender Kohlensäure unterdrücken.
Die beiden dunkelhäutigen Frauen tuschelten in einer exotischen Sprache. Lorenzi sah genauer hin und glaubte an ihrem Habit zu erkennen, dass sie zu den Missionsschwestern der Königin der Apostel gehörten. Das Ordenshaus dieser Kongregation bildete sich vor seinem geistigen Auge ab. Es lag an einem der schönsten Plätze Wiens, mitten im Grünen, an den Hängen des Schafsbergs.
Kurz vorher hatte er in der Zeitung von einem Mord gelesen, der sich in der Nähe des Ordenshauses zugetragen hatte. Ein Passant hatte eine Frau auf einem Gehsteig liegend entdeckt. Das Messer steckte so fest in ihrem Rücken, dass der Gerichtsmediziner Probleme hatte, es herauszuziehen. Die Medien berichteten in letzter Zeit vermehrt von Gräueltaten, die Menschen an ihresgleichen begingen. Lorenzi räusperte sich und fragte die Schwestern, ob sie nach Rom unterwegs seien. Sie nickten und lächelten verlegen. Er erinnerte sich, dass sich diese Missionsschwestern besonders für Indien einsetzten.
Seine Indienreise vor fünfzehn Jahren kam Lorenzi in den Sinn. Trotz notorischer Flugangst hatte er sich, vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln, in das Flugzeug gesetzt. Als er nach neun Stunden Flug in Bombay aus der Maschine stieg, dachte er, auf einem anderen Stern gelandet zu sein. Er erinnerte sich, wie er mit einem Shuttle-Bus vom internationalen Flughafen zum nationalen in Bombay fuhr, von wo er nach Südindien weiterreiste. Als er während der Fahrt in dem offenen Bus Menschen und Hunde zwischen Müll und Exkrementen in der Gosse liegen sah und den Gestank nach Fäkalien und Verwesung wahrnahm, wollte er sofort umdrehen und zurück nach Europa. Das Land faszinierte ihn, vor allem seine Geschichte und Kultur. Er hatte viel darüber gelesen. Aber die Wirklichkeit, mit der er in diesem Land konfrontiert wurde, behagte ihm ganz und gar nicht. Der Grund für die Reise war seine alte Bekannte Dagmar Sarkar, die er in Mitraniketan besuchen wollte. Sie war vor vielen Jahren von Österreich nach Indien ausgewandert, hatte einen Inder geheiratet, der aber bereits verstorben war. Sarkar unterstützte Hilfsprojekte in Südindien. Sie arbeitete in einer Schule und handwerklichen Ausbildungsstätte. Als Lorenzi die Frau endlich aufgespürt hatte, in einem feuchten, dunklen, nach Schimmel und Moder riechenden Loch, wusste er nicht, ob er Mitleid oder Bestürzung zeigen sollte.
Auf einmal tauchte das Gesicht von Harrika in seinem Kopf auf. Lorenzi war überrascht gewesen, eine Schwedin mitten im indischen Dschungel zu treffen, zumal sie an einem Buch über einen niederländischen Maler aus der Renaissance arbeitete.
All das kam Lorenzi angesichts seiner dunkelhäutigen Reisebegleiterinnen in den Sinn. Er erinnerte sich an die Ayurveda-Behandlung im Amala Cancer Hospital in Kerala, die er auf Anraten Sarkars über sich ergehen ließ. Jeden Tag wurde er auf einer harten Holzpritsche liegend mit erwärmten Ölen massiert und musste einen bitter schmeckenden Kräuterauszug trinken. Er erinnerte sich an dunkelhäutige Schwestern in weißen Saris und weißen Häubchen auf dem Kopf, die hin und her eilten, Rollstühle schoben und Patienten stützten. Das Krankenhaus-Milieu hatte ihm nicht behagt. Und zu allem Übel durfte er während der Behandlung das Gebäude nicht verlassen, und das, obwohl er gesund war.
7
Der Zug fuhr mit einem Quietschen in den Bahnhof Wiener Neustadt ein. Eine Handvoll Leute stiegen aus, wenige ein. Lorenzi schaute auf die Uhr. Es war 22.21 Uhr. Um 7.17 Uhr sollte der Zug Venedig erreichen. Mit einem Ruck setzte er sich wieder in Bewegung und rollte aus dem Bahnhof in die Dunkelheit. Das Licht im Abteil war automatisch dunkler geworden. Die Schwestern neben Lorenzi hatten Schlafposition eingenommen. Er rutschte mit dem Oberkörper tiefer und legte seinen Kopf zur Seite. Bald war er im Land der Träume. Seine Füße zuckten. Er saß in dem muffigen Haus von Dagmar Sarkar. Ihr Büro war von unten bis oben mit Schriften, Zetteln, Kopien und Zeitungsausschnitten angefüllt. Sie saß vor ihrer Reiseschreibmaschine und bearbeitete mit zwei Fingern die Tastatur. Er sah ihre nackten Füße, die in etwas steckten, das an Sandalen erinnerte. Ihre Zehen waren verwachsen, wie ineinander verschlungene Wurzeln. Hinter ihr stand eine Frau und diktierte etwas. Er konnte nicht genau hören, was sie sagte. Sarkar hörte auf zu schreiben, drehte sich um und stellte ihm Harrika vor.
Lorenzi kam näher, streckte der Frau die Hand entgegen und schaute in ihre blauen Augen, die Tatendrang signalisierten. Ihr aschblondes Haar hatte sie zu einem Zopf gebunden und hochgesteckt. Mit ihren kirschroten Lippen und dem violetten Sari wirkte sie overdressed neben der ungeschminkten Sarkar in ihrem grauen Kittel. Lorenzi fand das bunte indische Wickelgewand an einer hellhäutigen Frau unpassend. Sie setzten sich nieder und Sarkar servierte ihnen Masala Tschai, einen Schwarztee mit Milch und Gewürzen. Harrika nippte an der Tasse und stellte sie wieder hin. Lorenzi steckte die Nase in das heiße Getränk, bevor er einen Schluck nahm. Er meinte den Geschmack von Lebkuchen zu erkennen. Harrika lächelte, als hätte sie seine Verwunderung ob des gewürzten Tees erkannt. Er fragte sie, was ihr Gebiet sei. Sie befasse sich mit Zeichen und Symbolen in der Kunst der Alten Meister, sagte sie.
Das Quietschen der Bremsen riss Lorenzi aus dem Schlaf. Er öffnete die Augen und blinzelte. Dann erhob er sich aus der unbequemen Position. Auch die Schwestern erwachten und setzten sich auf. Lorenzi schaute auf die Uhr, es war kurz vor sechs Uhr morgens, er hatte die ganze Nacht durchgeschlafen und seine Indienreise im Traum noch einmal durchlebt. Die Schwestern lächelten und fragten ihn, ob er gut geschlafen habe. Er sagte „solala“ und massierte sich den Nacken.
Der Zug traf fast pünktlich in Venedig ein. Lorenzi erinnerte sich an seinen letzten Aufenthalt in dieser Stadt. Es war seines Vaters Wunsch gewesen, seinen alten Freund Franz Moser noch einmal zu sehen und sich von ihm die Absolution erteilen zu lassen. Lorenzis Vater war vor zehn Jahren sterbenskrank gewesen und dachte, er würde nicht mehr lange leben. Die lange Reise war ihm trotz seiner Krankheit nicht zu beschwerlich gewesen. Franz Moser, in Italien nannte er sich Padre Francesco, war Leiter des Ordens der Priesterbruderschaft des Herrn. Lorenzi erinnerte sich an einen hageren Mann in einer schwarzen Kutte, mit ausdruckslosen Augen in einem bleichen Gesicht. Er war in den siebziger Jahren die rechte Hand des Apostolischen Nuntius in Wien gewesen.
Die Priesterbruderschaft des Herrn machte oft Schlagzeilen wegen ihrer erzkonservativen katholischen Einstellung. Lorenzi wusste nicht viel über sie, nur dass die Priester dieser Vereinigung die heilige Messe nach tridentinischem Ritus praktizierten, indem sie den Gläubigen den Rücken zuwandten. Jetzt, da er Venedig erreicht hatte, fragte er sich, warum er sich diese Reise angetan hatte. Warum es ihn zu Padre Francesco nach Venedig zog. Ich hätte mit Geistlichen in Wien reden können. Hoffentlich trügt mich nicht wieder meine innere Stimme, dachte er. Jetzt wieder umzukehren wäre töricht, da wäre ich ja die ganze Strecke umsonst hierher gefahren, dachte er, stieg in ein Taxi und nannte dem Fahrer die Adresse.
8
Venedig
Das Kloster lag etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Der Taxilenker fragte Lorenzi in Englisch, ob er Tourist sei. Lorenzi schaute ihn an und sagte ja, um zu vermeiden, dass der Taxilenker ihm vielleicht Fragen stellte, die er nicht beantworten wollte. Der Taxilenker redete etwas von guter Qualität und nicht teuer. Lorenzi verstand nicht, was er meinte und wollte ihn auch nicht fragen. Er war zu angespannt. Sein spontaner Aufbruch aus Wien, er war sich nicht sicher, ob er das alles wirklich wollte. Es war ihm, als ob er von unsichtbarer Hand geführt würde. Doch wer versteckte sich hinter dieser unsichtbaren Hand?
Nach einer halbstündigen Fahrt erreichte das Taxi sein Ziel. Lorenzi bat den Fahrer zu warten, stieg aus, ging zum Eingang und läutete an der Glocke. Eine Stimme meldete sich. Lorenzi sagte auf Englisch, er sei ein Bekannter des Prälaten. Die schwere Holztür öffnete sich und eine Frau trat ins Freie. Lorenzis Verwunderung schwand schnell, als sie ihm erklärte, dass das Kloster jetzt als Hotel geführt wurde. Er konnte es nicht fassen. Die Hotelfrau sah, dass ihm die Nachricht sichtlich Unbehagen bereitete und rief etwas in das Innere des Gebäudes. Kurz darauf erschien ein junger Mann und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie nickte und sagte zu Lorenzi, der Prälat sei im Kloster San Pietro in Asolo zu finden.
Lorenzi spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Ich Idiot, dachte er, wäre ich doch in Wien geblieben. Das Hupen des Taxilenkers riss ihn aus seinen Selbstvorwürfen. Was tun, dachte er, als er zum Wagen ging. Er erklärte dem Fahrer, dass er wieder zurück nach Venedig fahren wolle. Dieser fragte ihn, warum er nicht bleiben wolle, das Hotel sei doch schön und preiswert. Lorenzi glaubte, der Fahrer habe mit dem Hotelbesitzer eine Abmachung, weil er von den Vorzügen des Hotels schwärmte. Er sagte schließlich, dass derjenige, den er glaubte hier anzutreffen, sich in einem Ort namens Asolo befand.
„Bene“, sagte der Fahrer. „Steigen Sie ein, wir fahren.“
Typisch Italiener, dachte er, sind heiter, auch wenn es keinen Grund dafür gibt. Er stieg in das Taxi und gedachte, den nächsten Zug nach Wien zu nehmen. Ein paar Tage in Venedig anzuhängen, danach stand ihm nicht der Sinn. Irgendwie kommt mir die Gegend verändert vor, dachte er und schaute auf die Uhr. Wir müssten längst wieder in Venedig sein. Er tippte den Fahrer auf die Schulter und fragte ihn, ob er eine andere Route nach Venedig genommen habe.
„Venedig, nein, wir fahren nach Asolo“, sagte er.
„Wieso fahren Sie nicht nach Venedig?“ Er verlor langsam die Geduld. Schuld war diese unselige Apokalypseausstellung, dachte er. Ich wäre sonst nie nach Italien gefahren.
„Schöne Stadt, Sie werden sehen“, erwiderte der Fahrer.
Lorenzi schaute auf den Taxameter. „Halten Sie an“, schrie er.
„Wir sind gleich da“, sagte der Fahrer.
Lorenzi war fuchsteufelswild. Nicht einen Euro bekommt er, schwor er sich. Der Fahrer erklärte ihm, dass der Ort für seine mehr als tausendjährige Vergangenheit bekannt sei und in einer der bekanntesten Weinbaugegenden Italiens liege. Die Region sei vor allem für ihren ausgezeichneten Prosecco bekannt, sagte der Fahrer und schnalzte mit der Zunge.
„Sprudelwein ist nicht das Meine“, sagte Lorenzi. „Von wegen, gleich da“, raunzte er und blickte auf die Uhr. Der Fahrer deutete mit der Hand auf die Stadt, deren Umrisse am Horizont auftauchten. Er bog nach links ab und fuhr eine kurze steile Straße hinauf. Die Ein- und Ausfahrt in die Stadt war einspurig und wurde durch eine Ampel geregelt. Sie mussten deshalb vor dem engen Stadttor einige Minuten warten. Lorenzis Groll hatte etwas nachgelassen. Doch über die Dreistigkeit des Taxilenkers gedachte er sich zu beschweren. Der Fahrer hielt am Hauptplatz und zeigte mit der Hand zum Kloster, das auf einer höheren Stelle im Ort lag. Lorenzi interessierte momentan mehr der Taxameter. Da hätte ich ja gleich fliegen können, dachte er, als er dem Taxifahrer widerwillig 140 Euro hinblätterte.
Lorenzi fühlte sich etwas wohler, als er die Gasse zum Kloster hinaufstieg, wohler als in Venedig, das ihm nie besonders gefallen hatte. Das Kloster steht auf einem herrlichen Platz, dachte er, als er ins Land hinunterschaute. Er ging weiter zur Eingangstür, die offen stand. Eine angenehme Kühle umgab ihn, als er in den dunklen Vorraum trat. Das Gemäuer roch nach Mittelalter und Geschichte. Die alten Gebäude haben alle eine Seele, dachte er und suchte nach etwas wie einem Empfang. Er sah Ständer mit Schriften der Priesterbruderschaft des Herrn und wusste, dass er richtig war. Hoffentlich lebt der Alte noch, dachte er. Es war ungewöhnlich ruhig. Lorenzi schaute auf die Uhr. Siesta, dachte er und ging hinaus. Er verspürte auch langsam Hunger. Er ging die Gasse hinunter, wo die kleinen Geschäfte, die sich eng aneinander schmiegten, seine Aufmerksamkeit erregten. Auf einmal hörte er Stimmen, die immer lauter wurden. Dutzende Menschen standen am Hauptplatz und schrieen Parolen. Er ging weiter und erblickte in einer Auslage ein Plakat. Wie kommt der denn hierher, dachte er, als er ein Portraitbild des österreichischen Malers Theophil Prinz wahrnahm. Daneben stand: Prinz in Asolo. Der österreichische Maler gab im Theater Duse in Asolo ein Orgelkonzert, anlässlich seiner Ausstellung beim Asolo Art Film Festival.
Lorenzi glaubte in der Gruppe der Protestierenden den Namen Prinz herauszuhören. Er ging in das Kaffeehaus am Hauptplatz. Menschen standen am Tresen auf einen schnellen Kaffee. Er erinnerte sich, dass ein Stehkaffee in Italien billiger war. Doch die appetitlich aussehenden Salate und Süßspeisen in der Vitrine versetzten seine Magennerven in Unruhe. Also setzte er sich an einen Tisch im hinteren Teil des Lokals. An der Wand hingen Bilder der verstorbenen Schauspielerin Eleonora Duse, die in Asolo begraben war. Sie soll zu ihrer Zeit eine der größten Schauspielerinnen Italiens gewesen sein. Lorenzi machte wieder einmal die Erfahrung, dass italienisches Essen am besten in Italien zubereitet wurde. Nach einem Espresso, der seinen Lebensgeistern neuen Antrieb verlieh, machte er sich erneut auf dem Weg zum Kloster.
9
Hingegen sollen wir den Leib mit seinen Lastern und Sünden hassen, weil er fleischlich leben will. (Franz von Assisi)
Padre Francesco hatte sich in sein Privatgemach zurückgezogen, das sich neben der Bibliothek befand. Er durfte auf keinen Fall gestört werden während der Exerzitien. Nur sein Sekretär war eingeweiht in das Ritual. Mit nacktem Oberkörper stand der abgemagerte alte Geistliche vor einem Marienbild und trieb verbissen die Dornen in sein blutendes Fleisch.
Maria, seit du mir erschienst
Steh inbrünstig ich dir zu Dienst
All meiner Liebe heißer Schwur
Gilt deiner holden Schönheit nur
Und allen Hunger, alle Pein
Still ich an deiner Brust allein
In wilder Sehnsucht spät und früh
Umfass ich bebend deine Knie
Verflucht sei meiner Sinne Glut
Zermartert sei mein Fleisch und Blut
Die Peitsche strafe den sündigen Leib
Die Dornen tief hinein ich treib
Er wand sich vor Schmerzen:
Mit jedem Blutstropfen, den ich zähl
Fließt eine Sünde aus der Seel’
Je größer Qual und Angst und Schmerz
Je eher reinigt sich das Herz
Nur rein und frei von sündigem Wahn
Darf ich mich deiner Unschuld nah‘n
Padre Francescos Gesicht war leichenblass, nur mit Mühe hielt er sich auf den Beinen, die Geißel fiel ihm aus der Hand. Sein Sekretär eilte herbei und stützte ihn. Mit einem Tuch wischte er den zerschundenen Rücken des Büßers ab. Der Alte hechelte wie ein Hund in der Sonne. Der alte Idiot, dachte der Sekretär, packte ihn und zerrte ihn zum Diwan.
„Ich Sünder, ich Sünder“, murmelte der Prälat.
Der Sekretär gab ihm ein Glas Rotwein, zu trinken gegen den Blutverlust. Gierig griff Padre Francesco mit seinen knochigen Fingern nach dem Kristallglas und leerte es in einem Zug. Der Sekretär hielt ihm ein reines Hemd hin und sagte, ein Mann aus Österreich wolle ihn sprechen. Der greise Ordensführer stand auf und zog sich mit Unterstützung des Sekretärs das Hemd an.
„Aus Österreich?“
Magnus Lorenzi kam die Stunde im Vorzimmer des Ordensleiters wie eine Ewigkeit vor. Der Raum war vom Boden bis zur Decke mit dunkelbraunem Holz verkleidet. Sitzbank und Sessel schienen aus demselben Holz geschnitzt zu sein. An den Fenstern hingen links und rechts dunkelviolette Vorhänge, an der Wand Gemälde, die Motive aus der Bibel darstellten: die Opferung des Isaak, die Enthauptung des Täufers, die Kreuzigung Christi. Lorenzi konnte kaum atmen in dieser Atmosphäre. Er dachte, es sei ein Fehler gewesen, in die Höhle des Löwen zu gehen. Sein Vater hatte ihm gesagt, er könne sich jederzeit an Bruder Franz wenden. Er werde ihm in jeder Lage helfen, er sei es ihm schuldig. Lorenzi war sich nicht im Klaren darüber, wie er sein Anliegen Bruder Franz vorbringen sollte.
Eine Tür öffnete sich. Mein Gott, der Sensenmann, schoss es Lorenzi in den Sinn, als er den Mann erblickte. Hinter ihm ging der Sekretär, Mitte 40, schätzte Lorenzi, einen Anflug an Grau an den Schläfen, gut aussehend. Lorenzi stand auf und ging zu dem Ordensmann. Der schien ihn sofort wiederzuerkennen.
„Ah, der Sohn von Gilberto“, sagte er auf Deutsch mit italienischem Akzent. Er streckte Lorenzi seine knochige rechte Hand entgegen, an deren Ringfinger ein goldener Siegelring mit dem eingravierten christlichen Symbol des Kreuzes prangte. Lorenzi zögerte einen Augenblick, dann reichte er ihm vorsichtig seine Hand, als würde er einen Toten berühren. Die Finger des Alten fühlten sich an, als sei alles Leben aus ihnen gewichen. Der Alte setzte sich mithilfe des Sekretärs nieder.
„Lieber Freund, setzen Sie sich. Was führt Sie zu mir?“
„Herr Prälat, das ist eine lange Geschichte“, sagte Lorenzi und schaute dem alten Mann verlegen in die Augen. Ihm war, als stünde er vor einem Richter und wusste nicht, warum.
Der Alte fragte, ob er einen Kaffee wolle.
„Gern“, sagte Lorenzi.
Der bleiche Greis winkte dem Sekretär, der kurz darauf mit einem Silbertablett kam, das er auf den Tisch stellte.
„Bitte bedienen Sie sich“, sagte der Alte.
Lorenzi stieg der Duft des frischen Kaffees in die Nase.
„Die Italiener brauen den besten Kaffee“, sagte er und nippte an der Tasse.
Der Alte führte die Tasse mit zittriger Hand zum Mund. „Sagen Sie …“
„Magnus.“
„Magnus, was führt Sie zu mir?“
Nachdem Lorenzi ihm vom Tod seines Vaters erzählt und der Alte ihm beteuert hatte, wie leid es ihm täte, begann er, über seinen Großvater zu reden.
„Sie sind ein guter Erzähler“, unterbrach ihn der Alte nach kurzer Zeit. „Aber Sie haben eine blühende Fantasie“, sagte er mit kalt blitzenden Augen. „Was soll ich davon halten? Eine Geschichte, eine Geschichte von vielen, die genauso wahr oder falsch ist wie andere derartige Hirngespinste.“
„Aber das ist kein Hirngespinst“, versuchte Lorenzi sich zu rechtfertigen.