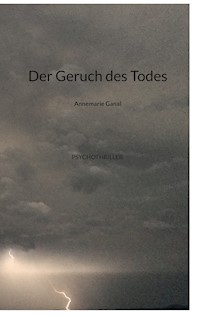Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit dem Verschwinden von Luna Bergs Eltern ändert sich das Leben der 28-jährigen Kinderbuchautorin grundlegend. Ein Schicksalsschlag verfolgt den anderen und ihr Leben verwandelt sich mehr und mehr in einen Albtraum, aus dem sie nicht mehr herauszukommen droht...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Prolog
Alles lief nach Plan. Es war dunkel und trotzdem erkannte ich sie, auch wenn ich drei Etagen weiter unten im Schnee stand. Ich wusste, dass sie mir nicht lange böse sein würde, und dann könnte ich endlich meinen Plan weiterführen. Ob sie gerade an mich dachte? Ich steckte die Hände tief in die Hosentaschen. Ein kleiner, rundlich aussehender Mann stapfte nach draußen. Er musterte mich einige Sekunden lang, bemerkte meinen Blick und grüßte mich kurz, bevor er Richtung Parkplatz davonging. Die Nacht war hell und klar und man hörte kaum Geräusche. Die Klinik befand sich am Waldrand. Sie wird es mir danken. Sie wird mich mehr lieben als je zuvor, wenn sie da wieder herauskommt und dann… Ein grelles Licht blendete mich. Ich hob die Hand zum Schutz vor meine Augen, um etwas erkennen zu können. Ein Scheinwerfer oben am Gebäude des Westflügels war angegangen und bestrahlte den ganzen Hof. Ich zog den Reißverschluss höher und drehte mich ganz langsam um, dann lief ich los zurück zu meinem Auto, das unten auf dem Parkplatz. Er war unbeleuchtet und erschien mir menschenleer. Alles war in einen leichten Nebel getaucht und als ich auf den Schlüsselknopf drückte, blinkten die Lichter meines Autos in der Ferne. Ich ging mit großen Schritten durch den Schnee. Ein kalter Wind wehte mir ins Gesicht. Ein Motor heulte hinter mir auf und als ich mich umdrehte, sah ich den kleinen Mann in einem verbeulten Mazda sitzen. Er beäugte mich noch einmal interessiert, bevor er zur Ausfahrt fuhr und mich mit der kühlen Nacht alleinließ. Ich freute mich auf den Tag, an dem sie wieder zu mir zurückkommen würde.
Ich freute mich darauf, dass sie mich nie mehr verlassen würde und stieg mit einem Hochgefühl ins Auto. Als das Licht ausging, öffnete ich meine Hose, um der Freude und den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Es ging nicht sehr lange und als ich fertig war, startete ich den Motor und fuhr los. Weg von ihr…
Kapitel 1
Luna
Ich schlenderte durch die beleuchtete Straße, weit weg von Zuhause. Den dicken Wollschal hatte ich um meinen dünnen Hals geschlungen. Die Hände steckten in den tiefen Taschen meines langen Mantels. Es schneite seit wenigen Tagen ununterbrochen und die Räumfahrzeuge kamen kaum noch hinterher den vielen Schnee zu beseitigen, ganz abgesehen davon, dass es kaum genug Platz gab, an dem sie ihn abladen konnten. Die Berge an den Straßenrändern wuchsen immer höher, selbst ein paar Parkplätze wurden zugeschüttet. Überall blinkten die orangenen Lichter im Dunkeln. Es war eiskalt und meine Nase war sicher schon so rot wie eine Christbaumkugel. Meine Hände versuchte ich zu wärmen, ohne jeglichen Erfolg. Ich spürte sie kaum noch, genau wie meine Füße. So sehr ich den Winter auch mochte, die Kälte zerfraß mich jedes Jahr aufs Neue.
Als ich kurze Zeit später mit meiner dicken Wolldecke, einer Wärmflasche, einer Tasse Tee und meinem Laptop wieder auf dem Sofa saß, beobachtete ich das Schneetreiben. Es war so viel angenehmer im Warmen zuzusehen, wie die kleinen Schneeflocken umherwirbelten und aussahen, als würden sie miteinander Tanzen. Es war einfach nur schön. Es erinnerte mich an früher. Als ich beim ersten Schnee jedes Mal stundenlang draußen im Dunkeln spielen konnte, völlig durchnässt, aber einfach glücklich. Als Mama und Papa Schnee geschippt haben und ich ihnen voller Stolz meine Meisterwerke gezeigt hatte.
Mama. Papa. Wo die beiden wohl waren? Ob sie überhaupt noch am Leben waren? Und wenn sie noch irgendwo da draußen waren, dachten sie auch gerade an den Winter? An Weihnachten? An die magischen Momente, die wir hatten?
An das Plätzchenbacken. An das Skifahren. Oder hatten sie das alles schon vergessen? Hatten sie mich vergessen? Und Maja? Würde ich sie jemals wiedersehen, in den Arm nehmen können und ihren Geruch einsaugen können?
Den vertrauten Geruch, der mich an Zuhause erinnerte. Eine Träne wollte sich lösen, doch bevor sie es schaffte, meine Wange hinunterzurollen, wischte ich sie ärgerlich mit dem Ärmel weg. Mühsam versuchte ich die Gedanken an meine Eltern irgendwo tief ins Innere meiner Gedankenwelt zu schieben. In die große Truhe, ganz weit unten im Verborgenen meines Gehirns einzuschließen, in die ich alles schob, was ich nicht fühlen wollte. Ausnahmslos. Und dieses Thema hatte ich schon etliche Male aus dem Bewusstsein verbannt, jedoch immer nur auf Zeit. Immer und immer wieder ploppte es aus dem Nichts auf, wie eine WhatsApp-Nachricht auf meinem Handybildschirm. Und anstatt sie zu ignorieren, las ich sie jedes Mal wieder, ohne darüber nachzudenken. Und irgendwann archivierte ich den Chat. Ich schüttelte den Kopf und begann endlich damit, die Geschichte für mein nächstes Kinderbuch weiterzuschreiben. Dafür brauchte ich meinen Kopf, und zwar, um in meiner Fantasie nach den richtigen Worten zu suchen. Ich konnte mir die skurrilsten Geschichten ausdenken. Völlig abgedrehte Hirngespinste kamen oft dabei heraus, wenn ich allzu lange allein war, weshalb ich meistens mehr als froh war, wenn Tom endlich nachhause kam und mich davon ablenkte.
Ich klappte den Laptop zu und stellte ihn seufzend auf dem Wohnzimmertisch ab. Ich konnte mich, trotz aller Bemühungen, nicht auf die Geschichte konzentrieren. Der Tee auf dem Tisch war zwar schon kalt, trotzdem nahm ich einen kleinen Schluck und stand vom Sofa auf, um das Abendessen zu machen, damit Tom nicht auch noch kochen musste, wenn er in einer Stunde kam. Er hatte die Hände voll zu tun mit seinem Job und sollte sich nicht auch noch um mich kümmern müssen. Ein lautes Geräusch ließ mich herumfahren. Was zur Hölle war das? War hier jemand? Vielleicht derselbe Jemand, der auch meine Eltern vor Jahren entführt und vielleicht umgebracht hatte? Ich griff nach der Tasse, sah mich suchend und voller Panik um, nach etwas, was größer als meine dumme Tasse war. Mein Herz raste und es fühlte sich an, als würde es jeden Moment aus meiner Brust hüpfen wollen. Mein Mund war trocken wie eine Wüste und ich zitterte am ganzen Körper wie verrückt. Ruhig bleiben, Luna! Es war bestimmt nichts. Meine Hände um die Tasse geklammert schlich ich in die Küche und lauschte angestrengt. Das einzige Geräusch stammte von der großen Wanduhr.
Tick. Tack.
Tick. Tack.
Hatte ich mir die Geräusche nur eingebildet? Spielte mein Verstand mir einen Streich? Mit zitternden Händen machte ich mich daran, die Zutaten aus dem Kühlschrank zu befördern und auf die Ablage daneben zu drapieren. Die Angst strömte noch immer durch meinen Körper und ließ mich nicht denken. Alles in mir schrie danach, das Haus zu durchsuchen, doch die Angst, etwas finden zu können, hielt mich zurück. Sie war mein ständiger Begleiter und kam immer wieder, ob ich es wollte oder nicht. Ein weiteres lautes Geräusch ließ mich erneut zusammenzucken, wobei mir vor Schreck die Tomate aus der Hand fiel und über den gefliesten Küchenboden rollte. Diesmal war ich mir sicher. Ich hatte mir das Geräusch nicht eingebildet, es war genauso real wie die Tomate am Boden. So real wie die ganzen Zutaten, die auf der Ablage lagen und darauf warteten, dass ich sie endlich verarbeiten würde. Doch die Angst lähmte mich. In Zeitlupe krabbelte ich unter den Küchentisch zu der Tomate und nahm sie in die Hand.
Dann ließ ich mich darunter nieder und wagte es nicht mehr, mich zu bewegen.
In meinem Kopf malte ich mir die schlimmsten Dinge aus. Ich würde wohl warten müssen. Auf Tom.
Das Geräusch des Schlüssels in der Türe, war das nächste, was ich bewusst wahrnahm. Hoffentlich war das endlich Tom. Ich konnte es noch immer nicht wagen, mein Versteck aufzugeben. Er würde etwas sagen. Er würde mich rufen.
Erst, als ich die vertraute Stimme hörte, konnte ich aufatmen. Er kam in die Küche, sah mich versteckt unter dem Tisch kauern und kroch zu mir. „Was ist denn los, mein Schatz?“, fragte er mit besorgter Miene und strich mir mit der Hand sanft über den Rücken. Ich erzählte ihm unter Tränen, was passiert war und ließ mich dann von ihm unter dem Tisch hervorziehen. Wir setzten uns auf das Sofa. „Das war sicher kein Einbrecher, vielleicht der Wind? Das Fenster im Schlafzimmer ist glaube ich noch offen. Ich geh Mal nachsehen“, beruhigte er mich und stand auf. Ich hörte, wie er die Treppe nach oben ging. „Ja, offen!“, rief er einige Sekunden nachdem er unsere Küche verlassen hatte. Mein Atem wurde zunehmend ruhiger und auch meine Anspannung ließen merklich nach. Es war nur der Wind gewesen. Keine Entführer oder Einbrecher. Niemand Fremdes.
Ich stand auf und ging zurück in die Küche. Dort begann ich endlich zu kochen.
„Tut mir leid! Eigentlich wollte ich fertig sein, wenn du da bist…“, murmelte ich, als er mich von hinten umarmte. „Schon Okay, ich freu mich darauf!“, entgegnete er und ließ die Hände höher wandern. Zu meinen Brüsten. Er küsste sanft meinen Nacken, sein warmer Atem ging stoßweise. Es war jedes Mal die reinste Qual. Seine Hände auf meinem Körper katapultierten mich in diese eine Nacht zurück, in der alles anfing… Die Schläge. Die Berührungen. Das heftige Eindringen gegen meinen Willen. Mein Onkel. Das alles, was ich bestens verdrängen konnte, kam zurück, sobald Tom begann mich zu berühren, zu küssen. Weil ich genau wusste, was jetzt passieren würde… Ich hörte wieder die heißere Stimme meines Onkels in mein Ohr flüstern: „Du machst mich so geil, ich will dich endlich Mal ficken!“ Spürte die widerlichen Küsse auf meinem ganzen Körper. Seine großen Hände, die an jene Stellen wanderten, an denen eine normale Frau ihre Lust empfand. Er zog mich immer mehr zu sich, ließ nicht mehr von mir ab und zog mir gewaltsam den Bademantel aus. Ich war gerade aus der Dusche gekommen, da hatte er auf einmal vor mir gestanden. Meine Familie war unten im Haus.
Sie aßen noch. Jetzt presste er seine Zunge durch meine Lippen in meinen Mund. Meinen Kopf hielt er mit der einen Hand, mit der anderen schlug er mir heftig auf den Po. Es tat weh und alles in mir schrie nur danach, dass er endlich von mir ablassen würde, doch diesen Wunsch wollte er mir nicht erfüllen. „Los ins Gästezimmer mit dir, du Geile!“, befahl er mir, was ich auch tat. Auch wenn ich am liebsten weggerannt wäre. Er schloss die Türe hinter uns ab, warf mich aufs Bett und holte aus dem großen Schrank eine Kiste hervor. Dann begann auch er sich auszuziehen. Ich blickte an die Decke und versuchte mit aller Kraft die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken. „So, jetzt erlebst du Mal etwas, was deine Vorstellungen sprengen wird, glaub mir, Schätzchen!“, raunte er und nahm aus der Kiste einige Utensilien, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Er legte sie auf den Boden. Mit einer langen Peitsche kam er auf mich zu. Angst, Panik durchströmte mich. Ich spürte den ersten Schlag, zuckte zusammen, begann zu weinen und schloss die Augen. Es folgten weitere Hiebe mit der Peitsche. Einer schmerzhafter als der andere. Ich spürte die roten Striemen, die sie hinterlassen würden, am ganzen Körper. Irgendwann wagte ich es, die Augen zu öffnen. Mein Onkel saß neben mir und in seiner Hand befand sich ein langes Seil. Er fesselte mich am Bett und legte sich mit seinem übergewichtigen, ekelerregenden Körper auf mich. Meine Knochen fühlten sich an, als würden sie brechen.
Meine Brüste wurden von seinen Händen fast zerdrückt und meine Haare riss er nach hinten, sodass meine Kopfhaut zu brennen begann. Ich wimmerte vor Schmerzen. Als er plötzlich in mich eindrang, schrie ich. Es tat so weh, dass ich das Gefühl hatte, mein Unterleib würde jeden Moment zerspringen. Der Schmerz, den ich spürte, machte meinen Onkel nur noch geiler. Er stieß immer noch fester zu, hielt mir die Hand vor den Mund, damit ich nicht schreien konnte. Alles, was ich spürte, war der unendliche Schmerz. Ein Schmerz, der so unerträglich war, dass ich das Gefühl hatte, zu explodieren.
Irgendwann, es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, ließ er von mir ab, stieg vom Bett herunter, entfesselte mich und befahl mir auf alle Viere zu gehen. Zuerst drang er in meinen Mund ein, bis ich würgen musste. Die Tränen liefen inzwischen ununterbrochen aus meinen Augen. Ich fühlte mich wie ein Häufchen Elend. Dreckig. Beschmutzt. Klein.
Dann begann er wieder damit, mich zu verprügeln. Ein Stoß in den Magen. Ein Schlag ins Gesicht. Meine Wange glühte. Mein Magen war verkrampft. Als nächstes trat er mit den Füßen auf mich ein. Irgendwann, als ich so benommen von den vielen Schmerzen war, dass ich sie kaum noch spürte, trat er hinter mich und begann in meinen Po einzudringen. So hart und fest, dass ich unter ihm zusammenbrach. Ich spürte nichts mehr. Ich konnte mich nicht bewegen, wollte mich auch nicht bewegen. Mein Kopf war leer und ich wünschte mich in eine andere Dimension. Weg von hier, von dieser Welt - von IHM. Nach einer unendlich langen Zeit, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, ließ er mich im Gästezimmer allein, sperrte zu und ging. Allein saß ich da und heulte. Die Augen brannten und mein Körper bestand nur noch aus unerträglichen Schmerzen. Ich fühlte mich schmutzig und leer. Einsam, als wäre ich der einzige Mensch auf der ganzen weiten Welt, als gäbe es niemanden mehr…
Der Schlag, den ich von Tom mitten in die Magengegend bekam, ließ mich aus meiner Erinnerung auftauchen. Ein weiterer Schlag landete auf meiner Nase. Blut spritzte über meinen Mund, das Kinn und tropfte nach unten. Tränen schossen in meine Augen, meine Sicht war verschwommen. Ich zitterte am ganzen Körper.
Ich wollte flüchten, doch mein Fluchtinstinkt funktionierte schon lange nicht mehr so wie er sollte. Dazu war ich viel zu feige. Gewaltsam riss mir Tom die Kleider von meinem ausgemergelten Körper. Der Herd hinter mir musste an sein.
Hatte Tom ihn eingeschaltet oder bildete ich mir die Wärme an meinem Rücken nur ein?
„Jetzt bekommst du das, worauf du schon den ganzen Tag gewartet hast. Deine Bestrafung.“, raunte Tom mir zu. Ich wollte den Kopf ausschalten, doch es gelang mir nicht. Es stimmte. Ich hatte den ganzen Tag darauf gewartet, aber nicht, weil ich mich darauf freute, sondern weil ich die Bilder der letzten Male nicht mehr aus dem Kopf bekam. Sie tauchten immer wieder vor meinem inneren Auge auf.
Sie bahnten sich minütlich ihren Weg in mein Bewusstsein. Zwischen den vielen anderen Erinnerungen, die ich versuchte zu verdrängen. Als nächstes spürte ich noch, wie Tom meine Hand nahm. Sanft, fast zärtlich, küsste er sie. Und im nächsten Moment spürte ich dort, wo der letzte Kuss gesetzt wurde, einen stechenden, brennenden Schmerz, der mir fast das Bewusstsein raubte…
Kapitel 2
Wenn es in den Nachrichten um eine Vergewaltigung gegangen war, war es mir nie in den Sinn gekommen, selbst einmal eine dieser verängstigten Frauen zu werden. Ich hatte bei keinem meiner grausamen Bücher darüber nachgedacht, dass mir so etwas einmal passieren könnte. Natürlich war mir immer klar gewesen, dass die Möglichkeit bestand. Trotzdem hatte ich mich immer für eine starke Person gehalten, die ein lautes „Nein“ über die Lippen bringen würde, meinen Peiniger wegschubsen würde und ihm einen festen Tritt in die Eier verpassen würde. Heute sah ich das alles ein wenig anders. Heute war ich zu feige, das Wort zu erheben, zu flüchten oder mich zu wehren…
Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, wo ich war. Ich versuchte meine Augen zu öffnen, was mir mit viel Anstrengung auch gelang, wollte sie aber am liebsten sofort wieder schließen, weil das grelle Licht in ihnen brannte. Ich versuchte mich aufzurichten, scheiterte aber beim ersten Anlauf und knickte mit dem Handgelenk um. Ich stöhnte vor Schmerzen, die ich am ganzen Körper spürte.
Als es mir endlich gelang, mich in eine sitzende Position zu begeben, erblickte ich Tom, der neben mir auf dem Sofa saß und auf den Boden starrte. Er weinte. Seine Schultern ließ er hängen. „Es tut mir leid, Luna. Ich wollte das nicht, nie. Ich war nicht ich selbst. Es tut mir so leid!“, sagte er unter Tränen, ohne aufzusehen. Auf einmal tat er mir furchtbar leid. Vielleicht war es diesmal wirklich das letzte Mal.
Es konnte doch sein. Er war krank, er konnte nichts dafür. Es war nun mal in seinem Wesen. Trotzdem schrie alles in mir danach, ihn zu hassen für das alles.
Für das, was er mir angetan hatte. Immer und immer wieder. Doch aus irgendeinem Grund gelang es mir einfach nicht. „Luna, bitte verzeih mir!“, weinte er und sah mich das erste Mal wieder an. Doch ich wendete den Blick ab, konnte ihm nicht in die Augen sehen. „Luna? Sag doch bitte etwas!“, forderte er mit fester Stimme. Ich konnte die Wut in seinen Worten hören. Die finstere, dunkle Seite in ihm spüren. Ich nickte nur, zu einer anderen Reaktion war ich nicht in der Lage. „Gut. Ich liebe dich doch, mein Engel“, flötete Tom mich an und strich mit einer Hand über meinen Oberschenkel. „So sehr!“ Seine Berührungen brannten auf meiner nackten Haut wie Feuer. Seine Worte klangen leer und unglaubwürdig. Nur seine Augen strahlten eine gewisse Wärme aus, die mich schon immer angezogen hatte. Ich wünschte mir den alten Tom zurück. Ich sehnte mich nach seiner Ruhe, seiner Zuneigung und seiner sanften Art. Doch nach der überstürzten Hochzeit damals, hatte er all das abgelegt. Alles, was ich so sehr an ihm geschätzt hatte. Weg.
Als wir später im Bett lagen, klingelte es auf einmal an der Türe. Es war bereits nach elf und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wer so spät noch bei uns klingeln würde.
„Wer ist das?“, fragte Tom müde, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich zuckte nur mit den Schultern und wollte mich aufrappeln. „Nein!“, rief Tom und kam mir zuvor. „Ich geh schon, bleib ruhig liegen!“ Innerlich wusste ich, dass er nicht wollte, dass dieser Jemand eine meiner Verletzungen zu sehen bekam und dumme Fragen stellte, auf die ich keine Antworten gewusst hätte. Er stand auf und tappte nach unten an die Haustüre. Ich hörte leise Stimmen, doch ich verstand kein Wort. Nach einiger Zeit polterte Tom die Treppen wieder hoch. An der Art, wie er ging, hörte ich, dass etwas nicht stimmte und setzte mich im Bett auf.
„WAS SOLL DAS?“, schrie er mich an.
„WAS SUCHT DIE POLIZEI UM DIE UHRZEIT BEI UNS?“
Ich zuckte heftig zusammen, wollte ihm sagen, dass ich das nicht war und keine Ahnung hatte, was die hier wollten, doch dazu kam ich nicht mehr.
„HAST DU DENEN WAS GESAGT? HAST DU DIE ANGERUFEN, DU MISTSTÜCK?!“
Seine Stimme bebte vor Wut schon landete der erste Schlag auf meiner Wange.
Geschrei.
Der zweite traf mich so hart, dass es mich vom Bett herunterschlug. Qualvolle Schmerzen durchströmten mich. Wieder. Irgendwann spürte ich nur noch den Aufprall. Ich hörte kaum etwas. Seine Worte drangen nicht mehr zu mir durch und um mich herum war alles verschwommen. Selbst weinen konnte ich nicht mehr. Irgendwann ging er und kam erst lange Zeit später wieder. Ich bewegte mich nicht. Kein bisschen. Stumm und starr lag ich einfach am Boden, die Augen geschlossen. Ich hatte mich nicht getraut, sie auch nur eine Millisekunde zu öffnen. Ich merkte, dass ich ins Bett gelegt wurde, doch seine Hände spürte ich nicht. Ich hörte auch keine Entschuldigungen oder Bitten, ihm zu verzeihen.
Nichts. Vielleicht war es endlich soweit und ich würde sterben. Vielleicht…
Kapitel 3
Ich war nicht gestorben. Ich lebte. Leider. Wie sehr hätte es mich erlöst. Ich hatte jenes Zeitgefühl verloren. Alles tat weh und trotzdem spürte ich kaum etwas.
Mein Kopf spielte verrückt. Vorsichtig richtete ich mich im Bett auf, langsam und unter Schmerzen. Tom war nicht mehr da, wahrscheinlich war er schon zum Arbeiten gefahren. Ich sah auf den Wecker, der kurz nach zehn zeigte und wunderte mich darüber, dass ich so lange geschlafen hatte. In Zeitlupe schleppte ich mich aus dem Bett, ins Bad und putzte mir die Zähne. Jede Bewegung kostete mich so viel Anstrengung und Kraft, dass ich mich am liebsten auf den Boden gesetzt hätte und weitergeschlafen hätte. Mit viel Mühe schaffte ich es, meine Klamotten auszuziehen und stellte mich in die Duschkabine. Ich wollte mich von dem vielen Schmutz, der Schuld, den Gedanken befreien. Es von mir abwaschen.
Ich stellte das Wasser heiß und ließ es auf mich hinunterprasseln. Der Strahl tat gut, auch wenn es im ersten Moment brannte. Mein ganzer Körper, an dem ich erst jetzt hinuntersah, war übersät von Wunden, Flecken und Narben. Narben aus einer Zeit, an die ich mich nur ungern zurückerinnerte. Ihr Anblick katapultierte mich wieder hinein in eine Flut von Erinnerungen.
„Lunaaaa!“, rief meine Schwester jetzt schon zum fünften Mal und klopfte dabei ungeduldig an die Badezimmertüre, die ich vorsorglich von innen abgeschlossen hatte, entgegen Mamas Verbot. Sie hasste es, wenn wir das taten. Sie fand es nicht so „familiär“, eher so, als würden Fremde miteinander wohnen. „Gleich, lass mich doch in Ruhe, ich brauch eben noch ein bisschen!“, fauchte ich wütend und genervt zurück. „Du brauchst immer nur noch „ein bisschen“ und dann stehst du wieder ne ganze Stunde da drin! Was machst du denn so lange? Musst du etwa kacken?“, meckerte Maja unbeirrt weiter. Sie ließ sich nicht abwimmeln, ganz im Gegenteil: Das Klopfen wurde nur noch drängender und lauter. „Nein und jetzt hau ab!“, schrie ich und widmete mich wieder meinen Haaren, die ich zu zwei gleichmäßigen Zöpfen flocht. Wenige Minuten und dann konnte ich endlich los. In die Schule. Ich band den Haargummi um den zweiten Zopf und schloss die Türe auf. „Na endlich!“, rief Maja aus und drängte sich an mir vorbei ins Bad.
Ohne ein einziges Wort zu verlieren, ging ich zurück in mein Zimmer, wo ich meinen Schulrucksack aufsammelte, um dann nach unten zu gehen. „Morgen Mama!“, begrüßte ich meine Mutter, die in der Küche hantierte. Wahrscheinlich bereitete sie das Pausenbrot für meine Schwester vor. Maja war gerade 14 geworden und führte sich dementsprechend auf. „Rebellin“ wurde sie von meinem Vater meistens genannt. „Hast du wieder abgeschlossen?“, fragte Mama mich, ohne sich dabei umzudrehen. „Ja, aber ich will eben ein bisschen Privatsphäre, wenn ich duschen gehe und auf dem Klo bin!“, antwortete ich genervt und schnappte mir einen Apfel. „Wir haben eine Abmachung, Luna, und ich fände es wirklich toll, wenn auch du dich daranhalten würdest. Du weißt, dass immer irgendwas passieren kann…“ „Ja, ich weiß, aber mir doch nicht. Wieso muss ich offenlassen, wenn es doch Maja ist, die jederzeit einen Anfall bekommen kann?“ Diesmal bemühte ich mich, ruhiger zu klingen. „Ich weiß, dass du das unfair findest, aber deine Schwester macht dir nun mal so gut wie alles nach…!“ Mama gab mir einen Kuss auf die Stirn und drehte sich wieder zurück an die Anrichte, um Majas Brote zu belegen.
Mama. Wie sehr ich sie vermisste. Wie gerne hätte ich sie jetzt bei mir. Ich würde alles dafür tun, ihr jetzt alles erzählen zu können. Von Tom. Von den Schlägen.
Mit einem Schlag erinnerte ich mich wieder an das Klingeln gestern und fragte mich, wieso die Polizei bei uns aufgekreuzt war. In Windeseile wusch ich meine Haare, trocknete die wunde Haut und schlupfte in frische Klamotten. Die Schmerzen, die sich dadurch nur verschlimmerten, ignorierte ich gekonnt. So schnell es mir möglich war, lief ich hinunter, suchte mein Handy und checkte meine Nachrichten. Sieben Anrufe in Abwesenheit. Vielleicht hatte die Polizei angerufen... Die Nummer jedenfalls kannte ich nicht.
Ich drückte auf „Rückruf“ und schon nach dem zweiten Freizeichen meldete sich eine männliche Stimme: „Polizei, Herr Koll, Guten Tag, was kann ich für Sie tun?“ Mit zitternder Stimme erklärte ich dem Polizisten, was ich wollte und tatsächlich wusste dieser sofort, wer mich angerufen hatte. Er wies mich an, einen Moment zu warten, damit er mich mit dem Kollegen verbinden konnte. „Guten Morgen, Frau Wickler! Ich bin Kommissar Eckert. Ein Glück, dass Sie anrufen, wir müssen Sie dringend sprechen! Wann wäre es Ihnen denn recht?“, kam es aus dem Hörer. Mein Herz begann zu rasen. Vorsichtig schob ich eine Strähne meiner braunen Haare nach hinten, die sich gelöst hatte. „Ähm, ich hab eigentlich immer Zeit…“, stotterte ich ins Telefon. „Ich komme in der nächsten halben Stunde. Mir ist bewusst, dass es eher unüblich ist, dass wir persönlich vorbeischauen, aber das erkläre ich Ihnen später. Ach, und entschuldigen Sie die gestrige späte Störung, Ihr Mann sagte mir, sie hätten schon geschlafen!“ „Schon Okay, können Sie mir sagen, worum es denn geht?“, fragte ich hoffnungsvoll, wurde jedoch sofort von dem netten Polizisten darauf hingewiesen, dass dies eine heikle Angelegenheit war, die man lieber persönlich klären sollte, dann verabschiedete er sich mit einem „Bis später“ und ich legte auf.
Angst und Panik waren wieder zurück. Was war so heikel? Wieso wollte die Polizei so dringend mit mir sprechen? Hatten sie möglicherweise Hinweise zum Verschwinden meiner Eltern gefunden? Auch wenn es Jahre her war, gab es keinen Tag, an dem ich nicht hoffte, sie würden gefunden werden. Die Ungewissheit brachte mich beinahe um den Verstand und raubte mir auch jetzt wieder jegliches Denkvermögen. Die Anspannung und Angst in mir stieg mit jeder Sekunde, die ich mit Warten verbrachte. Ich vergaß alles um mich herum und konnte nur noch daran denken, was dieser Polizist wohl zu sagen hatte. Meine Knie konnte ich kaum stillhalten, obwohl mein ganzer Körper noch immer von Schmerzen erfüllt war.
Es klingelte endlich. Wie ein aufgescheuchtes Huhn eilte ich zur Türe, wartete einige Sekunden, um tief durchzuatmen und öffnete schließlich die Haustüre, um ihn hereinzulassen. „Hallo, Frau Wickler, ich bin froh, dass Sie so früh Zeit für mich haben!“, begrüßte mich ein hochgewachsener, schlanker Mann. Seine schwarze Hose war ihm etwas zu kurz und seine grüne Jacke gab den Blick auf seinen Pulli frei, auf dem ein Schriftzug zu erkennen war. „Ähm, hallo, ja natürlich! Möchten Sie nicht hereinkommen?“, antwortete ich nervös und fummelte dabei an meiner dünnen Strickjacke herum, die ich über ein hellblaues T-Shirt gezogen hatte. Meine Füße steckten in warmen Hausschuhen und meine Haare fielen gleichmäßig über meine Schultern herab. Der Mann nickte und trat in den Flur. „Sie können Ihre Schuhe ruhig anlassen, ich muss heute eh noch wischen“, log ich, damit wir nicht allzu viel Zeit verplempern würden. Ich wollte endlich den Grund für sein Kommen erfahren. Kommissar Eckert folgte mir ins Wohnzimmer und nahm neben mir auf dem Sofa Platz.
„Also? Weswegen wollten Sie mich so dringend persönlich treffen?“, fragte ich bemüht ruhig. „Nun ja, wir haben vor wenigen Tagen einen anonymen Anruf bekommen, der Anrufer teilte uns mit, er habe Informationen zu Ihrem Fall von vor fünf Jahren. Zufällig habe ich das mitbekommen, meine Kollegen wollten den Anrufer schon abwimmeln, weil der Fall für sie klar ist. Aber ich bin mir sicher, dass er das nicht ist, und ich möchte ihn lösen. Natürlich ist mir klar, dass ich damit vermutlich vieles wieder aufrüttle, deshalb habe ich mich auch nicht sofort gemeldet, weil ich Ihnen keine falschen Hoffnungen machen wollte“, begann er, unterbrach dann aber, weil ich anfing zu weinen. Die Tränen schossen mir in die Augen wie Blitze und in mir tobte ein Sturm. Angst durchflutete mich und ließ mich kaum atmen. Ich versuchte mit aller Mühe mich unter Kontrolle zu bekommen, doch es funktionierte nur teilweise. Mama. Papa. Hatten sie sie womöglich gefunden? Lebend? „Möchten Sie sich ein Taschentuch holen?“, fragte der nette Kommissar, doch ich schüttelte nur den Kopf. Ich wollte wissen, was Sache war. Ich wollte dieses Gefühl der Ungewissheit loswerden.
„Nun, also wie schon gesagt, ich hatte selbst Zweifel an der Sache. Aber dann hab ich den Mann angerufen, um ihn um ein persönliches Gespräch zu bitten. Sie sollten vielleicht wissen, dass der Fall für mich mehr ist, als die üblichen Fälle es sind. Ich war mit Ihrem Vater damals in einer Klasse, wissen Sie?“, fuhr er ruhig fort. Schluchzend nickte ich und zog die Nase geräuschvoll hoch. „Naja, ich wollte also, auch aus persönlichem Interesse, diesen Fall unbedingt lösen! Ich habe den anonymen Anrufer zuerst nicht erreicht, er hatte über ein Hotel in der Stadt angerufen und zum Zeitpunkt meines Rückrufs war er nicht dort. Ich habe an der Rezeption dann meine Nummer hinterlassen und am selben Abend noch rief mich der Mann an. Ich bin also rangegangen und, Frau Wickler, ich konnte meinen Ohren kaum trauen, ich erkannte seine Stimme! Es war Ihr Vater, der mich anrief!“ Dann zog er eine dicke Mappe aus der braunen großen Umhängetasche, die mir erst jetzt auffiel und reichte sie mir. „Was ist das?“, fragte ich leise und ängstlich. Ich befürchtete schon, es wären Bilder. „Briefe, die er mir ein paar Stunden nach unserem Telefonat gegeben hat, als wir uns getroffen haben. Ich lasse Sie mal in Ruhe lesen, dürfte Ich vielleicht währenddessen Ihre Toilette benutzen?“, fragte er sanft. Ich nickte und zeigte auf die kleine Türe rechts neben der Haustüre. Mit zitternden Händen nahm ich ihm die Mappe ab, in mir brodelte ein Tornado, wütete durch meinen Kopf. Dann schlug ich die Mappe auf und begann zu lesen.
Kapitel 4
Liebe Natalie, 04.02.2005
es ist jetzt schon so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, und ich vermisse dich. Es ist schwierig, ohne dich zu sein. Natürlich verstehe ich, dass wir uns nicht mehr sehen können, du hast ja deine beiden kleinen Mäuse und deinen Mann… Wie geht es den beiden? Ich hoffe doch gut. Hier bei uns ist gerade viel los, wir sind dabei das Haus zu renovieren und morgen beginnen wir endlich mit deinem Büro. Amelie geht es gut, sie wächst soooo schnell. Schade, dass es noch so lange dauert, bis sie dich endlich kennenlernen darf. Sie kann inzwischen laufen und sogar schon ein bisschen sprechen.
Ich bin schon gespannt was du sagst, wenn du sie endlich siehst! Und unser Haus erst!
Du packst das, meine Liebe, bis Bald!
Ich liebe dich.
Deine Aria
Verwirrt starrte ich auf den Brief in meiner Hand. Was hatte das zu bedeuten? Ich legte ihn bei Seite und nahm mir neugierig und schockiert zugleich den nächsten.
Liebe Natalie, 10.03.2005
als dein Brief hier ankam, habe ich mich wie ein kleines Mädchen gefreut. Ich hab ihn bestimmt hunderte Male gelesen und jedes Mal hatte ich Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß, dass es anstrengend ist, eine solche Fassade aufrecht zu erhalten und ein solches Geheimnis zu bewahren, aber du wirst schon sehen, wenn es dann endlich vorüber ist, wirst du dich umso mehr freuen!
Es freut mich zu hören, dass es deinen beiden gut geht. Dass Luna sich so aufgeregt hat, ist bestimmt normal. Sie ist eben die ältere und das ist nicht immer ganz einfach. Ich war damals auch die ältere und mir ging es ganz genauso. Glaub mir, sie kriegt sich sicher wieder ein! Bleib standhaft und lass dich nicht unterkriegen!
Amelie macht immer mehr Fortschritte, bekommt schon ganze Sätze heraus, die zwar noch keinen Sinn ergeben, aber das ist mir egal!
Lieb dich!
Deine Aria
Der Polizist saß inzwischen wieder neben mir und sah sich ein wenig in unserer Wohnung um. Unter Tränen bedankte ich mich bei ihm. Ich fragte ihm Löcher in den Bauch, wollte alles wissen und bemerkte nicht, wie die Zeit verging. Er versprach mir hoch und heilig, ein Treffen mit meinem Vater zu arrangieren.
Draußen wurde es schon dunkel, als Herr Eckert mir mitteilte, dass er aufbrechen müsse. Ich nickte nur. Verstört und völlig ratlos begleitete ich Herrn Eckert zurück zur Tür und verabschiedete mich kurz, bevor ich sie hinter ihm schloss und zurück zu der Mappe mit den vielen Briefen ging. Zuerst hatte ich ein wenig Angst, was mich noch alles erwarten würde, doch die Neugier siegte und ich musste herausfinden was zum Henker diese Aria von meiner Mutter wollte. Wer war sie? Und wieso liebte sie meine Mutter?
Einige Briefe handelten nur von Erzählungen von Amelie, die allem Anschein nach Arias Tochter war. Vieles davon war wirr, eher uninteressant und nebensächlich, da ich sowieso keine Ahnung hatte, wer sie überhaupt war. Als ich einen der letzten Briefe öffnete, begannen meine Hände jedoch zu zittern.
20.04.2010. Ein Tag bevor sie einfach so verschwunden sind und uns ohne jegliches Lebenszeichen zurückgelassen haben. Allein. Für immer. Oder doch nicht für immer? In meinem Kopf schrillten die Alarmglocken. Alles in mir wehrte sich dagegen, diesen Brief zu lesen. Am liebsten hätte ich ihn einfach weggeworfen, verbrannt oder in den Schredder gesteckt. Aber auch jetzt war die Neugier zu groß. Die Panik durchflutete mich ein weiteres Mal, als ich die ersten Zeilen zu lesen begann und mein Magen rebellierte. Dann übergab ich mich auf den Fußboden.
Wie in Trance konnte ich mich dazu überwinden, den Brief beiseitezulegen und in die Küche zu laufen, um mein Erbrochenes aufzuputzen. Tom würde ausflippen. Mich schlagen. Das tun, was er am liebsten tat. Allein das Aufputzen kostete mich so viel Kraft, dass ich zu schwitzen begann. Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn und mein Kopf glühte, als säße ich vor einem Lagerfeuer.
Zu nah dran, sodass es sich anfühlt, als würde man jeden Moment Feuer fangen.
Ich brachte den Lappen zurück in die Küche, wrang ihn über dem Waschbecken aus und spülte ihn mit Wasser ab, bevor ich ihn wieder in die Spüle legte und zurück ins Wohnzimmer taumelte. Ich spürte meinen Körper kaum noch. Meine Gedanken waren wirr, durcheinander. Immer wieder wanderten sie von Mama zu Papa. Und von Papa zu Mama. Papa lebte! Er lebte! Mit zittrigen Händen nahm ich den Brief wieder und begann erneut zu lesen.
Liebe Natalie, 20.04.2010
Morgen ist es endlich so weit. Morgen können wir uns nach endlosen vergangen Jahren wieder sehen. Ich hoffe so sehr, dass du dich genauso freust, wie ich. Meine Liebe, wir können endlich zusammen sein und leben und müssen uns nie wieder verstecken. Ich verstehe, dass du etwas Angst hast, dass deine beiden Töchter zu sehr darunter leiden, dass du fort bist, aber irgendwann vergeht dieser Schmerz, den sie fühlen werden, glaub mir. Jetzt bist endlich du dran. Du hast dein halbes Leben für diese Familie geopfert, jetzt darfst du dir nehmen, was du willst! Amelie ist schon so aufgeregt und freut sich seit Tagen, dass sie endlich Mamas bessere Hälfte kennenlernen darf. Nach den vielen langen Jahren, die vergangen sind. Ich fahre heute noch los, in das Hotel, das du mir so empfohlen hast, in dem wir uns morgen treffen und den Plan durchführen wollen, den wir seit Jahren planen. Zuhause ist alles eingerichtet und fertig. Alles wartet auf dich.
Aber am meisten warte ich. Amelie bleibt morgen zuhause, sie soll den ganzen Stress lieber nicht mitbekommen. Gott sei Dank ist sie alt genug, um allein zu Hause zu bleiben.
Ich kann es kaum erwarten, dich in meine Arme zu schließen, zu riechen, zu küssen und zu spüren. Naja, wir sehen uns ja morgen, ich muss mich jetzt Mal auf die Socken machen, um die Restlichen Vorbereitungen zu treffen, die noch nötig sind.
Ich liebe dich so sehr und freue mich auf morgen!
Deine Aria
P.S. Liebe Grüße und ein Küsschen von Amelie
Ich starrte auf den Brief. Eine Träne kullerte auf das Papier. Ich habe nicht Mal gemerkt, dass ich zu weinen begonnen habe. Das darf nicht wahr sein. Dieser Brief lügt. Mama hätte uns das nie angetan. Verfluchte Scheiße. Ich wollte schreien, um mich schlagen, alles zerstören und diese Aria ausfindig machen, doch nichts dergleichen passierte. Ich war wie in einer Starre gefangen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht schreien oder um mich schlagen. Ich konnte nichts machen.
„Was bitte ist denn hier los?“, riss mich Toms brüllen aus meiner Trance. Die Tränen schossen mir wieder in die Augen. Ich sehnte mich nach einer Umarmung. Nach einer tröstenden Stimme und einem warmen Kuss. Doch stattdessen bekam ich einen heftigen Schlag auf die Nase. Weitere Tränen schossen mir in die Augen. „Los!“, schrie Tom: „Sag schon, was ist das? Wer hat dir das alles gegeben und warum stinkt es hier so dermaßen?!“ Ich fror am ganzen Körper und stotterte leise: „Ein Polizeibeamter hat mir neue Dinge vom Fall meiner Eltern gebracht.“ Wutentbrannt sah Tom mich an. Ich konnte seine Aggressionen förmlich spüren.
„DU HAST DEN HIER HEREINGELASSEN?“
Ich nickte nur vorsichtig. Ein Schlag in die Magengegend. Dann übergab ich mich ein weiteres Mal. „Putz das auf und dann komm hoch, da wartet deine Strafe auf dich!“
Verkrampft stemmte ich mich vom Sofa nach oben, ging leise in die Küche und putzte wieder den Boden. Tom war inzwischen voraus gegangen. Lange überlegte ich, was ich mit den Unterlagen machen sollte. Obwohl ich wusste, dass es Tom nur noch wütender machen würde, wenn ich sie verschwinden lassen würde, stopfte ich eilig alles zurück in die Mappe und versteckte diese hinter meinen vielen Büchern. Dann ging ich nach oben und ergab mich meinem Schicksal. Wie immer.
Kapitel 5
5 Jahre zuvor, 20.04.2010
„Aus Polly! Hör auf zu bellen, du hast doch gar keinen Grund!“, wies Natalie den großen Husky zurecht, der ununterbrochen die Gartentüre anbellte. Sie wusste, dass es nicht lange halten würde und er würde wieder loslegen, aber wenigstens hielt er für einige Minuten den Mund. Natalie machte sich wieder auf den Weg zurück in die Küche, um das Abendessen fertig vorzubereiten. Es war gerade Mal halb fünf und sie hatte schon so gut wie alles gemacht, was es zu machen gab.
Um sechs sollte ihr Mann vom Arbeiten zurückkommen und um sieben würden ihre beiden Töchter vorbeikommen, um gemeinsam mit ihnen zu Abend zu essen.
Luna und Maja waren inzwischen beide Berufstätig und lebten außer Haus, wodurch Familientreffen zu einer Seltenheit wurden, und auch sonst hatten Natalie und Georg wenig Ahnung von dem, was in deren Leben so vor sich ging.
„So, gleich ist alles fertig“, murmelte Natalie vor sich hin und stellte den Nudelauflauf in den vorgewärmten Backofen. Dann drehte sie sich um und warf nochmal einen Blick auf den Nachtisch, der sich im Kühlschrank befand. Polly begann wieder zu bellen. „Man Polly! Hör jetzt auf mit dem Mist! Du brauchst nicht den ganzen Tag Alarm zu schlagen, da ist nichts im Garten, also krieg dich endlich wieder ein!“, rief Natalie dem Hund zu: „Geh lieber zu deiner Schwester und spiel mit ihr!“ Eigentlich waren die beiden 8-jährigen Huskys wohlerzogen und schlugen nur Alarm, sobald jemand zu Besuch kam oder ein paar Idioten sich an ihrem Haus befanden. Doch heute waren die beiden ganz aufgedreht und kaum in den Griff zu bekommen. Polly verschwand wieder und kam einige Sekunden später zusammen mit Leslie wieder ins Wohnzimmer gerannt. Dann bellten sie gemeinsam die Türe an, als würde ein Geist dahinterstehen. Langsam