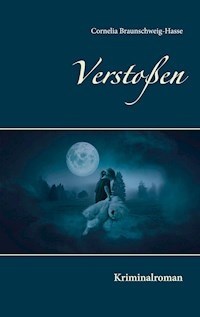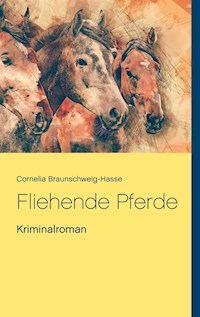Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Team um Hauptkommissar Uwe Berger sieht sich durch mehrere bestialische Morde eines offenkundig psychopathischen Serienkillers mit einer zunächst unlösbar scheinenden Herausforderung konfrontiert. Erst, als die neue Gerichtsmedizinerin mehr und mehr in die Vorfälle verwickelt zu sein scheint, kristallisiert sich aus den festgefahrenen Ermittlungen ein ungeheuerlicher Verdacht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiktionshinweis:
Dieser Roman dient ausschließlich der Unterhaltung und erhebt keinen Anspruch, authentisch zu sein, weder in seinem zeitlichen Ablauf, noch im Hinblick auf erwähnte Gebäude, beziehungsweise auf Arbeitsmethoden beschriebener Institutionen. Er ist rein fiktiv.
Sämtlche in dem Roman vorkommenden Figuren sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig
In jedem lebt ein Bild
dessen, was er werden soll.
Solang er dies nicht ist,
ist sein Friede nicht voll.
Angelus Silesius
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Prolog
Die Bestie ist frei. Lange genug hat sie im trüben Dunst schläfrigen Vergessens auf diesen Moment gewartet. Nun durchbricht sie die straffe Hülle sorgsam trainierter Beherrschtheit und erhebt sich brüllend über jede Vernunft. Sie hat nichts vergessen und badet ihren Wirt in schweißtreibenden Erinnerungen. „Die Rache ist dein“, flüstert sie lockend, „mache dich bereit.“
Er unterwirft sich.
Mit größtmöglicher Umsicht beginnt er zu planen, denn er benötigt ein ausgefeiltes Konzept, um seine Vorstellung zu verwirklichen.
Was ist sein Ziel?
Wie erreicht er es?
Wie rechtfertigt er seine Auswahl, um frevlerische Willkür zu vermieden?
Wie kann er die Bestie ins richtige Licht rücken?
Indem er ihr einen Namen gibt: GOTT. Mit der Namensfindung erschließt sich ihm zugleich seine Berufung. Er ist bereit und die Rache ist seine persönliche Zugabe.
„Mache deinen Weg zu deinem Ziel“, ermuntert ihn sein Gott, „verbinde die zwei Seelen in deiner Brust und du wirst beide zufriedenstellen.“
Er ist seinem Gott überaus dankbar für dessen wohlwollendes Verständnis, wodurch sich ihm eine Palette schillernder Möglichkeiten eröffnet. Er vermag die Sünde sowohl ins gleißende Licht der Offenbarung zu zerren, als auch für seine persönliche Inszenierung zu nutzen.
Allerdings entwickelte sich die Suche nach dem passenden Stilmittel für seine angestrebte Botschaft zu einer ermüdenden Herausforderung. Nur widerwillig hatte er sich durch zahlreiche Thriller um rituelle Tötungsdelikte gelesen, da er Trivialliteratur verabscheut. Als er endlich fündig geworden zu sein glaubte, sah er sich mit der diffizilen Aufgabe konfrontiert, die ausschweifende schriftstellerische Fiktion, handwerklich korrekt umzusetzen. Hierzu verfeinerte er sein laienhaftes Wissen mittels fundierter medizinischer Fachliteratur und wähnte sich schon bald bereit.
Dummerweise kam es zu einer nicht enden wollenden Verkettung dilettantischer Fehler, für deren Korrektur zahlreiche herrenlose Hunde und Katzen ihr kümmerliches Leben lassen mussten. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis trieb ihn an den Rand der Verzweiflung, aber er gab nicht auf.
Er gibt niemals auf!
Nun endlich glaubt er sich bereit für den nächsten, den entscheidenden Schritt. Zufrieden betrachtet er den metallenen Tisch sowie die bereitliegenden Instrumente. Bei ihrem Anblick durchpulst ihn ekstatische Vorfreude und er realisiert entzückt, wie ihm ein überaus köstliches Prickeln die Wirbelsäule hoch kriecht.
Seine erste menschliche Probandin wartet, an Händen und Füßen gefesselt, im Raum nebenan. Sie ist eine Ungläubige. Das macht sie für ihn zu einem bedenkenlos nutzbaren Objekt, ohne dass sie unmittelbar von der körperlichen Sünde befallen zu sein braucht. Ihrer habhaft zu werden war einfach, aber unschön gewesen. Auch in diesem Punkt muss er sein Vorgehen optimieren, da es voraussichtlich nicht bei diesem ersten Versuch am menschlichen Körper bleiben wird.
Noch hadert er mit seiner Vorgehensweise. Soll er sie vorher erlösen, oder sie die volle Pein ertragen lassen, so wie er es für seine künftig zu läuternden Sünderinnen vorgesehen hat? Er grinst verschlagen. Er wird ihr die Wahl überlassen.
Die Augen der gefesselten und geknebelten Frau spiegelten nackte Angst. Sie weiteten sich panisch, als sie ihren Peiniger betrachtete. Er trug einen vergilbten Kittel unter einer grünen, bodenlangen Gummischürze, Einweghandschuhe sowie schwarze Gummistiefel. Der überwiegende Teil seines Gesichts wurde durch einen Mundschutz verdeckt. Seine Augen musterten sie kalt – eiskalt.
Was würde dieser Mann ihr antun? Sie versuchte zu schreien, doch der Knebel steckte fest in ihrem Mund. Nur ein ersticktes Murmeln drang durch ihn hindurch.
Der Mann beugte sich zu ihr herunter und sah sie eindringlich an. „Wenn du dir unnötige Schmerzen ersparen willst, küsst du diese Bibel“, flüsterte er und hielt ihr ein abgegriffenes Exemplar der heiligen Schrift vor das Gesicht. „Wenn du als Ungläubige sterben willst, wird es sehr, sehr weh tun. Du entscheidest.“
Sie versteifte sich, als er sie kraftvoll packte und in den angrenzenden Raum trug. Vor Anstrengung keuchend warf er sie auf den rostig fleckigen Metalltisch. Ihr Kopf schlug gegen eine vorstehende Kante und der Schmerz explodierte hinter ihren Augen. Sie blinzelte. Beim Anblick der chirurgischen Instrumente auf dem Rollwagen neben dem Metalltisch schüttelte sie ultimatives Entsetzen und Panik badete ihren Körper schlagartig in kaltem Schweiß. Die Erkenntnis, dass sie hier und jetzt sterben würde, durchschnitt ihr Herz, noch bevor eine der Klingen ihre Haut berührt hatte. Sie dachte an ihre Kinder, ihren Mann und all die Dinge die ungesagt und ungetan bleiben würden. Sie weinte.
Der Mann zog den Mundschutz herunter und betrachtete sie teilnahmslos. „Also“, fragte er beinahe freundlich, „was soll´s denn nun sein? Schneller Tod oder qualvolles Verbluten?“ In seiner rechten Hand hielt er die Bibel hoch, in seiner Linken ein, im Licht der Deckenlampe, blitzendes Skalpell.
Sie wählte das Buch.
Er legte Skalpell und Buch auf ihren Bauch und zog ihr behutsam den Knebel aus dem Mund.
Sie wimmerte.
„Schschsch“, mahnend legte er den Zeigefinger an seinen Mund und sie verstummte.
Sein Gesicht verschwamm hinter einem Tränenschleier und als er die Gegenstände wieder von ihrem Bauch nahm, schloss sie ergeben die Augen.
Er presste den Buchrücken fest auf ihre Lippen, während das Skalpell durch ihre Kehle schnitt.
Konzentriert öffnet er den Leib von den Rippen bis zum Schambein. Das austretende Blut läuft wie geplant über die dafür angelegten Rillen des Tisches in eine darunterliegende Plastikwanne. Irritiert betrachtet er das reichlich vorhandene Fettgewebe. Es versperrt ihm die Sicht. Diese Behinderung hat er nicht einkalkuliert, seine Versuchstiere waren erbärmlich mager gewesen. Angewidert arbeitet er sich durch die gelbliche Masse. Er schneidet unpräzise, verletzt größere Gefäße. Das austretende Blut sickert in den geöffneten Bauchraum. Jetzt kann er nichts mehr sehen. „Ruhig bleiben“, ermahnt er seine protestierende Geduld, „irgendwann hört es auf.“ Er setzt einige unüberlegte Schnitte, damit das Blut schneller abfließen kann und perforiert dabei mehrfach die metallisch schimmernden Darmschlingen. Angesichts der übelst stinkenden Sauerei kämpft er heroisch gegen den würgenden Brechreiz an. Er atmet flach und spült die Bauchhöhle mit Wasser aus einer bereitstehenden Plastikgießkanne, bis sie ihm einigermaßen gereinigt erscheint.
Sein Atem beruhigt sich, sein Gehirn arbeitet wieder im vertrauten Modus. Er beginnt, die einzelnen Organe zu entfernen und in Gefrierbeutel zu packen. Diese wirft er in eine Plastikwanne. Er wird sie später zusammen mit der Leiche entsorgen.
Die Organe innerhalb des Brustkorbs interessieren ihn nicht, also belässt er sie an Ort und Stelle und sucht nach den Objekten seiner geplanten Reinigung, dem Uterus und den Ovarien. Die Eierstöcke hat er sich deutlich größer und von innen hohl vorgestellt. Sein grandioses Vorhaben, sie mit kleinen Puppenköpfen zu füllen, kann er vergessen, was ihn maßlos ärgert. Ein wichtiger Aspekt seiner Botschaft gründet gerade in diesem Detail. Jetzt muss er sich eine Alternative einfallen lassen. Wenigstens gelingt es ihm, den Uterus so zu öffnen, dass der Blick auf den Gegenstand möglich sein wird, den er, wenn auch nicht heute, einzuführen plant. Allerdings wird er auch diesen in seinen Ausmaßen beträchtlich verkleinern müssen. Er schnauft missgelaunt und sein, nach Perfektion strebenden Anspruch verkümmert in dieser Erkenntnis. Die auflodernde Wut explodiert in einem frustrierten Schrei. Schweiß tropft ihm von der Stirn ins rechte Auge, doch er versagt es sich gerade noch rechtzeitig, diesen mit seiner besudelten Hand wegzuwischen. Er reißt sich die Gummihandschuhe von den Händen und stürzt zum Waschbecken. Das Wasser kühlt seinen Zorn, doch seine anfängliche Euphorie verpufft in dumpfem Groll. Übellaunig sieht er sich um. Was für ein Desaster! Sein Arbeitsraum gleicht einem Schlachthaus. Er wird Unmengen an Zeit aufwenden müssen, um die blutige Schweinerei zu beseitigen. Notgedrungen macht er sich an die Arbeit und beobachtet verbittert, wie die Spuren seines Versagens im Ausguss verwirbeln.
1
Zwei Monate zuvor
Das stattliche Haus schmiegte sich an die Flanke einer langgestreckten Anhöhe. Die in einem weiten Bogen geschwungene Auffahrt führte vom Pförtnerhaus den Hügel hinauf, bis in den Innenhof der Villa. In ihrem Verlauf wurde sie von üppigen Rhododendronbüschen, turmhohen Linden, Eichen und Kastanien flankiert. Durch ihre mächtigen Stämme hindurch fiel der Blick auf den, in Terrassen angelegten, Blumengarten.
Der gepflasterte Innenhof war auf drei Seiten von Gebäuden umschlossen. Rechts neben der Auffahrt lagen die ehemaligen Stallungen, die inzwischen zu Garagen umgebaut worden waren, daran schloss sich an der Stirnseite das Gesindehaus und links das Haupthaus mit seiner weit geschwungenen Freitreppe an. In der Mitte des Hofes umrahmten Rosenbüsche einen stillgelegten Brunnen.
Doktor Ernst-Wilhelm Friedmöller, hatte vor einhundertfünfzig Jahren auf einer seiner Reisen durch Großbritannien das Gegenstück dieses Hauses entdeckt, dessen Proportionen in Skizzen festgehalten und, wieder in der Heimat, seinen Architekten mit dem Nachbau beauftragt. Seither thronte Haus Friedmöller, wie man die imposante Villa schlicht nannte, auf der Anhöhe über dem Tal, mit der Kleinstadt zu ihren Füßen.
Mit seinen sieben Schlafzimmern, fünf Bädern, einer Bibliothek, drei Salons, einem Esszimmer und einem Wintergarten, bot das Haus stets mehreren Generationen ein komfortables Heim, sowie einen Zufluchtsort vor den Widrigkeiten des Lebens. Sein Herzstück bildete die imposante Eingangshalle die sich, je nach Anlass, sogar in einen Ballsaal verwandeln ließ. Von hier führte eine geschwungene Treppe in die obere Etage und ins Dachgeschoss.
Im Gesindehaus beanspruchten die große Küche und die daran anschließenden Vorratsräume nahezu das gesamte Erdgeschoss. Eine eigene Dienstbotentreppe mit separatem Treppenhaus, gestattete dem Personal den Zuritt zum Haupthaus, ohne das Portal oder die Eingangshalle benutzen zu müssen.
Es war Weihnachten. Seit dem Vormittag wirbelten dichte Flocken aus einem blassgrauen Himmel, und überzogen den gefrorenen Boden mit einer pulvrig weiß Decke.
Carola Friedmöller hängte die letzten goldenen Kugeln in die drei Meter hohe Blautanne, die die Eingangshalle dominierte. Zufrieden betrachtete sie ihr Werk.
Franz Pahlke, Hausmeister, Gärtner und auch Pförtner, trug die hohe Leiter hinaus, mit deren Hilfe er die Spitze der Tanne dekoriert hatte. Seine Frau Renate deckte im angrenzenden Esszimmer den ausladenden Tisch mit dem guten Porzellan ein, das nur zu besonderen Anlässen aus der Vitrine geholt wurde.
Carola freute sich auf die Feiertage, führten sie doch die Familie wieder einmal zusammen. In diesem Jahr würde ihnen Marlene zudem ihren neuen Freund vorstellen und Carola wünschte ihrer Schwägerin von Herzen, endlich dem passenden Mann begegnet zu sein, damit sie ihre fragwürdige Karriere als Schauspielerin in unseriösen Erotikfilmen beenden konnte. Vielleicht würde dadurch auch Caroline, Carolas jüngste Tochter, in den Schoß der Familie zurückfinden. In den vergangenen drei Jahren hatte sie sich dem Einfluss ihrer Eltern bedauerlicherweise gänzlich entzogen. Unmittelbar nach ihrem sechzehnten Geburtstag, hatte sie die Schule geschmissen und war zu ihrer Tante Marlene nach Köln gezogen. Weder gutes Zureden noch Drohungen hatten sie von ihrem Entschluss abbringen können. Gesegnet mit einem perfekten Körper und dem Gesicht eines Engels, fasste Caroline in der Branche der Tante schnell Fuß und nannte sich fortan Schauspielerin.
Amelia Friedmöller, Carolas Schwiegermutter, betrat die Halle. „Sehr schön, meine Liebe“, lobte sie mit einem anerkennenden Blick auf die riesige Tanne, „wie in jedem Jahr einzigartig.“
„Danke, Mutter“, freute sich Carola über Amelias Lob.
„Wie spät ist es denn?“, wollte Amelia wissen, „und wann kommen die Kinder?“
„Es ist halb drei, Mutter, und Paul ist bereits da. Er macht sich nur noch etwas frisch und wird dich dann sofort begrüßen“, entschuldigte Carola ihren Sohn, als sie den missbilligenden Ausdruck in Amelias Gesicht wahrnahm. „Charlotte und Robert sollten in der nächsten Stunde eintreffen. Marlene, Caroline und Marlenes Freund im Verlauf des Nachmittags.“
„Nun, ich hoffe doch, dass zur Bescherung um achtzehn Uhr, alle anwesend sein werden. Wie spät ist es jetzt?“
„Halb drei, Mutter.“
„Sind Ernst-August und Ernst-Ludwig schon aus dem Wald zurück? Sie wollten spätestens um fünfzehn Uhr wieder hier sein.“
„Nein, noch nicht, aber auch sie werden bestimmt pünktlich sein.“ Carola schloss für einen Moment die Augen, um sich zu sammeln. Bleib ruhig, ermahnte sie sich. Ihre Schwiegermutter erforderte täglich mehr Geduld. Amelia begegnete der fortschreitenden Altersdemenz zunehmend unflexibel und organisierte die Tage in minutiösen Zeitabläufen.
„Kaffeetrinken exakt um sechzehn Uhr“, beharrte Amelia. „Wie spät ist es jetzt? Hat Renate schon gedeckt?“
„Sie ist dabei, Mutter, es ist ja erst halb drei.“
„Ich überzeuge mich doch lieber selbst, ob sie auch das richtige Porzellan genommen hat“, entschloss sich Amelia.“
„Mach das, Mutter, ich werde mich derweil umziehen.“
Carolas Flucht in die obere Etage wurde jedoch von ihrem Sohn Paul vereitelt, der genau in diesem Moment die breite Treppe herunter schlenderte. „Hallo Oma“, er umarmte seine Großmutter flüchtig und drückte ihr andeutungsweise einen Kuss auf die Wange.
„Guten Tag, mein Junge“, freute sich Amelia, „was macht das Studium?“
Paul verdrehte die Augen. „Oma, es ist Weihnachten, können wir da berufliche Dinge ausnahmsweise mal ausblenden?“
„Warum sollten wir das tun, Paul?“, wunderte sich Amelia, „gibt es in deinem Leben denn etwas Wichtigeres, als deine Zukunft?“
„Nein Oma, natürlich nicht“, lenkte er ein.
„Na siehst du“, lobte Amelia, „schließlich erwarten dein Großvater und dein Vater deinen baldigen Eintritt in die Klinik.“
„Sicher Oma“, Paul versagte sich eine Richtigstellung und entfloh Richtung Bibliothek. Seine Großmutter wollte partout nicht realisieren, dass er sein Medizinstudium nach dem zweiten Semester abgebrochen hatte und, trotz des entrüsteten Unverständnis seiner Familie, zur Theologie gewechselt war.
Draußen fuhr ein Wagen vor.
„Das werden Charlotte und Robert sein“, freute sich Carola und eilte zur Haustür.
Schneeflocken wirbelten zusammen mit ihrer Tochter und deren Mann herein und verflüssigten sich sofort in der behaglichen Wärme des Hauses. „Hallo Mama, hallo Oma, frohe Weihnachten.“ Charlotte umarmte die beiden Frauen voller Herzlichkeit.
„Hallo, mein Schatz, grüß dich Robert. Hattet ihr eine gute Fahrt?“ Carola drückte ihre Tochter fest an sich.
„Die Straßen sind weitgehend frei“, antwortete Robert und reichte den Frauen die Hand zum Gruß.
Charlotte rubbelte sich die feinen Tröpfchen der geschmolzenen Flocken aus den dunklen Haaren. „Sind Opa und Papa noch im Wald?“
„Ja, sie bringen, wie in jedem Jahr an Heiligabend, die von den Schulkindern gesammelten Eicheln und Kastanien zur Wildfütterung, aber sie sollten bald zurück sein. Tragt eure Sachen nach oben und dann machen wir es uns gemütlich. Ich freue mich so, dass ihr da seid.“
Seit Charlotte während ihres Medizinstudiums überraschend den Rechtsanwalt Robert von Haff geheiratet hatte, fand sie nur noch selten den Weg ins Elternhaus. Hin und wieder trafen sich Mutter und Tochter zu einem Einkaufsbummel in Münster, doch die einst so innige Verbundenheit zwischen Charlotte und ihrer Familie war einer freundlich-höflichen Distanz gewichen, seit sich Ernst-Ludwig vehement gegen die Heirat seiner Tochter ausgesprochen hatte. Er wähnte diese Ehe von vorne herein zum Scheitern verurteilt. Spätestens nach Charlottes Eintritt in die familieneigene Privatklinik für kosmetische Chirurgie, würden die Probleme eskalieren. Zwischen dem Wohnort der von Haffs und der Klinik der Friedmöllers lagen einhundertdreißig Kilometer und in einem Krankenhaus bestimmten fließende Arbeitszeiten und Bereitschaftsdienste den Alltag. Einen Umzug lehnte Robert jedoch rigoros ab, da er als Anwalt in der Kanzlei seines Vaters arbeitete und diese zu gegebener Zeit übernehmen würde.
Das konnte auf Dauer nicht gut gehen.
Pünktlich um sechzehn Uhr servierte Renate Pahlke den Kaffee zum traditionellen Frankfurter Kranz. Die Kölner waren noch nicht eingetroffen, was Amelia mit einem unmissverständlichen Stirnrunzeln quittierte.
Ernst-August und Ernst-Ludwig hingegen genossen die friedliche Stimmung vor dem unvermeidlichen Sturm. Beide waren im Vorfeld wenig begeistert gewesen, dass Marlene ausgerechnet an Weihnachten einen wildfremden Mann eingeladen hatte, doch ihr Veto war kläglich an Amelias Machtwort zerschellt. Wenn es um ihre Tochter Marlene ging, verweigerte die alte Dame jede Einsicht. Stoisch leugnete sie Marlenes unseriösen Geschäfte und ignorierte kategorisch deren Eskapaden.
Amelia hatte ihre zweitgeborenen Söhne, die Zwillinge Paul-Ernst und Karl-Friedrich, kurz nach deren achtzehnten Geburtstag, durch einen Autounfall verloren, als die beiden eine heimliche Spritztour mit dem neuen Wagen des Vaters gemacht hatten. In ihrer grenzenlosen Trauer fokussierte Amelia fortan ihre alles verschlingende Mutterliebe auf ihre jüngste Tochter, woraufhin Marlene, unmittelbar nach dem Schulabschluss, aus dem Elternhaus floh.
Amelias Erstgeborener Ernst-Ludwig erfüllte pflichtbewusst alle in ihn gesetzten Erwartungen, schloss sein Medizinstudium Summa cum laude ab, heiratete standesgemäß, zeugte drei Kinder, darunter auch den erwarteten Sohn und Erben und übernahm die Leitung der Klinik, nachdem sich sein Vater in den Ruhestand zurückgezogen hatte. Doch so sehr er sich auch bemühte, im Herzen seiner Mutter spielte er nie die Hauptrolle. Die war ausschließlich seiner Schwester vorbehalten.
Zwischen Buttercreme und Abendessen flatterte Marlene Friedmöller, schillernd wie ein Paradiesvogel, in die familiäre Runde. Ihr pinkfarbener Seidenkaftan, wetteiferte mit der silbernen hautengen Leggins um Aufmerksamkeit. Caroline präsentierte sich in einem provozierend knappen schwarzen Stretchkleid mit breitem roten Lackgürtel, schwarzen, blickdichten Strümpfen und roten Lackpumps.
Ernst-August sog hörbar die Luft ein und Ernst-Ludwig räusperte sich indigniert. Paul musterte die Frauen finster und Robert von Haff starrte scheinbar desinteressiert aus dem Fenster.
Carola schloss ihre Jüngste jedoch überschwänglich in die Arme. „Frohe Weihnachten, mein Liebling, und danke, Marlene, dass du sie mir zum Fest nach Hause gebracht hast. Ich sehe sie ja nur noch so selten.“
„Nichts zu danken, liebe Schwägerin“, flötete Marlene und genoss ihren spektakulären Auftritt. Ein amüsiertes Lächeln umspielte dabei ihre Mundwinkel. Das peinlich berührte Schweigen der Männer und die gluckenhafte Toleranz ihrer Mutter und ihrer Schwägerin waren bezeichnend für diese Heilewelt-Inszenierung. Wie berechenbar sie doch alle waren. „Euch allen ein frohes Fest“, rief sie aufgesetzt fröhlich in die Runde, „der böse Schnee ist Schuld an unserer kleinen Verspätung, und dass wir überhaupt heil angekommen sind, verdanken wir unserem überaus besonnenen Chauffeur.“ Sie hakte sich bei dem bulligen Mann ein, der im Türrahmen stehen geblieben war und zog ihn in den Salon. Sein weißer Anzug zu dem schwarzen Seidenhemd mit einer blutroten Krawatte, war nicht minder exzentrisch als das Outfit der ihn begleitenden Damen. „Darf ich euch meinen Freund und Geschäftspartner Giorgio Amato vorstellen“, strahlte Marlene und die Familie erhob sich formell zur Begrüßung des Gastes.
Marlene zwinkerte Caroline verstohlen zu. Die angestrebte Wirkung war unübertrefflich und die konsternierte Empörung verbarg sich nur notdürftig hinter den verbindlich starren Gesichtszügen ihrer bigotten Sippschaft.
Welch überaus gelungene Bescherung.
2
„Und dann hast du ihm die Lampen ausgeschossen?“, fragte Bernd Berger gespannt.
„Nun, er hat mir keine Wahl gelassen“, antwortete Kommissar Frank Richter verhalten und schielte zu seinem Freund, Hauptkommissar Uwe Berger, hinüber.
„Er hat ihm die Hufe hochgeklappt“; bestärkte Kai Berger seinen Bruder Bernd.
„Jungs, es reicht“, griff Uwe Berger ein, „es ist Weihnachten. Das ist, wie ihr wisst, das Fest der Liebe – der Nächstenliebe.“
„Manno“, maulte Kai, „immer wenn es spannend wird, blockst du ab. Wenn ich erst bei der Kripo bin, werde ich auch verdeckter Ermittler, genau wie Frank.“
„Aber bis dahin hörst du auf deinen Vater.“ Anne Berger stellte den goldbraun knusprigen Truthahn mitten auf den festlich gedeckten Tisch. Dann reichte sie ihrem Mann das Tranchierbesteck. „Ans Werk, Herr Hauptkommissar“, forderte sie ihn auf, „Flügel für die Jungs, Schenkel für die Männer und ein Stückchen Brust zu mir“, lachte sie fröhlich.
In perfekter Harmonie mit dem Rotkohl und den Klößen, entfachte der Truthahn nach dessen Verzehr, ein sattes Wohlbehagen, das noch von einem Vanilleeis mit heißen Kirschen gekrönt wurde.
„Anne, das war einfach köstlich“, bedankte sich Frank Richter bei der Frau seines Freundes.
„Ein wahrer Festtagsschmaus“, bestätigte Uwe, „ein Hoch auf die Köchin.“
Anne lächelte glücklich. „Möchtet ihr Schmeichler noch einen Kaffee zum Abschluss?“
„Nein danke, mein Schatz“, lehnte Uwe Berger liebevoll ab, „wir tendieren zu etwas Gehaltvollerem.“ Zwinkernd deutete er auf die Flasche mit dem erlesenen französischen Cognac, den Frank mitgebracht hatte.
„Den habt ihr euch auch redlich verdient“, zwinkerte Anne. „Kommt, Jungs“, forderte sie ihre Söhne auf, „wir lassen die Herren Kommissare ihr Schnäpschen genießen und probieren das neue Gesellschaftsspiel aus, das ihr von Frank bekommen habt.“
Die Männer machten es sich vor dem Kamin bequem. Emotionslastige Monate rund um einen verworrenen Fall lagen hinter ihnen. Um ein Haar wäre es Frank Richters letzter Einsatz gewesen. Doch im entscheidenden Moment hatte das Glück, wie schon so oft, seine schützende Hand über ihn gehalten. Das besinnliche Weihnachtsfest mit seiner neuen Freundin Iris und der heutige Abend mit der Familie seines Freundes, bildeten nach all den Turbulenzen einen verdient versöhnlichen Jahresabschluss.
„Erzähl, wie war deine Verabredung mit meiner Sekretärin“, stichelte Uwe.
„Überwältigend“, neckte Frank, „ich glaube, ich konnte sie dir erfolgreich abwerben.“
„Untersteh dich“, brummte Uwe, „Iris Haupt ist tabu für dich. Du unverbesserlicher Schürzenjäger wirst ihr nicht das Hirn vernebeln und sie der langen Liste deiner Eroberungen hinzufügen.“
„Darf ich dich an deine Empfehlung erinnern, mir endlich eine dauerhafte Partnerin zu suchen und das Vagabundieren aufzugeben.“
„Als ob du auf mich hören würdest“, lachte Uwe.
„Und wenn doch?“ Frank drehte versonnen den Cognacschwenker zwischen den Fingern.
Sein Freund beugte sich alarmiert nach vorne. „Heißt das, du willst ernsthaft sesshaft werden, und dann auch noch mit meiner Sekretärin?“
„Ich denke zumindest ernsthaft darüber nach“, bestätigte Frank grinsend. Genüsslich leerte er sein Glas und lehnte sich entspannt zurück. „Du hast ja Recht, Uwe“, sinnierte er, „ich werde langsam zu alt für dieses Lotterleben, und während meiner Zeit in der Klinik habe ich erkannt, wie sehr mir eine Frau an meiner Seite fehlt. Iris war jeden Tag da und seither wünsche ich mir, dass sie der ruhende Pol in meinem unsteten Leben wird, zu dem ich nach Hause kommen, und bei dem ich mich auch mal fallen lassen kann. Daher gedenke ich sie zu fragen, ob sie mein weiteres Leben mit mir teilen möchte.“
„Du willst sie heiraten?“ Uwe kam aus dem Staunen nicht heraus. „Der größte Casanova der Region will sich offiziell binden. Wenn das kein Weihnachtswunder ist.“ Er griff nach der Cognacflasche und schenkte ihnen noch einmal nach.
„Ja, vorausgesetzt, sie will mich“, zwinkerte Frank dem Freund zu. „Wie hast du es so trefflich formuliert? Eine ehrbare Frau, die einen Windhund wie dich nimmt, findest du nicht an jeder Ecke!“
„Und da hast du dir gedacht, nehme ich einfach die aus Uwes Büro“, schlussfolgerte Uwe Berger grinsend, „und was mache ich jetzt ohne die Haupt?“
„Sie bleibt dir als Sekretärin erhalten, Uwe, es ändert sich lediglich ihr Familienstand, den du hoffentlich als mein Trauzeuge beglaubigen wirst.“
„Du meinst es tatsächlich ernst“, erkannte Uwe immer noch verblüfft. Dann stand er auf und umarmte seinen Freund. „Das ich das erleben darf“, stichelte er lachend. „Anne, komm her und bring bitte den kaltgestellten Sekt mit, es gibt noch etwas zu feiern“, rief er nach seiner Frau.
„Auf unseren ehemaligen Casanova und die Frau, die ihn zu bändigen verstand“, brachte Uwe einen Toast aus und erhob sein Glas.
„Langsam, langsam“, bremste Frank, „ich habe Iris ja noch gar nicht gefragt.
„Wann gedenkst du ihr denn den Antrag zu machen?“, fragte Anne.
„Sobald ich aus Schottland zurück bin“, sagte Frank.
„Du fährst nach Schottland? Habe ich da etwas verpasst?“ Uwe Berger hatte sich wieder in den Sessel fallen lassen und sah überrascht zu seinem Freund auf, der immer noch neben Anne stand.
„John und Sophia haben mich über Silvester eingeladen“, erklärte Frank, „John hat angeblich einen brisanten Hinweis auf unsere verschollenen Blutbilder, wollte am Telefon aber nicht mehr dazu sagen.“
„John Arden bleibt uns offenbar verbunden“, resümierte Uwe nachdenklich.
„Wir waren ihm gegenüber ja auch äußerst kulant.“
„Wann fliegst du?“
„Ich fahre morgen los. Ich nehme die Fähre und sehe mir bei der Gelegenheit das Land an.“
„Fast wünschte ich, ich könnte dich begleiten“, räumte Uwe ein, „nur um zu sehen, wohin es den Schotten und Sophia Lorenz verschlagen hat.“ Er prostete seinem Freund zu. „Grüß die beiden von mir, auch wenn mir John Arden nach wie vor suspekt ist“, beauftragte er seinen Freund.
„Ich werde ihm deine innigsten Grüße ausrichten“, ulkte Frank grinsend, „John wird zutiefst betrübt sein, dass du es bedauerlicherweise nicht möglich machen konntest.“
„Das ist die unverfrorenste Übertreibung des endenden Jahres“, lachte Uwe.
3
Charlotte Friedmöller blickte wehmütig in den tief verschneiten Garten, der wie in Kaskaden den terrassenförmig angelegten Hang hinab wogte; im Sommer ein farbenprächtiges Blumenbild, jetzt eine märchenhafte Winterlandschaft. Das Licht des vollen Mondes ließ die Schneekristalle wie Diamanten blitzen.
Noch immer spürte sie einen Hauch der tiefen Verbundenheit mit diesem Haus, das in Kindertagen ihre Burg und Festung gewesen war. Die Entfremdung hatte eingesetzt, als ihr die hochgesteckten Erwartungen ihrer Familie die Luft abzuschnüren begannen. Dennoch hatte sie diese wunschgemäß erfüllt. Sie hatte sowohl ihr Medizinstudium als auch ihre Zeit als Assistenzärztin erfolgreich abgeschlossen. Lediglich ihre frühe Ehe mit Robert hatte nicht ins Familienkonzept gepasst. Doch diese Abweichung war ein Witz im Vergleich zu den Kapriolen ihrer Geschwister. Paul der Versager und Caroline die Hure! Charlotte kam nicht umhin, ihre sittenlose jüngere Schwester so zu bezeichnen. Mit Schaudern dachte sie an deren provokanten Auftritt am Heiligabend. Was war nur aus diesem einst so entzückenden Kind geworden?
Paul hingegen positionierte sich als selbsternannter Moralapostel, der sein klägliches Versagen mit auswendig gelernten Bibelzitaten zu rechtfertigen versuchte.
Dennoch würde der Aufschrei der Entrüstung ihr gelten, wenn sie die Familie heute mit ihrer Entscheidung konfrontieren würde, ab Januar in der Gerichtsmedizin, statt in der familieneigenen Klinik, zu arbeiten. Vater würde ausrasten. Er rechnete nach Pauls gedankenloser Abkehr von dessen Erbpflicht, fest mit Charlotte als Lückenbüßer. Niemand in dieser Familie käme auf die Idee, dass sie selbst das möglicherweise anders sehen könnte, denn genau, wie seinerzeit ihr Vater, war sie als einzige Wahl übriggeblieben. Ihre Geschwister waren rechtzeitig ausgestiegen.
In einem der Gästezimmer verfolgte Giorgio Amato vom Bett aus den wirbelnden Tanz der Schneeflocken. Seine Finger spielten dabei mit einer von Marlenes blondierten Locken. Sie schlummerte ermattet an seine Brust, nachdem sie sich gegenseitig exzessiv befriedigt hatten.
Giorgios Gefühle für Marlene waren widersprüchlich. Er hatte mit dieser Frau fraglos ein großes, wenn auch nicht das ultimative Los gezogen. Dazu war sie mit fünfundfünfzig bedauerlicherweise zu alt. In absehbarer Zeit würde ihre attraktive Erscheinung Risse bekommen. Falten hatte sie jetzt schon. Amato bevorzugte es jedoch jung und knackig.
Andererseits war Marlene, genau wie er selbst, überaus geschäftstüchtig und maßlos geldgeil, was sie für ihn wiederum reizvoll machte. Zudem war sie gut fürs Geschäft. Unter ihrer Führung florierte der Laden. Giorgio seufzte theatralisch. Das Leben war ein einziger beschissener Kompromiss.
Sinnierend betrachtete er Marlenes Profil auf seiner Brust. Ihre Nichte Caroline war ihr jüngeres Abbild. Bildschön und dazu hemmungslos nymphoman. Caroline kannte weder natürliche Scham noch sittliche Skrupel. Ihre Tabu freien Filme versprachen Blockbuster in der Erotik-Szene zu werden.
Für seine anstehenden Produktionen suchte Giorgio derzeit nach einer außergewöhnlichen Kulisse und genau die hatte ihm Marlene mit der Villa ihrer Familie in Aussicht gestellt. Nur deshalb war er hier.
Seine entsprechend hohen Erwartungen hatten allerdings, seit seinem Eintreffen, einen erheblichen Dämpfer erfahren. Das repräsentative Anwesen der Friedmöllers imponierte ihm in dem Maße, wie ihn der Rest der Familie anödete. Die versnobte Sippschaft schien ungewöhnlich fest auf diesem Flecken Erde verwurzelt zu sein. Es stand daher zu befürchten, dass er sich an den Herren Friedmöller unschön die Zähne ausbeißen könnte, sollte er versuchen, ihnen ihr Familiendomizil zu entwenden.
Stand der anstehende Aufwand noch in Relation zum praktischen Nutzen?
Wenn Charlotte, die hübsche aber unspektakuläre Erbin des Clans, in absehbarer Zeit das Ruder übernahm, dürfte es entschieden einfacher werden, sie mit einem nur schwer abzulehnenden Angebot zur Kooperation zu bewegen.
Den abtrünnigen Sohn des Hauses strich Amato aus seiner Kalkulation. Paul beschritt den Weg eines religiösen Eiferers, ständig bemüht, sein unstrittiges Versagen mit seiner Glaubensfindung zu rechtfertigen. Er war ein scheinheiliger Kotzbrocken, aber langfristig kein ernstzunehmender Gegner. Giorgio hielt ihn zudem für schwul. Den Burschen umgab eine seltsame Aura. Auf Marlene und Caroline reagierte er fast schon feindselig. Wahrscheinlich hatte er nur Luft im Schwanz. Das waren die Schlimmsten. Aber Muttis Liebling!
Nachdenklich strich Giorgio über seine wuchsfreudigen Bartstoppeln. Er würde Prioritäten setzen müssen, was die Reihenfolge seiner Expansionspläne anging.
Die Suche nach einem repräsentativen Rahmen für seine Filmproduktion war von großer Bedeutung, aber nicht akut relevant.
Sein vorrangiges Interesse galt nach wie vor den Fliehenden Pferden, einem umstrittenen Gemälde des obskuren russischen Malers Olgin Sasnikov. In Verbindung mit zwei weiteren Bildern des Künstlers, versprach es einen mehrstelligen Millionengewinn. Um dieses, als Blutbilder bekannte Tripple, rankten sich bizarre Gerüchte und diverse Leichen.
Die Fliehenden Pferde galten jedoch als verschollen und der Schwarzmarkt überbot sich mit astronomischen Offerten für das Sasnikov-Tripple. Die beiden kleineren Bilder waren bereits in seinem Besitz und Giorgio hatte alle verfügbaren Mitarbeiter auf die Suche nach dem Herzstück des Trios ausgesandt. Für ihn stellte sich nicht die Frage ob, sondern wann seine Männer fündig werden würden. Je mehr Zeit jedoch erfolglos verstrich, umso unleidlicher wurde Giorgio, denn Zeit war Geld. Sein Geld!
4
„Das könnt ihr nicht machen!“ Aufgebracht lief Paul Friedmöller in der Bibliothek auf und ab. Alle Familienmitglieder, außer Amelia und Giorgio Amato, hatten sich dort eingefunden. Amelia hielt ihr obligatorisches Mittagsschläfchen und der Italiener machte einen Schneespaziergang.
„Können wir nicht?“, indigniert zog Ernst-Ludwig die Augenbraue hoch.
„Ich bin der einzig männliche Nachkomme und als solcher der Erbe dieses Anwesens“, erboste sich Paul.
„Du bist der letzte männliche Nachkomme unseres Namens“, korrigierte ihn sein Vater, „und als künftiger Pfaffe wirst du das auch bleiben. Oder wurde das Zölibat zwischenzeitlich abgeschafft?“, fragte er zynisch.
„Außerdem wirst du dorthin gehen müssen, wo Mutter Kirche dich hinschickt, mein Junge“, pflichte Ernst-August seinem Sohn bei. „Was willst du zudem als alleinstehender Geistlicher mit einem derart großen Haus anfangen? Ich bin ebenfalls dafür, dass Charlotte es, samt ihrer künftigen Kinderschar, mit Leben füllt.“
„Wenn sie die Klinik übernimmt, hat sie außerdem das Recht, hier zu wohnen“, unterstrich Ernst-Ludwig die Ausführung seines Vaters.
„Ich werde die Klinik nicht weiterführen“, sagte Charlotte.
Für einen Moment war es totenstill im Raum und alle wandten sich zu ihr um.
„Was hast du gesagt?“, fragte Ernst-Ludwig ungläubig. „Das war doch wohl ein Scherz.“
„Keineswegs, Papa“, antwortete Charlotte ruhig. „Ich habe nicht Medizin studiert, um mein Leben lang Brüste aufzupeppen oder Fettpolster abzusaugen.“
„Ja klar“, höhnte Ernst-Ludwig verärgert, „du willst Menschenleben retten, den Krebs besiegen und ein Heilmittel gegen Aids finden.“
„Nein, Papa, ich werde den Opfern brutaler Verbrechen zu ihrem Recht verhelfen. Ab Januar arbeite ich in der Rechtsmedizin.“
„Charlotte, du wirst dort augenblicklich wieder absagen“, befahl Ernst-Ludwig rigoros, „ich gestatte solch einen Unsinn nicht!“
„Ich habe den Vertrag bereits unterschrieben“, entgegnete sie, scheinbar gelassen. Doch ihr Herz raste und ihr Magen flatterte.
„Ohne es vorher mit uns abzusprechen?“, wunderte sich Ernst-August.
„Wozu, Großvater? Eure Zustimmung hätte ich nie bekommen. Doch es ist mein Leben und ich bestimme, was ich damit mache. Hätte Paul sein Studium nicht geschmissen, um sich seiner religiösen Berufung zu verschreiben, hätte es keinen hier auch nur ansatzweise interessiert, in welche Richtung ich mich entwickle. Eure Aufmerksamkeit habe ich doch erst, seit ich als Lückenbüßer für meinen Bruder herhalten muss.“
„Charlotte, wir haben eine Klinik zu führen, deren Erbin du einst sein wirst“, mahnte Ernst-Ludwig gefährlich ruhig, „wir verhelfen Menschen zu einem vorteilhafteren Aussehen und schenken ihnen damit Lebensqualität. Leichen brauchen so etwas nicht mehr. Sie gehören in einen Sack und entsorgt. Tot ist tot, daran kannst auch du nichts mehr ändern und wirst daher deine Begabung nicht als Leichenfledderer vergeuden. Das dulde ich nicht. Wenn du den Arbeitsvertrag mit der Rechtsmedizin nicht rückgängig machen willst, werde ich mich persönlich um seine Auflösung kümmern.“
„Das wirst du nicht“, erboste sich Charlotte, „ich habe mich entschieden. Es ist mein Leben.“ Äußerlich immer noch beherrscht kreuzte sie trotzig den Blick des Vaters.
„Was soll dann aber aus der Klinik werden?“, wandte Carola ein, „du bist die Einzige, die sie weiterführen kann.“
„Genau das scheint deine Tochter nicht begreifen zu wollen“, schimpfte Ernst-Ludwig. „Sie tritt alles, was wir aufgebaut haben, mit Füßen.“
„Ach, und was hat Paul gemacht?“, wehrte sich Charlotte, aufbrausend. „Seine Abdankung wegen religiöser Hirngespinste wird stillschweigend hingenommen, während ich als Verräter gebrandmarkt werde?“
„Ich dulde nicht, dass du meinen Glauben und die heilige Mutter Kirche derart despektierlich abtadelst“, fuhr Paul seine Schwester an. „Wenn du an Gott und seine Allmacht glauben würdest, kämst du gar nicht auf die Idee, als Leichenschänder arbeiten zu wollen. Wir sollten nicht hinterfragen, was SEIN Wille ist.“
„Sagt ein ehemaliger Medizinstudent“, zischte Charlotte ihren Bruder an, „glaubst du wirklich, es ist Gottes Wille, wenn Menschen eines unnatürlichen Todes sterben?“
„Die Wege des HERRN sind unergründlich“, predigte Paul, „es steht dir nicht an, darüber zu urteilen.“
„Du spinnst doch“, kanzelte sie ihn ab, „verschone mich bitte mit deinem irrwitzigen Gefasel.“
„Kinder, bitte, es ist Weihnachten“, warf Carola flehentlich ein. Niemand beachtete sie.
„Ich bin sicher, wir finden eine, für alle Seiten zufriedenstellende Lösung, wenn wir die Situation in Ruhe analysieren“, brachte sich Robert in die Debatte ein. „Ich denke, Charlotte ist im Augenblick mit der Situation ein wenig überfordert. Ein Familienimperium dieser Größenordnung zu übernehmen, bedarf einer inneren Reife, die sie sich in den kommenden Jahren erst noch erarbeiten muss.“
„Hmm“, brummte Ernst-Ludwig.
Charlotte starrte ihren Mann verblüfft an. Seine Interpretation ihres Entschlusses hatte ihr die Sprache verschlagen.
„Ach du Scheiße“, spendete nun auch Marlene ihren Beitrag zu der Debatte.
„Also ich hätte nichts dagegen, das Haus zu übernehmen“, sagte Caroline.
„Lerne du erst einmal einen anständigen Beruf“, kanzelte ihr Vater sie ab.
„Pffft, vergiss es“, blaffte Caroline zurück.
„Es ist bezeichnend, wie ihr alle über mich verfügen zu können glaubt“, wehrte sich Charlotte. Ihre Stimme zitterte jetzt. „Mein Arbeitsverhältnis in der Rechtsmedizin beginnt am 2. Januar. Ich lasse mich nicht vor euren Karren spannen, nur weil der Sohn des Hauses machen darf, was er will. Hebe doch den Vertrag mit seinem Chef auf, Papa, und zwinge ihn zurück ins Medizinstudium. Ansonsten sucht euch einen Teilhaber für die Klinik oder verkauft sie. Ich jedenfalls stehe nicht zur Verfügung.“
Ernst-August erhob sich schwerfällig aus seinem Sessel. „Deine Tochter!“, zeterte er ungnädig zu seinem Sohn gewandt, „hast du eigentlich noch eins deiner Kinder im Griff? Bring ihr gefälligst Vernunft bei. Es reicht, dass du bei meinem nichtsnutzigen Enkel und deiner lasterhaften Jüngsten versagt hast.“ Auf seinen Stock gestützt verließ er, vor sich hin brummend, den Raum.
Ernst-Ludwig fuhr sich mit der Hand über die Augen. Mit einem Mal fühlte er sich unsagbar müde. Sein Vater hatte recht. Reichte es nicht, dass ihm Paul und Caroline entglitten, musste ihm nun auch noch Charlotte das Messer in den Rücken stossen? Er hatte es so satt. Wie unter Schmerzen stand er auf und trat vor seine älteste Tochter. Seine Miene war regungslos, sein Blick kalt. „Wenn du das tust“, sagte er leise, „wenn du das Vermächtnis unserer Familie tatsächlich ausschlägst, obwohl du in der Lage wärst, es fortzuführen, dann bist du in diesem Hause nicht länger willkommen.“
„Ernst-Ludwig!“, schrie Carola auf.
„Du bist still“, wies ihr Mann sie zurecht. „Ich hoffe, deine Tochter hat soviel Verstand, dass sie sich noch einmal überlegt, wo ihre eigentlichen Verpflichtungen liegen.“
Charlotte war aufgesprungen. Fassungsloses Entsetzen blockierte sekundenlang ihre Stimme. Sie räusperte sich und holte tief Luft. „Ich denke, dann haben wir uns vorläufig nichts mehr zu sagen“, konstatierte sie tonlos. „Robert, ich möchte bitte sofort aufbrechen.“
Peinlich berührt, verließ Robert von Haff zusammen mit seiner Frau die Bibliothek. Sein Verstand rotierte um Charlottes Offenbarung. Sie hatte sich in der Rechtsmedizin verpflichtet, ohne das vorher mit ihm abzusprechen? Er hätte es unbedingt vorgezogen, informiert zu sein und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Damit durchkreuzte sie gedankenlos seine eigenen Pläne und brachte ihn in eine überaus missliche Lage. Zudem brüskierte sie nicht nur ihre Familie, sondern seine gleich mit. Seine Eltern würden von dem Vorhaben ihrer Schwiegertochter ebenfalls entsetzt sein. Ein solches Erbe schlug man nicht für die Option aus, stinkende Leichen aufzuschneiden. Wie konnte sie ihm das nur antun? Seit wann war sie derartig dumm?
5
Nachdem Charlotte und ihr Mann gegangen waren, lastete die Ungeheuerlichkeit des Eklats schwer im Raum.
Carola schluchzte in ihr Taschentuch.
Paul hatte sich indigniert am Fenster postiert und starrte in den beständig fallenden Schnee.
Marlene füllte an der Bar zwei Gläser mit Cognac, eins für sich und eins für ihren Bruder. Betont lässig schlenderte sie zu ihm hin und drückte Ernst-Ludwig das Glas in die Hand. Wortlos nahm er es entgegen und leerte es sofort um die Hälfte.
Caroline räkelte sich provokant in dem ausladenden Sessel und ihre langen Beine baumelten lässig über der Armlehne. „Dann bekomme ich das Haus also doch?“, hakte sie nach, „bleibt ja sonst keiner mehr übrig.“
„Nur über meine Leiche, du peinliche Hure“, zischte ihr Bruder.
„Paul!“ Carola fuhr zu ihrem Sohn herum, „Sofort entschuldigst du dich bei deiner Schwester.“
„Warum sollte ich das tun?“ Angeekelt maß er Caroline mit einem abschätzigen Blick, „wir wissen doch alle, dass sie, ebenso wie Marlene, ihren Körper für Geld verkauft. Ob an Männer oder an die Werbung ist dabei völlig nebensächlich. In den Augen der Kirche ist das Hurerei.“
„Schweig“, brüllte Ernst-Ludwig, „es reicht.“
„Der Tag wird kommen, an dem ihr alle um Vergebung flehen werdet“, prophezeite Paul, „wenn die Verderbtheit, die diese Familie befallen hat, offen zutage tritt, werdet ihr um Gottes Gnade winseln.“
„Aber bis dahin hältst du dein bigottes Maul“, befahl Ernst-Ludwig rigoros. Es drängte ihn, alle hinauszuwerfen. Die offene Rebellion seiner Kinder raubte ihm seine gewohnte Gelassenheit. Er stürzte den Rest des Cognacs hinunter und trat an die Bar aus massivem Eichenholz. Seine Hände zitterten, als er sich nachschenkte.
„Und was jetzt?“ Ernst-August Friedmöller verharrte im Türrahmen und blickte fragend in die Runde. Nachdem Charlotte und Robert grußlos das Haus verlassen hatten, war der Senior in die Bibliothek zurückgekehrt.
„Keine Ahnung, Vater“, gestand Ernst-Ludwig bitter enttäuscht. „Das ausgerechnet Charlotte sich gegen die Familie stellt, hätte ich nie und nimmer für möglich gehalten.“
„Und warum ist das so?“, fragte Marlene anzüglich. „Weil sie, seit sie denken kann, immer ohne zu Murren funktioniert hat, so wie es von ihr als braver Tochter erwartet wurde?“, beantwortet sie dann ihre Frage selbst.
„Für dich sicher unvorstellbar“, konterte Ernst-Ludwig, „der Begriff brav kommt in deinem Wortschatz ja nicht vor.“
„Wenn du ihn mit unterwürfig definierst, sicher nicht.“
„Dafür ist dein Einfluss auf Caroline ja das prägnanteste Beispiel“, konstatierte Ernst-Ludwig bitter.
„Dass sie vor eurem spießigen Einfluss und aus diesem Mausoleums geflohen ist, war das Klügste, was sie machen konnte. Sie hat damit als Erstes deiner Kinder die Freiheit gewählt.“
„Du verwechselst offensichtlich Freiheit mit frivoler Freizügigkeit“, lachte Paul zynisch auf.
„Immer noch besser als fanatisch verklemmt“, schoss Marlene, an ihren Neffen gewandt, zurück. „Die Richtung, die du einschlägst, beweist mir, dass du dich, trotz meiner effizienten Bemühungen, den Freuden des Lebens nicht geöffnet hast.“
„Das liegt daran, dass du alles verdirbst, was deine Hand berührt“, positionierte sich Paul anklagend.
„Dich eingeschlossen, nehme ich an“, höhnte Marlene anzüglich, „hoffst du deinen Seelenfrieden zurückzuerlangen, indem du zukünftig Sündern im Beichtstuhl die Absolution erteilst, du falscher Pharisäer?“
Paul war bei Marlenes Worten blass geworden. Sein eisiger Blick durchbohrte sie. In ihm loderte ein Hass, der jeden anderen betroffen gemacht hätte, nicht so Marlene. Sie lächelte süffisant und spitzte provozierend die Lippen.
„Hebe dich hinfort von mir, Satan“, flüsterte Paul und kreuzte seine Zeigefinger als Abwehr gegen seine Tante, bevor er aus dem Zimmer floh.
In der Tür stieß er beinahe mit seiner Großmutter zusammen, die ihre Mittagsruhe beendet hatte. „Wie spät ist es denn“, wollte sie wissen, „ist der Kaffeetisch bereits gedeckt?“
„Es ist fünf nach zwölf“, zischte Ernst-Ludwig unbeherrscht, „und das Kaffeetrinken fällt heute aus.“
„Aber das ist völlig unmöglich“, hielt Amelia verständnislos dagegen, „wir haben bereits zu Mittag gegessen. Deine Uhr geht falsch“, erboste sie sich.
Carola erbarmte sich ihrer Schwiegermutter. „Es ist kurz vor drei, Mutter“, beruhigte sie die aufgebrachte Frau, „und ich würde es sehr begrüßen, wenn du Renate beim Eindecken des Kaffeetisches beaufsichtigen würdest, damit sie auch das richtige Porzellan nimmt.“
„Selbstverständlich, meine Liebe“, besänftigt verließ Amelia die Bibliothek, „und bitte stelle Ernst-Ludwigs Uhr richtig ein. Er scheint ja völlig durcheinander zu sein.“
Carola atmete tief durch und wandte sich erneut an Marlene. „Könntest du mir jetzt bitte erklären, worum es in deiner Debatte mit Paul ging“, verlangte sie.
„Dein Sohn kriegt bei Frauen keinen hoch“, nahm Marlene wie beiläufig den Faden wieder auf, „mit dem Zölibat dürfte er somit keine Probleme bekommen.“
Ernst-Ludwig sog zischend die Luft ein.
„Wie bitte?“, fragte Carola, bevor er etwas sagen konnte, „aber woher willst du das denn wissen?“ Ihre Frage hing hilflos in der Luft.
„Das wiederum willst du nicht wirklich wissen“, entgegnete Marlene. Sie stand abrupt auf. „Ich glaube, Giorgio ist zurück. Ihr entschuldigt mich?“
Die Stille, die ihrem Abgang folgte, lastete zäh und düster über der eingestürzten schönen Fassade, die die vormals heile Welt unter ihren splitternden Fragmenten begrub.
Nach einer Weile durchbrach Carolas leises Weinen die bleierne Sprachlosigkeit. „Warum musstet ihr ausgerechnet an Weihnachten damit anfangen?“, schluchzte sie, „hättet ihr die Frage der Nachfolge nicht nach den Feiertagen klären können?“
„Weihnachten ist vorbei!“, konstatierte Ernst-Ludwig bitter.
6
Das Licht des späten Vormittags war perlgrau. Ein dünner Wolkenschleier hing über dem Land. Der Schnee zeichnete sich sanft gegen den aufsteigenden Dunst ab. Diffus durch das zarte Gespinst dringende Sonnenstrahlen gaben der kalten Landschaft den Hauch eines warmen Schimmers.
Es war der erste Tag des neuen Jahres und Frank Richter sah ihm voller Vorfreude entgegen. Seine Eifersucht war überwunden, seine einstige Leidenschaft für Sophia Lorenz, einem warmen Gefühl freundschaftlicher Zuneigung gewichen. Sophia hatte mit John in Schottland ihr Zuhause gefunden. Die beiden wirkten glücklich und er freute sich aufrichtig mit ihnen.
Seit er John Arden und Sophia Lorenz von seinen Heiratsplänen erzählt hatte, fühlte er sich seltsam schwerelos. Iris Haupt war seine Zukunft. In ihren Armen fand er liebevolle Beständigkeit und innige Zuneigung. Sie schenkte seiner Seele Frieden. Die Zeit der erotischen Flächenbrände, die ihn regelmäßig emotional verschlungen hatten, war endgültig vorbei.
Die zaghaften Sonnenstrahlen verblichen hinter graugelben Wolken und es begann erneut zu schneien. Frank beendete seinen Morgenspaziergang und kehrte zurück zum Anwesen seines Freundes, dass John stolz seinen Familiensitz nannte. Zur Hochzeit der Beiden im Mai würden Iris und er gemeinsam nach Schottland reisen und wären zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereits verheiratet. Frank bedauerte aufrichtig, dass John und Sophia bei seiner Trauung fehlen würden, doch Johns Ausweisung aus Deutschland, schloss eine erneute Einreise vorerst aus.
Noch vor ein paar Monaten hätte Frank eine Freundschaft mit dem ehemaligen Galeristen für vollkommen unmöglich gehalten. Sie waren, wenn auch keine Feinde, so doch erbitterte Gegner gewesen. Frank hatte gegen John Arden wegen Beihilfe zur Geldwäsche und Mord ermittelt, ihn zunächst für schuldig gehalten und dann als schuldiges Opfer gesehen. Letztendlich hatte er für seine Ausweisung plädiert, nachdem sich John bei der Lösung des Falls kooperativ eingebracht hatte.
Nun wartete Frank voller Spannung auf die angeblich brisanten Details zu dem damaligen Fall, die John ihm vor Weihnachten angekündigt hatte. Da seine Freunde vorab auf einem harmonischen Jahreswechsel ohne Altlasten bestanden hatten, wuchs Franks Neugier mit jeder Sekunde dieses neuen Jahres. Was mochten die Beiden herausgefunden haben? Könnte es dazu beitragen, den Fall des Bildermörders endgültig abzuschließen? Einige gewichtige Fragen waren bis heute unbeantwortet geblieben.
Frank betrat die große Halle und rubbelte sich die Schneeflocken aus den feuchten Haaren, bevor er sich aus der dicken Daunenjacke schälte. In dem imposanten Kamin leckten züngelnde Flammen an mächtigen Holzscheiten und verbreiteten eine wohlige Wärme.
John Arden saß in einem der abgewetzten Chesterfieldsessel und nippte an einem Whiskey.
Frank rieb sich die kalten Hände und setzte sich neben John. „Es hat wieder angefangen zu schneien“, berichtete er, „und es ist saukalt.“
„Was du nicht sagst“, schmunzelte John. „Darf ich dir einen dreißig Jahre alten Malt anbieten.“
„Den auch“, bestätigte Frank Richter.
„Was denn noch?“ John gab sich ahnungslos, doch das amüsierte Zucken seiner Augenwinkel verriet ihn.
„Wie lange willst du mich eigentlich noch auf die Folter spannen?“, konnte sich Frank nicht länger zurückhalten.
Lachend stellte John das schwere Kristallglas auf den Beistelltisch und stemmte sich aus dem Sessel. „Na, dann komm“, sagte er lachend, „wird Zeit, dass du es endlich siehst.“
Frank zog fragend sie Augenbrauen hoch und folgte John in dessen Arbeitszimmer, das gerade renoviert wurde. Auf mehreren Wolldecken ausgebreitet beanspruchte ein opulentes Ölgemälde die Hälfte der Fußbodenfläche.
Die Fliehenden Pferde.
Frank Richter schnappte nach Luft. „Du hattest es?“, fragte er überwältigt. Das monströse dritte Gemälde des umstrittenen Malers Olgin Sasnikov galt als verschollen. Über den Verbleib seiner beiden Vorgänger wurde ebenfalls nur spekuliert.
„Nein, nicht ich, Sophia brachte das Bild, ohne es zu wissen, im Pferdetransporter mit nach Schottland. Es war in einer Pferdedecke eingenäht.“
„Wie du und Colin Ashford es euch ausgemalt hattet.“
„Ay.“ John zuckte irritiert zusammen. Er wollte nicht an seinen vermeintlich besten Freund und dessen Verrat erinnert werden. Colin war tot. Die Erinnerung schmerzte dennoch.
„Das heißt im Umkehrschluss, dass der Mörder von Colins Freund, Andreas Koch, bei diesem nur die beiden anderen Bilder gefunden hat und nach den Fliehenden Pferden immer noch suchen dürfte.“
„Das denke ich auch“, bestätigte John Franks Überlegung, „nach all den Verbrechen um die Gemälde, sind sie nur im Tripple wertvoll. Künstlerisch sind und bleiben sie eine dilettantische Schmiererei.“ John Arden war Kunstexperte und hatte in Münster eine exquisite Galerie betrieben.
„Mit seiner Gier nach dem fehlenden Bild, könnten wir den Mörder aus seinem Bau locken“, überlegte Frank weiter, „und wenn er zuschnappt, greifen wir ihn uns.“
„Er hat bereits die beiden anderen“, gab John zu bedenken, „was, wenn er zugreift, bevor die Falle zuschnappt?“
„Hmm“, Frank rieb sich das Kinn, „schwer vorstellbar, aber nicht gänzlich auszuschließen“, teilte er Johns Skepsis, „hast du eine Idee, wie wir diese Möglichkeit ausschließen könnten?“
Nachdenklich betrachtete John das Gemälde. „Die Bilder sind Müll, Frank. Sie haben nicht einmal einen erkennbaren Aufbau. Nur die Signatur Sasnikovs und die, die Bilder umrankenden Bluttaten, machen sie als Gesamtpaket zu einem Sammlerobjekt.“
„Worauf willst du hinaus, John?“
„Ich finde, es beeinträchtigt die Komposition keineswegs, wenn wir sie im unteren Teil um 20 cm kürzen.“
„Damit schneiden wir Sasnikovs Signatur ab.“
„Damit reduzieren wir lediglich den ideellen auf den tatsächlichen Wert“, befand John Arden, „und falls euch der Mörder mit dem Bild entkommen sollte, nutzt es ihm letztendlich nichts. Olgin Sasnikov ist Geschichte, von ihm wird es keine weiteren Gemälde geben.“
„Aber was soll das bringen?“, fragte Frank, „eine Unterschrift kann nachgemacht werden, zumal sie auf den beiden anderen Bildern im Original vorhanden ist.“
„Schon“, räumte John ein, „aber du machst vorab Fotos, vom Original und der Fälschung, für den Fall, dass die Signatur nachgemacht werden sollte. Offiziell gebt ihr bekannt, dass das dritte Gemälde der Blutbilder, das mit der Signatur, seinen finalen Aufenthaltsort in der Asservatenkammer der Polizei gefunden hat. Der Rücktransport der Fälschung sollte eventuelle kriminelle Kunstliebhaber von der Reiseroute des Originals fernhalten.“
„Genial“, stimmte Frank zu. „Die Idee könnte von mir sein“, grinste er und boxte seinen schottischen Freund spielerisch in die Seite. „Wir hätten von Anfang an zusammenarbeiten sollen, anstatt uns erst einmal ausgiebig zu befehden. Dann läge der Fall längst in der Registratur.“
„An mir lag es nicht“, wehrte sich John, „doch bedauerlicherweise musstest du ja unbedingt in mir den eigentlichen Drahtzieher vermuten. Keine kriminalistische Glanzleistung, wie du inzwischen hoffentlich zuzugeben bereit bist.“
„Der Russe hatte dich im Schwitzkasten“, konterte Frank, „du stecktest bis zum Hals in der Scheiße.“
„In der du mich nur zu gerne hättest verrecken lassen.“
„Absolut“, stimmte Frank zu, „erst recht, als ich erkennen musste, dass wir uns beide in dieselbe Frau verliebt hatten.“
„Ich war nach dieser Erkenntnis von einem Mord gar nicht so weit entfernt“, bestätigte John.
„Dabei war ich der edle Ritter auf seinem weißen Pferd“, beschwerte sich Frank, „ich war der Gute, du der Böse. Warum fliegen die Weiber eigentlich durchweg auf die Schurken?“
„Weil sie mit ihrer weiblichen Intuition den guten Kern im vermeintlich bösen Buben erkennen können.“ John klopfte Frank tröstend auf die Schulter. „Apropos weißes Pferd? Wie geht es Kevin?“
„Hervorragend“, bestätigte Frank stolz, „er ist genauso leichtrittig, wie sein großer Bruder Kaschmir. Sophia hat ein großartiges Händchen für Pferde.“
„Ay, das hat sie unbestritten“, stimmte John zu, „ihre Liebe zu Pferden ist grenzenlos. Ich konnte ihr Herz brechen hören, als ich Kaschmir erschießen musste.“
„Er war ein ganz besonders Pferd“, erinnerte sich Frank wehmütig.
„Das wird Kevin auch werden“, versprach John, „bis auf den Namen.“
„Mir gefällt Kevin“, beharrte Frank.
„Das behauptetest du bereits bei unserem letzten Zusammentreffen auf dem Kontinent“, erinnerte sich John, „und genau wie damals, glaube ich dir auch heute nicht.“
Frank grinste hintergründig und zuckte nur mit den Schultern. „Was ist jetzt mit dem Gemälde?“, lenkte er vom Thema ab, „du bist der Kunstexperte, womit kürzt man eine mit Ölfarbe beschmierte Leinwand?“
Bevor die Männer die Signatur des Malers abschnitten, machten, sowohl Frank als auch John, mehrere Fotos von dem Original. Selbst, wenn Franks Aufnahmen verloren gehen sollten, hätte John Arden die Sicherungskopien.
Anschließend rief Frank bei seiner Dienststelle an und klärte die Transportfrage des wiedergefunden Gemäldes. Er gab die Abfahrtzeit der Fähre in Dover an, die er nehmen wollte und bat darum, die Behörden zu informieren, damit sie ihn ungehindert passieren ließen, sowohl in Dover als auch in Ostende. Er genoss die letzten, unbeschwerten Tage seines Weihnachtsurlaubs und machte sich am siebten Januar auf den Heimweg.
7
Giorgio Amato betrat das Aufnahmestudio und wartete geduldig, bis Caroline die Szene abgedreht hatte. Sie ritt einen stattlichen Muskelprotz, während ein zweiter Mann hinter ihr kniete und ihre sehenswerten Brüste knetete. Mit den Fingern ihrer rechten Hand stimulierte sie sich zusätzlich selbst. Ihr Oskar reifer Orgasmus war nicht gespielt, erkannte Amato grinsend. Caroline genoss es sichtlich, ihre unersättliche Lust vor der Kamera auszuleben.
Sie stieg von dem Muskelberg und schlüpfte in den seidigen Bademantel. Lachend kam sie auf ihn zu. „Na, wie war ich“, fragte sie erhitzt.
„Nicht zu toppen“, lobte er sie, „du bist einzigartig.“ Er legte den Arm um sie und führte sie zu der roten Sitzgruppe. „Hör zu, meine Schöne, ich habe einen delikaten Auftrag für dich. Da kannst du zeigen, welches Talent wirklich in dir steckt. Als Belohnung winkt ein Shoppingausflug in eine Metropole deiner Wahl. Bist du dabei?“
Sie nickte und leckte sich dabei die Lippen. „Was muss ich dafür tun?“ Er griff unter ihren Morgenmantel zwischen ihre Schenkel und erklärte es ihr. Aufreizend spreizte sie ihre langen Beine und überließ sich zuckend seinen streichelnden Fingern.
Frank Richter saß an der Bar auf dem Oberdeck der Fähre und schrieb Iris Haupt eine SMS über sein Handy, als die schönste Frau, die er je gesehen hatte, den Raum betrat. Endlos lange Beine, eine atemberaubende Figur und das Gesicht eines Engels, umrahmt von üppigen rotbraunen Locken, die ihr bis zur Taille reichten.
Er ließ die SMS unvollendet und das Handy in seine Hosentasche gleiten, als ihn die Göttin mit einem strahlenden Lächeln bedachte und geradewegs auf ihn zu schlenderte.
„Eigentlich suche ich das Restaurant“, sie klang leicht verlegen. „Dieses Schiff ist aber auch riesig.“
„Ich fürchte, da sind sie hier völlig falsch“, lächelte Frank Richter zurück und erhob sich. „Darf ich Ihnen den Weg weisen?“
„Das wäre wunderbar“, strahlte sie ihn an, „dann möchte ich Sie im Gegenzug aber dazu einladen, mir Gesellschaft zu leisten. Ich speise so ungern alleine.“
In ihren intensiv blauen Augen schwelte eine Glut, die Franks Schwachstelle traf. Es gelang ihm nicht länger, unbeteiligt zu bleiben. Diese Frau war nicht nur jede Sünde wert, sie war die Sünde selbst. Sie schien eigens dafür gemacht, einem Mann seinen Seelenfrieden zu rauben.
Auf dem Weg zum Restaurant hakte sich die Sirene wie selbstverständlich bei ihm ein und es störte ihn überhaupt nicht. Noch war er ein freier Mann, würde Iris erst übermorgen bitten, seine Frau zu werden. Danach wäre alles anders. Doch nicht hier und jetzt, nicht heute, nicht bei dieser zauberhaften Frau, deren jugendlicher Schmelz ihn zunehmend betörte.
Sie speisten gut und üppig, und bereits beim Dessert ruhte ihre Hand auf seiner und streichelte seine Finger. „Gehen wir zurück in die Bar?“, warb sie lockend.
Auf dem Weg dorthin lag sein Arm auf ihren Schultern und sie schmiegte sich eng an ihn. Nach zwei Gläsern Sekt zog sie ihn an seiner Krawatte zu sich heran und küsste ihn lüstern. Ab da übernahm Frank. Seine Hände glitten gerade noch schicklich über ihre festen Kurven. Ihr wollüstiges Stöhnen spornte ihn an, sodass seine Küsse immer leidenschaftlicher wurden.
Sie saß auf dem Barhocker, ein Bein angewinkelt, das andere gestreckt. Ihr kurzer Rock war unzüchtig nach oben gerutscht und gab den Blick auf das schmale Stück nackter Haut zwischen den halterlosen Strümpfen und dem Spitzenslip frei. Frank vermochte den Blick nicht abzuwenden. Lächelnd nahm sie seine Hand und schob sie zwischen ihre Schenkel, spreizte diese gerade soweit, dass er ihre geile Nässe fühlen konnte.
Er verlor jede Kontrolle. Während sie sich zuckend um seine tastenden Finger schloss, war in seinem Gehirn nur noch Platz für den Wunsch, sie zu besitzen. Sie verließen die Bar, taumelten ein Stück den Gang hinunter, bis sie einen schweren Vorhang fanden, hinter dem sich eine Garderobe verbarg. Es war höchste Zeit, sein Verlangen drohte ihn schmerzhaft zu zerquetschen. Sie befreite seinen Penis aus der engen Hose und kletterte an Frank hoch, indem sie die Beine um seine Hüften schlang. Wild und gänzlich enthemmt nahm sie ihn in sich auf.
„Wie sehe ich aus?“, fragte sie ihn, „alles wieder ordentlich?“ Kokett zupfte sie an ihrem engen Rock.
„Verführerisch“, bestätigte er ihr grinsend und ordnete mit den Fingern ihre wilden Locken.
„Die Reise ist noch lang“, gurrte sie, „lass uns etwas trinken, dann machen wir es noch einmal und nehmen uns viel Zeit. Verlockend leckte sie sich die Lippen.“
Frank war zu allem bereit. An der Bar bestellte er zwei Gläser Sekt.
„Oh, Mist, ich habe meine Tasche hinter dem Vorhang vergessen“, sie bedachte ihn mit einem strahlenden Lächeln, „holst du mir sie bitte?“