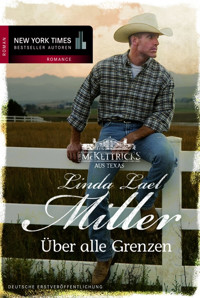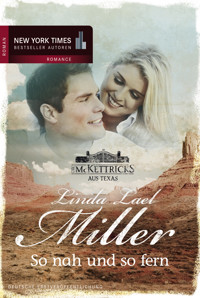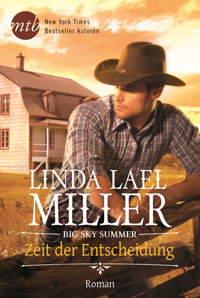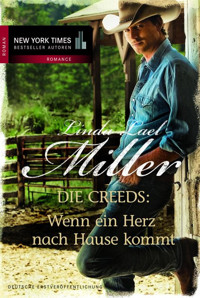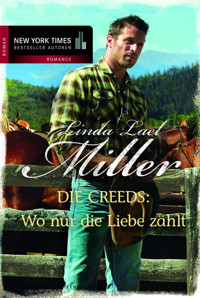4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Quade-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Lydia McQuire verschlägt es nach San Francisco. Ganz auf sich allein gestellt und ohne jegliches Auskommen fällt ihr Blick auf eine Anzeige: Junger, reicher, ordentlicher Mann sucht eine Ehefrau! Was sollte ihr schon passieren, wenn sie sich bei diesem Devon Quade meldete? Verzaubert von seinem Charme beschließt sie, ihm zu seinem Familiensitz zu folgen. Erst auf der Schifffahrt dorthin erfährt sie, dass nicht Devon eine Ehefrau sucht, sondern sein Bruder Brigham, der weit weniger charmant ist. Hinter der rauen Schale verbirgt sich jedoch eine ungeahnte Leidenschaft ...
Romane voller Romantik und Leidenschaft - "Verzaubert von deinen Augen" ist der Auftakt zur Trilogie um die Familie Quade von der Bestsellerautorin Linda Lael Miller.
Band 1: Verzaubert von deinen Augen
Band 2: Goldene Sonne, die dich verbrennt
Band 3: Süße Annie, wildes Herz
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
24
Epilog
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Lydia McQuire verschlägt es nach San Francisco. Ganz auf sich allein gestellt und ohne jegliches Auskommen fällt ihr Blick auf eine Anzeige: Junger, reicher, ordentlicher Mann sucht eine Ehefrau! Was sollte ihr schon passieren, wenn sie sich bei diesem Devon Quade meldete? Verzaubert von seinem Charme beschließt sie, ihm zu seinem Familiensitz zu folgen. Erst auf der Schifffahrt dorthin erfährt sie, dass nicht Devon eine Ehefrau sucht, sondern sein Bruder Brigham, der weit weniger charmant ist. Hinter der rauen Schale verbirgt sich jedoch eine ungeahnte Leidenschaft ...
Linda Lael Miller
Verzaubert von deinen Augen
Aus dem amerikanischen Englischvon Katharina Braun
1
San Francisco, 1866
Ein nagendes Hungergefühl quälte Lydia McQuire, doch sie wusste, dass der Verdienst aus ihrem nächtlichen Pianospiel höchstens für ein Zimmer in Miss Killgorams Pension ausreichte oder für eine Mahlzeit, doch keinesfalls für beides. Mit müden, vom Zigarrenrauch brennenden Augen betrachtete sie das Schild, das an der Außenwand des Restaurants hing.
Gesucht wird eine Frau für einen anständigen, wohlhabenden Mann, der kein Trinker ist. Bitte wenden Sie sich an Mister Devon Quade, Federal Hotel, Zimmer Vier.
Lydia seufzte. Das Federal Hotel lag nur wenige Blocks entfernt und hätte sich doch in einer anderen Welt befinden können, denn dort schliefen die Gäste auf gestärkten weißen Laken, tranken ihren Tee mit so viel Milch und Zucker, wie sie wollten, und nahmen Mahlzeiten zu sich, die sie nicht zuerst nach Schimmelspuren oder Käfern untersuchen mussten. Wenn sie diesen Devon Quade aufsuchte, würde er ihr während des Gesprächs bestimmt eine Erfrischung anbieten – Brötchen und Kaffee vielleicht. Selbst das erschien Lydia, die seit dem Vortag, als ihr ein gutmütiger Kellner zwei hartgekochte Eier überließ, nichts mehr gegessen hatte, wie eine Festmahlzeit.
Entschlossen wandte sie sich ab und schlug die Richtung zum Hotel ein. Es war noch früh am Morgen, nur wenige Kutschen und Pferdewagen bevölkerten die Straßen. Für einen Moment kam Lydia der Gedanke, dass Mister Quade möglicherweise noch schlief, aber sie ließ sich davon nicht beirren und ging weiter. Vielleicht würde ihr Eifer ihn derart beeindrucken, dass er ihr schäbiges Kleid übersah und auch, wie strähnig ihr blondes Haar war, und nicht den schalen Zigarrengeruch wahrnahm, der ihrer Haut und ihren Kleidern anhaftete.
Als sie das Hotel erreichte, faltete sie den Zettel mit Mister Quades Adresse zusammen und steckte ihn in ihre Tasche zu den zwei schäbigen Münzen, die sie für ihr Klavierspiel im Saloon erhalten hatte. Für einen flüchtigen Moment überlegte sie, ob sie sich ernsthaft um die Stellung als Ehefrau des Fremden bemühen sollte, gab die Idee jedoch schnell wieder auf. Mit der Zeit würde sie schon eine Stellung als Gouvernante finden oder genug Geld zusammensparen, um sich ein Zimmer in einer Pension nehmen zu können, die über ein Piano verfügte. Dann konnte sie Klavierunterricht geben und sich einen anständigen, wenn auch bescheidenen Lebensunterhalt verdienen.
Der Hotelportier, der in seiner Uniform mit den goldenen Epauletten und glänzenden Kupferknöpfen wie ein Offizier aussah, schaute sie unter dem Rand seiner Mütze neugierig an. Sein Blick drückte sowohl Bewunderung als auch Verachtung aus, als er Lydias wohlgeformte Gestalt unter dem schäbigen Kleid musterte, ihr hübsches Gesicht und ihr dichtes, honigblondes Haar.
»Wünschen Sie etwas, Madam?«, erkundigte er sich mit einer ätzenden Höflichkeit, die Lydia sehr verletzte. Es war offensichtlich, dass er sie für eine Halbweltdame auf der Suche nach Kundschaft hielt. Am liebsten wäre sie geflohen, doch der Hunger hatte Lydia zu sehr geschwächt, sie brachte einfach nicht mehr die Kraft auf, sich abzuwenden und zu gehen. Sie nahm den Zettel heraus und zeigte ihn dem Portier. »Ich möchte Mister Devon Quade sehen«, sagte sie ruhig und unter Aufbietung ihres letzten Rests von Stolz.
Der Portier musterte sie noch einmal, dann lächelte er. Es war keine freundliche Geste, aber immerhin bedeutete er ihr mit einer Handbewegung, einzutreten.
Lydia betrat ein Foyer mit Topfpalmen und Orientteppichen, und für einen Moment erfasste sie eine solche Verzweiflung, dass sie die Augen schließen musste, um ihre Tränen zurückzudrängen.
Dann blinzelte sie, schaute noch einmal auf den Zettel in ihrer Hand und ging entschlossen auf die Treppe zu. Die gesuchte Tür war nicht schwer zu finden.
Sie brauchte nur noch anzuklopfen.
Lydia biss sich auf die Unterlippe. Sie war müde, hungrig und schmutzig, und das letzte, was sie sich auf Erden wünschte, war ein Mann – was machte sie also hier? Sie wusste es selbst nicht; nichts in ihrem Wissen oder ihrer Erfahrung konnte den seltsamen Zwang erklären, der sie hierhergetrieben hatte. Denn es war sehr viel mehr gewesen als nur die Hoffnung auf Kaffee und Brötchen.
Mit klopfendem Herzen hob sie die Hand und pochte leise an die Tür. Im gleichen Augenblick erfasste sie ein überwältigendes Entsetzen, und sie schaute sich hastig um, als wollte sie die Flucht ergreifen. Aber ihre Beine versagten ihr den Dienst. Wie erstarrt blieb sie vor der Tür des Fremden stehen.
Leise Geräusche erklangen im Raum, und wieder kämpfte Lydia vergeblich gegen die Starre an, die sie überfallen hatte. Wie angewurzelt stand sie da und harrte furchtsam der Dinge, die da kommen sollten.
Da öffnete sich die Tür, und er stand vor ihr, groß und gutaussehend, sein dunkelblondes Haar vom Schlaf zerzaust. Seine tiefblauen Augen verengten sich, und er runzelte die Stirn. »Ja?«
Lydia überreichte ihm mit zitternder Hand den Zettel. Der Mann war ganz offensichtlich genauso wohlhabend, wie er behauptet hatte, und nüchtern schien er auch zu sein, wenn man davon ausging, wie früh es noch am Morgen war. Was allerdings seine ›Anständigkeit‹ betraf, so erlaubte Lydia sich einen leisen Zweifel. Solch gutaussehende Männer wie Mister Quade stellten sich häufig als Wüstlinge heraus.
Als sie merkte, dass sie ihn anstarrte, zwang sie sich, etwas zu sagen. »Mister Quade? Mein Name ist Lydia McQuire, und ich komme wegen Ihres ... Angebots.« Es war klar, dass er ihr keine Erfrischung anbieten würde, schlaftrunken und im Morgenmantel, wie er vor ihr stand, aber Lydia glaubte, ihm trotzdem eine Erklärung schuldig zu sein, warum sie seinen Schlaf gestört hatte.
Seine tiefblauen Augen musterten sie prüfend, wenn auch nicht mit der gleichen Herablassung, die Lydia beim Portier gespürt hatte. »Kommen Sie herein, Miss McQuire«, forderte er sie auf und trat zurück.
Lydia schluckte. Eine solch peinliche .Entwicklung hatte sie nicht vorausgesehen. Sie verschränkte die Finger, bis sie schmerzten. »Ich glaube nicht ...«
Ganz unvermittelt erhellte ein Lächeln sein Gesicht, strahlend wie früher Sonnenschein auf einem stillen See. »Natürlich«, sagte er. »Ich lebe schon so lange unter Holzfällern, dass ich meine guten Manieren vergessen habe. Lassen Sie mir fünfzehn Minuten Zeit, dann treffe ich Sie unten im Speisesaal. Beim Frühstück können wir uns unterhalten.«
Lydias Magen knurrte laut und vernehmlich bei dieser Aussicht; sie konnte nur hoffen, dass Mister Quade es nicht gehört hatte. Sie nickte und blieb noch lange, nachdem er die Tür geschlossen hatte, auf dem Gang stehen. Dann, getrieben von der Aussicht auf etwas zu essen, verdrängte sie ihre Bedenken und eilte auf die Treppe zu.
Der Speisesaal wurde gerade geöffnet, und als Lydia dem Kellner mitteilte, dass sie mit Mister Devon Quade aus Zimmer Vier das Frühstück einnehmen würde, wurde sie unverzüglich zu einem Tisch geführt. Eine silberne Kanne mit duftendem Kaffee wurde gebracht und eine Platte mit frischem Gebäck.
Lydias Augen wurden groß, als sie zusah, wie die dampfende braune Flüssigkeit in eine zerbrechliche Porzellantasse gegossen wurde. »Bitte sehr, Madam«, sagte der Kellner freundlich.
Mit zitternder Hand griff Lydia nach der Zuckerschale und dem Sahnekännchen, bediente sich großzügig und trank genüsslich ihren heißen Kaffee. Nach zwei weiteren durstigen Schlucken – Gott, war der Kaffee köstlich! – nahm Lydia sich ein Stück von dem Gebäck. Ihr Mund war vollgestopft damit, als Devon Quade in der Tür zum Restaurant erschien und so verblüffend gut aussah, dass Lydia sich fast verschluckte. Hastig kaute und schluckte sie und errötete beschämt, als Mister Quade den Tisch erreichte, denn sie wusste, dass es ihr nicht gelungen war, ihm etwas vorzumachen. Er musste gesehen haben, dass sie mit einem einzigen Biss ein halbes Brötchen verschlungen hatte, was ihn sehr zu amüsieren schien.
Der Kellner kam und brachte Speisekarten, und noch mehr Kaffee wurde eingeschenkt.
Lydia war froh, dass sie bereits etwas von dem Gebäck gegessen hatte, denn nun war ihr Magen so weit beruhigt, dass sie Mister Quade gelassen beobachten konnte, während er die Karte studierte.
Er überraschte sie, indem er aufschaute und sagte: »Sie sind eine sehr schöne Frau. Ich muss gestehen, dass ich mich frage, wieso Sie nicht auf traditionellere Weise einen Mann gefunden haben.«
Lydia errötete. »Der Krieg hat nicht viele heiratsfähige Männer übriggelassen«, erwiderte sie. »Jene, die ihn überlebten, sind verwundet, innerlich oder äußerlich, oder sie sind bereits verheiratet.«
Mister Quade schien aufrichtig beschämt. »Natürlich. Entschuldigen Sie bitte.« Er winkte dem Kellner, der eifrig herbeieilte, was Lydia mit Neid erfüllte und sie sich fragen ließ, wie es sein mochte, auf solch mühelose Weise bedeutend zu sein wie ihr Frühstückspartner. Er bestellte für beide und musterte Lydia, als sie wieder allein waren, mit einem nachdenklichen Stirnrunzeln. »Erzählen Sie mir etwas von sich«, forderte er sie auf.
Ihre natürliche Veranlagung zum Trotz hätte sie fast zu der Entgegnung veranlasst, es sei ihr gutes Recht, zuerst etwas über ihn zu erfahren. Doch da sie ihr Frühstück nicht gefährden wollte, durfte sie ein solches Risiko nicht eingehen.
»Ich bin fünfundzwanzig«, begann sie und straffte die schmalen Schultern. »Ich stamme aus Fall River, Massachusetts. Mein Vater war Arzt, und meine Mutter starb, als ich noch ein Baby war. Ich habe eine gute Erziehung und Ausbildung genossen, kann kochen und saubermachen, obwohl ich zugebe, dass ich lieber lese oder spazieren gehe. Als der Krieg ausbrach, meldete mein Vater sich zu den Truppen – natürlich auf der Seite der Union.«
»Natürlich«, stimmte Mister Quade ernsthaft zu, obwohl ein flüchtiges Lächeln über seine Züge huschte.
In einer nervösen Geste strich Lydia ihre zerknitterten Röcke glatt. »Papa war erst eine Woche fort, als aus Washington ein Telegramm kam, in dem er meine Unterstützung anforderte. Natürlich bin ich seinem Ruf sofort gefolgt und habe als Krankenschwester Seite an Seite mit meinem Vater und den anderen Chirurgen gearbeitet.« Lydia machte eine kurze Pause und dachte an all das Entsetzliche, was sie auf den Kriegsschauplätzen gesehen hatte. »Wir zogen von Schlacht zu Schlacht, und in Virginia erlitt Papa einen Herzanfall und starb. Danach war ich ...«
Wieder brach sie ab, um Atem zu holen. »Ich bin bei den Sanitätstruppen geblieben, weil ich keinen Grund hatte, nach Hause zurückzukehren.«
Mister Quade schwieg sehr lange und schaute Lydia prüfend in die Augen. Die Mahlzeit wurde serviert, und Lydia musste den letzten Rest ihrer Beherrschung aufbieten, um sich nicht den Teller mit Rührei, Speck und Kartoffeln vollzuhäufen.
»Ihr Vater muss doch in Fall River ein Haus besessen haben«, sagte Mister Quade schließlich.
Lydia schüttelte den Kopf, den Mund voller Bratkartoffeln, die sie herunterschluckte, bevor sie antwortete: »Papa war kein praktisch veranlagter Mann. Wir hatten Zimmer über einer Metzgerei und waren zwei Monatsmieten schuldig, als er sich zur Armee meldete.«
Mister Quade strich Marmelade auf eine Scheibe Toast und schaute Lydia dabei nicht an. »Wie sind Sie nach San Francisco gekommen?«
Es war die reinste Qual, die Gabel in der Hand zu halten und sie nicht in das verlockend heiße Essen zu tauchen, aber Lydia nahm sich zusammen und erwiderte: »Als Gesellschafterin einer alten Dame. Ich hatte vor, eine Musikschule in Kalifornien zu eröffnen, aber Mrs. Hallingsworth starb sehr bald nach unserer Ankunft, und ihr Sohn und ihre Schwiegertochter hatten keine Verwendung für mich. Mit anderen Worten – ich war plötzlich ganz auf mich allein gestellt.«
»Wann war das?«
»Letzten Monat.« Lydia aß rasch ein paar Bissen und fuhr dann fort: »Seitdem lebe ich von dem, was ich mit Pianospielen in Saloons verdiene.«
Mister Quade nippte an seinem Kaffee. »Ich verstehe«, sagte er. »Gibt es irgendetwas, was Sie mich gern fragen würden?«
Lydia schluckte ihr Rührei hinunter. »Sie scheinen nicht in San Francisco zu leben, sonst wären Sie nicht hier im Hotel«, bemerkte sie. »Woher kommen Sie?«
Er lehnte sich zurück und schob beide Daumen in die Taschen seiner Brokatweste. »Mein Bruder und ich führen ein Holzgeschäft in der Nähe von Seattle, im Washingtoner Territorium.«
Lydia unterdrückte ein Schaudern. Man erzählte sich, dass die neuerschlossenen Gebiete von blutrünstigen Indianern und Banditen bevölkert wurden und in den Bergen Wildkatzen auf den Bäumen hockten, die nur darauf warteten, vorbeiziehenden Reisenden ins Genick zu springen.
»Sie können unmöglich im Staate Washington aufgewachsen sein«, bemerkte Lydia. »Diese Gebiete sind erst seit knapp zwanzig Jahren besiedelt, und Sie scheinen mir ein gebildeter Mann zu sein.«
Er lächelte. »Brigham – das ist mein Bruder – und ich sind in Maine aufgewachsen. Als wir alt genug waren, unsere Erbschaft anzutreten, sind wir mit einem Siedlerzug hierhergekommen.«
»Gibt es keine Frauen in Seattle?«, fragte Lydia.
»Nicht eine einzige, die es wert wäre, erwähnt zu werden«, antwortete Mister Quade. Er sah wirklich gut aus mit seinem dichten, goldblonden Haar, das wie eine Löwenmähne sein Gesicht umrahmte, mit seinem markanten Kinn und der geraden Nase beides so perfekt, dass sie wie gemeißelt wirkten. Und kultiviert war er auch – bestimmt würde er die Frau, die er zu seiner Gattin auserwählte, gut behandeln. »Frauen sind im Nordwesten rar. Ich möchte wetten, dass Sie schon auf dem Weg vom Hafen zu Yeslers Sägewerk mit mindestens sechs Heiratsanträgen rechnen können.«
Lydia schluckte. Sie hatte Quade aufgesucht, um sich ein Frühstück zu sichern, aber nicht, um sich zwischen einem Haufen liebeshungriger Holzfäller und Sägewerksarbeiter niederzulassen. »Haben sich viele Frauen auf Ihre ... Anzeige gemeldet?«, fragte sie leise, und ohne Quade anzusehen.
»Die meisten waren ungeeignet«, gab er zu. »Das Gebiet um den Puget Sound ist noch immer reichlich unzivilisiert und kein Ort für zaghafte oder hysterische Charaktere. Andererseits hingegen ist es ein wunderbares Land, und ich kann Ihnen versichern, dass es einer Frau, die den Namen Quade trägt, an nichts fehlen würde.«
Die Idee begann Lydia allmählich zu gefallen, und obwohl sie sich gar nicht sonderlich stark zu diesem attraktiven Mann hingezogen fühlte, konnte sie sich vorstellen, ihm eine gute Frau zu sein. Zudem wäre dies einigen der anderen Möglichkeiten, die ihr das Leben bot – wie zu verhungern oder als Dirne zu enden – ganz ohne Zweifel vorzuziehen.
Mister Quade schenkte Lydia Kaffee nach – mit solch galanter Aufmerksamkeit, als hätte er eine Herzogin vor sich statt eines heimatlosen Niemands, dessen ganzer Besitz aus zwei schäbigen Münzen bestand. »Würden Sie mich nach Quade’s Harbor begleiten, Lydia?«, fragte er. »Das Schiff legt in drei Tagen ab, und bis dahin bringe ich Sie natürlich hier im Hotel unter. Selbstverständlich würde ich Ihnen auch einen Vorschuss auf Ihr Nadelgeld geben, da Sie sicherlich einiges brauchen werden.«
Lydia starrte ihn an: Von einem derartigen Antrag hatte sie bisher weder gehört noch gelesen. Aber er war nicht ohne Reiz. Sie würde in einem anständigen Hotel essen und schlafen und sich zusätzlich noch ›einiges‹ kaufen können. Weiter dachte sie nicht; sie war zu verblüfft von dieser unerwarteten Wendung ihres Schicksals.
»Ja«, antwortete sie, mit einem Mut, der ihrer Verzweiflung entsprang. »Ja, Mister Quade, sehr gern.«
»Nun denn«, entgegnete er mit einem jungenhaften, liebenswerten Lächeln und zog seine Brieftasche heraus, entnahm ihr einige Scheine und reichte sie Lydia. »Sie brauchen Kleider für ein regnerisches Klima«, sagte er. »Ich werde am Empfang ein Zimmer für Sie reservieren lassen, und Sie können den Tag verbringen, wie es Ihnen beliebt. Lassen Sie Ihre Mahlzeiten und alles andere, was Sie brauchen, auf meine Rechnung schreiben.« Damit schob Mister Quade seinen Stuhl zurück, stand auf und nickte Lydia aufmunternd zu, bevor er ging.
Lydia überlegte kurz, ob sie sich ein zweites Frühstück bestellen sollte, sah dann das Geld an, das auf dem Tisch lag, und steckte es ein.
Es mochte vielleicht nicht schicklich sein, Geld von einem Mann zu nehmen, ganz zu schweigen von einem Zimmer im Hotel, aber andererseits hatte Mister Quade nichts Unziemliches von ihr verlangt. Er schien nicht zu erwarten, dass sie Quartier in seinem Zimmer bezog und hatte sich vom ersten Augenblick ihrer Begegnung an wie ein wahrer Gentleman verhalten.
Lydia faltete die Scheine, steckte sie in ihre Rocktasche und verließ mit ruhiger Würde den inzwischen vollbesetzten Speisesaal.
Der Empfangschef zeigte sich äußerst entgegenkommend. Ja, ein Zimmer sei für Miss Lydia McQuire reserviert. Er übergab ihr einen Schlüssel und sagte ihr, dass Zimmer Zehn in einer halben Stunde bezugsbereit sein würde.
»Danke«, antwortete Lydia und beherrschte sich, bis sie draußen auf der Straße stand, wo sie einen lauten Freudenschrei ausstieß und sich einmal um die eigene Achse drehte. Der Portier bedachte sie mit einem argwöhnischen Blick, enthielt sich jedoch einer Bemerkung.
Im ersten Augenblick wusste sie nicht, wie sie sich verhalten sollte. Eigentlich hätte sie jetzt einfach verschwinden können – die ansehnliche Summe, die Mister Quade ihr gegeben hatte, würde reichen, um wochenlang davon zu leben. Die andere Möglichkeit war, sich kopfüber ins Abenteuer zu stürzen. Denn ein Abenteuer war es, und nicht ganz ungefährlich, mit einem Fremden ins Washingtoner Territorium zu reisen und seine Frau zu werden. Aber Lydia liebte gefährliche Unternehmungen, was auch der Grund war, warum sie ihrem Vater von Feldlazarett zu Feldlazarett gefolgt war und nach Kriegsende mit Mistress Hallingsworth nach San Francisco gekommen war, um sich hier ein neues Leben aufzubauen.
So ging sie also nach kurzer Überlegung auf das zweistöckige Warenhaus an der nächsten Straßenecke zu. Ihren Schritten haftete eine ganz neue Sicherheit an, weil sie gegessen hatte, Geld besaß und eine Zukunft in Aussicht hatte, so ungewiss und gefährlich sie auch sein mochte. Außerdem brauchte sie sich zum ersten Mal seit Monaten nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wo sie übernachten oder ob sie an diesem Tag genug zu essen haben würde.
Sie kaufte mehrere schlichte, praktische Kleider, einen Umhang mit Kapuze für das regnerische Klima, das Mister Quade erwähnt hatte, und mehrere Paare feste Schuhe. Nach einem sehnsüchtigen Blick auf die Tanzschuhe aus Satin, die im Schaufenster ausgestellt waren, beschloss sie, auf einen derartigen Luxus zu verzichten, obwohl sie genug Geld dafür gehabt hätte. Stattdessen suchte sie warme Unterwäsche aus, Strümpfe und zwei schlichte Flanellnachthemden.
Ihre eigenen Sachen, die sich in einem Koffer in dem Saloon befanden, wo sie nachts Klavier spielte, waren es kaum wert, abgeholt zu werden. Als Folge der Beschränkungen des Krieges hatte sie seit fünf Jahren keine neuen Kleider mehr gehabt, und alles, was sie besaß, war abgetragen und hoffnungslos altmodisch.
Der letzte Gedanke ließ Lydia leise auflachen. Wann hatte sie, Tochter des gutmeinenden, aber chronisch armen Dr. Wilkes McQuire, sich je mit Mode befasst? So war dann auch der einzige Luxus, den sie sich heute bei ihren Einkäufen leistete, ein Buch – die wenigen, die sie in ihrem Koffer aufbewahrte, hatte sie schon so oft gelesen, dass sich die Seiten aus dem Einband lösten. Noch immer reichlich mit Geld versehen und mit vielen kleinen Päckchen beladen, kehrte Lydia zum Hotel zurück.
Zimmer Zehn war überraschend groß, die Einrichtung bestand aus einem polierten Mahagonibett und einer mit blauem Taft bezogenen Sitzgarnitur, die vor einem Kamin aus schimmerndem, weißem Marmor stand. Den Kaminsims zierte eine Vase mit bunten Frühlingsblumen.
Entzückt schloss Lydia die Tür, legte ihre Pakete auf dem Sofa ab und trat vor den Kamin, um eine der zarten Blüten zu berühren. Der Strauß aus roten Zinnien, weißen Margeriten, blauen Iris und roten und gelben Tulpen bildete ein Kaleidoskop von Farben, die sich in dem goldgerahmten Spiegel über dem Kamin widerspiegelten.
Lydia war solchen Luxus nicht gewöhnt und empfand ihn deshalb als umso überwältigender. Es kam ihr jetzt fast unglaublich vor, dass sie sich noch wenige Stunden zuvor um solch grundsätzliche Notwendigkeiten wie Essen oder ein Dach über dem Kopf gesorgt hatte.
Denn nun befand sie sich in einem eleganten Hotelzimmer, verfügte über Geld, das sie nach Belieben ausgeben konnte, neue Kleider, ein Buch zum Lesen und Küchenpersonal, das zu jedem Zeitpunkt des Tages bereit war, ihre Wünsche zu erfüllen, und mochten sie noch so ausgefallen sein.
Sie ging zu einem Sessel und nahm stirnrunzelnd darauf Platz. Wenn es etwas gab, was das Leben sie gelehrt hatte, dann, dass alles seinen Preis besaß. Früher oder später würde sie zur Kasse gebeten werden ...
Lydia schloss die Augen und umklammerte die Sessellehne. Es war durchaus möglich, dass Mister Quade alles andere als der Gentleman war, als der er sich gab: er mochte sogar ein Zuhälter sein. Wer konnte schon zu diesem Zeitpunkt sagen, ob er sie nicht für ein Bordell angeworben hatte, einen Harem im weit entfernten Orient oder vielleicht sogar für eine Opiumhöhle!
Seufzend öffnete sie die Augen.
Es ist aber auch möglich, dachte sie mit einer gewissen Erleichterung, dass ich irgendwo in einer Blockhütte in den Bergen enden und Devon Quades Haushalt führen werde. Dort würde sie in Frieden leben, drei oder vier Kinder großziehen, und wenn es irgendwann mit ihr vorbei war, würde die Welt sich weiterdrehen, als hätte es sie nie gegeben.
All diese Gedanken flößten ihr keinen nennenswerten Trost ein, und um sich davon abzulenken, stand Lydia auf und begann ihre Umgebung zu erforschen. Ein kleiner Nebenraum diente als Bad, und nach kurzer Überlegung zündete Lydia das Gas unter dem großen Tank an. Während das Wasser sich erhitzte, packte sie ihre Einkäufe aus und breitete ihre Neuerwerbungen auf dem Bett aus, um sie zu bewundern und etwas zum Anziehen auszusuchen. Alles, was sie gekauft hatte, waren schlichte, praktische Dinge aus Wolle und Leinen, aber das änderte nichts daran, dass sie sich reich vorkam wie eine Prinzessin. So muss es sein, wenn man als Mätresse eines Mannes lebte, dachte sie.
Eine gute Stunde später drehte Lydia den Heißwasserhahn über der Wanne auf und zog sich aus, um ein Bad zu nehmen, ein Luxus, den sie seit der Zeit vor Kriegsbeginn nicht mehr genossen hatte.
Als sie mit frisch gewaschenem Haar und rosig glänzender Haut aus der Wanne stieg, fühlte sie sich wie eine Frau, die dem Tode entronnen und zu neuer Pracht wiederauferstanden war. Sie trocknete ihr Haar und kämmte es, zog saubere neue Unterwäsche an und entschied sich für ein Kleid aus grau-weiß gestreiftem Baumwollstoff mit hohem, steifem Kragen. Darunter trug sie die neuen Strümpfe, die noch ein wenig kratzten, und ein Paar glänzend schwarzer Schuhe. Ihre alten Sachen stopfte sie in den Abfallkorb im Badezimmer.
Da sie inzwischen wieder hungrig geworden war, ging sie zum Restaurant hinunter, wo sie mit Mister Quade das Frühstück eingenommen hatte. Da er nirgendwo zu sehen war, machte sie sich nach dem Essen auf den Weg zum Saloon, um ihre wenigen Habseligkeiten abzuholen.
Jim, der Barkeeper, hielt sich im Hinterzimmer auf und packte Kisten mit irischem Whisky aus. Als er Lydia in ihren neuen Kleidern sah, pfiff er anerkennend durch die Zähne.
»Miss McQuire!«, sagte er beeindruckt. »Was ist geschehen? Sind Sie einer guten Fee begegnet?«
Lydia lächelte. »So ähnlich, Jim. Ich fahre nach Seattle und heirate einen Sägewerksbesitzer.«
Ein besorgter Blick trübte Jims kluge Augen. »Aha, so ist das. Aber Sie sollten vorsichtig sein, was diese Brautsucher betrifft, Miss. Wir haben einige sehr unschöne Dinge in dieser Hinsicht erlebt.«
Lydia bezweifelte nicht, dass Jim die Wahrheit sagte, aber sie konnte einfach nicht in San Francisco bleiben und weiter von der Hand in den Mund leben, ohne je zu wissen, wo sie übernachten sollte oder wann sie ihre nächste Mahlzeit einnehmen würde. Das Schicksal hatte ihr eine Chance geboten, und die würde sie ergreifen, selbst wenn ein Risiko damit verbunden war.
»Ich werde vorsichtig sein«, versprach sie. Der Gedanke, dass niemand sie vermissen würde, wenn sie nach Seattle fuhr und vielleicht für immer in einem Bordell verschwand, tat weh.
»Sie wollen sicher Ihre Sachen abholen«, meinte Jim, und eine Spur von Resignation klang in seiner Stimme mit.
»Ich nehme nur meine Bücher und einige wenige persönliche Dinge mit«, entgegnete Lydia. »Vielleicht können Sie den Rest verschenken, falls Sie jemanden kennen, der die Sachen brauchen kann.«
Der Barkeeper nickte. »Natürlich. Es gibt eine Menge Leute, die sich darüber freuen werden.«
Ohne mehr dazu zu sagen, ging Lydia in den Lagerraum und öffnete den Koffer, der in einer Ecke stand. Es stimmte sie nicht traurig, ihre alten, abgetragenen Kleider zurückzulassen, aber sie nahm die Fotografien ihrer Eltern an sich und die Bronzemedaille, die ihr ein sterbender Soldat geschenkt hatte, ihr Tagebuch, den Ehering ihrer Großmutter und ihre Briefe. All das legte sie in ein Tuch, verknotete es und stieg die Stufen zum Saloon hinunter.
Jim war nirgendwo zu sehen, was Lydia nicht erstaunte. Er war ihr ein guter Freund gewesen, und eine Abschiedsszene hätte beide zu sehr geschmerzt.
Lydia trat an die schwarze Tafel, auf der Jim seine Bestellungen notierte, nahm ein Stück Kreide und schrieb: Danke für alles, Jim. Dann kehrte sie ins Hotel zurück.
Am Abend speiste sie mit Mister Quade in einem Restaurant, das für seine hervorragenden Beefsteaks bekannt war, und später führte er sie in ein Theater, in dem eine fahrende Schauspielertruppe ein Melodrama aufführte.
Lydia begann sich zu fragen, wann die Trauung stattfinden würde, ob sie und Mister Quade noch hier in San Francisco oder erst in Seattle heiraten würden. Da sie jedoch nicht gerade begierig war, die Pflichten zu erfüllen, die nach der Hochzeit auf sie warteten, bezähmte sie ihre Neugierde und beschränkte sich darauf, zuzusehen, wie die Ereignisse ihren Lauf nahmen.
Am nächsten Tag trat ihr zukünftiger Mann erst zum Abendessen in Erscheinung und machte einen gehetzten, geistesabwesenden Eindruck. Lydia hatte einen Teil ihres kostbaren Kapitals darauf verwandt, eine Kutschenfahrt durch die Stadt zu unternehmen und hatte sich am Hafen von einer Zigeunerin die Zukunft voraussagen lassen. Doch da Mister Quades Verhalten verriet, dass derartige Erlebnisse ihn nicht interessierten, behielt Lydia sie für sich.
Am nächsten Morgen, als die Sonne hell und strahlend über der Bucht aufging, holte Mister Quade seine Braut und ihr Gepäck ab und ließ sich mit ihr in einer Kutsche zum Hafen fahren.
Lydias Gefühle schwankten zwischen Angst und freudiger Erregung. Sie werden sehr viel Kraft brauchen, hatte ihr die Zigeunerin gesagt, während sie mit ernster Miene Lydias Handfläche betrachtete. Sie haben schon viel gelitten. Jetzt müssen Sie sich einer noch größeren Herausforderung stellen: Sie werden Leidenschaft und wahre Freude kennenlernen.
Das Schiff, das sie bestiegen, wirkte recht solide, obwohl es längst nicht so groß war wie jenes, auf dem Lydia mit der armen Mistress Hallingsworth um Kap Horn gesegelt war. Während Lydia sich auf Deck umsah, dachte sie mit Schrecken an die rollenden Bewegungen, die einsetzen würden, sobald das Schiff den Hafen verlassen hatte und sich auf offener See befand. Lydia hatte im Krieg viel Schreckliches erlebt und mit angesehen, ohne dass ihr je übel geworden wäre, aber sie ertrug keine Schiffsreise, ohne seekrank zu werden.
Vielleicht, dachte sie, lässt Mister Quade die Trauung auf dem Schiff vornehmen. Sie hatte gehört, dass der Kapitän zum Vollzug einer solchen Zeremonie ermächtigt war.
Doch Mister Quade erwähnte nichts dergleichen. Er begleitete Lydia zu ihrer kleinen Kabine, die mit einer schmalen Koje, einem eingebauten Schrank und einem Waschtisch versehen war. Nachdem Lydia ihre Kleider ausgepackt und eingeräumt hatte, kehrte sie auf Deck zurück, um sich das Schiff genauer anzusehen.
Es entfernte sich bereits vom Kai, als Lydia den Bug umrundete und Devon an der Reling sah. Neben ihm stand eine schöne dunkelhaarige Frau, sehr elegant gekleidet, und ihre Hand ruhte in vertrauter, besitzergreifender Weise auf Devons Arm.
Eisige Kälte durchzuckte Lydias Herz, gefolgt von rasendem Zorn. Mister Quade war also doch ein Wüstling!
Vielleicht wäre Lydia über Bord gesprungen und an Land zurückgeschwommen, wenn sie nicht gewusst hätte, dass hungrige Haie die Bucht bevölkerten. Ihre ganze Würde aufbietend, gesellte Lydia sich zu dem Paar an der Reling und schaute fragend zu dem Mann auf, der versprochen hatte, sie zu heiraten.
Devon strahlte, als sei alles in bester Ordnung. »Ah, Miss McQuire«, sagte er und tätschelte die Hand der Frau an seiner Seite. »Darf ich Ihnen Mrs. Polly Quade vorstellen – meine Frau?«
2
Devon Quade war also schon verheiratet.
Lydia streckte die Hand aus und umklammerte haltsuchend die Reling. »Sie werden mir die Anmaßung verzeihen, Mister Quade«, sagte sie mühsam beherrscht, »aber ich hatte den Eindruck, dass ich ... dass wir ...« Sie spürte, wie sie errötete, und verstummte, von einem überwältigenden Gefühl der Demütigung erfasst. Doch zu ihrer eigenen Überraschung empfand sie auch so etwas wie Erleichterung.
Devon wirkte aufrichtig zerknirscht. Er schaute die schöne Polly an, die das Drama verfolgte, ohne sich jedoch den geringsten Triumph oder Besorgnis anmerken zu lassen. Devon erblasste, das Blut wich aus seinem Gesicht, und er murmelte: »Beim großen Zeus – diesen Eindruck scheine ich tatsächlich erweckt zu haben!«
Lydia schwieg einen kurzen Moment lang in der Vorstellung, Devon Quade mitten ins Gesicht zu schlagen. »Ja«, erwiderte sie schlicht und fragte sich, ob der Kapitän wohl auf eine entsprechende Bitte hin bereit wäre, das Schiff zu wenden und zum Hafen zurückzufahren.
Nein, das war sehr unwahrscheinlich.
Devon seufzte, entzog seiner wahren Braut sanft den Arm und legte die Hand auf Lydias Schulter. Aus irgendeinem Grund zuckte sie weder zusammen, noch wich sie vor ihm zurück.
»Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt«, sagte er in heiserem, aufrichtigem Ton. »Der Mann, für den ich eine Braut suchte, ist mein Bruder Brigham. Er wird Ihnen ein feiner Gatte sein, Lydia, sobald er sich mit dem Gedanken abgefunden hat, wieder eine Frau zu haben ...«
Lydia, die bei Amputationen assistiert hatte, ohne auch nur zu schwanken, fühlte eine Ohnmacht nahen. »Sobald er sich mit dem Gedanken abgefunden hat?«, wiederholte sie mit zunehmendem Entsetzen. Es war schlimm genug, dass sie ihre gesamte Zukunft einem ihr völlig Fremden anvertraut hatte, aber die Entdeckung, dass Brigham Quade sie nicht einmal erwartete, brachte sie von neuem auf den Gedanken, über Bord zu springen. »Wie konnten Sie etwas so ... so Anmaßendes, so Hinterhältiges tun?«
»Ja, das wüsste ich auch gern«, mischte sich jetzt Polly ein, und Lydia dachte flüchtig, dass die Frau bisher eine erstaunliche Zurückhaltung bewiesen hatte. »Wie konntest du nur, Devon?«
Mister Quade nahm seine Hand von Lydias Schulter und strich sein dichtes, vom Wind zerzaustes Haar zurück. Dann seufzte er schwer. »Ich dachte, ich hätte alles erklärt«, wiederholte er, und zu ihrer eigenen Verwunderung glaubte Lydia ihm. »Es tut mir leid. Sie werden Brighams Kindern eine gute Gefährtin sein, und außerdem sind Sie eine sehr schöne Frau. Ich bin überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis Brigham Ihre zahlreichen guten Eigenschaften erkennt und Sie bittet, ihn zu heiraten.«
Lydia nickte hölzern, wandte sich ab und tastete sich blindlings an der Reling entlang. Ihre Gedanken überschlugen sich und hallten in ihrem Kopf wie ein Konzert aus tausend Vogelstimmen wider.
Doch bald, denn Krisen waren Lydia nicht fremd, hatte sie ihren Verstand wieder unter Kontrolle und war imstande, ihre Lage nüchtern und sachlich zu beurteilen. Sie liebte Devon Quade nicht, obwohl nicht abzustreiten war, dass er phantastisch aussah und ein Mann mit überwältigend guten Zukunftsaussichten war. Niemand würde von ihr verlangen, ihm ewige Treue und Gehorsam zu schwören und sein Bett zu teilen.
Und da Devons Bruder nicht damit rechnete, eine Frau frei Haus geliefert zu bekommen, würde er auch nicht am Hafen auf sie warten, einen Blumenstrauß in der Hand und einen Priester an der Seite. Lydia war ein Aufschub geschenkt worden, so unsicher er auch sein mochte, und es bestand immerhin die Möglichkeit, dass Mister Brigham Quade sie als Gouvernante für seine Kinder einstellen und weiter nichts von ihr erwarten würde.
Lydia holte tief Atem, schaute sich nach San Francisco um, das langsam ihrer Sicht entschwand, und fühlte die See sich aufbäumen wie ein großes, ungezähmtes Raubtier.
Die Zeit hatte Lydia zu einer Expertin darin gemacht, sich veränderten Umständen anzupassen, so hart sie auch sein mochten, und so hielt sie sich in den folgenden Tagen für sich und dachte über das Abenteuer nach, das sie in Seattle erwartete. Sie aß, wenn auch sehr wenig, machte lange Spaziergänge auf Deck und verhielt sich Devon gegenüber freundlich, wenn er es wagte, sie anzusprechen – was nicht sehr oft vorkam.
Seattle, so stellte sich heraus, war nichts als eine Ansammlung hässlicher, ungestrichener Holzhäuser, die an steilen Hängen klebten und von dichten, undurchdringlichen Wäldern flankiert wurden. Hier und da erhob sich der Stumpf eines uralten Immergrünbaums aus der schlammbedeckten Straße, und Haufen von Sägemehl und Sägespänen zeugten davon, dass einige Bewohner der Stadt hier eine Industrie aufzubauen versuchten. Die Bierhallen, aus denen schon am frühen Morgen Musik und raue Stimmen drangen, gaben lautstark Zeugnis von den Gewohnheiten anderer Bewohner. Die Sägen in den Mühlen kreischten, und es roch nach frischgeschnittenem Holz.
Lydia verspürte eine seltsame Regung in den Tiefen ihres Herzens, das still und taub gewesen war, seit sie vor langer Zeit den ersten verwundeten Soldaten erblickt hatte.
Eine Haarsträhne fiel ihr ins Gesicht, und der Wind brachte den Geschmack von Salzwasser auf ihre Lippen, der sie schwach an Tränen erinnerte. Lydia konnte sich nicht entsinnen, wann sie zum letzten Mal geweint hatte; vielleicht beim Begräbnis ihrer Mutter, als sie noch ein kleines Kind gewesen war.
Sie richtete sich ein wenig straffer auf an ihrem gewohnten Platz an Bord des Dampfschiffs ›San Francisco‹ und lächelte Polly zu, die der hässlichen kleinen Stadt entgegensah, als eröffnete sich Paris vor ihr.
Offensichtlich hatte die junge Braut in ihrem Mann alles gefunden, was sie sich von dieser Ehe erhofft hatte, denn ihre Wangen waren ständig leicht gerötet, und ein glückliches Strahlen erhellte ihre schönen Augen.
Im Hafen von Seattle bestiegen sie ein anderes, kleineres Boot, und der letzte Teil der Reise begann. In einer Stunde, teilte Devon den Damen mit, würden sie Quade’s Harbor erreichen, das sich am entgegengesetzten Ende der Bucht befand.
»Du hast mir was gebracht?« Brigham Quade hätte seinen Bruder sicher angeschrien, wenn ihm der Schock nicht den Atem geraubt hätte. In ungläubigem Entsetzen starrte er seinen Bruder an und hoffte, ihn missverstanden zu haben.
Devon hockte auf der Kante von Brighams riesigem Kirschholzsekretär, einem sehr wertvollen Möbelstück, das an Bord eines Frachters aus China gekommen war. »Ich habe dir eine Frau mitgebracht«, sagte er gelassen. »Glaub mir, Brig, Lydia wird dir gefallen.« Er streckte eine Hand aus. »Sie ist etwa so groß, hat veilchenblaue Augen und blondes Haar und ist kerngesund.«
»Als nächstes wirst du mir noch sagen, dass sie gute Zähne hat!«, schrie Brigham und stieß fast seinen Stuhl um, als er aufsprang. »Lieber Himmel, Devon, du beschreibst diese Frau, als wäre sie eine Zuchtstute!«
Sein jüngerer Bruder zuckte mit den Schultern. »Das ist sie natürlich nicht«, gab er zu. »Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie dir gesunde Kinder gebären würde. Das steht außer Zweifel.«
Brigham kam langsam um den Sekretär herum. »Ich habe bereits Kinder, Devon. Zwei. Oder sollte dir das bisher entgangen sein?«
Devons Augen blickten völlig unschuldig. »Charlotte und Millie sind Mädchen«, wandte er ein. »Sie werden eines Tages heiraten und eine eigene Familie gründen. Du brauchst Söhne, die das Geschäft übernehmen, wenn du alt bist und ...«
»Devon«, unterbrach Brigham ihn und wunderte sich, dass er seinen Bruder noch nicht erwürgt hatte. »Ich habe noch einige gute Jahre vor mir, das kannst du mir glauben.« Er trat ans Fenster und starrte in den strömenden Regen hinaus. »Wir haben die Firma gemeinsam aufgebaut«, sagte er schließlich. »Und gemeinsam werden wir sie auch führen.«
Er hörte Devons Seufzen hinter sich und wusste, was nun kam.
»Wir haben das Geschäft nicht aufgebaut, das warst du, Brig. Ich habe dich nur in einigen Dingen unterstützt, und das weißt du so gut wie ich. Ich möchte etwas Eigenes besitzen.«
Brighams Enttäuschung verriet sich in seiner Stimme. »Ja, ein Warenhaus«, sagte er mit einem wütenden Blick auf seinen Bruder. Devon war jedoch der einzige Mensch, den er nie einzuschüchtern vermocht hatte, und es war offensichtlich, dass sich daran nichts geändert hatte.
»Ja, ein Warenhaus«; bestätigte Devon.
»Verdammt, Quade’s Harbor braucht kein Warenhaus!«, beharrte Brigham und strich ärgerlich sein dunkles Haar zurück. »Wir haben einen Firmenladen!«
»Hast du Angst vor Konkurrenz?«, fragte Devon grinsend.
Donnerwetter, der Kerl hat Mut, dachte Brigham mit widerwilliger Anerkennung. Auf eine fünfzigprozentige Teilhaberschaft an einem der größten Sägewerke im Territorium zu verzichten, um ein Geschäft zu gründen, für das keine Kundschaft vorhanden war – eine fremde Frau als Braut heimzubringen und eine zweite, um sie seinem arglosen Bruder aufzuhalsen ...
Brigham fluchte wütend, stürzte zu dem Teakholzschrank, den er vor einigen Monaten aus San Francisco hatte bringen lassen, und schenkte sich einen Brandy ein. »Konkurrenz!«, stieß er hervor. »Unsere Firma verkauft alles, was ein Mann hier braucht. Was willst du noch verkaufen, Devon? Sag mir, was!«
»Vielleicht Dinge, die eine Frau braucht«, erwiderte Devon, noch immer sehr gelassen, und deutete auf die bewaldeten Berge, wo Brighams Männer Bäume schlugen. »Es ist sehr einsam hier. Deine Arbeiter brauchen Frauen, Brig, und sie werden kommen – aus dem Osten, wo heiratsfähige Männer seit dem Krieg Mangelware sind, und auch aus San Francisco. Du wirst schon sehen, Brig. Diese Frauen werden Kleider kaufen wollen und Blumenvasen und Farbe für ihre Gartenzäune.«
Brigham seufzte. Er hatte den Argumenten seines Bruders nichts entgegenzusetzen, so gern er es auch getan hätte. Das Gebiet um den Puget Sound veränderte sich täglich, und die wenigen beherzten Männer, die bereit waren, in den Bergen Holz zu schlagen, sehnten sich nach weiblicher Gesellschaft. Devon selbst war den ganzen Winter über ruhelos wie ein eingesperrter Kater gewesen ... Und nun saß eine Braut in seinem Schlafzimmer, eine junge Frau, die er kaum kannte.
Doch Polly bereitete Brigham keine Sorgen; es war Devons Privatangelegenheit, ob er einer Fremden seinen Namen geben wollte. Die andere jedoch, die Frau, die sein Bruder so fürsorglicherweise für ihn mitgebracht hatte – wie ein Souvenir von einer Reise! – die war ganz eindeutig sein, Brighams Problem.
Isabel, seine erste Frau und die Mutter seiner Töchter, hatte ihn für alle Zeiten von seinen falschen Vorstellungen von ehelichem Glück kuriert. Vor neun Jahren war sie auf tragische Weise an Lungenentzündung gestorben, und obwohl es keine Liebe gewesen war, was ihn und Isabel verbunden hatte, hatte er ihren Tod bedauert. Selbst heute noch, nach all den Jahren, dachte er mit Zorn an sie, weil er wusste, dass es ihr eigener Wille gewesen war zu sterben. Sie hatte einfach aufgegeben, ihr Leben fortgeworfen wie ein Kleidungsstück, das nicht mehr gebraucht wurde, ohne auch nur im Geringsten an ihre Kinder zu denken oder an ihren Mann.
Er schüttelte diese beunruhigenden Erinnerungen ab und trank einen weiteren Schluck von seinem Brandy. »Die andere – Lydia – wird zurückkehren müssen. Vorausgesetzt natürlich, du hast nicht vor, dir einen Harem anzulegen.«
Devon stand auf und schenkte sich einen Drink ein. »Lydia ist so schön, dass sie einen Mann durchaus auf solche Ideen bringen könnte«, gab er schmunzelnd zu, doch dann wurde er ernst. »Ich rate dir, die Augen zu öffnen, Brig, und dir dein Leben anzusehen. Du brauchst ganz dringend eine Frau, und deine Kinder benötigen eine Mutter.«
Brigham war an seinen Schreibtisch zurückgekehrt und nahm einen Stapel Papiere auf. »Charlotte und Millie haben Tante Persephone. Sie gibt ihnen alles, was Mädchen von einer Frau verlangen können.«
Devon schwenkte sein Glas und betrachtete die Flüssigkeit darin, als könnte sie ihm Aufschluss über ein Rätsel geben, das ihn zutiefst verwirrte. »Damit bleibt immer noch das andere Problem. Und sag mir nicht, die Huren in Seattle wären genug, denn das ist reiner Unsinn, und das weißt du so gut wie ich. Lydia ist eine schöne und sehr weibliche Frau«, setzte er gedehnt und wie nach langer Überlegung hinzu.
»Wenn sie so viele Tugenden besitzt«, knurrte Brigham, »warum hast du sie dann nicht selbst geheiratet?«
Sein Bruder schien wie immer ungerührt von Brighams Ärger. »Sie ist sehr stark, sowohl körperlich als auch geistig. Um ehrlich zu sein – ich wollte lieber jemanden, der zu mir aufschaut und sich an mich anlehnt. Ich glaube, Lydia hat fast ihr ganzes Leben für sich selbst sorgen müssen.«
Mit einem weiteren schweren Seufzer nahm Brigham eine Akte auf und ließ sie auf die polierte Schreibtischplatte fallen. Warum ein Mann sich ein zartes Veilchen wünschen sollte, das sich an seinen Kragen klammerte und ihn erstickte, war ihm unbegreiflich. Brighams Meinung nach musste eine Frau ihrem Mann auch eine Partnerin sein, mindestens ebenso sehr wie eine Bettgefährtin. Was allerdings nicht hieß, dass er Frauen schätzte, die allzu sehr auf ihrer Unabhängigkeit beharrten. Wenn er eins nicht ertrug, dann pferdegesichtige Blaustrümpfe, die über ihre Rechte plapperten.
Er dachte, dass Lydia McQuire vermutlich in diese Kategorie von Frauen einzuordnen war, und ein Schaudern erfasste ihn. Lieber wäre er dem Geist von Hamlets Vater nachts auf dem Korridor begegnet!
Devon, der schon von Kindheit an Brighams Gedanken zu erraten verstand, lachte schallend. »Du wirst angenehm überrascht sein, wenn du sie siehst«, meinte er, stellte sein leeres Glas auf den Schrank und ging hinaus.
Vielleicht hätte Brigham den ganzen Nachmittag ungestört seine Akten aufgearbeitet, wenn die Unterredung mit seinem Bruder nicht gewesen wäre. Aber so beunruhigte ihn die Tatsache, dass oben eine Frau saß, die zweifellos erwartete, noch vor Ende dieser Woche Mistress Brigham Quade zu werden.
Immer wieder richtete er seine dunklen Augen auf die Zimmerdecke, denn die Gästezimmer: befanden sich direkt über ihm. Irgendwann gab er es dann auf, legte die Feder beiseite und schraubte das Tintenfass zu.
Als er den Raum durchquerte und die breite Doppeltür öffnete, stand er zu seiner Überraschung einer zierlichen blonden Frau gegenüber, die die Hand erhoben hatte, um anzuklopfen, und ihn mit einer Mischung aus Trotz und Furcht ansah. Ihre Augen waren von einem dunklen, samtigen Blau, ihr schmales Gesicht mit den hoch angesetzten Wangenknochen von einer bezaubernden Röte überzogen, ihr Kinn war trotzig erhoben, und Brigham wünschte plötzlich wider alle Vernunft, dass diese Frau nicht Polly sein möge, die Braut, die sein Bruder für sich ausgesucht hatte.
Die blauen Augen weiteten sich, die kleine Hand sank langsam herab. Die Frau trug ein schlichtes graues Kleid mit glatten Ärmeln und hohem Kragen. »Mister Brigham Quade?«, fragte sie mit der Würde einer Prinzessin, die sich zwischen lauter Bauern verirrt hatte.
Brigham hielt den Atem an und hatte das Gefühl, auf einem sich drehenden und hüpfenden Baumstamm inmitten reißender Fluten zu stehen. Aber er besaß genügend Selbstbeherrschung, um nicht zu zeigen, wie sehr dieses Mädchen ihn aus der Fassung brachte.
»Ich bin Lydia McQuire«, sagte sie so trotzig, als rechnete sie mit Widerspruch.
Erleichterung erfasste Brigham mit der Macht eines Präriesturms. »Keine Angst, ich glaube Ihnen«, erwiderte er lächelnd.
Lydias schöne Augen wurden schmal, aber die Röte wich nicht aus ihren Wangen. Es war Brigham ein Trost, dass auch sie die seltsamen Unterströmungen zwischen ihnen zu spüren schien und er nicht als einziger die Fassung verloren hatte.
»Wünschen Sie etwas?«, erkundigte er sich übertrieben höflich und stützte die Hände in die Hüften, um sich selbst daran zu hindern, sie auf ihre zarten Wangen zu legen oder auf ihr glänzendes Haar.
Die Frage schien sie zu verwirren, doch dann straffte sie die Schultern und musterte ihn herausfordernd. »Ich werde Sie nicht heiraten, Mister Quade, unter gar keinen Umständen«, informierte sie ihn. »Ich würde mich jedoch gern mit Ihnen über Ihre Absichten bezüglich der Ausbildung Ihrer Töchter unterhalten.«
Brigham lächelte nachsichtig. »Ich kann mich nicht entsinnen, Ihnen einen Antrag gemacht zu haben, Miss McQuire«, erwiderte er.
Wieder errötete sie. »Gut«, sagte sie kühl, »dann ist das geklärt, und wir können über die Erziehung Ihrer Töchter sprechen.«
Der Hausherr verschränkte die Arme und lehnte sich an den Türrahmen. »Tante Persephone hat den Mädchen das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. Und ich will ganz ehrlich sein, Miss McQuire – wieder Millie noch Charlotte verfolgen irgendwelche ehrgeizigen Projekte, die sie von anderen Mädchen unterscheiden würden. Meiner Ansicht nach wäre es das Vernünftigste, ihnen Haushaltsführung beizubringen.«
Einen köstlichen Moment lang glaubte Brigham, dass ihn sein schöner Gast gegen das Schienbein treten würde. Aber dazu war sie zu klug. »Natürlich sind Ihre Töchter nicht ehrgeizig, Mister Quade. Kinder neigen dazu, sich so zu sehen, wie es ihre Eltern tun, was bedeutet, dass Charlotte und Millie sich vermutlich als ebenso tüchtig und nützlich empfinden wie ein Paar langhaariger Schoßhunde.«
Ein solch heftiger Zorn erfasste Brigham, dass er sich vorbeugte und Lydia anfuhr: »Niemand wird meine Töchter zu Blaustrümpfen erziehen! Ich möchte nicht erleben, dass sie Politikern mit Forderungen nach Wahlrecht auf die Nerven gehen oder in aller Öffentlichkeit Reden halten!«
Lydia wich nicht vor ihm zurück, obwohl er so dicht vor ihr stand, dass seine Nase nur noch Millimeter von ihrer entfernt war. Nein, sie hielt die Stellung wie ein Soldat, obwohl sie vor lauter Empörung kein Wort über die Lippen brachte. Ihr Kinn zitterte, ihre Augen füllten sich mit Tränen, und irgendwo in der Ferne, weit, weit entfernt, glaubte Brigham ein Horn zu hören, das zur Schlacht aufrief.
3
Lydias Abneigung gegen Brigham Quade war unmittelbar und heftig; ihre Wangen waren rot vor Zorn, als sie sich abwandte, die Treppe hinaufstürmte und Zuflucht in ihrem Zimmer suchte.
Es dauerte einen Moment, bis sie das Kind bemerkte, das mit untergeschlagenen Beinen auf ihrem Bett hockte.
Das Mädchen war etwa zehn Jahre alt, sehr hübsch und hatte so dunkles Haar und graue Augen wie Brigham Quade. Ihre langen Locken reichten ihr bis über die Taille, ihre schmalen Wangen schimmerten rosig vor Gesundheit, und in ihrem duftigen weißen Kleid mit der gelben Schärpe wirkte sie wie einem französischen Gemälde entstiegen. Das einzige, was ihr dazu noch fehlte, waren ein Hut mit weicher, breiter Krempe und ein Hund im Arm.
»Hallo«, sagte sie, »ich bin Millicent Alexandria Quade. Aber Sie dürfen mich Millie nennen.«
Lydia lächelte und machte eine angedeutete Verbeugung. »Mein Name ist Lydia McQuire«, erwiderte sie, »und du darfst mich ›Miss McQuire‹ nennen.«
Millie runzelte die Stirn und zupfte an einer der goldenen Schleifen in ihrem Haar. »Ich dachte, ich müsste Sie ›Tante Lydia‹ nennen«, bekannte sie. »Aber da ich schon zehn bin, weiß ich natürlich, dass Onkel Devon nicht zwei Frauen geheiratet haben kann. Sind Sie die zweite Wahl, falls ihm die andere nicht gefällt?«
Lydia wäre beleidigt gewesen, wenn die Verwirrung des Kindes sich nicht so deutlich in seinem Blick verraten hätte. »Ich werde eure Gouvernante sein«, erwiderte sie und bereute die Worte, kaum dass sie ausgesprochen waren. Denn vielleicht schickte Brigham Quade sie schon mit dem nächsten Schiff wieder fort.
Das kleine Mädchen seufzte. »Ach, das ist nicht nötig. Ich habe von Tante Persephone genug gelernt«, entgegnete sie gelangweilt. »Ich kann Bücher lesen und rechnen. Ich spiele sogar auf dem Spinett.« Sie streckte einen kleinen Fuß aus, der in einem Samtpantoffel steckte, und bewegte ihn anmutig. »Es wird allerdings leichter für mich sein, wenn ich an die Pedale reiche«, fügte sie stirnrunzelnd hinzu. Aber dann hellte ihr Gesicht sich wieder auf. »Können Sie angeln, Miss Quade?«, fragte sie mit einem hoffnungsvollen Blick auf Lydia.
Lydia lachte und setzte sich auf die Bettkante. »Ja. Während meiner Kindheit in Massachusetts war ich oft mit meinem Vater angeln. Ich habe sogar immer mehr Forellen gefangen als er.«
Millie wirkte erfreut, aber dann verblasste ihr Lächeln. »Konnte Ihr Vater Sie gut leiden?«, erkundigte sie sich schüchtern.
Ein heftiger Ärger auf Brigham Quade stieg bei diesen Worten in Lydia auf. »Ja«, erwiderte sie sehr sanft. »Ich glaube schon. Und dein Vater? Mag er dich?«
»Papa hat viel in seinem Sägewerk zu tun«, entgegnete Millie traurig. »Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mich besonders interessant findet. Jedenfalls bestimmt nicht so sehr wie die Frau, die er manchmal in Seattle besucht.«
Lydia spürte, wie eine heiße Röte in ihre Wangen stieg. Rasch nahm sie Millies Hand. »Ich finde dich sehr interessant«, sagte sie entschieden, und tatsächlich war Millie Quade eines der aufgewecktesten Kinder, denen sie je begegnet war. »Vielleicht könnten wir beide Freundinnen werden?«
»Vielleicht«, stimmte Millie nachdenklich zu. »Ich habe natürlich Charlotte, meine Schwester, aber Freundin kann man sie nicht nennen, weil sie mich manchmal überhaupt nicht leiden mag. Und Tante Persephone tun die Knochen weh, wenn es regnet, und deshalb verbringt sie die meiste Zeit in ihrem Zimmer.«
Mitleid mit diesem Kind durchzuckte Lydias Herz. Es fiel ihr nicht schwer, sich vorzustellen, wie einsam dieses große, elegante Haus sein konnte, das mitten in diesem wilden, zum größten Teil noch unbesiedelten Gebiet stand. »Gibt es keine anderen Kinder in Quade’s Harbor?«, fragte sie.
Millie zuckte mit den Schultern. »Nur Indianer, und Tante Persephone lässt uns nicht mit ihnen spielen, weil sie Läuse haben.« Sie beugte sich vor und flüsterte Lydia vertraulich zu: »Und sie benutzen auch keinen Nachttopf!«
Lydia verkniff sich ein Lächeln. »Ach, du liebe Güte!«, erwiderte sie, als teilte sie Millies Schock über diese Entdeckung. »Aber was ist mit den Holzfällern?«, fragte sie dann. »Haben sie denn keine Kinder?« Sie erinnerte sich an die Reihe solider kleiner Wohnhäuser, die sie bei ihrer Ankunft in Quade’s Harbor gesehen hatte. Sie war verblüfft gewesen, wie sehr die Stadt den schon viel länger besiedelten Dörfern im Osten ähnelte.
Millie schüttelte den Kopf. »Die meisten haben keine Familien, und wenn doch, dann wollen sie nicht herkommen.«
Lydia setzte gerade zu einer Entgegnung an, als sie ein leises Rascheln in der offenen Tür ihres Zimmers vernahm. Eine zierliche weißhaarige Dame stand auf der Schwelle und musterte sie prüfend. Das muss Tante Persephone sein, dachte Lydia. Trotz Millies Bemerkung, dass die alte Dame häufig an Knochenschmerzen litt, sah sie nicht so aus, als hätte sie auch nur einen Tag in ihrem Leben im Krankenbett verbracht.
Lydia stand auf und strich ihre Röcke glatt. »Guten Tag«, sagte sie. »Ich bin Lydia McQuire – die neue Gouvernante.«
Die vornehme alte Dame in dem dunkelblauen Kleid neigte den Kopf. »Ja«, stimmte sie in nachdenklichem Ton zu. »Die Gouvernante. Ich bin Persephone Chilcote. Brigham und Devon sind meine Neffen.« Der freundliche, majestätische Blick glitt zu dem Kind auf dem Bett. »Millicent, komm sofort vom Bett herunter! Man dringt nicht in anderer Leute Zimmer ein und beschmutzt ihre Bettdecke mit seinen Füßen.«
Millie gehorchte widerspruchslos und stürmte in einem Anfall erstaunlicher Energie auf den Korridor hinaus. »Charlotte!«, hörte Lydia sie dort rufen. »Im Hafen liegt ein Schiff, das dich nach China bringen wird! Papa hat dich an eine Bande von Räubern mit langen Schnurrbärten verkauft!«
Mistress Chilcote verdrehte die Augen, aber ihr Gesichtsausdruck blieb sanft. »Ich tue, was ich kann«, seufzte sie, »aber ich fürchte, dass meine Großnichten zu wild geworden sind für eine alte Frau wie mich.«
Lydia dachte, dass vermutlich nicht einmal eine ganze Horde Indianer sich als ›zu wild‹ für Mistress Chilcote erweisen würde, aber natürlich sprach sie es nicht aus. Devon und Polly waren frisch verheiratet und mit sich selbst beschäftigt, und der Hausherr hatte sich ihr gegenüber alles andere als freundlich gezeigt. Sie brauchte wenigstens einen ihr wohlwollenden erwachsenen Menschen in diesem Haus.
Freundlich deutete sie auf die beiden Sessel beim Fenster, und Mistress Chilcote nahm Platz.
»Diese Stadt, dieses Haus ...« sagte Lydia nachdenklich. »Es kommt einem fast so vor, als hätte ein Genie das alles aus einem Dorf in Neuengland entfernt und hergebracht, mitten in diese unberührte Wildnis.«
Mistress Chilcote lächelte, und Lydia dachte, dass diese Frau in ihrer Jugend eine auffallende Schönheit gewesen sein musste. »Quade’s Harbor sieht nicht halb so heruntergekommen aus wie Seattle«, stimmte sie zu. »Mein Neffe – ich meine Brigham – hatte schon eine Vorstellung davon, wie dieser Ort aussehen würde, noch bevor er das Land in Besitz nahm. Und im allgemeinen entwickelt sich auch stets alles so, wie Brigham es sich vorstellt.«
»Ja«, erwiderte Lydia flach.
Mistress Chilcote beugte sich vor, ihre Augen funkelten belustigt. »Irre ich mich in der Annahme, dass sie Brigham bereits begegnet sind und ihn etwas ... schwierig fanden?«
Lydia wich den forschenden Blicken der alten Dame aus. »Er war sehr brüsk und überheblich.«
Brighams Tante lachte. »Ja, er ist recht eigenwillig«, stimmte sie zu, doch dann wurde sie ernst. »Aber beurteilen Sie ihn nicht zu hart, Miss McQuire. Er hat kein einfaches Leben gehabt, trotz der glücklichen Umstände seiner Geburt, und er hat ein Königreich in diesen Wäldern aufgebaut, obwohl das Schicksal ihm mehr Steine in den Weg gelegt hat, als es ihm Unterstützung zukommen ließ.«
Mistress Chilcotes letzte Bemerkung verblüffte Lydia, doch sie stellte diesbezüglich keine Fragen. Die Aufregungen des Tages begannen sich allmählich bemerkbar zu machen, und Lydia wünschte sich jetzt nichts sehnlicher als ein warmes Kaminfeuer, eine Tasse heißen, starken Tee und einige Stunden ungestörten Schlaf.
»Sie müssen müde sein«, bemerkte Mistress Chilcote, und Lydia fügte den Qualitäten, die sie bei der alten Dame entdeckt zu haben glaubte, Klugheit und Feingefühl hinzu. »Wie wäre es mit einem kleinen Imbiss?«
»Eine Tasse Tee wäre wundervoll«, antwortete Lydia. »Vielen Dank.« Als ihre Gastgeberin aufstand und hinausging, hockte Lydia sich vor den Kamin, um ein Feuer anzufachen.
Es prasselte bereits behaglich, und sie wärmte ihre Hände über seinem Schein, als die alte Dame mit einem Tablett zurückkehrte und es auf einem reich geschnitzten Tisch abstellte. Neben einer Kanne Tee standen eingemachte Birnen, Sandwiches, von denen die Kruste abgeschnitten worden war, und ein Eintopfgericht, das einen verlockenden Duft ausströmte.
»Ich lasse Sie jetzt allein, damit Sie sich einrichten können«, sagte Mistress Chilcote freundlich. »Dinner ist um sieben, so unzivilisiert das auch erscheinen mag. Aber Brigham meint, er würde verhungern, wenn er bis acht Uhr warten müsste.«
Unwillkürlich sah Lydia wieder Brighams Bild vor Augen; er wirkte groß und kräftig wie ein Bär, obwohl er in Wirklichkeit den gleichen schlanken Körperbau besaß wie sein Bruder. Die beherrschte Kraft, die er ausstrahlte, ließ darauf schließen, dass seine Energie auf kleiner Flamme brannte, aber jeden Augenblick zu einem alles verschlingenden Feuer auflodern konnte ...
Lydia dankte Mistress Chilcote, und als sie allein war, setzte sie sich an den Tisch, um zu essen. Als das Tablett leer und ihr Hunger gestillt war, schürte sie das Feuer und streckte sich auf dem Bett aus.
Stunden später, als sie die Augen wieder öffnete, war es dunkel im Zimmer, und sie hörte den Regen gegen die Fensterscheiben prasseln. Es war kühl und feucht im Raum, das Feuer war bis auf ein Häufchen Glut heruntergebrannt. Ihre Arme reibend, um sich zu wärmen, stand Lydia auf und legte rasch einige große Holzscheite nach. Im Schein des aufflackernden Feuers fand sie die Petroleumlampe neben ihrem Bett und zündete sie an.
Sie befestigte gerade den bemalten Porzellanschirm auf der Lampe, als es an der Tür klopfte.
Lydia, die mit Mistress Chilcote oder Millie rechnete, öffnete erfreut die Tür. Ein schlankes junges Mädchen, das genauso hübsch wie Millie, jedoch älter war, stand in der Halle. Doch während Millie dunkles Haar und graue Augen hatte, war dieses Mädchen mittelblond und mit hellen, bernsteinfarbenen Augen.
Es konnte nur Charlotte Quade sein, und ihr Anblick versetzte Lydia einen Stich, weil sie plötzlich ganz sicher war, dass Charlotte ihrer verstorbenen Mutter ähnlich sah, die – dem Aussehen ihrer Tochter nach zu urteilen – eine Schönheit gewesen sein musste.
Unverhohlene Feindseligkeit glitzerte in Charlottes Augen. »Papa sagt, wenn Sie jetzt nicht zum Dinner herunterkommen, essen wir ohne Sie«, erklärte sie kühl.
Lydia seufzte innerlich. Wenn sie nicht so hungrig gewesen wäre, hätte sie Mister Quade durch diese gereizte kleine Botin bestimmt eine ähnlich unhöfliche Antwort überbringen lassen, doch so erwiderte sie nur: »Schön, dich kennenzulernen, Charlotte. Ich bin Miss McQuire und würde sehr gern mit euch zu Abend essen – wenn du so freundlich wärst, mir den Weg zu zeigen?«
Charlotte warf den Kopf zurück, musterte Lydia für einen Moment aus schmalen Augen und wandte sich zum Gehen. »Ich verstehe nicht, warum Onkel Devon Sie hierhergebracht hat«, bemerkte sie, ohne sich nach Lydia umzuschauen. »Wir haben hier nämlich keine Verwendung für Sie.«
Lydia erwiderte nichts darauf, da ihr klar war, dass es ihr doch nur eine weitere unfreundliche Antwort eingebracht hätte.
Im Erdgeschoss durchquerten sie die Küche, wo – umgeben von schmutzigen Pfannen und Töpfen – ein Mann am Tisch saß und eine Ausgabe der Seattle Gazette las.
»Das ist Jake Feeny, unser Koch«, erklärte Charlotte, ohne Mister Feeny weiter zu beachten. »Papa hat ihn eingestellt, nachdem die Indianerin gegangen war.«