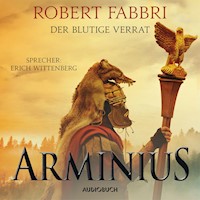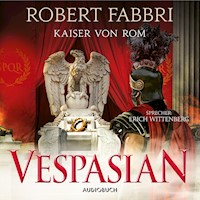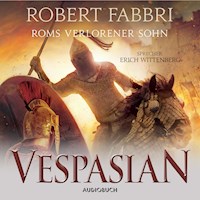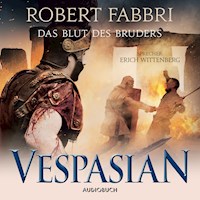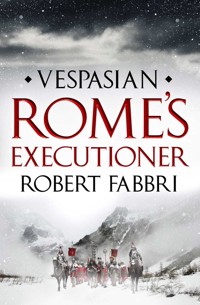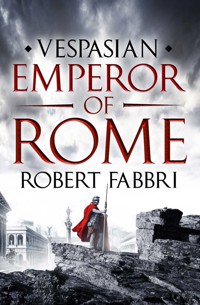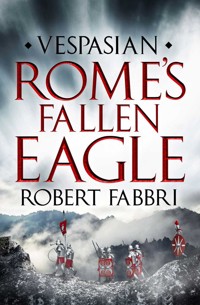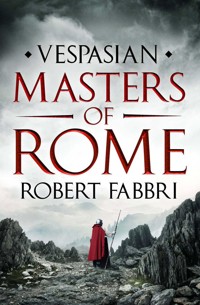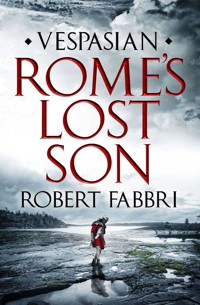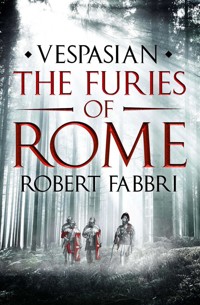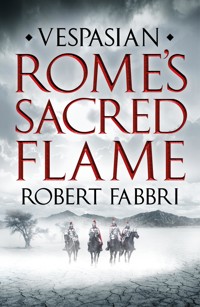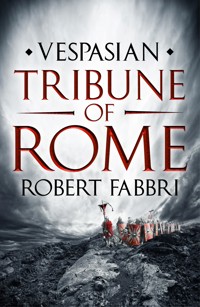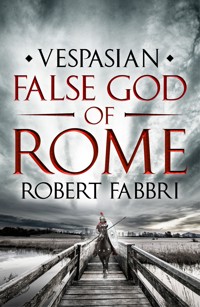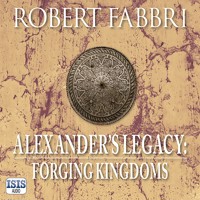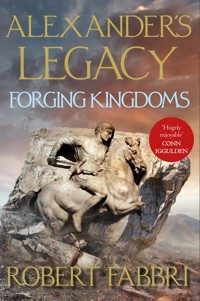9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Vespasian-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das britische Bestseller-Epos über das Leben des Kaisers Vespasian geht weiter! Exakt recherchierte Historie und packende Action für Fans von Bernard Cornwell und David Gilman. A.D. 58: Das Römische Reich wird von innen erschüttert: Kaiser Nero hat einen Tross von Speichelleckern um sich versammelt, und zusammen wüten sie des Nachts in Roms ungeschützten Straßen. Neros Ausgaben steigen ins Unermessliche, zugleich ist die Kontrolle über Britannien kaum noch zu bezahlen. Kann Nero sich aus der Provinz zurückziehen, ohne als Verlierer dazustehen? Panisch versuchen die römischen Investoren, ihren Reichtum aus Britannien abzuziehen. Vespasian muss noch einmal auf die Insel. Dort wird er in eine tödliche Rebellion verwickelt, angeführt von der unerbittlichen und furchtlosen Königin und Heerführerin Boudicca. Während der Aufstand um sich greift, muss Vespasian seinen Auftrag erfüllen – bevor ganz Britannien in Flammen aufgeht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Robert Fabbri
Vespasian: Das zerrissene Reich
Historischer Roman
Über dieses Buch
ROM ZERBRICHT.
BRITANNIEN BRENNT.
KÖNIGIN BOUDICCA ERHEBT IHR HEER.
A. D. 58: Das Römische Reich wird von innen erschüttert. Kaiser Nero hat einen Tross von Speichelleckern um sich versammelt, und zusammen wüten sie des Nachts in Roms ungeschützten Straßen. Neros Ausgaben steigen ins Unermessliche, zugleich ist die Kontrolle über Britannien kaum noch zu bezahlen. Kann Nero sich aus der Provinz zurückziehen, ohne als Verlierer dazustehen?
Panisch versuchen die römischen Investoren, ihren Reichtum aus Britannien abzuziehen. Vespasian muss noch einmal auf die Insel. Dort wird er in eine tödliche Rebellion verwickelt, angeführt von der unerbittlichen und furchtlosen Königin und Heerführerin Boudicca. Während der Aufstand um sich greift, muss Vespasian seinen Auftrag erfüllen – bevor ganz Britannien in Flammen aufgeht …
«Massive Intrigen und Korruption in Rom – und Britannien im Strudel von Gewalt, Vergeltung und Krieg ... Eine würdige Ergänzung einer durchweg hervorragenden Serie.» (For Winter Nights)
Vita
Robert Fabbri, geboren 1961, lebt in London und Berlin. Er arbeitete nach seinem Studium an der University of London 25 Jahre lang als Regieassistent und war an so unterschiedlichen Filmen beteiligt wie «Die Stunde der Patrioten», «Hellraiser», «Hornblower» und «Billy Elliot – I Will Dance». Aus Leidenschaft für antike Geschichte bemalte er 3500 mazedonische, thrakische, galatische, römische und viele andere Zinnsoldaten – und begann schließlich zu schreiben. Mit seiner epischen historischen Romanserie «Vespasian» über das Leben des römischen Kaisers wurde Robert Fabbri in Großbritannien Bestsellerautor.
Mehr zum Autor und zu seinen Büchern: www.robertfabbri.com
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «Vespasian. The Furies of Rome» bei Corvus/Atlantic Books Ltd., London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«The Furies of Rome» Copyright © 2016 by Robert Fabbri
Karten © Peter Palm, Berlin
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karten © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich, nach der Originalausgabe von Atlantic Books Ltd.
Coverabbildung Tim Byrne
ISBN 978-3-644-00630-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meinen Cousin Aris Caraccio, seine Frau Nathalie und ihre Kinder Mathilde, Arthur, Victor und Margaux; und auch für meinen Onkel Giuseppe «Pino» Caraccio in Liebe.
Außerdem für George und Ice, ihre italienischen Corso-Doggen, die meine Vorbilder für die Jagdhunde Castor und Pollux waren – mit großer dichterischer Freiheit!
Prolog
Rom, November A.D. 58
Nur wenige konnten Neros Gastmähler genießen. Sie schienen kein Ende zu nehmen, und der heutige Abend bildete keine Ausnahme.
Es lag nicht an der endlosen Abfolge der Speisen, die allesamt köstlich angerichtet waren und von Dutzenden spärlich bekleideter – sofern denn überhaupt bekleideter – Sklaven beider Geschlechter sowie solcher ohne Geschlecht aufgetragen wurden. Es lag auch nicht an der geistlosen Konversation oder den künstlerischen Darbietungen, die aus einer ganzen Reihe heroischer Oden in den vom Kaiser bevorzugten Stilrichtungen bestanden. Sie wurden teils auf Griechisch, teils auf Latein von einem unerträglich selbstgefälligen Leierspieler vorgetragen, der keine Zweifel an seinen eigenen Fähigkeiten kannte und wusste, dass er hoch in der Gunst des Kaisers stand. Selbst die vulgär anmutende Größe der Veranstaltung wäre noch verzeihlich gewesen – auf dreißig Speisesofas lagen jeweils drei Gäste an niedrigen Tischen, die u-förmig um den Gastgeber angeordnet waren –, doch seit Nero regierte, waren derartige Festessen nichts Ungewöhnliches mehr.
Nein, nichts von alledem war der Grund dafür, dass Titus Flavius Sabinus jeder Moment dieser Veranstaltung zur Qual wurde und er zu seinem Herrn Mithras betete, der Abend möge bald zu Ende gehen. Es war ein gänzlich anderer Faktor: Angst.
Die Angst hielt alle im Raum gefangen wie ein unsichtbares Netz, wie wenn bei den Gladiatorenspielen der Retiarius sein mit Bleigewichten beschwertes Netz auswarf und es zuzog, sodass niemand mehr daraus entkommen konnte. Die meisten Gäste waren in diesem Netz der Angst gefangen, auch wenn niemand es sich anmerken ließ. Denn nach gut vier Jahren unter diesem Kaiser hatte die Elite Roms gelernt: Wenn man vor Nero Angst zeigte, stachelte ihn das nur zu noch schlimmeren Exzessen an.
Es war nicht immer so gewesen. In den ersten Jahren seiner Herrschaft hatte Nero sich in Mäßigung geübt, wenigstens in der Öffentlichkeit. Allerdings hatte er seinen Adoptivbruder Britannicus missbraucht und anschließend vergiftet, den leiblichen Sohn und wahren Erben von Kaiser Claudius, der seiner Jugend wegen übergangen worden war. Doch diese Gräueltat konnte, wenigstens soweit es den Brudermord betraf, durch politische Notwendigkeit gerechtfertigt werden: Hätte Britannicus länger gelebt, hätten sich Unterstützer um ihn scharen können, die ihn statt Nero auf dem Thron sehen wollten. Es hätte Zwietracht gegeben, die womöglich eskaliert wäre. Sein Tod, so wurde argumentiert, hatte einem neuen Bürgerkrieg vorgebeugt, Britannicus war also letztlich für das Allgemeinwohl geopfert worden. Deshalb war das Volk bereit zu vergessen, dass der Knabe am Vorabend seines vierzehnten Geburtstags, an dem er das Mannesalter erreicht hätte, ermordet worden war.
Nachdem somit sein einziger ernsthafter Rivale tot war, ebenso wie ein paar weitere weniger bedeutende Widersacher, hatte Nero sich in einem bequemen Leben im Überfluss eingerichtet. Die Regierungsgeschäfte überließ er größtenteils seinem einstigen Lehrer und jetzigen Berater Lucius Annaeus Seneca sowie dem Prätorianerpräfekten Sextus Afranius Burrus. Er selbst widmete sich indessen seinen beiden Leidenschaften, dem Wagenrennen und dem Gesang, beides selbstverständlich im Privaten. Es wäre undenkbar gewesen, dass ein Patrizier, erst recht der Kaiser, öffentlich solch unwürdigen Betätigungen nachging, die sonst nur Freigelassene und Sklaven ausübten. Nero war sich der Würde seines Standes wohl bewusst, und so hielt er seine Vorlieben vor allen bis auf den engsten Kreis auf dem Palatin geheim. Für das Volk von Rom war der sogenannte goldene Kaiser, dessen Haar strahlte wie die Morgenröte, ein aufrechter und gnädiger Herrscher. Davon zeugten auch die großzügigen Spiele und öffentlichen Festessen, die er stiftete. Nach außen hin führte er eine sittsame Ehe mit Claudius’ Tochter Claudia Octavia und betrug sich ganz und gar wie ein würdiger Römer. Dass die Ehe im Grunde genommen inzestuös war, wurde – wiederum für das übergeordnete Wohl – geflissentlich übersehen. Doch hinter der Fassade sah es anders aus.
Inzwischen hatten allerdings alle, die Nero nahestanden, erkannt, dass niemand anders als er selbst sein Verhalten zügeln konnte. Entschied er, es nicht zu tun, so war das sein Vorrecht. Seneca und Burrus hatten sich einst die Aufgabe geteilt, den jungen Princeps zu einem maßvollen und gerechten Herrscher zu formen, doch mittlerweile waren sie machtlos gegen die wachsenden Begierden des nunmehr fast einundzwanzigjährigen Nero.
Und diese Begierden waren groß.
Zu groß, um von seiner steifen, patrizischen Gemahlin befriedigt zu werden, die zu seiner Linken lag. Ihr Gesicht war ausdruckslos wie stets in den vergangenen vier Jahren, seit Nero sie demütigte, indem er sich eine Freigelassene ins Bett holte und ihr, seiner Ehefrau, die Möglichkeit vorenthielt, einen Erben zu empfangen. Doch nicht einmal die Reize der Freigelassenen Acte stellten den wollüstigen jungen Mann zufrieden, der erkannt hatte, dass er alles tun konnte, was ihm beliebte.
Wie sich herausstellte, beliebte ihm so einiges. Dass er die Elite Roms spontan und ohne Vorankündigung zu üppigen Gastmählern rief, mochte zwar lästig sein, doch es war noch die harmloseste seiner Launen. Es gab weit anrüchigere Betätigungen, an denen Nero noch größeres Vergnügen fand. Einer davon würde der Kaiser nachher wohl wieder einmal nachgehen, wie Sabinus erriet, als Tigellinus, der Präfekt der Vigiles, sich seinem Sofa näherte.
Tigellinus, ein Mann mit dunklen Augen und scharfen Gesichtszügen, beugte sich hinunter, um Sabinus ins Ohr zu flüstern: «Von der vierten Stunde an auf dem Quirinal.» Mit einem Grinsen, das dem Ausdruck eines tollwütigen Hundes glich, tätschelte er Sabinus’ Wange, ehe er sich wieder entfernte.
Sabinus griff seufzend nach seinem Becher und leerte ihn in einem Zug, dann hielt er ihn hinter sich. Ein nackter junger Sklave, der am ganzen Körper silberfarben geschminkt war, schenkte ihm nach. Indessen wandte Sabinus sich mit leiser Stimme an seinen beleibten Nachbarn. «Du solltest rasch nach Hause gehen, sobald das Mahl beendet ist, Onkel – sofern es denn jemals endet. Er plant, heute Nacht wieder auszugehen. Tigellinus hat mir mitgeteilt, dass seine Vigiles ab der vierten Nachtstunde nicht mehr auf dem Quirinal patrouillieren, natürlich abgesehen von dem Trupp, der Nero heimlich folgt, um für seine Sicherheit zu sorgen.»
Sein Onkel, Gaius Vespasius Pollo, strich sich eine sorgfältig gekräuselte Locke seines schwarz gefärbten Haares aus den geschminkten Augen und schaute Sabinus an. Er war sichtlich bestürzt, dass die Nachtwachen Roms aus seinem Viertel abgezogen wurden. «Doch nicht schon wieder auf dem Quirinal, lieber Junge? Die Gegend hat sich von seinem Streifzug im vergangenen Monat noch nicht wieder erholt.»
Sabinus nickte und trank nachdenklich einen Schluck aus seinem Becher. «Ein Block mit Mietwohnungen und zwei Häuser sind bis auf die Grundmauern niedergebrannt, außerdem gab es ein halbes Dutzend Vergewaltigungen, unzählige gebrochene Knochen und mehrere Morde. Und Iulius Montanus wurde gezwungen, sich selbst zu töten, weil er es gewagt hatte, sich zu wehren. Er hielt seinen Angreifer für einen Sklaven mit einer albernen Perücke.»
Gaius’ feiste Wangen und sein Doppelkinn zitterten vor Entrüstung. Er nahm sich noch eine Sardellenpastete. «Einen Mann von senatorischem Rang für so etwas zum Selbstmord zu zwingen. Dabei hat er sich entschuldigt, sobald er erkannte, dass der Gegner, den er inzwischen im Schwitzkasten hatte, in Wirklichkeit der Kaiser war. Das ist wirklich unerhört. Es geht nun schon über ein Jahr so. Wie lange müssen wir dergleichen noch erdulden?» Das Gebäck verschwand in Gänze in Gaius’ Mund.
«Du kennst die Antwort: so lange, wie es Nero gefällt. Es ist seine Vorstellung von Vergnügen, und da sein Freund Otho und andere junge Böcke ihn noch ermutigen, kann es nur schlimmer werden.» Sabinus schaute zu dem hochgewachsenen, gutgebauten und überaus attraktiven Mann hinüber, der zur Rechten des Kaisers lag: Marcus Salvius Otho, drei Jahre älter als Nero, war seit dessen zehntem Lebensjahr immer wieder zeitweise der Geliebte des Kaisers.
«Und als Stadtpräfekt, der für Recht und Ordnung verantwortlich ist, stehst du am Ende als der Dumme da, lieber Junge.» Gaius fiel in den stürmischen Applaus ein, den der hemmungslos weinende Nero anführte, nachdem der Leierspieler seinen letzten Vortrag beendet hatte.
Sabinus hob die Stimme, um den übertriebenen Beifall zu übertönen. «Du weißt sehr wohl, dass ich nichts dagegen tun kann. Tigellinus gibt mir Bescheid, von wo er seine Patrouillen abzieht, damit ich eine Centurie der Cohortes urbanae in der Gegend in Bereitschaft halten kann für den Fall, dass Nero schnell in Sicherheit gebracht werden muss oder sein Treiben einen Aufruhr verursacht. Er sagt, er versucht, die Gewalt auf ein Minimum zu begrenzen.»
«Von wegen!», schnaubte Gaius und nahm sich noch eine Pastete. «Ich verwette mein fettes Hinterteil darauf, dass es ihm gar nicht gewalttätig genug zugehen kann. Ihm ist es doch nur recht, wenn wir alle in Angst leben, denn je mehr wir Nero fürchten, desto sicherer ist er in seiner Position und Tigellinus ebenfalls. Glücklicherweise stehen vier von Tigrans Jungs bereit, um mich nach Hause zu eskortieren. Seit er von Magnus die Führung der Bruderschaft vom südlichen Quirinal übernommen hat, muss ich solche Dienste allerdings mit mehr Gefälligkeiten vergelten. Und all das nur, weil du nicht in der Lage bist, deine Pflicht zu erfüllen.»
Sabinus wollte aufbrausen, da kam am anderen Ende des Raumes Unruhe auf. Zur schlecht verhohlenen Empörung der meisten Anwesenden trat die Mätresse des Kaisers ein, die Freigelassene Acte. Sie war überaus vulgär gekleidet, frisiert und mit Schmuck behängt, was bei einer Frau, die es erst kürzlich zu Geld und Stand gebracht hatte, nicht überraschte. Sie hielt inne, damit ihr Gefolge aus Dienerinnen – deren große Zahl wiederum vulgär war – unnötigerweise ihre Kleidung und ihr kunstvoll aufgetürmtes blondes Haar richtete und letzte Hand an ihre übertriebene Schminke legte. Acte schaute sich mit triumphierender Herablassung im Raum um, bis ihr Blick auf Nero fiel. Sie verscheuchte die Frauen, die sich um sie bemühten, und ging geschmeidigen Schrittes auf den Kaiser zu.
Angespanntes Schweigen senkte sich über den Raum. Alle Blicke waren auf die Kaiserin gerichtet.
«Mich dünkt, es ist an der Zeit, dass ich mich zurückziehe, liebster Gemahl», sagte Claudia Octavia und erhob sich anmutig. «Mich hat ein leichter Geruch von etwas Unbekömmlichem angeweht, und es wäre wohl das Beste, wenn ich mich hinlege, damit mein Magen sich wieder beruhigt.» Ohne Neros Zustimmung abzuwarten, schritt Claudia Octavia aufrecht und mit patrizischer Würde hinaus. Neros Aufmerksamkeit galt bereits ganz Actes durchsichtigem Gewand.
«Die Kaiserin hat viele Anhänger», flüsterte Gaius Sabinus zu. «Zum Beispiel Calpurnius Piso, Thrasea Paetus, Roms griesgrämigsten Stoiker, und Faenius Rufus.»
Nero begrüßte nun mit großem Aufheben seine Mätresse, die als Sklavin geboren war, und Acte bemühte sich sehr, alle sehen zu lassen, wie hoch sie in seiner Gunst stand. Indessen warf Sabinus einen verstohlenen Blick zu drei Senatoren mittleren Alters auf einem Sofa ihm gegenüber, die mit missbilligenden Mienen zusahen, wie die Tochter des vorigen Kaisers durch eine ordinär herausgeputzte Sexualakrobatin verdrängt wurde. Ihre Ehefrauen auf dem Sofa neben ihnen weigerten sich demonstrativ, eine solche Beleidigung weiblicher Würde auch nur zur Kenntnis zu nehmen. «Ich habe Faenius Rufus’ Jahresbericht als Präfekt für die Getreideversorgung durchgesehen, und von vereinzelten kleinen Bestechungszahlungen abgesehen scheint es, als hätte er sein Amt nicht dazu genutzt, sich zu bereichern.»
«Er steht von jeher in dem Ruf, geradezu unvernünftig ehrlich zu sein, lieber Junge. Er hat die Moral und Gesinnung eines aufrechten Republikaners aus alten Zeiten – eines Cato, nicht eines Crassus. Was Piso und Thrasea betrifft: Die Götter allein wissen, wie sie darüber denken, dass der Kaiser so mit einer Tochter der Claudier umspringt, auch wenn ihr Vater ein sabbernder Schwachkopf war. Und was sie alle davon halten, wie Nero in der Stadt wütet, das würde ich mir an deiner Stelle gar nicht ausmalen wollen.»
Sabinus erwiderte nichts, sondern widmete sich stirnrunzelnd wieder seinem Becher, während der Leierspieler zur nächsten Ode ansetzte. Innerlich grollte er darüber, dass er als unfähig dastand, die vornehmeren Viertel Roms zu schützen. Fast zwei Jahre war es her, dass Sabinus aus den Provinzen Moesien, Makedonien und Thrakien abberufen worden war, wo er als Statthalter gedient hatte. Anschließend war er überraschend zum Stadtpräfekten von Rom ernannt worden, dem Magistrat, der über die alltäglichen Geschäfte der Stadt wachte. Seitdem hatte Sabinus vergeblich herauszufinden versucht, wessen Einflussnahme er diesen Posten verdankte. Weder sein Onkel noch sein Bruder Vespasian konnten ihm helfen zu ergründen, wer der namenlose Wohltäter war. Natürlich fand Sabinus es beunruhigend, nicht zu wissen, in wessen Schuld er stand und wann er diese Schuld würde begleichen müssen. Andererseits war er sehr froh über das Amt und das damit verbundene Ansehen: Er war einer der fünf einflussreichsten Männer in der Stadt nach dem Kaiser selbst – wenigstens offiziell.
Inoffiziell gab es andere, die mehr Gehör beim Kaiser fanden als er, namentlich Seneca, Burrus und die Konsuln, vor allem aber Otho und Tigellinus. Sabinus war zwar Tigellinus’ Vorgesetzter, da die Vigiles ebenso wie die Cohortes urbanae dem Befehl des Präfekten von Rom unterstanden, doch Tigellinus war unmöglich zu beherrschen. Mit seiner schamlosen Verderbtheit hatte er die Gunst des Kaisers erlangt, in dem er auf Anhieb einen verwandten Geist erkannt hatte. Tigellinus war derjenige gewesen, der Britannicus festhielt, während Nero ihn schändete, hier in diesem Raum bei jenem Abendessen, das für den Knaben tödlich ausging. Diese Unfähigkeit, seinen Untergebenen unter Kontrolle zu halten, raubte Sabinus’ Stellung den Glanz. Er hatte das Gefühl, dass der Eindruck entstand, er billige all die Gewalt. Diese hatte sich mit der Zeit noch gesteigert, da immer mehr junge Männer die Gelegenheit nutzten, es dem Kaiser gleichzutun, wenn er hemmungslos in der Stadt wütete.
«Ich schließe aus dem Austausch vorhin», drang eine Stimme in Sabinus’ Gedanken, «sollen wir es einen Austausch nennen? Nein, das geht nicht, denn Ihr habt Tigellinus mit keiner Silbe geantwortet, nicht wahr, Präfekt? Sagen wir also, es war ein Befehl, ja, Präfekt, ein Befehl von Eurem Untergebenen. Ich schließe also aus diesem Befehl, dass Nero heute Nacht wieder einmal ausgeht.»
«Sehr scharfsinnig, Seneca», versetzte Sabinus, ohne sich umzuschauen.
«Ein weiterer Triumph für Recht und Ordnung in Rom. Da frage ich mich doch, ob ich gut daran getan habe, das sehr beträchtliche Bestechungsgeld anzunehmen. Vielleicht hätte ich mich zum allgemeinen Wohl mit einer geringeren Summe begnügen und dafür sorgen sollen, dass ein fähigerer Mann als Ihr den Posten bekommt.»
Sabinus sah sich noch immer nicht um. «Wann habt Ihr jemals etwas für das allgemeine Wohl getan?»
«Das ist hart, Sabinus. Ich setze mich seit Jahren dafür ein, dass der Kaiser sich in seinem Verhalten mäßigt.»
«Inzwischen könnt Ihr ihn kaum noch zurückhalten. Ich nehme an, es bereitet Euch Vergnügen, mich als Stadtpräfekten dumm dastehen zu lassen. Da wir gerade davon sprechen: Wer hat Euch eigentlich bestochen, damit Ihr mir das Amt verschafft?»
«Ich sagte doch bereits: Als ein Mann von strengen moralischen Grundsätzen kann ich eine solch vertrauliche Information nicht preisgeben. Nicht ohne angemessenen, wie soll ich es am besten nennen … hmm … Anreiz, ja, genau, Anreiz. Aber das nur am Rande – ich wollte eigentlich wegen Eurer Anfrage mit Euch sprechen.»
«Ach ja?» Sabinus blickte stur nach vorn.
«Ja. Die Konsulate sind alle vergeben …»
«Ihr meint wohl verkauft.»
«Macht Euch nicht lächerlich, der Kaiser erkauft sich das Konsulat nicht.»
«Schade für Euren Geldbeutel.»
«Das habe ich überhört. Frühestens in drei Jahren kann Euer Schwiegersohn mit einer Ernennung rechnen, und der Preis ist nicht verhandelbar: zwei Millionen Sesterzen.»
«Zwei Millionen! Das ist das Doppelte des Vermögens, das ein Mann besitzen muss, um in den Senat aufgenommen zu werden.» Nun wandte Sabinus sich doch um, aber er sah nur noch, wie Senecas stattliche Gestalt sich entfernte. Er beobachtete, wie Neros oberster Berater sich unauffällig Marcus Valerius Messalla Corvinus näherte, Sabinus’ und Vespasians Erzfeind. Corvinus hatte seinerzeit Sabinus’ inzwischen verstorbene Frau Clementina entführt und sie Caligula ausgeliefert, der sie mehrmals brutal geschändet hatte. Augenblicklich vergaß er seine Empörung über Senecas Forderung, denn seine Neugier war geweckt. «Worüber verhandelt Corvinus gerade mit Seneca, Onkel?»
«Hmm, wie, lieber Junge?»
Sabinus wiederholte die Frage.
«Über einen einträglichen Statthalterposten. Gerüchten zufolge ist er auf Lusitanien aus, wegen der Steuereinnahmen aus dem Handel mit Garum. Wie du dir sicher denken kannst, steckt in Fischsoße eine Menge Geld.»
«Ich frage mich nur, wie er die erforderliche Summe aufbringen will, um Seneca zu bestechen.»
«Ganz einfach: Wenn Corvinus sich nicht an den exorbitanten Zinsen stört, wird Seneca selbst ihm das Geld für seine eigene Bestechung leihen, vorausgesetzt, Corvinus kann einen Bürgen beibringen. Der wird ihn wiederum einiges kosten, aber wenn er dafür Lusitanien bekommt, ist es den Aufwand wert.»
Also so laufen die Dinge heutzutage, sinnierte Sabinus: Seneca war anscheinend einzig daran interessiert, ein Vermögen anzuhäufen, indem er seine Position ausnutzte – sehr zur heimlichen Belustigung der wenigen, die seine philosophischen Abhandlungen gelesen hatten. Allerdings war Seneca in dieser Hinsicht kein Einzelfall: Sein Vorgänger Pallas, während Claudius’ Regierungszeit und zu Beginn von Neros Herrschaft der wichtigste Unterstützer der Flavier, war als Claudius’ vertrautester Berater zu beträchtlichem Reichtum gelangt, ehe er zusammen mit seiner Geliebten, Neros Mutter Agrippina, bei Nero in Ungnade gefallen war. Nun war Pallas auf seine Landgüter verbannt und spielte keine Rolle mehr in der hohen kaiserlichen Politik. Immerhin hatte er noch mehr Glück gehabt als Narcissus, der Mann, den er überflügelt und von seiner Position verdrängt hatte: Narcissus war hingerichtet worden, trotz seines Vermögens oder vielleicht auch gerade deswegen.
Sabinus hatte keine Ahnung, wie er die ungeheuerliche Summe auftreiben sollte, die Seneca dafür forderte, seinem Schwiegersohn Lucius Caesennius Paetus zum Konsulat zu verhelfen. Es sei denn, er lieh sich das Geld von Seneca selbst, doch so weit würde es niemals kommen. Sabinus richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das Thema, von dem er abgelenkt worden war, als er am Nachmittag die Einladung des Kaisers zum Abendessen erhalten hatte. Manche Pflichten des Präfekten von Rom waren weniger leidig als andere, und die Befragung Gefangener, welche eine Bedrohung für die Sicherheit des Imperiums darstellten, zählte zu den angenehmeren Aufgaben. Wenn der Betreffende kein Bürger mehr war und Sabinus somit freie Hand hatte, konnte ein solches Verhör geradezu ein Vergnügen sein. In diesem Fall wurde das Vergnügen zusätzlich dadurch versüßt, dass es sich nicht direkt um eine kaiserliche Angelegenheit handelte: Sein Bruder Vespasian hatte den Mann zu ihm geschickt, damit er ihn einkerkerte und verhörte. Es ging um einen Gefallen, den Vespasian vergelten musste, auch wenn Sabinus nicht wusste, was für einen Gefallen und gegenüber wem.
«Meine Freunde», drang Neros heisere Stimme durch den Applaus für die letzte Ode, welche die Geduld der Zuhörer erheblich strapaziert hatte. Sabinus wurde neuerlich aus seinen Gedanken gerissen. «Ich wünschte, wir hätten Zeit, noch länger dieses erhabene Geschenk der Götter zu genießen.» Nero hob eine Hand gen Himmel und schaute hinauf, einen Ausdruck tiefster Dankbarkeit im Gesicht. Dann richtete er den Blick auf den Leierspieler, atmete lange und tief ein und schloss die Augen, als röche er den lieblichsten Duft. «Terpnus hier wurde von Apollon mit einer honigsüßen Stimme und geschickten Fingern gesegnet.»
Im Publikum erhob sich zustimmendes Raunen, auch wenn diejenigen, die wirklich ein musikalisches Gehör besaßen, Neros Feststellung übertrieben fanden.
Nero nickte Terpnus zu, dann richtete er sich zu seiner vollen Größe auf und holte noch einmal tief Luft. Terpnus zupfte einen Akkord, und zur allgemeinen Verblüffung – wobei manche überraschter schienen als andere – brachte Nero einen langen, vibrierenden Ton hervor. Er kam dem Akkord, den Terpnus gezupft hatte, einigermaßen nahe, war allerdings nicht annähernd so kraftvoll und anhaltend. Neros Zuhörer jedoch entschieden, den Ton als Zeugnis unermesslichen künstlerischen Genies zu deuten statt als den beklagenswerten Missklang, der er in Wirklichkeit war. Sie brachen in stürmischen Beifall aus, sobald der Ton auf den Lippen des Kaisers jämmerlich erstorben war. Hochgestellte Frauen, die Nero brutal geschändet hatte, und andere, die fürchteten, bald dasselbe Schicksal zu erleiden, klatschten sittsam, während ihre Ehemänner dem Mann zujubelten, der ihre Frauen entehren und sie selbst um ihr Vermögen und ihr Leben bringen würde. Sabinus und Gaius schlossen sich dem Applaus an, wobei sie es vermieden, einander in die Augen zu sehen.
«Meine Freunde», setzte Nero wiederum heiser an, «seit nunmehr drei Jahren unterrichtet Terpnus mich und fördert das angeborene Talent zutage, das in Eurem Kaiser steckt. Ich habe mit Bleigewichten auf der Brust dagelegen, ich habe Klistiere und Brechmittel angewandt sowie Äpfeln und anderen Speisen entsagt, welche der Stimme schaden. All das habe ich unter Anleitung des größten Sängers unserer Zeit getan, und so werde ich nun bald bereit sein, für Euch zu singen!»
Einen Moment lang blieb es still. Es war eine widerwärtige Vorstellung, ein Tabubruch, dass eine bedeutende Person – erst recht der Kaiser – öffentlich als Sänger auftreten sollte. Dann erhob sich überschwänglicher Jubel, als hätte Nero eben genau das angekündigt, wonach jeder Einzelne sich innig gesehnt und das er doch bis jetzt nicht für möglich gehalten hätte.
Nero stand seitlich, die linke Hand auf dem Herzen, die rechte seinen Gästen entgegengestreckt. Tränen liefen über seine blassen Wangen in den goldenen Bartflaum unter dem Kinn, das trotz seiner Jugend bereits durch das Gewicht des üppigen Lebensstils zu hängen begann. In dieser Pose sonnte er sich in den Huldigungen. «Meine Freunde», sagte er schließlich in rührseligem Ton, «ich verstehe Euer Glück. Dass ich Euch endlich an meinem Talent teilhaben lassen kann, welches sich durch meine Stimme ausdrückt, ist das Schönste, das ich kenne.»
Acte, die inzwischen Claudia Octavias Platz eingenommen hatte, schien von dieser Einschätzung wenig angetan.
«So schön wie meine neue Frau, Princeps?», fragte Otho hörbar angeheitert. Da er Nero seit langem nahestand, durfte er sich als einziger Mann in Rom solche Scherze erlauben.
Nero war keineswegs verärgert über die Unterbrechung. Er drehte sich um und lächelte seinen Freund und zeitweiligen Geliebten an. «Du rühmst schon den ganzen Abend Poppaea Sabinas Reize, Otho. Wenn du sie nach Rom holst, werde ich vor ihr singen, und dann magst du urteilen, was schöner ist, deine neue Frau oder meine Stimme.»
Otho hob seinen Becher, um Nero zuzuprosten. «Das werde ich tun, Princeps, und anschließend werde ich über den Sieger herfallen. Sie wird in vier Tagen hier sein.»
Das gab Anlass zu lauten Ausrufen und derben Witzen seitens der jungen Böcke, die sich selbst zum engeren Kreis um den Kaiser zählten. Gleich darauf brachte Nero sie mit einem vernichtenden Blick zum Schweigen. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, wandelte sich seine Miene zu einem Ausdruck demütigster Bescheidenheit. «Bald, meine Freunde, werde ich für Euch bereit sein. Bis dahin werde ich weiter üben. Lebt wohl.» Mit gezierten Gesten forderte er Acte, Otho, Terpnus und seine jungen Schmeichler auf, ihm zu folgen, dann wandte Nero sich ab und ging hinaus. Damit war das Gastmahl beendet, und alle, die zurückblieben, konnten aufatmen, denn mit ihm verließ die Angst den Raum.
«Mir wird schon nichts geschehen, lieber Junge», versicherte Gaius, als er und Sabinus das Forum Romanum erreichten. Die Pflastersteine, nass vom leichten Nieselregen, glänzten im Schein der zahlreichen Fackeln ihrer Leibgarde und anderer Gruppen, die ebenfalls auf dem Heimweg waren. «Es ist ja nur eine halbe Meile den Hügel hinauf, und Tigrans Jungs passen auf mich auf.»
Sabinus blickte skeptisch drein. «Du solltest dich trotzdem beeilen.» Er schlug dem größten und bulligsten der vier Männer auf die Schulter. «Sucht keinen Streit, Sextus, und bleibt auf den breiteren Straßen, wo es heller ist.»
«Alles klar, Herr, keinen Streit suchen und auf den breiteren Straßen bleiben», erwiderte Sextus, der seine Befehle wie immer schwerfällig verarbeitete. «Und richtet Senator Vespasian und Magnus schöne Grüße von allen Jungs aus, wenn Ihr sie seht.»
«Das werde ich.» Sabinus fasste seinen Onkel am Arm. «Wir brechen zur zweiten Stunde des Tages nach Aquae Cutiliae auf, Onkel.»
«Ich erwarte euch mit meinem Wagen an der Porta Collina. Hoffentlich hält meine Schwester noch die zwei Tage durch, bis wir dort sind.»
Sabinus lächelte. Sein rundes Gesicht, halb im Dunkeln, halb im Schein der Fackeln, nahm einen nachdenklichen und betrübten Ausdruck an. «Mutter ist eine entschlossene Frau. Sie wird den Styx nicht überschreiten, ehe sie uns noch einmal gesehen hat.»
«Vespasia neigt von jeher dazu, den Männern zu trotzen. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie absichtlich vor unserer Ankunft sterben würde, damit wir ein schlechtes Gewissen haben, weil wir unsere Abreise um einen Tag verschieben mussten.»
«Es ging nun einmal nicht anders, Onkel. Privatsachen müssen hinter den Angelegenheiten Roms zurückstehen.»
«So ist es von jeher gewesen, lieber Junge. Nun denn, wir sehen uns morgen.»
Sabinus schaute seinem Onkel nach, während er durch eine Arkade auf das Caesarforum am Fuß des Quirinals ging. Seine Leibwächter umringten ihn wie vier fackeltragende Kolosse, um die Gefahren einer Stadt abzuwehren, die nachts zur wilden Bestie wurde.
Als Gaius außer Sicht war, sandte Sabinus ein stummes Gebet an seinen Herrn Mithras, er möge seine sterbende Mutter noch für zwei Tage erhalten. Dann wandte er sich ab und ging die paar Schritte zum Tullianum am Fuß des Kapitolinischen Hügels.
«Wie geht es ihm, Blaesus?», erkundigte sich Sabinus, als ein muskelbepackter, kahlköpfiger Mann in Tunika und fleckigem Lederschurz ihm die eisenverstärkte Tür öffnete.
Blaesus zuckte die Schultern. «Ich habe ihn nicht angerührt, Präfekt. Hin und wieder höre ich von dort unten Stöhnen, ansonsten ist er ruhig. Jedenfalls hat er nicht geplaudert, falls Ihr das wissen wolltet.»
«Ja, das wollte ich wohl», seufzte Sabinus. Er setzte sich auf den einzigen bequemen Stuhl in dem niedrigen Raum und schaute zu einer Falltür im hinteren Bereich hinüber, die im schwachen Schein einer Öllampe auf dem einzigen Tisch eben noch zu erkennen war. «Nun, dann sollten wir ihn heraufholen und weitermachen. Ich denke, diesmal versuchen wir es mit einem etwas stärkeren Anreiz. Ich brauche die Antwort noch heute Nacht, denn morgen früh verlasse ich die Stadt für ein paar Tage.»
Blaesus gestikulierte in eine Ecke. Dort im Schatten erhob sich ein haariger Riese von einem Mann, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, von einem Haufen Lumpen, auf dem er eingerollt gelegen hatte. In einer Hand hielt er einen Knochen, über dessen Herkunft Sabinus lieber nicht nachdenken mochte. «Runter mit dir, Grazie», sagte Blaesus und zog an einem Strick, um die Falltür zu öffnen. «Hol ihn rauf. Und beiß ihn nicht mehr als ein Mal.»
Grazie grunzte. Sein Gesicht, das flach war, als hätte jemand mit einer Schaufel darauf eingeschlagen, verzog sich zu einem hässlichen Grinsen. Er ließ seinen Knochen fallen und nickte heftig zum Zeichen, dass er die Anweisungen verstanden hatte. Sabinus sah zu, wie das Monstrum durch das Loch im Boden verschwand. Angewidert von dem Anblick, fragte er sich kurz, wie die Kreatur in Wirklichkeit heißen mochte, doch er fand es weit unter seiner Würde, sich danach zu erkundigen.
Ein Schmerzensschrei drang aus der Zelle, dem einzigen anderen Raum in Roms öffentlichem Gefängnis, und hallte von den nackten Steinwänden wider. Auf den Schrei folgte ein Knurren. Sabinus nahm an, dass Grazie den Gefangenen ermunterte, sich in Bewegung zu setzen. Augenblicke später erschien durch das Loch im Boden der Kopf des einzigen Insassen des Tullianums. Der Mann zog sich in verzweifelter Hast hoch, um der abscheulichen Bestie zu entkommen, die ihn von unten antrieb. Ein paar rasende Herzschläge später war der verstörte Gefangene dem dunklen Loch entstiegen, nackt, aber unversehrt. Das lange Haar und der Schnurrbart waren schmutzig und verfilzt.
«Guten Abend, Venutius», begrüßte Sabinus ihn freundlich, als wäre der Anblick des Mannes Anlass zu größter Freude. «Wie schön, dass Ihr es vermeiden konntet, von Grazie zum Abendessen verspeist zu werden. Nun können wir uns vielleicht wieder dem Thema zuwenden, über das wir bereits heute Nachmittag sprachen.»
Venutius richtete sich auf. An seiner Brust, seinen Armen und Beinen zeichneten sich ausgeprägte Muskeln ab, und seiner Nacktheit zum Trotz strahlte er Würde aus, als er auf seinen Kerkermeister hinunterschaute. «Ich habe Euch nichts zu sagen, Titus Flavius Sabinus, und da ich ein Bürger Roms bin, könnt Ihr mir nichts antun, ehe ich von meinem Recht Gebrauch gemacht habe, an den Kaiser zu appellieren.»
Sabinus lächelte freudlos. «Eure Rechte habt Ihr verwirkt, als Ihr die Briganten in eine Revolte gegen Rom führtet. Wie ich Euch bereits mitgeteilt habe, wurde Euch das Bürgerrecht aberkannt, und Ihr werdet wohl niemanden finden, der Einwände dagegen hätte, dass einem Verräter sein gesetzlicher Schutz entzogen wird. Der Kaiser weiß nicht, dass Ihr Euch in Rom befindet, und Ihr könnt froh darüber sein, denn ich denke, er würde Euch auf der Stelle hinrichten lassen. Ich frage Euch also noch ein letztes Mal im Guten: Von wem hattet Ihr das Geld, mit dem Ihr Eure Rebellion in Britannien finanziert habt?»
Venutius zuckte zusammen und wich von der Falltür zurück, denn nun kam Grazie wieder zum Vorschein. Das Monstrum knurrte leise vor sich hin und verfiel dabei in eine Art Singsang, als wäre es mit seinem Werk zufrieden. «Ich stehe unter dem Schutz von jemandem, der dem Kaiser sehr nahesteht. Ihr könnt mich nicht anrühren», erklärte Venutius, nachdem Grazie den Knochen aufgehoben und sich wieder auf seinen Lumpen niedergelassen hatte, um daran zu nagen.
«Und ich wurde von jemandem, der dem Kaiser sehr nahesteht, herauszufinden ersucht, woher Ihr das viele Geld hattet.» Das war eine Lüge, doch Sabinus fand, dass es der Wahrheit nah genug kam, um glaubhaft zu sein. «Und diesem Jemand ist sehr daran gelegen, es rasch herauszufinden, genau genommen noch heute Nacht.» Sabinus nickte Blaesus zu.
«Grazie!», rief Blaesus im Befehlston. «Leg den Knochen weg.»
Das Ungeheuer stieß ein tiefes, langgezogenes Grollen aus und gehorchte sichtlich widerstrebend.
«Er wird bald hungrig werden, wenn er nicht an seinem Knochen nagen darf», bemerkte Sabinus an Venutius gerichtet. Der beäugte die haarige Kreatur in der Ecke sichtlich besorgt.
Grazie knurrte nochmals. Venutius warf Sabinus einen raschen Blick zu, dann schaute er wieder zu dem Monstrum. «Niemand hat meine Rebellion finanziert, das Geld war mein eigenes. Nachdem meine Frau, diese Hure Cartimandua, sich von mir abgewandt und stattdessen den Emporkömmling Vellocatus zum Gemahl genommen hatte, beschloss ich, mich zu rächen und sie zu stürzen. Und das habe ich mit Vergnügen getan.»
«Aber es war kostspielig, so viele Krieger um Euch zu scharen und sie zu unterhalten. Und als Ihr dann noch die Überlebenden aus Cartimanduas Streitmacht aufgenommen habt, bedeutete das noch größere Unkosten.»
Grazie knurrte noch einmal, erhob sich mit einem lauten Furz und betrachtete Venutius geifernd.
Venutius erklärte hastig: «Ich habe Cartimanduas Schatzkammer gefunden, sie war reichlich gefüllt. Lauter frisch geprägte silberne Denare, zigtausend davon, und dazu Hunderte, wenn nicht Tausende goldener Aurei.»
«Römische Münzen, die Ihr dazu benutzt habt, gegen Rom zu rebellieren», stellte Sabinus fest, während Grazie mit schwerfälligen Schritten den Raum durchquerte.
Venutius’ Gesicht verriet etwas, das man bei einem britannischen Häuptling nicht oft sah: Angst. «Ich konnte nicht einfach aufhören, nachdem ich Cartimandua besiegt hatte. Die Druiden haben meine Männer aufgehetzt, Myrddin, der oberste Druide von ganz Britannien, kam zu uns. Um meinen Stand zu behaupten, musste ich eine Rebellion gegen die römische Herrschaft anführen.» Venutius begann, vor Grazie zurückzuweichen. Das Ungeheuer warf einen raschen Blick zu seinem Herrn.
Blaesus lächelte und nickte seiner Kreatur aufmunternd zu.
Venutius stand jetzt mit dem Rücken zur Wand. Grazie kam knurrend und fauchend näher. «Ich hatte keine Wahl.»
«Doch, die hattet Ihr durchaus. Ihr hättet hierher nach Rom zu Eurem Wohltäter fliehen können, um an die Gnade des Kaisers zu appellieren. Stattdessen habt Ihr all das frisch geprägte Geld gegen den Kaiser eingesetzt. Und nun versucht Ihr, die Schuld auf die Druiden zu schieben.»
Mit einem überraschend behänden Sprung fiel Grazie den britannischen Häuptling an, und das Knurren steigerte sich zu einem hungrigen Brüllen. Venutius schrie auf, als die Bestie ihn auf den Rücken warf, sich auf ihn stürzte und seine Brust zerkratzte.
Sabinus erhob sich und beobachtete die albtraumhafte Szene äußerlich ungerührt. «Also, woher kam das Geld?»
«Es war ein Darlehen!», schrie Venutius, als Grazie das Maul aufriss, spitze Zähne entblößte und sich zu seiner Beute hinunterbeugte.
«Und das Geld Eurer Frau?»
«Das auch. Jetzt ruft diese Kreatur zurück!»
Mit einem genüsslichen Knurren schlug Grazie die Zähne in Venutius’ Brustmuskeln und begann, sie mit ruckartigen Kopfbewegungen zu zerfleischen wie ein wildes Tier.
Venutius’ Schreie hätten selbst den Frieden des Hades erschüttert. Er flehte um Gnade, schluchzend vor Grauen, da die Bestie ihn verschlingen wollte. Doch Grazie ließ nicht von ihm ab. Venutius’ Schreie steigerten sich. Vergebens schlug er mit den Fäusten auf den haarigen Rücken und Kopf des Ungeheuers ein, den Blick flehentlich auf Sabinus gerichtet.
«Wer hat Euch und Eurer Frau diese Darlehen gewährt?», fragte Sabinus stirnrunzelnd.
Grazie riss den Kopf hoch, dass das Blut spritzte. Im schwachen Licht erschienen die Tropfen schwarz.
Venutius starrte voller Entsetzen auf den triefenden Klumpen, der aus dem grässlichen Maul hing. Mit aufgerissenen Augen sah er zu, wie Grazie sein eigenes kostbares Fleisch kaute. Dann stieß er einen Schrei aus, der noch lauter war als alle vorherigen: «Seneca!»
Teil I
Aquae Cutiliae, November A.D. 58
I
Sie lag im Sterben, daran zweifelte Vespasian nicht, als er auf seine Mutter Vespasia Polla hinunterschaute. Durch das schmale Fenster über ihrem Bett drang das Licht des Spätnachmittags in die kleine, schlicht eingerichtete Schlafkammer. Von hier aus würde Vespasia ihre letzte Reise antreten. Ihre faltige Haut wirkte wächsern, ihr Gesicht friedvoll: Die Augen waren geschlossen, die schmalen, aufgesprungenen Lippen öffneten sich zitternd mit jedem unregelmäßigen Atemzug, und ihr langes graues Haar lag offen über das Kissen gebreitet. Eine ihrer Leibsklavinnen hatte es so hergerichtet, dass es ihr noch im Sterben weibliche Würde verlieh.
Vespasian nahm die zarte Hand etwas fester in seine beiden Hände und sprach ein Gebet an seinen Schutzgott Mars. Er betete, der Bote, den er nach Rom entsandt hatte, möge schnell vorangekommen sein und sein Bruder und sein Onkel möchten eintreffen, ehe seine Mutter die Dienste des Fährmanns benötigte. Er versprach dem Gott einen weißen Stier, wenn sie rechtzeitig kämen.
Da fühlte Vespasian eine Berührung an der Schulter. Als er aufblickte, stand Flavia neben ihm, die Frau, mit der er seit neunzehn Jahren verheiratet war.
Er war so innig ins Gebet versunken gewesen, dass er sie nicht bemerkt hatte. Sie war aufwendig geschminkt und reichlich mit Schmuck behängt, trug ihr Haar kunstvoll hochgesteckt und war mit einer scharlachroten Stola und einer safrangelben Palla aus edelster Wolle bekleidet, die ihre Figur vorteilhaft zur Geltung brachten. Vespasian ärgerte es, dass sie das Sterbezimmer in solcher Aufmachung betrat, als gälte es, hochstehende Besucher zu empfangen. Doch er verbiss sich eine Bemerkung darüber, denn er wusste, Flavia wäre es niemals eingefallen, sich dem Anlass entsprechend in Schlichtheit zu üben. Stattdessen erkundigte er sich: «Sind die Jungs noch mit Magnus und seinen neuen Jagdhunden unterwegs?»
«Titus schon, aber Domitian ist vor einer halben Stunde mit einem der Jagdsklaven zurückgekommen. Er schmollte, weil Magnus ihn wegen irgendetwas gescholten hatte. Dann hat er seine Schwester gekniffen und gekratzt.»
«Domitilla hat schon Schlimmeres von ihm erduldet.»
«Sie ist doppelt so alt wie er und wird bald heiraten, es geht nicht an, dass sie sich von einem Siebenjährigen so etwas gefallen lassen muss. Ich habe ihn seiner Kinderfrau übergeben, sie weiß ihn zu bändigen. Und ich habe ihm versprochen, dass er von dir die Tracht Prügel seines Lebens bekommt, nachdem …» Flavia sprach nicht aus, was ihren Mann davon abhielt, seinen jüngsten Sohn sofort zu züchtigen. «Möge Mutter Isis ihr Leiden lindern. Soll ich die Ärzte noch einmal rufen lassen?»
Vespasian schüttelte den Kopf. «Was könnten sie schon tun? Wenn sie ihr die Geschwulst aus dem Leib schneiden, stirbt sie schneller, als wenn sie sie darin belassen. Außerdem hat sie die Ärzte beim letzten Mal fortgeschickt.»
Flavia konnte ein Schnauben nicht unterdrücken. «Sie war schon immer der Meinung, alles besser zu wissen.»
Vespasian knirschte mit den Zähnen. «Wenn du unbedingt eine sinnlose Fehde mit einer Sterbenden fortsetzen willst, Flavia, dann solltest du es besser im Geiste allein in deinem Zimmer tun, wo niemand es mit anhören muss. Ich habe jetzt weder Zeit noch Geduld für Weibergezänk.»
Flavia versteifte sich und ließ Vespasians Schulter los. «Es tut mir leid, mein Gemahl, ich wollte nicht respektlos sein.»
«Doch, das wolltest du.» Vespasian richtete die Aufmerksamkeit wieder auf seine Mutter, während seine Frau gereizt den Raum verließ. Ihre Schritte verhallten im Säulengang.
Seit nunmehr gut neunundvierzig Jahren gehörte Vespasia Polla zu seinem Leben. Vespasian drückte noch einmal ihre Hand und dankte ihr. Er wusste, weder er noch sein Bruder hätten das Konsulat erreicht, wenn sie nicht so ehrgeizig darauf gedrungen hätte, dass ihre Söhne es zu etwas brachten. Vespasians Vorfahren väterlicherseits waren ehrbare, ländlich lebende Ritter gewesen, sabinisch in ihrer Abstammung und ihrem Akzent. Vespasia hingegen stammte aus einer Familie, die sich bereits eines Senators rühmen konnte, welcher prätorischen Rang erreicht hatte: ihr älterer Bruder Gaius Vespasius Pollo. Diese Verbindung hatte sie genutzt, um die Laufbahn ihrer Söhne in Rom in Gang zu setzen. Durch Gaius’ Beziehungen zu Antonia, der Nichte des Augustus, Schwägerin des Tiberius, Mutter des Claudius, Großmutter des Caligula und Urgroßmutter Neros, waren sie dann in den Sumpf der kaiserlichen Politik hineingezogen worden. Doch es war ihnen gelungen, darin zu schwimmen und nicht unterzugehen, wenn auch oft nur mit knapper Not. Beide hatten den Cursus Honorum durchlaufen, die Abfolge militärischer und ziviler Ämter, durch welche die Elite Roms aufstieg, und beide hatten den höchsten Rang erreicht, der darin vorgesehen war. Das war weit mehr, als Emporkömmlinge, die nicht aus Senatorenfamilien stammten, erwarten konnten. Sabinus war nach seiner Amtszeit als Konsul sogar zum Statthalter einer Provinz ernannt worden, und gegenwärtig war er der Stadtpräfekt von Rom. Ja, sinnierte Vespasian und rieb sich den dünnen Haarkranz auf dem sonst kahlen Kopf, Vespasia konnte stolz auf das sein, was sie für ihre Familie erreicht hatte.
Doch eines ließ sie in Vespasians Augen unerledigt: Sie nahm ein Geheimnis mit ins Grab, ein Geheimnis, das fast so alt war wie er. Um es zu bewahren, hatte Vespasia alle, die Zeugen des betreffenden Ereignisses gewesen waren, auf Stillschweigen eingeschworen, darunter auch den damals fast fünfjährigen Sabinus. Der Vorfall hatte sich bei der Zeremonie zu Vespasians Namensgebung zugetragen, am neunten Tag nach seiner Geburt, und er hatte etwas mit den Zeichen auf den Lebern der Opfertiere zu tun, eines Ochsen, eines Keilers und eines Widders. Wie diese Male beschaffen gewesen waren, hatte ihm wegen ebenjenes Schwurs niemand sagen können. Allerdings wusste er, dass seine Eltern geglaubt hatten, die Zeichen sagten etwas über seine Zukunft voraus. Als Jüngling von sechzehn Jahren hatte er einmal mit angehört, wie sie in Andeutungen darüber gesprochen hatten. Was ihm vorherbestimmt sein sollte, wusste er jedoch nicht. Und nun ging seine Mutter über den Styx ins Schattenreich hinüber, ohne die anderen von ihrem Schwur zu entbinden. Aufgrund gewisser merkwürdiger Ereignisse in Vespasians Leben und Prophezeiungen, die er gehört hatte, konnte er sich inzwischen vorstellen, was die Omen vor all den Jahren angekündigt haben könnten. Aber der Gedanke war ungeheuerlich und gänzlich abwegig, solange die politischen Verhältnisse so waren, wie sie eben waren, und das Prinzipat in den Händen einer einzigen Familie lag.
Wenn jedoch diese Blutlinie einmal versiegen sollte, was dann? Wenn der Kaiser kinderlos starb, woher sollte dann ein neuer Kaiser kommen?
Deshalb hatte Vespasian daran mitgewirkt, einen Krieg zwischen Rom und dem Partherreich um das nominell unabhängige Königreich Armenien herbeizuführen, der noch immer andauerte. Die Mächte hinter dem Thron begrüßten diesen Kriegszustand, da er dazu beitrug, den jungen Kaiser Nero in seiner Stellung abzusichern. Auch Vespasian wollte das so. Er wollte, dass Nero für einige Zeit herrschte, denn er ahnte – nein, es war mehr als eine Ahnung, es grenzte schon an Gewissheit –, dass Neros Exzesse sich steigern würden. Im Vergleich zu Nero würden selbst die Verderbtheiten seiner Vorgänger wie verzeihliche kleine Schwächen wirken. Wenn es erst so weit gekommen war, dann bezweifelte Vespasian, dass Rom einen weiteren Kaiser aus demselben Geschlecht dulden würde. Und an wen würde Rom sich dann wenden, um das Amt zu besetzen? Der Kandidat musste von konsularischem Rang sein und sich als militärischer Befehlshaber bewährt haben. Solche Männer gab es in Rom einige, darunter auch Vespasian. Aber, so sagte sich Vespasian, wenn es einer wie er werden sollte, warum dann nicht er selbst?
Das war es, was Vespasia nun mit ins Grab nahm: die Bestätigung für Vespasians Ahnung … oder deren Widerlegung. Ihm war klar, selbst wenn sie noch einmal zu Bewusstsein käme, würde er sie niemals umstimmen können.
«Herr?» Eine Stimme riss ihn aus seinen Grübeleien.
Vespasian wandte sich um. In der Tür stand sein Sklave. «Was gibt es, Hormus?»
«Pallo schickt mich mit der Nachricht, dass Euer Bruder eingetroffen ist.»
«Dem Mars sei es gedankt. Sorge dafür, dass unser prächtigster weißer Stier bereit gemacht wird, sobald Sabinus und mein Onkel bei meiner Mutter waren.»
«Euer Onkel, Herr?»
«Ja.»
«Das muss ein Missverständnis sein. Nur Euer Bruder ist gekommen, Euer Onkel ist nicht bei ihm.»
Das Atrium des Haupthauses auf dem Hof der Flavier in Aquae Cutiliae war zwar mit einer Hypokauste ausgestattet, einer Warmluftheizung unter dem Fußboden, und zusätzlich brannte im Herd ein loderndes Holzfeuer, aber nach der Wärme in Vespasias Sterbezimmer kam Vespasian der Raum dennoch kühl vor. Er rieb sich die Arme, während er Hormus über den Mosaikboden folgte, auf dem die diversen landwirtschaftlichen Tätigkeiten der Familie abgebildet waren. Noch ehe sie den Raum durchquert hatten, kam Pallo, der alte Gutsverwalter, von draußen herein und hielt Sabinus die Tür auf. Dieser war staubig und zerzaust von der Reise.
«Weilt sie noch unter uns?», fragte Sabinus, ohne Zeit auf eine Begrüßung zu vergeuden.
Vespasian machte kehrt und ging neben seinem Bruder her. «Nur gerade eben noch.»
«Nun, das muss genügen. Ich glaube, ich habe den Weg von Rom hierher noch nie in so kurzer Zeit zurückgelegt.»
«Hast du Onkel Gaius unterwegs abgehängt?»
Sabinus schüttelte den Kopf. Sie durchquerten jetzt das Tablinum, das Studierzimmer am hinteren Ende des Atriums, und traten von dort ins Peristyl hinaus, den von Säulengängen umgebenen bepflanzten Innenhof. «Ich fürchte nein. Er war nicht in der Verfassung, die Reise überhaupt anzutreten.»
«Was ist denn mit ihm?»
Sie hatten die Tür zu Vespasias Kammer erreicht und hielten inne. Sabinus schaute seinen Bruder voller Besorgnis an – ob wegen ihrer sterbenden Mutter oder der Verfassung ihres Onkels, konnte Vespasian nicht erkennen. «Ich erzähle es dir, wenn wir bei Mutter waren und …»
Er beendete den Satz nicht. Ihnen beiden war vollauf bewusst, wobei sie ihrer Mutter gleich zusehen würden. Vespasian öffnete die Tür und ließ Sabinus den Vortritt. Gerade als er ebenfalls eintrat, schlug Vespasia zu ihrer beider Überraschung die Augen auf. Ihre Lippen verzogen sich zu einem schwachen Lächeln. «Meine Söhne», krächzte sie. «Ich wusste, dass ich euch beide noch einmal zusammen sehen würde, bevor es zu Ende geht.»
Die Brüder traten an ihr Bett. Sabinus setzte sich auf den Stuhl, Vespasian blieb neben ihm stehen.
Vespasia streckte jedem ihrer Söhne eine Hand entgegen. «Ich bin stolz auf das, was ihr für unsere Familie erreicht habt. Nun wird der Name des Hauses des Flavius in Erinnerung bleiben.» Sie hielt inne und tat ein paar unregelmäßige, keuchende Atemzüge, und ihre Lider flatterten. Vespasian und Sabinus schwiegen abwartend. «Aber das war noch nicht alles, meine Söhne. Mars hat gesprochen. Sabinus, ich hinterlasse dir einen Brief, Pallo hat ihn sicher in Verwahrung. Lies ihn und handele danach, wenn du denkst, dass der rechte Zeitpunkt gekommen ist.» Wieder rang sie nach Luft, und die Brüder hielten den Atem an, bis sie weitersprechen konnte: «Ich entbinde dich nicht von dem Schwur, den du vor all den Jahren geleistet hast. Aber da ist ja noch jener zweite Eid, den euer Vater euch beide ablegen ließ – nicht nur bei Mars, sondern bei allen Göttern einschließlich Mithras –, dass ihr einander helfen würdet. Wie er schon sagte, hat dieser Schwur Vorrang vor dem anderen und kann ihn außer Kraft setzen, falls es nötig werden sollte.» Sie drückte die Hände ihrer Söhne, und ihr geschwächter Körper wurde von Husten geschüttelt, der immer heiserer klang.
Vespasian hielt ihr einen Becher Wasser an den Mund. Der Trunk verschaffte ihr sofortige Linderung.
«Und es wird nötig werden, Sabinus», fuhr Vespasia mit merklich schwächerer Stimme fort. «Denn du wirst deinen Bruder führen müssen.» Sie richtete ihre tränenden Augen auf Vespasian. «Und du wirst Führung brauchen. Unentschlossenheit könnte tödlich sein.»
«Ich glaube, ich kenne den Inhalt der Prophezeiung, Mutter», wagte Vespasian sich vor. «Sie besagt –»
«Versuche nicht zu raten, Vespasian», fiel Vespasia ihm ins Wort. Ihre Stimme war nun kaum mehr als ein Flüstern. «Und mache deine Überlegungen keinesfalls öffentlich. Niemand außerhalb der Familie sollte je erfahren, dass es bei der Zeremonie deiner Namensgebung überhaupt außergewöhnliche Omen gab. Du glaubst vielleicht, du könntest die Bedeutung entschlüsseln, doch ich sage dir, das kannst du nicht. Auf den drei Lebern waren drei verschiedene Zeichen. Ich habe sie alle in dem Brief für Sabinus beschrieben, um seine Erinnerung aufzufrischen, da er damals noch so klein war.» Ihr fielen vor Anstrengung die Augen zu, doch sie sprach weiter. «Es geht um das Was, das Wann und vor allem um das Wie.»
«Dann sage es mir jetzt, Mutter.»
Vespasia schien kurz darüber nachzudenken, während sie weiter mühsam atmete. «Das zu tun hieße, die Götter zu versuchen. Würde ein Mensch den genauen Weg, den zeitlichen Ablauf und die Natur seiner Bestimmung kennen, so wären seine Entscheidungen von etwas anderem als seinen eigenen Begierden und Befürchtungen geleitet. Das würde ihn aus dem Gleichgewicht bringen und schließlich verderben. Nicht jede Prophezeiung erfüllt sich.»
«Ich weiß.» Vespasian erinnerte sich, was Myrddin, der unsterbliche Druide von Britannien, zu ihm gesagt hatte, als er versucht hatte, ihn zu töten. «Man hat stets die Möglichkeit, den Tod willentlich auf sich zu nehmen.»
«Man kann aber auch zu angestrengt danach streben, dass die Prophezeiung sich erfüllt. Indem man die Erfüllung herbeizuführen versucht, könnte man den zeitlichen Ablauf verändern, sodass die nötigen Faktoren nicht mehr richtig zusammentreffen und das Ganze deshalb niemals zustande kommt. Ich habe aus zwei Gründen alle Zeugen diesen Eid schwören lassen: erstens damit die Prophezeiung nicht an die Ohren derer dringt, die ihre eigene Position eifersüchtig verteidigen würden. Und zweitens um zu verhindern, dass du die Einzelheiten erfährst. Du solltest stets deinen Instinkten folgen, nicht einem Weg, von dem du glaubtest, er sei dir vorherbestimmt – das hätte in Verderben und Tod geendet.» Vespasia öffnete die Augen wieder. Ihr Ausdruck verriet ebenso wie ihr flacher Atem, wie sehr sie das viele Reden anstrengte. «Was du vielleicht vermutest, mag durchaus eintreffen, Vespasian. Aber den Schlüssel dazu, wie und wann es geschieht, hat Sabinus. Damit du nicht voreilig handelst, wird er dieses Wissen so lange hüten, bis er findet, dass du bereit bist, es zu erfahren. Dann wird er von dem Schwur Gebrauch machen, den dein Vater euch beide füreinander schwören ließ. Ihr seid jetzt aneinander gebunden, meine Söhne. Nun, da ich bald nicht mehr bin, habt nur ihr beide gemeinsam die Macht, diese Familie zu einer der größten Roms zu machen.»
Vespasias Blick glitt langsam von einem Sohn zum anderen. Die Brüder fingen ihn auf und neigten die Köpfe zum Zeichen, dass sie sich ihren Wünschen beugten. In diesem Moment verstärkte sich der Griff ihrer Mutter, die noch immer ihre Hände hielt, ein wenig und erschlaffte dann. Als sie wieder aufschauten, begegneten sie dem starren Blick der Toten, die ihre Mutter gewesen war.
«Ich will nicht! Ich gehe nicht! Sie war nie nett zu mir.» Domitian stand trotzig vor seinen Eltern im Tablinum und schaute zu ihnen auf, die Fäuste geballt, als wollte er zuschlagen. Hinter ihm stand Phyllis, seine Kinderfrau, und hielt ihn mit beiden Händen an den Schultern fest.
«Du meinst wohl, sie hat versucht, dich zu disziplinieren», entgegnete Vespasian. Es fiel ihm schwer, angesichts seines aufsässigen jüngeren Sohnes ruhig zu bleiben. «Und genau das werde ich tun, wenn du dich weigerst, hinzugehen und deiner toten Großmutter deinen Respekt zu erweisen.»
«Du wirst mich für das, was ich heute Nachmittag angestellt habe, sowieso prügeln, also warum sollte ich?»
«Weil ich dich sonst doppelt so fest und doppelt so lange prügeln werde.»
Der Knabe reagierte auf diese Drohung, wie Kinder es seit jeher taten: Er streckte die Zunge heraus und versuchte, sich Phyllis’ Griff zu entwinden. Sie war zwar erst zwanzig, aber sie verfügte bereits über reichlich Erfahrung mit kleinen Jungen, und so hatte sie Domitian an den Haaren gepackt, ehe er zwei Schritte weit gekommen war.
«Bring ihn her», befahl Vespasian und schnallte seinen Gürtel los.
Phyllis, stämmig und resolut, schleifte den widerstrebenden Domitian zu seinem Vater hinüber, der auf einen Tisch zeigte. «Dort drauf.»
Es gelang Phyllis, den zappelnden Knaben bäuchlings auf den Tisch zu legen. Sie hielt ihn an den Schultern mit einem Griff, der fast eines Ringkämpfers würdig gewesen wäre, doch die Füße waren frei, und Domitian trat heftig um sich. Vespasian kümmerte das in seinem Zorn nicht. Es war nichts Neues, dass er wütend auf seinen Sohn war, denn Domitian war ein ungebärdiges Kind. Vespasian wickelte das Gürtelende mit der Schnalle um sein rechtes Handgelenk und nahm das andere Ende in die Hand, sodass der Riemen doppelt lag. Mit der freien Hand drückte er die strampelnden Beine hinunter. Mit einer Mischung aus Trauer um seine Mutter und Wut auf sein Kind, das sich weigerte, ihr im Tod den gebotenen Respekt zu erweisen, prügelte er den schreienden Domitian und hörte erst auf, als Flavia schon sichtlich in Sorge geriet.
Keuchend ließ Vespasian den Gürtel sinken. Da hörte er hinter sich ein Kichern, und als er sich umschaute, spähte seine Tochter Domitilla durch die Vorhänge, die den Raum vom Atrium trennten. «Danke, Vater», sagte sie und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln, das ihn an Flavia damals bei ihrer ersten Begegnung in der Kyrenaika erinnerte. «Das geschieht dem kleinen Scheusal recht.»
Im Sterbezimmer waren Vespasian, Sabinus, Flavia und die drei Kinder um die Tote versammelt. Domitian schniefte leise. Titus, Vespasians Ältester, trug noch seine Jagdkleidung. Vespasia lag unverändert da, wie sie gestorben war, denn bis der Totenritus begann, rührte niemand den Leichnam an. Draußen im Peristyl, wo es schon dämmerte, waren die Freigelassenen der Familie und die Sklaven versammelt, um an der Totenklage teilzunehmen.
Nach einer angemessenen Zeit stillen Gedenkens trat Sabinus als ältester anwesender Blutsverwandter vor und kniete bei Vespasia nieder. «Möge dein Geist hinübergehen», flüsterte er, dann beugte er sich vor, küsste sie auf den Mund und schloss ihre Augen. Damit war besiegelt, dass der Geist den Körper verlassen hatte. «Vespasia Polla!», rief Sabinus laut. «Vespasia Polla!»
Vespasian und die übrigen Angehörigen stimmten ein und riefen ebenfalls den Namen der Verstorbenen. Bald schlossen die Männer des Hausstaats draußen sich an, während die Frauen in lautes Wehklagen ausbrachen. Immer lauter und eindringlicher hallte es durch das Haus.
Vespasian schrie sich fast heiser, doch seine Mutter hatte bereits ihre letzte Reise angetreten und konnte nicht mehr hören, wie er sie beim Namen rief.
Als Sabinus fand, dass des Wehklagens genug war, erhob er sich wieder und fasste die Tote unter den Achseln. Vespasian nahm die Fußknöchel, und gemeinsam hoben sie Vespasia vom Bett und legten sie auf den Boden. Nachdem sie ihr diesen letzten Dienst erwiesen hatten, überließen die Männer den Leichnam Flavia und Domitilla, die ihn gemeinsam mit den anderen Frauen wuschen, einbalsamierten und mit Vespasias schönstem Gewand bekleideten. Dann brachten sie die Tote ins Atrium, wo sie mit den Füßen zur Tür aufgebahrt wurde.
«Es soll also morgen geschehen», sagte Magnus, Vespasians langjähriger Freund, wenngleich von ganz anderem gesellschaftlichen Stand als er. Eben hatte Sabinus vor dem Hausaltar im Atrium das letzte Gebet beendet, nachdem er seiner toten Mutter eine Münze unter die Zunge gelegt hatte.
«Ja», bestätigte Vespasian und entblößte seinen Kopf, den er während der religiösen Zeremonie mit einer Falte seiner Toga bedeckt hatte. «Pallo lässt die Sklaven die ganze Nacht arbeiten, um einen Scheiterhaufen für sie zu errichten und ihr Grab aufzubauen.»
Magnus’ Gesicht, nach achtundsechzig Lebensjahren von Alter und Kämpfen gezeichnet, nahm einen fragenden Ausdruck an. Sein linkes Auge, eine billige Imitation aus Glas, starrte Vespasian ebenso eindringlich an wie das echte. «Ihr Grab aufzubauen? Heißt das, Ihr hattet es bereits in Auftrag gegeben, noch ehe sie überhaupt tot war?»
«Nun, offensichtlich ja, sonst könnten die Sklaven es nicht heute Nacht zusammensetzen.»
«Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Herr, war das nicht etwas voreilig? Ich meine, was, wenn sie sich wieder erholt hätte? Hätte es dann nicht womöglich so ausgesehen, als hättet Ihr gehofft, dass sie sterben würde, und hättet es gar nicht erwarten können, schon alles vorzubereiten?»
«Selbstverständlich nicht. Viele Leute geben Grabdenkmäler im Voraus in Auftrag, weil man mit den Steinmetzen einen günstigeren Preis aushandeln kann, wenn es keine Eile hat.»
Magnus kratzte sich in seinem grauen Haar, sog die Luft durch die Zähne und nickte mit ironischem Ausdruck. «Ah, ich verstehe, so kann man auch im Tod noch sparen. Sehr umsichtig. Schließlich war sie ja nur Eure Mutter, da wollt Ihr natürlich nicht, dass sie Euch unnötige Kosten verursacht, wie?»
Vespasian schmunzelte. Er war es gewohnt, von seinem Freund dafür kritisiert zu werden, dass er so ungern in seinen Geldbeutel griff. «Für meine Mutter macht es keinen Unterschied, ob ihre Asche morgen in einem Grab beigesetzt wird oder ob sie noch vier oder fünf Tage lang in der Urne herumsteht, während ein Steinmetz für das doppelte Geld genau dasselbe Grabdenkmal anfertigt.»
«Bestimmt nicht», pflichtete Magnus ihm bei. Die übrige Familie ging jetzt an Vespasia vorbei, die wie schlafend auf ihrer Bahre lag, ins Triclinium, wo die Haussklaven schon darauf warteten, das Abendessen aufzutragen. «Aber vielleicht sollte Schicklichkeit doch manchmal vor Sparsamkeit gehen, wenigstens wenn es den Tod von Angehörigen betrifft. Man will doch der nächsten Generation kein schlechtes Beispiel geben. Schließlich werden wir alle nicht jünger, wenn Ihr versteht, was ich meine?»
«Oh, gewiss. Aber wenn du damit sagen willst, meine Kinder könnten mir im Tod nicht die gebührende Achtung erweisen, so irrst du: Titus und Domitilla werden mir ein würdiges Grabdenkmal setzen.»
«Wie könnt Ihr das wissen?»
«Weil ich es zugleich mit dem Grab meiner Mutter in Auftrag gegeben habe. Ich habe Rabatt bekommen, weil ich zwei auf einmal bestellt habe!»
Magnus konnte nicht anders, als über die unverhohlene Knauserigkeit seines Freundes zu lachen. «Mir ist nicht entgangen, dass Ihr Domitian nicht als eines der Kinder erwähnt habt, die Euch im Tode angemessen würdigen werden.»
Vespasian schaute mit bedauerndem Kopfschütteln zu seinem jüngsten Sohn hinüber, der gerade von Phyllis in sein Zimmer geführt wurde. Sie hielt ihn fest am Handgelenk, und sein Protest traf auf taube Ohren, denn inzwischen war die ganze Familie daran gewöhnt. Man nahm nicht mehr Notiz davon als vom Plätschern des Springbrunnens im Impluvium. «Ich darf ihn nicht abschreiben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals Achtung vor irgendjemandem oder irgendetwas haben wird, der oder das ihm nicht unmittelbar nutzt.»
«Ich hätte gemeint, das sei bei einem Sohn eine wünschenswerte Einstellung. Ein Zeichen von skrupellosem Ehrgeiz.»
«Normalerweise würde ich dir zustimmen, Magnus – weshalb sollte man Zeit auf etwas verschwenden, das einem keinen Nutzen bringt? Aber wie dir nicht entgangen sein wird, habe ich von ‹unmittelbarem› Nutzen gesprochen. Ich fürchte, da liegt Domitians grundsätzlicher Fehler: Wenn der Nutzen nicht unmittelbar ist, dann hält er ihn der Mühe nicht für wert. Er besitzt keine Geduld und keinen Weitblick. Mit anderen Worten: Ihm fehlt der Sinn dafür, zu planen und Dinge geschickt einzufädeln, und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um in unserer Gesellschaft zu überleben und voranzukommen. Ohne diese Fähigkeit hat er kaum Chancen.»
Magnus wurde sehr ernst. Er dachte kurz nach, dann richtete er sein gutes Auge auf Vespasian. «Wollt Ihr wissen, warum ich Domitian heute Nachmittag nach Hause zurückgeschickt habe?»
«Findest du, ich sollte es wissen?»
«Wahrscheinlich wird es Euch erzürnen, dennoch denke ich, ja, das solltet Ihr. Aber bestraft den Jungen nicht dafür.»
«Nun, dann lass hören.»
Magnus bedeutete Titus mit einer Kopfbewegung, näher zu kommen. «Erzähle deinem Vater, was dein kleiner Bruder heute Nachmittag getan hat.»
Titus, nunmehr achtzehn Jahre alt, war das Ebenbild seines Vaters mit breiter Brust, einem runden Gesicht mit ausgeprägter Nase, großen Ohren und Augen, die meist heiter funkelten. Doch jetzt schaute er bedrückt drein.
«Schon gut», redete Vespasian ihm zu, «ich werde deshalb nichts unternehmen.»
Titus schien skeptisch. «Nun, wenn du darauf bestehst … Es ist schwer zu sagen, wie genau es dazu kam, jedenfalls waren wir schon gute drei Stunden auf der Jagd, ohne dass die Hunde Witterung aufgenommen hätten, und Domitian führte sich so auf wie immer: Er beklagte sich, die Hunde würden sich nicht genug anstrengen, unsere Pferde seien zu langsam, die Sklaven zu laut und Magnus ein unfähiger Jäger, er treffe immerfort falsche Entscheidungen und schlage die falsche Richtung ein. Plötzlich reckten Castor und Pollux die Schnauzen in die Luft, nahmen Witterung auf und rannten los, den mit Gestrüpp bewachsenen Hang hinter der unteren Weide hinauf.»
«Ein gutes Versteck für Rehe, wenn sie auf unserem Weideland aufgestört wurden», bemerkte Vespasian.
«Gewiss, Vater. Deshalb sind wir noch einmal dorthin geritten, nachdem wir beim ersten Mal kein Glück hatten. Tatsächlich kamen ein Bock und seine zwei Ricken aus der Deckung und sprangen schnell den Hang hinauf. Die Hunde rannten kläffend hinterher. Aber eine der Ricken war hochträchtig und blieb hinter den anderen zurück. Castor und Pollux fielen sie an, ehe Magnus sie zurückrufen konnte, damit wir die Beute sauber töten könnten. Magnus war schnell zur Stelle und zerrte seine Hunde fort, aber die Ricke hatte schon zahlreiche Bisse abbekommen, und durch den Schreck hatte die Geburt eingesetzt.» Titus warf einen Blick zu Magnus, der ihm auffordernd zunickte. «Nun, weder Magnus noch ich konnten die Ricke töten, während sie ihr Kitz zur Welt brachte. Ich weiß selbst nicht, warum, es schien einfach falsch, also zogen wir uns ein wenig zurück und warteten ab, dass die Natur ihren Lauf nahm. Endlich war es vorüber, das Kitz taumelte umher, und die Mutter leckte es trotz ihrer Wunden ab. Da beschlossen wir, dass es das Beste wäre, die beiden in Ruhe zu lassen in der Hoffnung, dass sie künftig einmal eine gute Jagdbeute abgeben würden.»