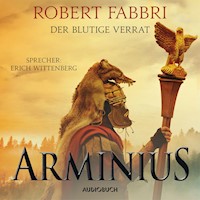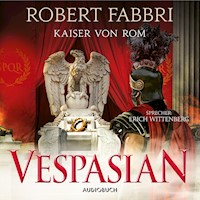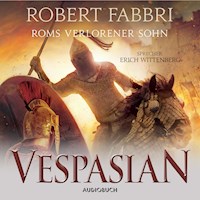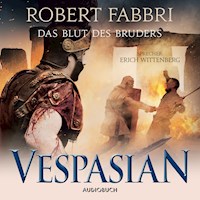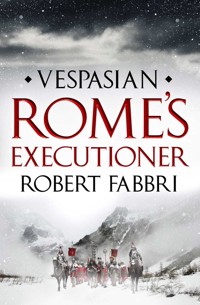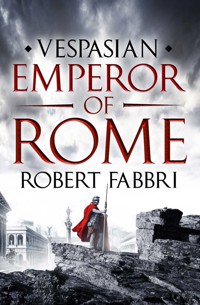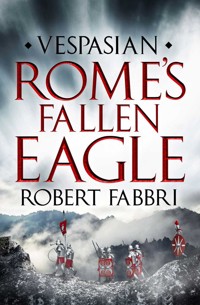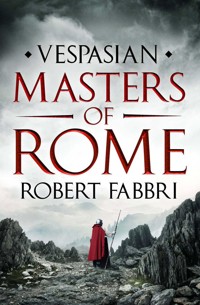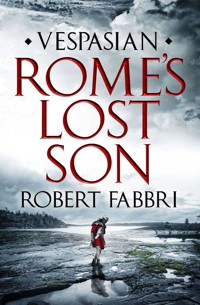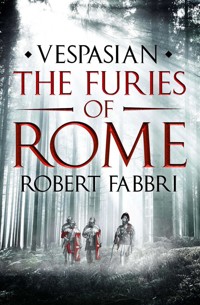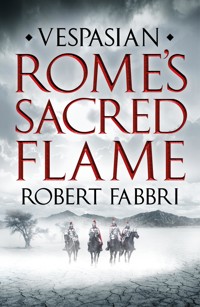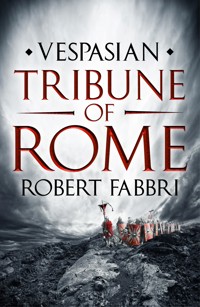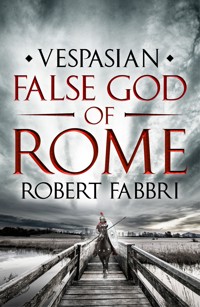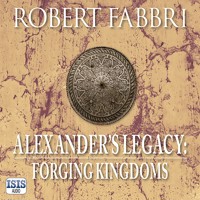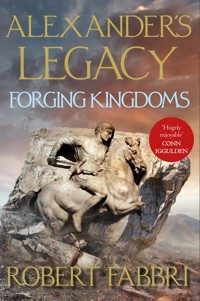9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Vespasian-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Jagd auf ein verlorenes Heiligtum Die Invasion gegen eine gewaltige Streitmacht Wer wird sich den Sieg auf die Fahne schreiben? Im Jahr 41 n. Chr.: Caligula findet seinen gerechten Tod. Nun ist Claudius der neue Kaiser von Rom – aber der unbeholfene Herrscher braucht einen präsentierbaren Erfolg. Vespasian und sein Bruder Sabinus sollen den gefallenen Adler der Legio XVII zurück nach Rom holen, der bei Varusʼ desaströser Niederlage in den Wäldern Germaniens verloren ging. Mithilfe dieser Trophäe will Claudius in Britannien einmarschieren. Die Brüder haben keine Wahl, sie nehmen die Fährte auf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Robert Fabbri
Vespasian. Der gefallene Adler
Historischer Roman
Über dieses Buch
Die Jagd auf ein Relikt wie ein Heiligtum
Die Invasion gegen ein übermächtiges Heer
Wer wird sich den Sieg auf die Fahne schreiben?
Im Jahr 41 n. Chr.: Caligula findet seinen gerechten Tod. Nun ist Claudius der neue Kaiser von Rom – aber der unbeholfene Herrscher braucht einen präsentierbaren Erfolg. Vespasian und sein Bruder Sabinus sollen den gefallenen Adler der XVII Legion zurück nach Rom bringen, ein Relikt, das bei Varusʼ desaströser Niederlage in den Wäldern Germaniens verloren ging. Mit dieser Trophäe will Claudius in Britannien einmarschieren. Die Brüder haben keine Wahl, sie nehmen die Fährte auf …
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
«Vespasian. Rome’s Fallen Eagle»
bei Corvus/Atlantic Books, Ltd., London.
Deutsche Erstausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag,
Reinbek bei Hamburg, März 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Vespasian. Rome’s Fallen Eagle» Copyright © 2013 by Robert Fabbri
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karte © Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich, nach der Originalausgabe von Atlantic Books Ltd
Umschlagabbildung Tim Byrne
Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-40505-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
FÜR MEINE SCHWESTER TANYA POTTER, IHREN MANN JAMES UND IHRE DREI WUNDERBAREN TÖCHTER ALICE, CLARA UND LUCY.
PS: An alle, die sich fragen, was aus meiner Widmung im vorigen Band geworden ist: Ihr werdet euch freuen zu erfahren, dass Anja ja gesagt hat!
Prolog
Eine grell bemalte Komödiantenmaske mit großen Augen grinste dem Publikum starr entgegen. Der Träger führte ein kleines Freudentänzchen auf, den linken Handrücken unter das Kinn gelegt, den rechten Arm ausgestreckt. «Die Tat, die dir so große Sorge macht, tat ich selbst, bekenn’ es offen.»
Die Zuschauer brüllten vor Lachen über diese gut vorgetragenen, bewusst zweideutigen Verse, schlugen sich auf die Schenkel und klatschten in die Hände. Der Schauspieler, der den jungen Liebhaber darstellte, neigte dankend den maskierten Kopf, dann wandte er sich seinem Kollegen auf der Bühne zu, der die groteskere, düstere Maske des Schurken trug.
Ehe die Schauspieler die Szene fortsetzen konnten, sprang Caligula auf. «Wartet!»
Die zehntausend Zuschauer in dem provisorischen Theater am Nordhang des Palatin wandten sich der kaiserlichen Loge zu, die auf hölzernen Stützen genau in der Mitte des Baus aus den Rängen hervorragte.
Caligula imitierte die Haltung des Schauspielers. «Plautus hätte gewollt, dass diese Zeilen so vorgetragen werden.» Er tanzte das Freudentänzchen fehlerfrei, wobei er das breite Grinsen der Maske nachahmte und die eingesunkenen Augen weit aufriss. Das Weiß darin bildete einen scharfen Kontrast zu den dunklen Tränensäcken darunter, den Spuren seiner Schlaflosigkeit. «Die Tat, die dir so große Sorge macht, tat ich selbst, bekenn’ es offen.» Bei der letzten Silbe fasste er sich mit der linken Hand, die zuvor unter dem Kinn gelegen hatte, an die Stirn und warf mit melodramatischer Geste den Kopf zurück.
Das Publikum brach in noch lauteres und stürmischeres Gelächter aus als beim ersten Vortrag, doch die Heiterkeit war erzwungen. Die beiden Schauspieler hielten sich die Bäuche vor Lachen. Caligula gab seine Pose auf, ein höhnisches Grinsen auf dem Gesicht, breitete die Arme weit aus und drehte sich langsam erst nach links, dann nach rechts, um von allen Seiten in dem halbrunden Bau die Verehrung des Publikums entgegenzunehmen.
Ganz zuhinterst im Theater stehend, im Schatten eines der zahlreichen Sonnendächer, die über den steil ansteigenden Sitzreihen angebracht waren, blickte Titus Flavius Sabinus unter seiner Kapuze hervor voller Abscheu auf seinen Kaiser hinunter.
Caligula hob einen Arm, die Handfläche dem Publikum zugewandt, das fast augenblicklich verstummte. Er nahm wieder Platz. «Fahrt fort!»
Während die Schauspieler seinem Befehl gehorchten, begann ein Mann mittleren Alters in Senatorentoga, der Caligula zu Füßen saß, die roten Pantoffeln des jungen Kaisers mit Küssen zu bedecken und sie zu streicheln, als hätte er nie etwas Schöneres gesehen.
Sabinus wandte sich an seinen Begleiter, einen blassen Mann in den Dreißigern mit schmalem Gesicht und rötlichem Haar. «Wer ist dieser schamlose Speichellecker, Clemens?»
«Das, mein lieber Schwager, ist Quintus Pomponius Secundus, der diesjährige erste Konsul, und im Amt vertritt er ungefähr so eigenständige Ansichten wie jetzt gerade.»
Sabinus spuckte aus und umklammerte den Griff des Schwerts, das er unter seinem Mantel verborgen trug. Seine Handfläche war feucht. «Das hier kommt nicht einen Augenblick zu früh.»
«Im Gegenteil, es ist längst überfällig. Meine Schwester lebt seit nunmehr über zwei Jahren mit der Schande, dass Caligula ihr Gewalt angetan hat – weit länger, als es die Ehre zulässt.»
Unten auf der Bühne streckte ein herzhafter Tritt des jungen Liebhabers ins Hinterteil seines Sklaven denselben zu Boden, und das Publikum brach erneut in Gelächter aus. Die Heiterkeit steigerte sich noch, als die Schauspieler eine Verfolgungsjagd über die Bühne begannen, wobei sie immer wieder stolperten, Haken schlugen und sich gegenseitig knapp verfehlten. In der kaiserlichen Loge gab Caligula indessen seine eigene Version einer komödiantischen Verfolgungsjagd zum Besten, indem er seinen lahmen Onkel Claudius hin und her jagte, diesmal zur echten Belustigung der Menge, die Späße auf Kosten eines Krüppels stets genoss. Sogar die sechzehn bärtigen Germanen der Leibgarde an der Rückseite der Loge weideten sich mit allen anderen daran, wie der unselige Mann erniedrigt wurde. Die zwei Prätorianertribune, die zu beiden Seiten standen, unternahmen keinen Versuch, ihre Untergebenen zur Ordnung zu rufen.
«Wollt ihr wirklich diesen Tölpel zum Kaiser machen?», fragte Sabinus. Er musste die Stimme heben, um das immer lauter werdende Gelächter zu übertönen, da nun Claudius’ schwache Beine einknickten und er der Länge nach hinschlug.
«Was bleibt uns anderes übrig? Er ist der letzte erwachsene Nachfahr der julisch-claudischen Linie. Meine Prätorianer würden eine Wiedereinführung der Republik nicht hinnehmen. Sie wissen, dass die Garde dann aufgelöst würde. Sie würden meutern und mich und jeden anderen Befehlshaber, der sich ihnen in den Weg stellt, umbringen, und dann würden sie Claudius ohnehin zum Kaiser machen.»
«Nicht, wenn wir auch ihn töten.»
Clemens schüttelte den Kopf. «Es wäre gegen meine Ehre, seinen Tod zu befehlen, ich bin sein Klient.» Er deutete auf die beiden Prätorianertribune in der Loge, wo Caligula es indessen leid geworden war, seinen Onkel zu drangsalieren, und wieder Platz nahm. Während das Publikum zur Ruhe kam und sich erneut der Darbietung auf der Bühne zuwandte, fuhr Clemens mit gesenkter Stimme fort: «Cassius Chaerea, Cornelius Sabinus und ich sind übereingekommen, dass Claudius Kaiser werden muss. So besteht für uns am ehesten die Hoffnung, das hier zu überleben. Wir haben insgeheim mit seinen Freigelassenen Narcissus und Pallas verhandelt und auch mit Caligulas Freigelassenem Callistus. Er hat erkannt, in welche Richtung die Dinge sich entwickeln, und sich Claudius’ Befürwortern angeschlossen. Sie haben uns zugesichert, dass sie sich bemühen werden, uns vor Vergeltungsaktionen durch Claudius zu schützen. Dessen Ehre würde natürlich verlangen, dass er den Mord an einem Angehörigen rächt, auch wenn er selbst der Nutznießer ist – ein höchst überraschter Nutznießer.»
«Claudius weiß von alldem noch nichts?»
Clemens zog eine Augenbraue hoch. «Würdest du diesem geschwätzigen Trottel solch ein Geheimnis anvertrauen?»
«Und doch wollt ihr ihm das Reich anvertrauen?»
Clemens zuckte die Schultern.
«Ich sage, er sollte sterben.»
«Nein, Sabinus, und ich verlange, dass du das bei Mithras schwörst. Wir hätten unseren Plan schon vor ein paar Monaten umsetzen können, aber wir haben gewartet, bis du nach Rom zurückkehren konntest, um die Tat selbst auszuführen und deine Ehre wiederherzustellen. Bei Jupiters prallem Sack, ich habe bereits eine andere Verschwörung gegen den Kaiser aufgedeckt, um sicherzustellen, dass wir das Vergnügen haben, ihn zu töten.»
Sabinus knurrte zustimmend, denn ihm war sehr wohl bewusst, dass er nicht in der Position war, Einwände zu erheben. In den zwei Jahren seit der Vergewaltigung seiner Frau Clementina und seiner Ernennung zum Legatus der VIIII Hispana durch denselben Mann, der die ungeheuerliche Tat begangen hatte, war er mit seiner Legion fernab von Rom an der Nordgrenze der Provinz Pannonien stationiert gewesen. Ihm war nichts anderes übrig geblieben, als zu warten, bis Clementinas Bruder Clemens – einer der beiden Präfekten der Prätorianergarde – unter seinen Befehlshabern einige ausgemacht hatte, denen Caligulas Exzesse so zuwider waren, dass sie bereit waren, durch einen Mordanschlag ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das hatte sich, wie Sabinus aus Clemens’ verschlüsselten Briefen erfahren hatte, als langwierig erwiesen, da sich seine Männer verständlicherweise scheuten, über solchen Verrat zu sprechen. Hätten sie sich dem Falschen anvertraut, dann wären sie auf der Stelle hingerichtet worden.
Im vergangenen Jahr war die Stimmung endlich gekippt, nachdem Caligula von einer halbherzigen Strafexpedition nach Germanien und einer abgebrochenen Invasion Britanniens zurückgekehrt war, wo die Legionen sich geweigert hatten, an Bord der Schiffe zu gehen. Er hatte sie für ihre Befehlsverweigerung gedemütigt, indem er sie gezwungen hatte, Muscheln zu sammeln, die er dann bei einem Triumphzug durch Rom zur Feier seines vermeintlichen Sieges präsentierte. Nachdem er die Armee gegen sich aufgebracht hatte, war ihm dasselbe auch mit dem Senat und der Prätorianergarde gelungen, sodass er nun gänzlich ohne Freunde dastand, da er seine Absicht erklärt hatte, Alexandria statt Rom zur Hauptstadt des Reiches zu machen. Das hatte sowohl bei den Befehlshabern als auch bei den neuntausend Soldaten der Prätorianergarde für Fassungslosigkeit gesorgt. Sie befürchteten, entweder in die unerträglich heiße Provinz Ägypten übersiedeln zu müssen oder, schlimmer noch, zurückzubleiben und in Bedeutungslosigkeit zu versinken, da der Kaiser, der ihr Daseinsgrund war, in weiter Ferne wäre.
Durch die Befürchtungen über ihre Zukunft geeint, hatten die Befehlshaber zögerlich begonnen, miteinander über ihr Unbehagen zu sprechen. Bald war es Clemens gelungen, den Tribun Cassius Chaerea auf seine Seite zu ziehen. Er hatte schon lange geargwöhnt, dass dieser Mordabsichten gegen Caligula hegte, der sich unablässig über seine hohe Stimme lustig machte. Chaerea hatte seinen engen Freund und Kollegen, den Tribun Cornelius Sabinus, sowie zwei vergrätzte Centurionen mit in die Verschwörung eingebracht. Nachdem endlich genug Verschwörer zusammengekommen waren, hatte Clemens sein Versprechen gegenüber Sabinus eingelöst, er solle derjenige sein, der den ersten Streich führte. Er hatte Sabinus also geschrieben, alles sei bereit und er solle heimlich nach Rom zurückkommen, und so war Sabinus vor zwei Tagen eingetroffen. Seitdem hatte er sich in Clemens’ Haus versteckt gehalten. Nicht einmal sein Bruder Vespasian oder sein Onkel, der Senator Gaius Pollo, die er jetzt nebeneinander nahe der kaiserlichen Loge sitzen sah, wussten, dass er sich in der Stadt aufhielt. Sobald die Tat getan war, würde er auf seinen Posten zurückkehren. Er war zuversichtlich, die Stadt unbemerkt wieder verlassen zu können. Die Unterbefehlshaber, denen er das Kommando über seine Legion im Winterquartier übertragen hatte, glaubten, er habe seine Frau und seine beiden Kinder besucht, die außerhalb von Caligulas Reichweite bei seinen Eltern in Aventicum im Süden der Germania Superior lebten. Auf diese Weise, so hatte Clemens argumentiert, würde Clementina im Fall einer Vergeltungsaktion gegen die Verschwörer nur ihren Bruder verlieren und nicht zugleich auch ihren Ehemann.
Unten auf der Bühne hatten die Verwicklungen inzwischen ein glückliches Ende gefunden, und die Figuren zogen durch eine Tür in der Scenae Frons zum Hochzeitsmahl – der zwei Stockwerke hohen Schauwand an der Rückseite der Bühne, die mit Säulen, Fenstern, Türen und Bögen bemalt war. Sabinus verbarg sein Gesicht noch tiefer in der Kapuze, als der letzte Schauspieler sich umwandte, um zum Publikum zu sprechen.
«Gern würden wir all unsere Freunde hier mit einladen. Aber auch wenn genug so gut ist wie ein Festmahl, so ist genug für sechs doch eine karge Mahlzeit für so viele tausend. Daher wünschen wir Euch, zu Hause gut zu speisen, und bitten unsererseits um einen Applaus.»
Während das Publikum in Beifall ausbrach, teilte sich die Reihe der germanischen Leibgarde, um einen hochgewachsenen Mann durchzulassen, der in ein purpurnes Gewand gehüllt war und ein goldenes Diadem auf dem Kopf trug. Er betrat die kaiserliche Loge und verbeugte sich vor Caligula in der Manier des Ostens, indem er beide Hände an die Brust legte.
«Was macht der denn hier?», fragte Sabinus überrascht, an Clemens gerichtet.
«Herodes Agrippa? Er ist schon seit drei Monaten in Rom. Er will, dass der Kaiser sein Königreich erweitert. Caligula spielt mit ihm und lässt ihn für seine Habgier leiden. Er behandelt ihn beinahe so schlecht wie Claudius.»
Sabinus beobachtete, wie der König von Judäa neben Claudius Platz nahm und ein paar Worte mit ihm wechselte.
«Caligula wird bald aufbrechen, um sein Bad zu nehmen», sagte Clemens, als der Applaus allmählich verebbte. «Auf dem Weg dorthin will er eine Probe einer Gruppe aitolischer Jünglinge anhören, die morgen auftreten sollen. Callistus lässt sie oben vor dem Haus des Augustus warten, gleich neben dem Zugang, der direkt zu der Treppe bei der kaiserlichen Loge führt. Du kannst durch diesen Ausgang dorthin gelangen.» Er zeigte auf das äußerste linke Tor an der Rückwand des Theaters. «Klopfe dreimal an, dann warte kurz und wiederhole das Signal. Das Tor wird von zwei meiner Centurionen bewacht. Sie erwarten dich schon und werden dich durchlassen. Das Losungswort lautet ‹Freiheit›. Zieh dir dein Halstuch über das Gesicht. Je weniger Leute dich erkennen, desto besser, falls es zum Schlimmsten kommen sollte. Chaerea, Cornelius und ich geleiten Caligula aus der Loge und die Treppe hinauf. Sobald du uns losgehen siehst, machst du dich auf den Weg und folgst dem Gang. Wir werden uns etwa auf der Hälfte begegnen. Ich werde seiner germanischen Leibgarde befehlen, zurückzubleiben und dafür zu sorgen, dass uns niemand folgt. So gewinnen wir ein wenig Zeit, wenn auch nicht viel. Schlag zu, sobald du kannst.» Clemens streckte den rechten Arm aus.
«Das werde ich, mein Freund», erwiderte Sabinus und ergriff ihn. «Ich ziele direkt auf den Hals.»
Sie blickten einander einen Moment lang in die Augen, und der Griff um ihre Unterarme war fester als je zuvor, dann nickten sie und trennten sich ohne ein weiteres Wort. Beiden war bewusst, dass dieser Tag vielleicht ihr letzter sein würde.
Sabinus beobachtete, wie Clemens die kaiserliche Loge betrat, und auf einmal durchströmte ihn Ruhe. Es kümmerte ihn nicht mehr, ob er überlebte oder am Ende des Tages tot sein würde. Seine einzige Sorge war, die mehrfache brutale Vergewaltigung Clementinas zu rächen, begangen von dem Mann, der sich selbst als unsterblicher Gott über alle Menschen erhaben wähnte. Das Bild von Clementina, wie sie ihn anflehte, sie vor diesem Schicksal zu bewahren, hatte sich in seine Erinnerung eingebrannt. Damals hatte er sie im Stich gelassen – doch heute nicht. Wieder umklammerte er den Griff seines Schwerts, aber diesmal war seine Hand trocken. Er atmete tief und fühlte, wie sein Herz langsam und stetig schlug.
Auf der Bühne erschien jetzt ein Trupp Akrobaten, die Sprünge vollführten, Rad schlugen, Pirouetten drehten und andere Kapriolen darboten, vom Publikum jedoch nichts als desinteressiertes Gemurmel ernteten, ganz gleich, wie hoch und weit sie sprangen. Alle Blicke waren auf den Kaiser gerichtet, der sich anschickte zu gehen.
Sabinus sah, wie die Germanen vor Clemens salutierten, als er ihnen einen barschen Befehl zurief. Cassius Chaerea und Cornelius Sabinus verließen ihre Posten und traten hinter den Stuhl des Kaisers. Der erste Konsul bedeckte die herrlichen roten Pantoffeln mit ein paar letzten leidenschaftlichen Küssen, ehe er von den Objekten seiner Verehrung mit einem Tritt beiseitegestoßen wurde, als Caligula sich erhob.
Die Menge jubelte und huldigte Caligula als ihrem Gott und Kaiser, doch ihr Gott und Kaiser beachtete sie gar nicht. Stattdessen schaute er auf Claudius hinunter und hob dessen Kinn an, um seinen Hals zu betrachten. Dabei fuhr er mit dem Finger quer darüber wie mit einem Messer. Claudius zuckte, und sein Speichel lief über die Hand seines Neffen. Mit angewidertem Blick wischte Caligula den Speichel an Claudius’ grauem Haar ab und schrie seinem Onkel etwas ins Gesicht, das über den Lärm hinweg nicht zu verstehen war. Sogleich stand Claudius auf und hinkte aus der Loge. Die Reihe der Germanen teilte sich, um ihn durchzulassen, und er verschwand, so schnell seine schwachen Beine ihn trugen. Sabinus konzentrierte sich weiter auf Caligula, der seine Aufmerksamkeit nun auf Herodes Agrippa richtete. Auf ein paar schroffe Sätze verbeugte sich dieser unterwürfig und verließ ebenfalls die Loge. Caligula warf den Kopf zurück und lachte, dann äffte er Herodes Agrippas kriecherischen Abgang nach, sehr zur Erheiterung der Menge. Nachdem er die Komik der Situation ausgekostet hatte, ging er mit langen Schritten hinaus, wobei er im Vorbeigehen Chaerea auf den Hintern schlug. Sabinus sah, wie der Tribun sich versteifte und seine Hand nach dem Schwert zuckte, doch er hielt mitten in der Bewegung inne, als er Clemens’ Blick auffing. Chaerea ließ die Hand wieder sinken und ballte mehrmals die Faust, während er und Cornelius Caligula zur Treppe folgten. Ehe Clemens die Loge verließ, sah er kurz zu Sabinus auf, und seine Augen weiteten sich ein wenig. Dann marschierte er an der germanischen Leibgarde vorbei, deren eine Hälfte ihm folgte, um die Treppe abzusperren, sodass die Öffentlichkeit keinen Zugang hatte, während der Kaiser mit seinem Gefolge hinaufstieg. Zurück blieben der Konsul, der sich das geschundene Gesicht rieb, und die übrigen acht Germanen, welche die kaiserliche Loge bewachten.
Alles war bereit.
Sabinus drehte sich um und ging hinter der letzten Sitzreihe entlang zu dem Tor, das Clemens ihm gezeigt hatte. Er zog sein Halstuch über Mund und Nase hoch, dann gab er das vereinbarte Klopfzeichen. Augenblicklich hörte er einen Riegel zurückgleiten, das Tor wurde einen Spalt geöffnet, und er starrte in die dunklen, harten Augen eines Centurios der Prätorianergarde.
«Freiheit», flüsterte Sabinus.
Mit einer leichten Neigung des Kopfes trat der Centurio zurück und öffnete das Tor weiter. Sabinus ging hindurch.
«Hier entlang, Herr», sagte ein zweiter Centurio, der ihm bereits den Rücken gekehrt hatte, während der erste das Tor wieder schloss und verriegelte.
Sabinus folgte dem Mann über einen gepflasterten Weg, der die letzten paar Fuß bis zur Kuppe des Palatin sanft anstieg. Von oben tönte klagender Chorgesang herab. Hinter sich hörte er das rhythmische Klappern der genagelten Sandalen des ersten Centurios, der ihm folgte.
Nach dreißig Schritten erreichten sie den Gipfel. Zu seiner Linken sah Sabinus zwei Centurien Prätorianer, in Tuniken und Togen gekleidet, in lockerer Haltung neben den aitolischen Jünglingen stehen, die ihren melancholischen Gesang vor den Überresten der imposanten Fassade vom Haus des Augustus probten. Einst eine architektonische Studie in Eleganz, gepaart mit Macht, war sie jetzt durch eine Reihe von Anbauten verunstaltet, die Caligula hinzugefügt hatte. Sie schlängelten sich vorwärts, jeder vulgärer und unüberlegter als der andere, und ergossen sich den Hügel hinunter bis zum Tempel von Castor und Pollux am Fuß des Palatin. Dieser diente jetzt – was viele insgeheim als Sakrileg empfanden – als Vorhalle für den ganzen Palastkomplex. Der Centurio führte Sabinus zum nächsten dieser Anbauten, der direkt vor ihm lag.
Mit einem Schlüssel, den er am Gürtel trug, schloss der Centurio eine schwere Tür aus Eichenholz auf. Sie ließ sich geräuschlos öffnen, da die Scharniere mit Gänsefett geschmiert waren, und dahinter tat sich ein breiter Gang auf. «Nach rechts, Herr», sagte der Centurio und trat zur Seite, um Sabinus durchzulassen. «Wir bleiben hier, um zu verhindern, dass jemand Euch folgt.»
Sabinus nickte und trat in den Gang, der durch Fenster an beiden Seiten von Sonnenlicht erhellt wurde. Er zog sein Schwert aus der Scheide unter dem Mantel und einen Dolch aus seinem Gürtel, dann folgte er entschlossen dem Gang. Das Geräusch seiner Schritte hallte von den weiß getünchten, verputzten Wänden wider.
Nach ein paar Dutzend Schritten hörte er hinter einer Biegung nach links Stimmen und beschleunigte seinen Schritt. Aus dem Theater unten ertönte neuerliches Gelächter, gefolgt von Applaus. Sabinus näherte sich der Ecke. Die Stimmen klangen jetzt sehr nah. Er hob sein Schwert und machte sich zum Schlag bereit, dann sprang er vor. Ihm stockte das Herz, als ihn ein schriller Aufschrei empfing und er in ein Paar entsetzter Augen in einem langen, schiefen Gesicht blickte; aus der ausgeprägten Nase lief Schleim. Claudius’ Schrei blieb ihm in der Kehle stecken, und er starrte mit offenem Mund erst das Schwert an, das direkt auf ihn gerichtet war, dann wieder Sabinus. Herodes Agrippa stand stocksteif neben ihm, das Gesicht zu einer angstvollen Grimasse verzerrt.
Sabinus wich zurück. Er hatte Clemens sein Wort gegeben, Claudius nicht zu töten. «Verschwindet von hier, alle beide!», rief er.
Nach einem Augenblick verwirrten Zögerns hinkte Claudius zuckend und vor sich hin brabbelnd davon, wobei er eine Urinlache zurückließ. Herodes Agrippa bückte sich schwer atmend, um unter die Kapuze zu spähen, die Sabinus’ Gesicht verbarg. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke, und Herodes’ Augen weiteten sich ein wenig. Dann machte Sabinus eine drohende Geste mit dem Schwert, und der Judäer rannte davon, Claudius nach.
Sabinus fluchte und betete zu Mithras, der König möge ihn nicht erkannt haben. Gleich darauf drangen Stimmen durch den Gang zu ihm und vertrieben den Gedanken. Eine der Stimmen war ganz unverkennbar Caligulas. Sabinus zog sich wieder hinter die Ecke zurück und wartete, während die Männer näher kamen.
«Wenn diese aitolischen Jungen hübsch aussehen, nehme ich vielleicht ein paar von ihnen mit ins Bad», sagte Caligula gerade. «Möchtet Ihr auch welche, Clemens?»
«Wenn sie hübsch aussehen, göttlicher Gaius.»
«Aber wenn nicht, haben wir ja immer noch Chaerea. Ich würde so gern einmal hören, wie seine liebliche Stimme vor Ekstase stöhnt.» Caligula kicherte. Seine Begleiter stimmten nicht ein.
Sabinus stürzte um die Ecke, das Schwert erhoben.
Caligulas Lachen verstummte, und seine tiefliegenden Augen weiteten sich vor Angst. Er machte einen Satz rückwärts, da umklammerten Chaereas starke Hände seine Oberarme und hielten ihn fest.
Sabinus ließ sein Schwert durch die Luft sausen, bis es sich am Halsansatz in Caligulas Fleisch grub. Caligula kreischte, und Blut spritzte Chaerea ins Gesicht. Ein Ruck durchfuhr Sabinus’ Schwertarm, und der Griff der Waffe entglitt ihm, als die Klinge im Schlüsselbein stecken blieb.
Einen Moment lang herrschte entsetzte Stille.
Caligula starrte mit aufgerissenen Augen auf das Schwert hinunter, das in ihm steckte, dann brach er plötzlich in irres Gelächter aus. «Ihr könnt mich nicht töten! Ich lebe noch, ich bin ein G–» Er zitterte heftig, den Mund noch immer aufgerissen, und die Augen traten hervor.
«Dies ist das letzte Mal, dass Ihr meine liebliche Stimme hört», flüsterte Chaerea ihm ins Ohr. Mit der linken Hand hielt er noch immer Caligula fest, doch die andere war nicht mehr zu sehen. Chaerea machte mit der Kraft seines ganzen Körpers eine ruckartige Drehung nach links, sodass die Spitze eines Gladius aus Caligulas Brust hervorbrach. Sein Kopf fiel zurück, und er stieß heftig die Luft aus, wobei er einen feinen purpurroten Nebel versprühte. Sabinus riss seine Waffe heraus und zog sein Halstuch herunter. Der falsche Gott sollte wissen, wer seinem Leben ein Ende gemacht hatte und warum.
«Sabinus!», krächzte Caligula, während ihm Blut über das Kinn lief. «Ihr seid mein Freund!»
«Nein, Caligula, ich bin Euer Schaf, erinnert Ihr Euch?» Damit rammte er seine Klinge in Caligulas Unterleib. Clemens und Cornelius zogen ebenfalls ihre Schwerter und durchbohrten den verwundeten Kaiser von beiden Seiten.
Mit dem bitteren Genuss der Rache drehte Sabinus lächelnd aus dem Handgelenk die Klinge in Caligulas Eingeweiden nach rechts und links, dann stieß er sie weiter hinein, bis er fühlte, wie sie unten am Gesäß wieder austrat.
Alle vier Mörder zogen ihre Schwerter gleichzeitig zurück. Caligula blieb einen Moment lang frei stehen, dann brach er ohne einen Laut in Claudius’ Urinlache auf dem Boden zusammen.
Sabinus starrte auf seinen einstigen Freund hinunter, zog die Nase hoch und spuckte ihm einen Klumpen Schleim ins Gesicht, dann zog er sein Halstuch wieder hoch. Chaerea zielte einen Tritt in Caligulas blutigen Unterleib.
«Wir müssen es zu Ende bringen», sagte Clemens leise und wandte sich zum Gehen. «Schnell, die Germanen werden die Leiche bald finden. Ich habe ihnen befohlen, so lange zu warten, bis sie bis fünfhundert gezählt haben, um zu verhindern, dass jemand hinter uns die Stufen heraufkommt.»
Die vier Mörder gingen raschen Schrittes zurück durch den Gang. Die beiden Centurionen warteten an der Tür.
«Lupus, führt Eure Centurie in den Palast», befahl Clemens im Vorbeigehen. «Aetius, Ihr bleibt mit Eurer draußen und lasst niemanden ein. Und schafft diese jaulenden Aitolier weg.»
«Haben Claudius und Herodes Agrippa Euch gesehen?», erkundigte sich Sabinus.
«Nein, Herr», antwortete Lupus. «Wir sahen sie kommen und sind nach draußen gegangen, bis sie vorbei waren.»
«Gut. Dann los.»
Die beiden Centurionen grüßten zackig und gingen durch die Tür hinaus zu ihren Männern. Von weiter unten im Gang ertönten kehlige Rufe.
«Scheiße!», zischte Clemens. «Diese verdammten Germanen können nicht zählen. Lauft!»
Sabinus sprintete los und warf dabei einen Blick über die Schulter. Um die Ecke erschienen die Silhouetten von acht Mann mit gezogenen Schwertern. Einer machte kehrt und rannte zurück in die Richtung des Theaters, die übrigen sieben nahmen die Verfolgung auf.
Clemens stieß, ohne innezuhalten, eine Tür auf und führte sie eine Marmortreppe hoch, durch einen hohen Raum voller lebensecht bemalter Statuen von Caligula und seinen Schwestern und weiter in den Palast. Dort bogen sie nach links ab und erreichten das Atrium, als gerade die ersten von Lupus’ Männern zur Tür hereinkamen.
«Bringt Eure Jungs in Stellung, Centurio», rief Clemens. «Es scheint, als müssten sie ein paar Germanen töten.»
Auf einen scharfen Befehl von Lupus wurde eine Linie gebildet, da stürmten auch schon die Germanen ins Atrium. «Schwerter!», schrie Lupus.
Mit der Präzision, die von den Elitesoldaten Roms erwartet wurde, zogen die achtzig Prätorianer ihre Schwerter wie ein Mann.
Hoffnungslos in der Unterzahl, aber rasend wütend über die Ermordung des Kaisers, dem sie bedingungslose Treue schuldeten, griffen die Germanen an, wobei sie die Schlachtrufe ihrer von düsteren Wäldern überzogenen Heimat hinausschrien. Sabinus, Clemens und die zwei Tribune zogen sich hinter die Linie der Prätorianer zurück. Im nächsten Moment krachte Metall gegen Metall, dass es laut zwischen den Säulen im Raum widerhallte, da die Germanen sich mit ihren Schilden mit voller Wucht gegen die Prätorianer warfen. Sie zielten mit ihren langen Schwertern auf die Köpfe und Leiber der Verteidiger, die keine Schilde hatten. Vier gingen unter dem wüsten Ansturm sofort zu Boden, doch ihre Kameraden hielten die Linie, teilten mit dem linken Arm anstelle eines Schilds Schläge aus und stießen mit ihren kürzeren Schwertern nach den Unterleibern und Oberschenkeln der Angreifer, deren Zahl rasch schrumpfte. Bald lagen fünf ihrer Gefährten tot oder sterbend am Boden, und die letzten zwei Germanen gaben den Kampf auf und traten Hals über Kopf den Rückzug an.
Eine schrille Frauenstimme drang durch den Lärm: «Was geht hier vor sich?»
Sabinus wandte sich um und sah eine hochgewachsene Frau mit langem Pferdegesicht und einer ausgeprägten Aristokratennase. Sie hielt ein kleines Mädchen von etwa zwei Jahren im Arm. Das Kind starrte begierig auf das Blut am Boden.
«Mein Mann wird davon erfahren.»
«Euer Mann wird überhaupt nichts mehr erfahren, Milonia Caesonia», versetzte Clemens kalt. «Nie mehr.»
Einen Moment lang zögerte sie, dann richtete sie sich zu ihrer vollen Größe auf und blickte Clemens an. Ihre Augen funkelten vor Trotz. «Wenn Ihr auch mich töten wollt, so wird mein Bruder mich rächen.»
«Nein, das wird er nicht. Euer Halbbruder Corbulo findet, dass Ihr Schande über die Familie gebracht und ihre Ehre beschmutzt habt. Wenn er vernünftig ist, wird er seine Legion, die Zweite Augusta, dazu bringen, dem neuen Kaiser die Treue zu schwören. Anschließend, wenn er seine Zeit als Legatus gedient hat, wird er nach Rom zurückkehren und darauf hoffen, dass die Zeit den Fleck auf seiner Ehre tilgt, den Ihr hinterlassen habt.»
Milonia Caesonia schloss die Augen, als müsste sie sich selbst die Wahrheit dieser Feststellung eingestehen.
Clemens ging mit gezogenem Schwert auf sie zu.
Sie hielt das Kind hoch. «Werdet Ihr wenigstens Iulia Drusilla verschonen?»
«Nein.»
Milonia Caesonia drückte ihre Tochter fest an die Brust.
«Aber Euch zuliebe werde ich Euch zuerst töten, damit Ihr nicht zusehen müsst, wie sie stirbt.»
«Danke, Clemens.» Milonia Caesonia küsste ihre Tochter auf die Stirn und setzte sie ab. Sofort begann das Kind zu weinen, streckte die Arme nach seiner Mutter aus und hüpfte auf und ab, um wieder hochgenommen zu werden. Als die Mutter sie nicht beachtete, fiel die Kleine in einem Wutanfall über sie her und zerriss mit scharfen Nägeln und Zähnen ihre Stola.
Milonia Caesonia schaute mit müdem Blick auf das schreiende Balg zu ihren Füßen hinunter. «Tut es jetzt, Clemens.»
Clemens packte sie mit der linken Hand an der Schulter und stieß sein Schwert aufwärts unter ihre Rippen. Ihre Augen traten hervor, und der Atem entwich ihr leise. Das Kind schaute einen Moment lang verständnislos auf das Blut, das aus der Wunde drang, dann begann es zu lachen. Clemens stieß sein Schwert noch tiefer hinein, und Milonia Caesonias Augen schlossen sich. Als er die Waffe mit einem Ruck herauszog, erstarb das Lachen des Kindes. Mit einem verängstigten Aufschrei drehte es sich um und lief davon.
«Lupus! Fangt das kleine Ungeheuer ein», rief Clemens und ließ den Leichnam zu Boden sinken.
Der Centurio holte die kleine Gestalt mit wenigen Schritten ein. Sie kratzte seinen Arm blutig, als er sie hochhob, dann schlug sie die Zähne in sein Handgelenk. Mit einem Schmerzensschrei packte Lupus sie am Fußknöchel und hielt sie kopfunter auf Armeslänge von sich, während die Kleine kreischte und zappelte.
«Um der Götter willen, bringt es zu Ende!», befahl Clemens.
Ein schriller Aufschrei endete in einem widerlichen Knirschen. Sabinus zuckte zusammen.
Nach einem raschen Blick auf sein Werk warf Lupus den leblosen Körper beiseite, sodass er verrenkt und zerschunden an der Basis der blutigen Säule liegen blieb.
«Gut», sagte Clemens, ebenso wie alle anderen erleichtert über die plötzliche Stille. «Jetzt nehmt die Hälfte Eurer Männer und sucht die Ostseite des Palastes nach Claudius ab.» Er zeigte auf einen Optio der Prätorianer. «Gratus, du führst die andere Hälfte in den Westteil.»
Lupus und Gratus salutierten, dann führten sie ihre Männer davon.
Clemens wandte sich an Sabinus. «Ich werde schon herausfinden, wo mein sabbernder Schwachkopf von einem Patron sich versteckt hat. Du solltest jetzt gehen, mein Freund, die Tat ist getan. Verschwinde aus Rom, ehe sie entdeckt wird.»
«Ich glaube, sie wurde bereits entdeckt», erwiderte Sabinus. Der fröhliche Lärm aus dem Theater unten hatte sich in aufgebrachtes Geschrei verwandelt.
Sabinus fasste seinen Schwager an der Schulter, dann wandte er sich ab und lief aus dem Palast. Gebrüll und panische Schreie zerrissen die Luft, während er den Palatin hinunterrannte.
Das Töten hatte begonnen.
Teil I
I
Vespasian hatte die Aufführung trotz der ständigen Unterbrechungen durch den Kaiser genossen. Der Goldtopf war nicht sein Lieblingsstück von Plautus, aber die doppeldeutigen Dialoge, die Missverständnisse und komischen Verfolgungsjagden, während derer der geizige Protagonist Euklio versuchte, seinen neuerworbenen Reichtum zu bewahren, brachten ihn immer wieder zum Lachen. Sein Problem mit dem Stück bestand darin, dass er im Grunde Euklios Bestreben, so wenig wie möglich von seinem Geld herzugeben, durchaus nachempfinden konnte.
Die Truppe junger männlicher Akrobaten, die jetzt auf der Bühne umhersprangen, faszinierte Vespasian nicht so wie seinen Onkel Gaius Vespasius Pollo, der neben ihm saß. Deshalb wartete er mit geschlossenen Augen auf den Beginn der nächsten Komödie, döste vor sich hin und dachte an seinen kleinen Sohn Titus, der jetzt etwas über ein Jahr alt war.
Vespasian schrak auf, als ein heiserer Schrei den halbherzigen Applaus für die Akrobaten übertönte, deren Darbietung gerade ein rasantes Finale erreichte. Er ließ den Blick über die Zuschauermenge gleiten und versuchte, die Quelle und Ursache des Schreis auszumachen. Zwanzig Schritt zu seiner Linken kam ein Germane der kaiserlichen Leibgarde eine überdachte Treppe heruntergestürmt. Er hielt die rechte Hand hoch, die blutverschmiert war, schrie Unverständliches in seiner Muttersprache und rannte auf acht seiner Kollegen am Eingang zur kaiserlichen Loge zu, welche der Kaiser erst kürzlich verlassen hatte. Die Zuschauer in der Nähe starrten erschrocken den Mann an, der mit seiner blutigen Hand vor den Gesichtern seiner Kameraden fuchtelte.
Vespasian wandte sich an seinen Onkel. Der applaudierte noch immer den spärlich bekleideten Jünglingen, die jetzt die Bühne verließen. Vespasian stand auf und zog Gaius am Ärmel seiner Tunika. «Ich habe das Gefühl, dass jeden Moment etwas Schlimmes passieren wird. Wir sollten sofort gehen.»
«Was ist denn, lieber Junge?», fragte Gaius geistesabwesend.
«Wir müssen gehen, jetzt sofort!»
Die Dringlichkeit in der Stimme seines Neffen veranlasste Gaius, seinen korpulenten Leib hochzustemmen. Er strich sich eine sorgfältig gedrehte Locke aus den Augen und schaute noch einmal den Akrobaten nach, ehe sie ganz verschwunden waren.
Vespasian warf einen nervösen Blick über die Schulter. Die Germanen der Leibgarde zogen jetzt gleichzeitig ihre langen Schwerter. Ihre wütenden Schreie brachten die Menge in ihrer Nähe zum Schweigen, und die Stille breitete sich wie eine Welle durch das ganze Publikum aus.
Die Germanen reckten ihre Schwerter in die Höhe, die Gesichter wutverzerrt, und für einen Moment lag eine tiefe, angespannte Stille über dem gesamten Theater. Alle Blicke waren fragend auf die neun Barbaren gerichtet. Dann schnellte ein Schwert durch die Luft, ein Kopf flog, und Blut regnete auf die Leute hinunter, die mit offenen Mündern entgeistert den grausigen Flugkörper beobachteten. Der Rumpf des enthaupteten Zuschauers – eines Senators – blieb noch zwei oder drei Herzschläge lang aufrecht und reglos sitzen und verspritzte Blut über die Umsitzenden, die ihn entsetzt anstarrten. Dann kippte er vornüber auf einen alten Mann in der Sitzreihe davor, ebenfalls einen Senator, der mit weitaufgerissenen Augen verständnislos dasaß. Er drehte sich um, da wurde auch schon ein Schwert in seinen offenen Mund gerammt, dass die Spitze hinten am Schädel wieder austrat, ohne dass sich der Ausdruck seiner Augen verändert hätte.
Noch einen halben Herzschlag lang blieb es völlig still, dann zerriss der Schrei einer Frau die Luft, da der Kopf in ihrem Schoß gelandet war, und eine Kakophonie des Grauens brach los. Die Schwertklingen der Germanen sausten blitzschnell durch die Luft und schlugen eine Schneise in die Menge, wobei sie unterschiedslos alle töteten oder verstümmelten, die sich nicht schnell genug in Sicherheit bringen konnten. Der Sturm auf die Ausgänge begann. In der kaiserlichen Loge starrte der erste Konsul einen Moment lang entgeistert einem Barbaren entgegen, der sich mit gebleckten Zähnen auf ihn stürzen wollte, dann sprang er über die Balustrade der Loge und fiel, mit Armen und Beinen rudernd, mitten in die panische Menge hinunter.
Vespasian schob seinen Onkel vorwärts, wobei er eine kreischende Matrone beiseitestieß, und steuerte auf den nächsten Durchgang zu, der zwischen den Sitzreihen zur Bühne hinunterführte. «Jetzt ist keine Zeit für gute Manieren, Onkel.» Während er sich einen Weg durch das Gedränge bahnte und seinen beleibten Onkel wie einen Rammbock einsetzte, nahm er verschwommen das Chaos und Gemetzel um sich herum wahr. Zu seiner Linken gingen zwei Senatoren unter einem Hagel von Schwerthieben zu Boden. Hinter ihm schlugen drei wütende Germanen eine blutige Schneise durch die wogende Menschenmasse geradewegs in seine Richtung. Vespasian fing den Blick des Anführers auf. «Anscheinend haben sie es hauptsächlich auf Senatoren abgesehen, Onkel», schrie er und zerrte die Toga von seiner rechten Schulter, damit der breite purpurne Streifen nicht so deutlich sichtbar war.
«Warum?», schrie Gaius zurück, während er über einen Unglücklichen hinwegtrampelte, der in dem Gedränge zu Boden gegangen war.
«Ich weiß es nicht, lauf einfach weiter.»
Mit ihrem vereinten Gewicht und dem Schwung, den sie bergab gewannen, gelang es ihnen, ihren Vorsprung vor den Germanen zu vergrößern, denn diese waren in der Masse der Toten und Sterbenden ins Stocken geraten. Als sie die Orchestra zwischen den Sitzreihen und der eigentlichen Bühne erreichten, wo weit weniger Gedränge herrschte, wagte Vespasian noch einen Blick hinter sich. Er war erschüttert, welches Gemetzel nur neun bewaffnete Männer unter so vielen wehrlosen Leuten anrichten konnten: Die Sitzreihen waren mit Leichen übersät, von denen nicht wenige blutige Senatorentogen trugen. Vespasian packte seinen Onkel am Arm und fing an zu rennen. Über eine kurze Treppe gelangte er auf die Bühne. Er lief weiter, so schnell Gaius eben watscheln konnte, auf einen Durchgang in der Scenae Frons auf der anderen Seite zu, der völlig verstopft war, da die Leute verzweifelt zu entkommen suchten. Sie stürzten sich in das Getümmel, drängten und schoben, schwitzend vor Anstrengung, hatten Mühe, auf den Beinen zu bleiben, und fühlten unter ihren Füßen die Körper derer, denen es nicht gelungen war, ehe sie endlich aus dem Theaterbau auf eine Straße am Fuß des Palatin hinausstürzten.
Die Menge wandte sich nach rechts, da von links die dröhnenden, gleichmäßigen Schritte von drei Centurien der Cohortes urbanae ertönten, die im Laufschritt nahten. Vespasian und Gaius blieb nichts anderes übrig, als mit dem Strom zu laufen. Dabei versuchten sie jedoch, an den Rand der Menge zu gelangen. Sobald er mit der linken Schulter die Mauer streifte, begann Vespasian, nach einer Abzweigung Ausschau zu halten.
«Bereit, Onkel?», rief er, als sie sich der Einmündung einer Gasse näherten.
Gaius nickte nur keuchend und schnaufend. Der Schweiß lief ihm in Strömen über die feisten Wangen. Vespasian zerrte ihn energisch nach links, und endlich waren sie der panischen Masse entkommen.
Als sie der Gasse weiter folgten, wäre Vespasian beinahe über die Leiche eines Germanen der kaiserlichen Leibgarde gestolpert, die quer auf dem schlammigen Boden lag. Kurz vor dem Ende der Gasse sprangen sie über einen weiteren Germanen hinweg, kahlköpfig, jedoch mit langem blondem Vollbart, der an eine Hauswand gelehnt saß und den Stumpf seines rechten Arms umklammerte in dem Versuch, den Blutfluss einzudämmen. Er starrte entsetzt auf die abgetrennte Hand hinunter, die neben ihm lag, noch um den Griff seines Schwerts geschlossen. Am Ende der Gasse angekommen, rang Gaius schwer nach Luft, während Vespasian sich hastig umsah. Zu seiner Rechten hinkte ein Mann mit gesenktem Kopf davon. Blut lief unter seinem Mantel hervor am rechten Bein hinunter, und in der Hand hielt er ein blutiges Schwert.
Vespasian rannte nach links in Richtung der Via Sacra. Gaius mühte sich schwerfällig, ihm zu folgen, doch er wurde mit jedem rasselnden Atemzug langsamer.
«Schnell, Onkel», rief Vespasian über die Schulter, «wir müssen dein Haus erreichen, ehe sich die Gewalt womöglich in der ganzen Stadt ausbreitet.»
Gaius blieb keuchend stehen, die Hände auf die Knie gestützt. «Lauf nur voraus, lieber Junge, ich kann nicht mithalten. Ich gehe zum Senatsgebäude. Kümmere du dich um Flavia und den kleinen Titus. Ich komme nach, sobald ich in Erfahrung gebracht habe, was geschehen ist.»
Vespasian hob die Hand zum Zeichen des Einverständnisses und rannte weiter, um nach seiner Frau und seinem Sohn zu sehen. Er bog gerade auf die Via Sacra in Richtung des Forum Romanum ein, als zwei Centurien der Prätorianergarde mit hallenden Marschtritten den Palatin herunterkamen. Hinter ihnen ertönten vom Nordhang noch immer Rufe und gequälte Schreie. Vespasian war gezwungen zu warten, bis die Prätorianer die Via Sacra überquert hatten. In ihrer Mitte saß in einer Sänfte Claudius. Er zuckte und sabberte, Tränen liefen ihm über das Gesicht, und er flehte um sein Leben.
«Verschließe und verriegele die Tür», befahl Vespasian dem jungen und äußerst attraktiven Türhüter, der ihn eben ins Haus seines Onkels eingelassen hatte. «Und dann geh um das Haus herum und sieh nach, ob alle Fenster geschlossen sind.»
Der Jüngling verbeugte sich und rannte davon, um den Befehl auszuführen.
«Tata!»
Vespasian drehte sich um, atmete tief durch und lächelte seinen dreizehn Monate alten Sohn an, der eifrig über den Mosaikboden des Atriums auf ihn zu krabbelte.
«Was ist los?», fragte Flavia Domitilla, die seit zwei Jahren Vespasians Frau war, und blickte von ihrem Spinnrad an der Feuerstelle im Atrium auf.
«Ich weiß es nicht genau, aber den Göttern sei Dank, dass ihr beide wohlauf seid.» Vespasian nahm seinen Sohn hoch und küsste ihn erleichtert auf beide Wangen, während er zu ihr hinüberging.
«Warum sollten wir nicht wohlauf sein?»
Vespasian setzte sich seiner Frau gegenüber und ließ Titus auf seinem Knie reiten. «Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, jemand hat endlich –»
«Sei vorsichtig mit dem Kleinen, die Amme hat ihn eben erst gefüttert», fiel Flavia ihm mit missbilligendem Blick ins Wort.
Vespasian überhörte den Einwurf seiner Frau und ließ Titus seinen wilden Ritt fortsetzen. «Er verträgt das schon, er ist ein wackerer kleiner Kerl.» Er betrachtete strahlend seinen kichernden, pausbäckigen Sohn und kniff ihn in die Wange. «Nicht wahr, Titus?» Der Kleine krähte vor Vergnügen, dann kreischte er, als Vespasian mit dem Knie eine plötzliche Bewegung nach links machte, sodass der winzige Reiter beinahe abgestürzt wäre. «Ich glaube, jemand hat endlich Caligula umgebracht, und ich bete um Sabinus’ willen, dass es nicht Clemens war.»
Flavia machte vor Aufregung große Augen. «Wenn Caligula tot ist, dann kannst du endlich etwas von deinem Geld ausgeben, ohne befürchten zu müssen, dass er dich tötet, um dein Vermögen an sich zu bringen.»
«Flavia, das ist im Augenblick meine geringste Sorge. Wenn der Kaiser ermordet wurde, muss ich überlegen, wie ich während des Regimewechsels für unser aller Sicherheit sorge. Sofern wir die törichte Praxis beibehalten, wieder einen Nachkommen von Iulius Caesar zum Kaiser zu machen, wäre Claudius die nächstliegende Wahl. Das könnte sich für die Familie günstig auswirken.»
Flavia tat die Worte ihres Mannes mit einer Handbewegung ab. «Du kannst nicht von mir erwarten, ewig im Haus deines Onkels wohnen zu bleiben.» Sie deutete auf die vielen homoerotischen Kunstwerke, mit denen das Atrium dekoriert war, und den geschmeidigen, flachsblonden germanischen Jüngling, der diskret an der Tür zum Triclinium stand, um ihnen aufzuwarten. «Wie viel länger muss ich all das noch ertragen, dieses, dieses …» Sie verstummte. Ihr fehlten die Worte für Senator Gaius Vespasius Pollos Vorlieben hinsichtlich der Raumgestaltung und der Auswahl seiner Sklaven.
«Wenn du Abwechslung wünschst, kannst du mich auf meinen Hof bei Cosa begleiten.»
«Und was soll ich dort? Maultiere zählen und mich mit Freigelassenen gemein machen?»
«Nun, meine Liebe, wenn du darauf bestehst, in Rom zu bleiben, dann wohnst du eben hier. Mein Onkel hat sich sehr großzügig gegen uns gezeigt, und ich habe nicht die Absicht, seine Gastfreundschaft zu beleidigen, indem ich ausziehe, wo doch reichlich Platz für uns alle ist.»
«Du meinst wohl, du hast nicht die Absicht, die Kosten für ein eigenes Haus auf dich zu nehmen», versetzte Flavia und drehte mürrisch ihre Spindel.
«Auch das», räumte Vespasian ein und ließ Titus noch einmal in vollem Galopp reiten. «Ich kann es mir nicht leisten, als Prätor hatte ich nicht genügend zusätzliche Einnahmen.»
«Das war vor zwei Jahren. Was hast du seither getan?»
«Es geschafft, zu überleben, indem ich den Anschein erweckte, arm zu sein!» Vespasian warf einen strengen Blick auf seine Frau mit ihrer makellosen Erscheinung, der Frisur nach der neuesten Mode und erheblich mehr Schmuck, als er für nötig hielt. Er bedauerte, dass sie sich in finanziellen Dingen niemals einig waren. Doch der unverbesserliche Eigensinn in ihren großen braunen Augen, der Reiz ihrer vollen Brüste und die Wölbung ihres schwangeren Leibes – schon wieder unter einer neuen Stola, wie ihm schien – erinnerten ihn an die drei Hauptgründe, aus denen er sie geheiratet hatte. Er versuchte es mit Vernunft. «Flavia, meine Liebe, Caligula hat viele Senatoren hinrichten lassen, die ebenso vermögend waren wie ich, um in den Besitz ihres Geldes zu gelangen. Darum lasse ich mein Geld auf dem Landgut festgelegt, fernab von Rom, und lebe im Haus meines Onkels. Mitunter kann es lebensrettend sein, arm zu erscheinen.»
«Ich rede nicht von dem Landgut, ich rede von dem Geld, das du aus Alexandria mitgebracht hast.»
«Das ist noch immer versteckt und wird es so lange bleiben, bis ich sicher bin, dass wir einen Kaiser haben, der weniger darauf aus ist, sich den Besitz seiner Untertanen anzueignen – und wo wir schon davon sprechen, auch deren Frauen.»
«Und was ist mit ihren Mätressen?»
Titus bekam plötzlich heftigen Schluckauf, und gleich darauf ergoss sich ein Schwall halbverdauter Linsen über Vespasians Schoß, doch ihm kam die Ablenkung ganz gelegen. Unterredungen mit seiner Frau über Geld verliefen niemals angenehm, erst recht, da unweigerlich zur Sprache kam, dass er sich eine Mätresse hielt. Er wusste, dass Flavia nicht in sexueller Hinsicht eifersüchtig auf Caenis war. Ihr ging es um das Geld, das er vermeintlich für seine Mätresse ausgab, während sie, seine legitime Ehefrau, fand, dass ihr Annehmlichkeiten vorenthalten blieben, insbesondere ein eigenes Haus in Rom.
«Was habe ich dir gesagt?», rief Flavia aus. «Elpis! Wo bist du?»
Eine gutaussehende Sklavin mittleren Alters eilte herbei. «Ja, Herrin?»
«Das Kind hat sich auf den Herrn erbrochen. Mach das weg.»
Vespasian stand auf und übergab Titus seiner Amme, wobei die Linsen auf den Boden kleckerten.
«Komm her, du kleiner Racker», gurrte Elpis und fasste Titus unter den Armen. «Ach, du bist deinem Vater wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten.»
Vespasian lächelte. «Ja, der arme kleine Kerl wird später auch ein rundes Gesicht und eine so lange Nase haben.»
«Hoffen wir, dass er einmal einen größeren Geldbeutel hat», murmelte Flavia.
Ein lautes Klopfen an der Haustür enthob Vespasian einer Erwiderung. Der attraktive Türhüter schaute durch den Sehschlitz und öffnete sofort den Riegel. Gaius hastete durch die Vorhalle ins Atrium, wobei seine Leibesfülle heftig unter der Toga wabbelte. Seine Locken klebten ihm schweißnass an Stirn und Wangen.
«Clemens hat das Ungeheuer umgebracht. Dieser tollkühne Schwachkopf», verkündete Gaius mit dröhnender Stimme, noch ehe er recht zu Atem gekommen war.
Vespasian schüttelte bedauernd den Kopf. «Nein, dieser mutige Schwachkopf. Aber nach dem, was Caligula seiner Schwester angetan hat, war es wohl unvermeidlich. Ich dachte nur, nach zwei Jahren sollte sein Selbsterhaltungstrieb wieder die Oberhand gewonnen haben. Den Göttern sei Dank, dass Sabinus nicht in Rom ist, sonst hätte er sich ihm angeschlossen. Ich habe gehört, wie die beiden einen Pakt schlossen, es gemeinsam zu tun, und dann hätte meine Ehre verlangt, dass ich ihnen helfe. Clemens ist ein toter Mann.»
«Das fürchte ich auch. Nicht einmal Claudius wäre töricht genug, ihn am Leben zu lassen. Er wurde ins Lager der Prätorianer gebracht.»
«Ja, das habe ich gesehen. Nach dem Wahnsinnigen bekommen wir nun den Schwachkopf. Wie lange kann es noch so weitergehen, Onkel?»
«So lange, wie die Blutlinie Caesars fortbesteht, und ich fürchte, dieses Blut fließt auch in Claudius’ missgestaltetem Körper.»
«Der Schwachkopf hat um sein Leben gefleht. Ihm war gar nicht klar, dass sie ihn in Sicherheit bringen wollten, bis der Senat ihn zum Kaiser erklärt hat.»
«Was sicher sehr bald geschehen wird. Zieh dir eine frische Tunika an, lieber Junge, die Konsuln haben in einer Stunde eine Versammlung des Senats im Jupitertempel anberaumt.»
Über die Gemonische Treppe zum Gipfel des Kapitols waren sie langsam vorangekommen, da sich dort nicht nur Senatoren drängten, die dem Ruf ihres Konsuls folgten, sondern auch Sklaventrupps, die viele schwere Truhen hinauftrugen. Der gesamte Inhalt der Schatzkammer sollte jetzt oben im Jupitertempel, dem heiligsten Gebäude Roms, sicher untergebracht werden. Am Fuß der Treppe, vor dem Concordiatempel auf dem Forum, waren auf Befehl des Stadtpräfekten Cossus Cornelius Lentulus alle drei Kohorten der Cohortes urbanae in Stellung gegangen für den Fall, dass die Prätorianer versuchten, sich Roms Schätze anzueignen. Auf der anderen Seite des Forums, auf dem Palatin, stand das provisorische Theater verlassen da, nur die Leichen lagen noch kreuz und quer in den leeren Sitzreihen.
Endlich waren mehr als vierhundert Senatoren in dem riesigen, düsteren Raum versammelt. Um sie herum ging der Transport der Schatztruhen weiter, indes die Konsuln der Gottheit des Hauses einen Widder opferten.
«Das könnte unschön werden», flüsterte Gaius Vespasian zu, während Quintus Pomponius Secundus, der erste Konsul, die Auspizien einholte und sein Kollege Gnaeus Sentius Saturninus ihm dabei assistierte. «Wenn sie den Inhalt der Schatzkammer hier heraufbringen, ziehen sie offenbar in Erwägung, den Prätorianern zu trotzen.»
«Dann sollten wir von hier verschwinden, Onkel. Dass Claudius Kaiser wird, ist unvermeidlich.»
«Nicht unbedingt, lieber Junge. Lass uns erst anhören, was die Leute zu sagen haben, ehe wir irgendwelche voreiligen und womöglich gefährlichen Schlüsse ziehen.»
Zufrieden mit dem, was er sah, erklärte Pomponius Secundus die Auspizien des Tages im Hinblick auf die Geschäfte des Senats für günstig und betrat die Rednerfläche. Sein Gesicht wies einen Bluterguss auf, wo Caligula ihn vorhin getreten hatte. «Patres Conscripti und Gleichgesinnte in der Liebe zur Freiheit, heute ist der Tag, an dem sich unsere Welt gewandelt hat. Heute ist der Tag, da der Mann, den wir gleichermaßen hassten und fürchteten, endlich vernichtet wurde.»
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, wies er mit einer Kopfbewegung auf das Standbild von Caligula neben der sitzenden Statue von Roms heiligstem Gott. Eine Gruppe Sklaven stieß von hinten gegen das Bildnis des ermordeten Kaisers, und es stürzte krachend auf den Marmorboden, wo es in unzählige Einzelteile zersprang. Die Senatoren brachen in Jubel aus, der im Saal widerhallte. Einen Moment lang erinnerte Vespasian sich an den umgänglichen, lebhaften Jüngling, den er einst gekannt hatte, und er bedauerte den Verlust eines Freundes. Doch dann kehrten die Erinnerungen an das Ungeheuer zurück, in das dieser sich verwandelt hatte, und er stimmte in den Jubel ein.
«Heute ist der Tag», fuhr Pomponius Secundus lauter fort, um den Lärm zu übertönen, «da wir alle, die wir uns so furchtlos der tyrannischen Herrschaft Caligulas widersetzt haben, uns endlich wieder freie Männer nennen können.»
«‹Furchtlos widersetzt› – und das sagt einer, der im Theater Caligulas Pantoffeln geküsst hat», murmelte Gaius in den neuerlichen Jubel hinein, den diese Feststellung auslöste. Nach dem Ausdruck auf zahlreichen Gesichtern zu urteilen, nahm Vespasian an, dass sein Onkel mit seiner Ansicht nicht allein war.
Der erste Konsul redete weiter, ohne wahrzunehmen, dass ein Teil des Beifalls jetzt ironisch war: «Die Prätorianergarde hat sich zum Ziel gemacht, uns einen neuen Kaiser aufzuzwingen: Caligulas Onkel Claudius. Patres Conscripti, ich sage nein! Nicht nur, weil Claudius stottert, sabbert und hinkt und dadurch die Würde des Amtes beflecken würde, sondern auch, weil die Legionen ihn nicht kennen und daher nicht lieben. Wir können nicht zulassen, dass die Prätorianer uns einen solchen Kaiser aufzwingen. Wenn die Legionen am Rhenus oder Danuvius beschlössen, ihre eigenen, kriegstüchtigeren Kandidaten aufzustellen, so käme ein neuer Bürgerkrieg auf uns zu. Als freie Männer sollten wir einen aus unseren Reihen zum neuen Kaiser wählen, damit er gemeinsam mit einem treuen Senat herrscht. Es sollte ein Mann sein, den wir, die Legionen und die Prätorianergarde als Kaiser akzeptieren können. Es sollte –»
«Ihr solltet derjenige sein, darauf wollt Ihr doch hinaus», rief Gnaeus Sentius Saturninus, der zweite Konsul, und sprang auf, wobei seine feisten Wangen und sein Bauch wabbelten. Er zeigte anklagend mit dem Finger auf seinen Kollegen, dann blickte er sich mit seinen durchdringenden blauen Augen im Tempel um. «Dieser Mann will, dass wir die bekannte Tyrannei einer Familie durch die unbekannte Tyrannei einer anderen ersetzen. Ist das die Art freier Männer? Nein!» Auf diese Worte hin erhob sich zustimmendes Raunen, und Saturninus warf sich in eine so staatsmännische Pose, wie seine fette Gestalt es zuließ, den linken Arm, über den die Toga drapiert war, quer vor dem Körper, den rechten ausgestreckt an seiner Seite. «Patres Conscripti, heute haben wir eine historische Gelegenheit, uns wieder zu unserer früheren Macht aufzuschwingen und erneut die legitime Regierung Roms zu werden. Befreien wir uns von diesen Kaisern und kehren zur wahren Freiheit unserer Vorväter zurück, einer Freiheit, die uns so lange verwehrt wurde, dass nur ganz wenige unter uns sie je gekostet haben; einer Freiheit, die in einer Zeit herrschte, da die ältesten der hier anwesenden Männer noch Knaben waren: der Freiheit einer Republik.»
«Lass dir nichts anmerken, lieber Junge», zischte Gaius Vespasian ins Ohr. «Jetzt ist nicht der Augenblick, sich zu einer Meinung zu bekennen.»
Fast die Hälfte der Versammlung brach in begeisterten Applaus und Jubel aus, nicht wenige jedoch machten finstere Mienen und begannen, untereinander zu tuscheln. Die Übrigen standen mit ausdruckslosen Gesichtern da und zogen es ebenso wie Gaius vor abzuwarten, welche Partei die Oberhand gewinnen würde.
Gaius zog Vespasian am Ellenbogen zum hinteren Rand der Menge. «Wir täten gut daran, unauffällig zu beobachten, bis diese Angelegenheit entschieden ist, so oder so.»
«Und dann werden wir uns zur Siegerseite bekennen, nicht wahr, Onkel?»
«Das ist eine vernünftige Vorgehensweise. So hat man weitaus größere Überlebenschancen, als wenn man voreilig für das jubelt, woran man glaubt.»
«Ich stimme dir voll und ganz zu.»
Der Beifall verebbte allmählich, und der vormalige Konsul Aulus Plautius betrat die Rednerfläche.
«Jetzt wird es interessant», murmelte Gaius. «Plautius hat großes Geschick darin, sich die Gunst der Herrschenden zu sichern.»
Vespasian grinste schief. «Du meinst wohl, er hat großes Geschick darin, die Seiten zu wechseln.» Fast zehn Jahre zuvor hatte Aulus Plautius sich selbst gerettet, indem er als Erster den Tod seines einstigen Wohltäters Seianus gefordert hatte, dessen Anhänger er zuvor gewesen war.
«Patres Conscripti», deklamierte Plautius, straffte seine breiten Schultern und warf sich in die Brust. Die Adern an seinem kräftigen Hals traten hervor. «Auch wenn ich die unterschiedlichen Ansichten unserer beiden geschätzten Konsuln durchaus verstehe und erkenne, dass jede ihre Vorzüge hat und der Diskussion würdig ist, so möchte ich das Haus doch daran erinnern, dass eines bislang nicht berücksichtigt wurde: die Macht der Prätorianergarde. Wer kann sich gegen sie durchsetzen?» Er wandte sich an den Stadtpräfekten Cossus Cornelius Lentulus. «Eure Cohortes urbanae, Lentulus? Drei Kohorten von nicht ganz fünfhundert Mann gegen die neun Kohorten der Prätorianer, von denen jede fast tausend Mann stark ist? Selbst wenn Ihr die Vigiles zur Verstärkung hinzunehmen würdet, wären die Prätorianer Euch zahlenmäßig noch immer dreifach überlegen.»
«Das Volk würde sich uns anschließen», entgegnete Lentulus.
Plautius schürzte verächtlich die Lippen. «Das Volk! Und mit welchen Waffen würde das Volk gegen die Elitetruppe Roms antreten? Mit Essmessern und Hackbeilen, mit Backblechen als Schilden und altem Brot als Schleudergeschossen? Pah! Vergesst das Volk. Patres Conscripti, sosehr es gegen Eure Dignitas gehen mag, ich sage Euch, praktisch gesehen liegt diese Angelegenheit nicht in Eurer Hand.»
Vespasian beobachtete von seinem Platz am hinteren Rand der Versammlung die Reaktionen und sah, dass die Senatoren widerwillig die Wahrheit von Plautius’ Feststellung erkannten.
Plautius’ Blick verhärtete sich, da auch er bemerkte, dass sein Argument wirkte. «Ich schlage Folgendes vor, Patres Conscripti: Wir sollten eine Abordnung zum Lager der Prätorianer schicken, um mit Claudius zu sprechen. Wir müssen uns vergewissern, ob er wirklich unser Kaiser sein will, und wenn ja, wie er zu herrschen gedenkt. Wenn er es nicht will und sich überreden lässt, das Angebot der Prätorianer abzulehnen, wen würden sie an seiner statt akzeptieren? Denn etwas kann ich Euch mit Gewissheit sagen: Wenn die Prätorianer eines nicht hinnehmen werden, dann die Rückkehr zur Republik.»
Die Senatoren schwiegen, während das letzte Wort durch den Raum hallte, bis es schließlich verklungen war, wie die vage Erinnerung an einen schönen Traum dahinschwindet, wenn man in die Wirklichkeit des Alltags zurückkehrt.
«Wir sollten sofort gehen», flüsterte Vespasian Gaius ins Ohr, «und bei Claudius vorsprechen.»
«Und was, wenn der Senat Claudius tatsächlich dazu bringt, das Amt abzulehnen? Wo würden wir dann stehen? Es ist noch zu früh, eine solche Entscheidung zu treffen. Wir bleiben bei der Herde.»
Vespasian runzelte die Stirn, und Zweifel trübte seine Gedanken. «Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles, was wir tun könnten, gefährlich. Wir sollten auf den wahrscheinlichsten Ausgang der Angelegenheit setzen.»
«Willst du wirklich das Leben deiner Frau und deines Kindes aufs Spiel setzen?»
Vespasian brauchte nicht über die Antwort nachzudenken. «Nein.»
«Dann halte dich bedeckt und triff keine Entscheidung, solange du nicht alle Informationen hast.»
Der erste Konsul trat vor, jetzt deutlich kleinlauter. «Ich sehe mich gezwungen, dem vormaligen Konsul beizupflichten, und schlage vor, dass wir eine Abordnung ernennen, welche die Würde dieses Hauses in vollem Maße repräsentiert. Sämtliche Konsuln und Prätoren, ehemalige wie derzeitige, sollen ihr angehören.»
Zustimmendes Raunen erhob sich.
«Sehr schön, Konsul», höhnte Plautius, «und wer soll diese Delegation anführen?»
«Als erster Konsul selbstverständlich –»
«Nein, durchaus nicht selbstverständlich. Euch würde man als möglichen Kandidaten für das Amt und somit nicht als unvoreingenommen ansehen. Diese Abordnung muss von jemandem angeführt werden, der zwar Senatorenrang innehat, aber nicht als Kaiser oder auch nur als Konsul in Frage kommt. Es muss jemand sein, den Claudius als Freund betrachtet, damit er nicht das Gefühl hat, bedrängt oder überlistet zu werden. Kurz, keiner der hier Anwesenden kommt in Betracht.»
Secundus schaute verwirrt drein. «Wer dann?»
«König Herodes Agrippa.»
Die Dunkelheit war hereingebrochen, als der König von Judäa endlich ausfindig gemacht und vor den Senat bestellt worden war. Im Tempel waren Fackeln und Wandleuchten entzündet worden, deren Licht sich auf dem polierten Marmor spiegelte, sodass der Raum von tanzendem Licht erfüllt war, viel heller als bei Tag. Die sitzende Statue der Schutzgottheit Roms wachte über die Beratungen. Hätte Jupiters strenges Gesicht Gefühle zeigen können, so hätte es beim Anblick der geschrumpften Versammlung womöglich einen verächtlichen Ausdruck angenommen. Während der letzten paar Stunden – nachdem klargeworden war, dass die Prätorianer die Oberhand hatten – waren vielen der Senatoren, die sich öffentlich für die Wiedereinführung der Republik ausgesprochen hatten, plötzlich dringende Gründe eingefallen, eilends ihre Landgüter außerhalb von Rom aufzusuchen. Vespasian und Gaius waren geblieben. Sie wähnten sich nicht in Gefahr, da sie sich bislang mit ihrer Meinung zurückgehalten hatten.
Herodes Agrippas dunkle Augen in dem hakennasigen Gesicht funkelten belustigt, als er in die Runde der verbliebenen Senatoren blickte. «Es wird mir eine große Freude sein, Eure Delegation anzuführen, Patres Conscripti. Eure Einladung ehrt mich. Allerdings ist mir nicht klar, was diese Delegation ausrichten kann.»
«Wir möchten wissen, wie Claudius zu der Angelegenheit steht», erwiderte Pomponius Secundus gereizt. «Möglicherweise wäre er gewillt, das Angebot der Prätorianer, ihn zum Kaiser zu machen, abzulehnen.»
«Das hat er versucht, doch er wurde überredet, seine Meinung zu ändern.»
«Durch die Prätorianer, mit gezogenen Schwertern?»
«Nein, Secundus, durch mich.»
«Durch Euch!» Pomponius Secundus verschluckte sich und musste sich auf die Brust klopfen. Ungläubig starrte er Herodes Agrippa an, der in seinem goldbestickten purpurnen Gewand und mit dem königlichen Diadem aus Gold gelassen vor ihm saß.
«Nun, jemand musste es tun.»
«Niemand musste es tun», platzte der erste Konsul heraus, «am allerwenigsten Ihr, ein schmieriger kleiner Klientelkönig aus dem Osten, der es nicht einmal über sich bringt, Schweinefleisch zu essen wie jeder Römer, der etwas auf sich hält.»
«Ich glaube, das war die letzte Information, die ich noch brauchte, um eine Entscheidung zu treffen, Onkel», raunte Vespasian verstohlen.
Gaius nickte bedächtig. «Ich bin soeben zum glühenden Anhänger von Claudius geworden. Ich war schon immer der Meinung, dass er der beste Mann für dieses Amt ist, ein geborener Herrscher.»
Herodes Agrippa ließ sich durch den Ausbruch des Konsuls nicht aus der Ruhe bringen. «Dieser schmierige kleine Klientelkönig aus dem Osten – der, nebenbei bemerkt, sehr gern Schweinefleisch isst – hat es heute auf sich genommen, Eure törichten Köpfe zu retten, weil ich erkannt habe, dass der Ausgang unvermeidlich ist. Anders als manche anderen bin ich Claudius ins Lager der Prätorianer gefolgt und war dabei, als sie ihn zum Kaiser erklärten. Allerdings fand Claudius, es sei verfassungswidrig, dass die Prätorianer ihm den Purpur zusprechen –»
Gnaeus Sentius Saturninus sprang auf, da er vor latent republikanischer Entrüstung nicht mehr an sich halten konnte. «Es ist absolut verfassungswidrig, das darf nur der Senat!»
Herodes Agrippa lächelte milde. «Ja, das fand Claudius auch, obwohl die Prätorianer das Gegenteil bewiesen haben, indem sie einen Kaiser töteten und durch einen anderen ersetzten. Claudius war sehr daran gelegen – er hat sogar darauf bestanden, sobald man ihn in das Lager gebracht hatte –, dass der Senat ihn zum Kaiser erklärt. Er wollte, dass seine Ernennung wenigstens zum Schein auf Antrag dieses Hauses geschieht. Er wartete stundenlang, hörte jedoch nichts von Euch. Stattdessen habt Ihr hier oben auf den Schatztruhen gesessen und Pläne und Intrigen geschmiedet, über deren Inhalt er nur Vermutungen anstellen konnte. Eines wusste er allerdings sicher: Euer Zögern, ihn zum Kaiser zu erklären, konnte nur bedeuten, dass Ihr ihn nicht wolltet.»
«Das haben wir nie gesagt», stellte Pomponius Secundus tonlos fest.
«Erniedrigt Euch nicht selbst, indem Ihr mich anlügt. Jedes Wort, das hier gefallen ist, wurde Claudius jüngst von ein paar Senatoren hinterbracht, unter anderem auch von einem der Prätoren. Diese Männer legten großen Wert darauf zu betonen, dass sie nichts mit der Angelegenheit zu tun hatten, aber seltsamerweise haben sie ihn dennoch um Verzeihung gebeten.
So, wie ich es sehe, ist der Einzige unter Euch, der hier eine einigermaßen gute Figur abgegeben hat, Aulus Plautius.»