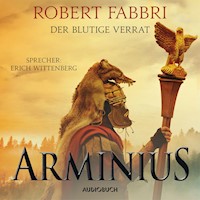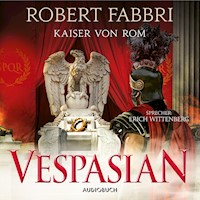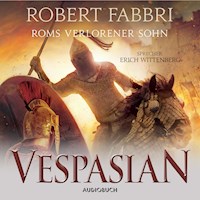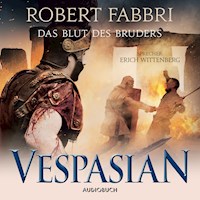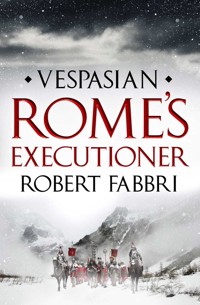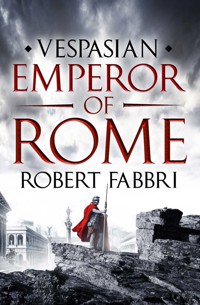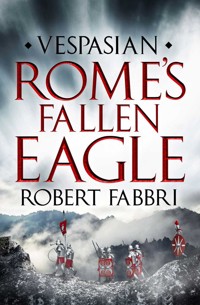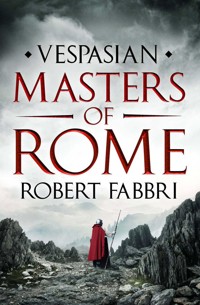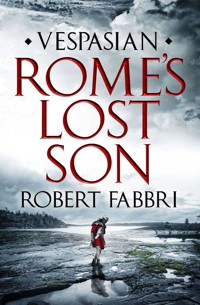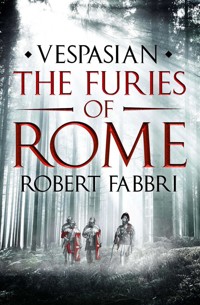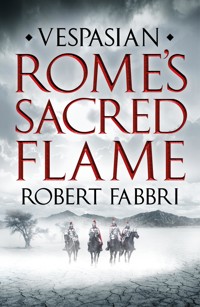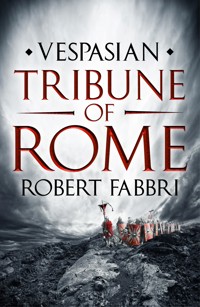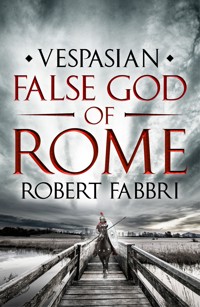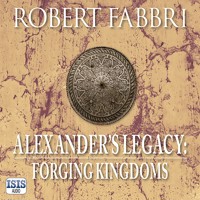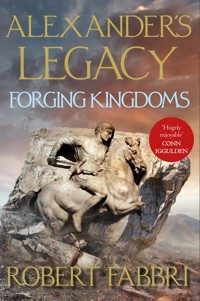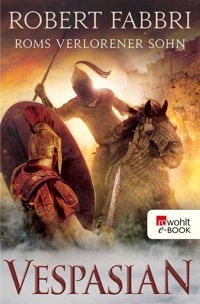
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Vespasian-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das britische Bestseller-Epos über das Leben des Kaisers Vespasian geht weiter! Exakt recherchierte Historie und packende Action bieten besten Stoff für Fans von Bernard Cornwell und David Gilman. Das Jahr 51 n. Chr.: Endlich kann Vespasian seinem Kaiser Claudius einen der zähesten Widersacher Roms vorführen: den britannischen Häuptling Caratacus. Doch gleich darauf hat Roms Politik Vespasian wieder in den Klauen. Aus Bosheit blockiert Agrippina, die neue Gemahlin des Kaisers, Vespasians Karriere, wo sie nur kann. Gleichzeitig stiften Parther Unruhe in Armenien und anderen oströmischen Provinzen. Gehen die Spannungen auf eine List von Agrippina zurück, um ihren Sohn Nero so schnell wie möglich auf den Thron zu bekommen? Um sich und seine Familie zu retten, muss Vespasian den weiten Weg auf sich nehmen und es herausfinden. Aber er wird verraten und erbarmungslos eingekerkert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Robert Fabbri
Vespasian. Roms verlorener Sohn
Historischer Roman
Über dieses Buch
Unruhe im Osten des Römischen Reiches. Intrigen einer skrupellosen Herrscherin. Vespasian in grausamer Gefangenschaft.
Das Jahr 51 n. Chr. Endlich kann Vespasian seinem Kaiser Claudius einen der zähesten Widersacher Roms vorführen: den britannischen Häuptling Caratacus. Doch gleich darauf hat Roms Politik Vespasian wieder in den Klauen. Aus Bosheit blockiert Agrippina, die neue Gemahlin des Kaisers, Vespasians Karriere, wo sie nur kann. Gleichzeitig stiften Parther Unruhe in Armenien und anderen oströmischen Provinzen. Gehen die Spannungen auf eine List von Agrippina zurück, um ihren Sohn Nero so schnell wie möglich auf den Thron zu bekommen? Um sich und seine Familie zu retten, muss Vespasian den weiten Weg auf sich nehmen und es herausfinden. Aber er wird verraten und erbarmungslos eingekerkert …
«Robert Fabbri erreicht mit dieser Serie Großartiges. Er überrascht mich mit jedem Band.» (For Winter Nights)
Vita
Robert Fabbri, geboren 1961, lebt in London und Berlin. Er arbeitete nach seinem Studium an der University of London 25 Jahre lang als Regieassistent und war an so unterschiedlichen Filmen beteiligt wie «Die Stunde der Patrioten», «Hellraiser», «Hornblower» und «Billy Elliot – I Will Dance». Aus Leidenschaft für antike Geschichte bemalte er 3500 mazedonische, thrakische, galatische, römische und viele andere Zinnsoldaten – und begann schließlich zu schreiben. Mit seiner epischen historischen Romanserie «Vespasian» über das Leben des römischen Kaisers wurde Robert Fabbri in Großbritannien Bestsellerautor.
Mehr zum Autor und zu seinen Büchern: www.robertfabbri.com
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel «Vespasian. Rome’s Lost Son» bei Corvus/Atlantic Books, Ltd., London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Rome's Lost Son» Copyright © 2015 by Robert Fabbri
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karten © Peter Palm, Berlin
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich,
nach der Originalausgabe von Atlantic Books Ltd
Coverabbildung Tim Byrne
ISBN 978-3-644-40647-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Schwiegereltern Eddie und Christel Müller, meine Schwägerin Liane Olbertz, ihren Mann Sven und ihren Sohn Fabian in Dankbarkeit dafür, dass sie mich in ihre Familie aufgenommen haben.
Prolog
Stygische Finsternis herrschte in den Wassern des Pontus Euxinus, doch die Oberfläche glänzte im Mondlicht so silbrig hell, dass es Titus Flavius Sabinus in den Augen schmerzte. Stöhnend beugte er sich über die Reling einer Trireme, die vor der Mündung des Flusses Tyras vor Anker lag. Das Spiegelbild des Mondes wurde von den Wellen verzerrt, dann vielfach gebrochen, ehe es sich wieder zu einem fast vollkommenen Abbild zusammenzog, während das Schiff sich im Rhythmus der Wellen hob und senkte, die zu beiden Seiten nur hundert Schritt entfernt ans Ufer brandeten.
Das ständige Tanzen des einzigen Lichtes in seinem Blickfeld verstärkte noch den Aufruhr in Sabinus’ Eingeweiden. Wieder einmal krampfte sein Magen sich zusammen, und er erbrach einen kleinen Schwall Galle und Rotwein über die bereits besudelten Planken, von wo die Flüssigkeit auf das hinterste Ruderpaar an Steuerbord hinuntertropfte. Sein Stöhnen ging im Knarren von gespannten Leinen und Holz unter.
Der Trierarchus stand im Heck des Schiffes bei den zwei Steuerrudern und tat, als bemerkte er nicht, dass Sabinus beim Würgen unfreiwillig ein pfeifender Leibwind entfuhr. Er unterließ auch jede Bemerkung darüber, dass der Mann sich ausgerechnet an der Windseite des Schiffes erbrach. Der Statthalter der kaiserlichen Provinzen Moesien, Makedonien und Thrakien konnte auf seinem Schiff seinen Mageninhalt von sich geben, wo immer es ihm beliebte. Und auf der zweitägigen Fahrt von Novidunum, dem Heimathafen der Danuviusflotte etwa hundert Meilen vom Flussdelta entfernt, zu diesem trostlosen Ort an der Küste des Pontus Euxinus hatte der Stellvertreter des Kaisers sich bereits an diversen Orten erbrochen – nicht immer über Bord.
Sabinus atmete schnell und flach und verfluchte das Schicksal, das ihn gezwungen hatte, an Bord eines Schiffes zu gehen und hier sehr viel länger zu bleiben als der Inhalt seines Magens. Er hatte nie von sich behauptet, ein Seefahrer zu sein. Doch mit seiner Ernennung zum Statthalter vor drei Jahren ging eine Verantwortung nicht nur gegenüber dem Kaiser, sondern gegenüber dem Imperium selbst einher. Und nun war das Imperium – oder zumindest dessen östlicher Teil – womöglich ernsthaft bedroht, wenn das stimmte, was er durch einen Mittelsmann von den Stämmen der Geten und Daker nördlich des Danuvius erfahren hatte.
Er hatte keinen Grund gehabt, dem Bericht zu misstrauen. Der Mittelsmann war Tryphaina treu, der einstigen Königin von Thrakien. Als Urenkelin von Marcus Antonius war Tryphaina eine Bürgerin Roms und dem Imperium unverbrüchlich treu. Zwar lebte sie jetzt in Kyzikos an der Küste der Provinz Asia, seit sie auf Caligulas Betreiben abgedankt hatte, doch sie legte großen Wert darauf, sich über die Angelegenheiten ihrer einstigen Untertanen und jene ihrer Feinde auf dem Laufenden zu halten. Wenn Tryphainas Informant von einer Bedrohung gegen das Imperium berichtete, so war das unbedingt ernst zu nehmen.
Bis der Mann den gefahrvollen Weg über Land nach Novidunum zurückgelegt hatte, war die Neuigkeit bereits vier Tage alt. Er hatte Sabinus berichtet, bei den Königen der Stämme jenseits des Danuvius sei eine Gesandtschaft von Vologaeses, dem parthischen Großkönig, eingetroffen. Sabinus hatte daraufhin die drei Biremen und eine Trireme genommen, die im Hafen lagen, und war hinunter aufs Meer gefahren. Dort hatte er sich entlang der Küste nordwärts gehalten, um vor Tyras zu ankern, einer griechischen Kolonie unter dem Einfluss des Dakerkönigs Koson, der kein Freund Roms war.
Manche Pflichten waren von so entscheidender Wichtigkeit, dass man sie nicht delegieren konnte. Sabinus wusste, hätte er dem Kaiser Claudius – und vor allem der Kaiserin Agrippina und ihrem Geliebten Pallas, den wahren Machthabern in Rom – berichten müssen, er habe einen Untergebenen ausgeschickt, die parthische Gesandtschaft abzufangen, sie sei ihm jedoch durchs Netz gegangen, dann würde man das Versagen ihm anlasten. Wenn er selbst scheiterte, hätte er es wenigstens sich allein zuzuschreiben. Doch Sabinus hatte durchaus nicht die Absicht zu scheitern. Er konnte sich denken, worüber verhandelt worden war, als die Könige der Daker, Geten, Sarmaten und Bastarnen sich laut dem Informanten in einem Lager im Grasland fünfzig Meilen westlich von Tyras versammelt hatten. Es gab nur eines, was sie alle einte und zugleich auch für die Parther von Interesse war: ihren Hass auf Rom. Wenn dieser Hass über Roms nördliche Grenzen vordrang, würden die Parther, Roms erbittertster Feind im Osten, entweder nach Westen marschieren und wieder einmal versuchen, die Küste Syriens einzunehmen, um Zugang zum Mare Nostrum zu erlangen – zum ersten Mal, seit Rom den Osten erobert hatte. Oder sie würden nordwärts vorstoßen, durch die römischen Klientelkönigreiche Armenien und Pontos, um Zugang zum Pontus Euxinus zu bekommen.
So oder so waren Roms östliche Provinzen bedroht.
Doch nun bot sich Sabinus eine Gelegenheit, den Zeitpunkt und die Richtung eines solch kühnen Vorstoßes zu erfahren. Wenn man wusste, wie, wo und wann die Angriffe erfolgen sollten, konnte man sie abwehren. Es war daher von entscheidender Wichtigkeit, die Gesandten abzufangen, um sie zu verhören, wenn sie von Tyras in See stachen. Die Lichter der Stadt am Südufer der Mündung des gleichnamigen Flusses waren in der Dunkelheit schwach zu erkennen.
Er würgte noch einmal, wobei ihm wiederum ein Wind entfuhr – Ersteres diesmal trocken, Letzteres weniger –, dann richtete Sabinus sich auf. Trotz der kalten Meeresbrise schwitzte er. Das Spiegelbild des Halbmonds auf den Wellen wurde jetzt von einer düsteren Wolkenbank verschluckt. Der silberne Umriss tanzte noch ein paar Augenblicke auf dem schwarzen Wasser, dann verblasste und verging er. Sabinus schaute auf. Die Wolke verdeckte alles Licht am Himmel, sodass es zum ersten Mal, seit sie vor drei Nächten ihre Wache von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang begonnen hatten, völlig dunkel war. Bei Tag zogen sie sich nur gerade eben aus der Sichtweite der Turmwachen von Tyras zurück, hielten sich jedoch in der Nähe, um jedwedes Schiff abfangen zu können, das die Mündung verließ, um entlang der Küste den freundlichen Hafen zu erreichen, von dem die Parther aufgebrochen waren – welcher auch immer das sein mochte. Allerdings bezweifelte Sabinus, dass die Parther bei Tage segeln würden, denn der Informant hatte ihm berichtet, sie seien in tiefer Nacht in Tyras eingetroffen, was, wie Sabinus wusste, selbst für den erfahrensten Schiffsführer keine geringe Leistung war. Außerdem gab er sich keinen Illusionen hin – gewiss war seine Anwesenheit trotz aller Vorsicht nicht unbemerkt geblieben. Also würden die Parther vermutlich auf völlige Dunkelheit warten, wie sie jetzt herrschte, ehe sie sich aufs Meer hinauswagten.
Noch immer auf die Reling gestützt, wandte Sabinus sich an den Trierarchus. «Beordert die Ruderer auf ihre Plätze, Xanthos, und gebt das Signal für die drei Biremen, sich kampfbereit zu machen.» Während der Trierarchus den Befehl nach unten zum Ruderdeck weitergab, wischte Sabinus sich Erbrochenes vom Kinn und schaute zum Bug. Dort waren undeutlich die Umrisse der halben Centurie Marinesoldaten auszumachen, die bei der Balliste auf dem Deck kauerten, schweigend, wie er es befohlen hatte. Er bedeutete dem Centurio, der sie befehligte, mit einer Geste, sie sollten aufstehen und sich bereit machen. Von unten ertönten die gedämpften Laute der einhundertzwanzig Ruderer, die ihre Plätze einnahmen, je ein Mann an den Rudern der unteren Reihe und je zwei an den oberen. Sabinus versuchte seine Benommenheit abzuschütteln. Mit einem Blick nach unten stellte er fest, dass die Ruder ausgefahren waren und das Schiff sich jederzeit in Bewegung setzen konnte. Gerade fielen die ersten Regentropfen ins Meer und trommelten langsam und unregelmäßig auf das Deck.
Das Schiff war bereit. Sabinus zog seinen roten Wollmantel so zurecht, dass er ihm auch die Arme wärmte. Er band die rote Schärpe enger, die er über seinem bronzenen Brust- und Rückenpanzer um die Taille trug, und richtete sein Wehrgehänge, sodass das Schwert gerade an seiner rechten Hüfte hing. Nachdem er den Helm aufgesetzt und den Kinnriemen geschlossen hatte, nahm er seinen gewölbten Schild, ging nach vorn zum Bug und stellte sich neben den Centurio der Marine. Über ihnen ragte der Corvus auf, über den sie ein gegnerisches Schiff entern würden. Sabinus richtete sich wieder aufs Warten ein. Vor ihnen lagen noch drei Nachtstunden. Er spähte in die Dunkelheit, die nun noch undurchdringlicher schien, da der Regen stärker wurde.
Zuerst war es nur eine Ahnung. Durch den strömenden Regen war nichts zu sehen, und kein Geräusch übertönte das unablässige Prasseln auf Holz und Wasser, doch eine knappe Stunde vor Tagesanbruch war Sabinus sicher, dass sie nicht mehr allein waren. Er wischte sich den Regen vom Gesicht und spähte mit zusammengekniffenen Augen in die Finsternis. Der Guss war wie eine schwarze Wand aus Wasser, nur gelegentlich schimmerte Licht von der gut eine Meile entfernten Stadt hindurch. Doch dann drang eine neue Wahrnehmung in sein Bewusstsein: ein Geräusch, nur ganz schwach, aber eindeutig etwas anderes als der prasselnde Regen und das Knarren von Holz und gespannten Leinen, mit dem das Schiff der Kraft des Meeres widerstand. Da war es wieder, tief und langgezogen. Sabinus zählte bis fünf, da wiederholte sich der Laut. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr: Es war ein stetiger Rhythmus, das vereinte angestrengte Stöhnen Dutzender Ruderer, die sich gleichzeitig in die Riemen legten.
Er wandte sich zum Trierarchus um, hob den Arm und gab das Zeichen loszurudern. An beiden Enden des Schiffes holten Matrosen die Ankerleinen ein, und binnen weniger Augenblicke kündigte der schrille Pfeifenton des Taktgebers den ersten Ruderschlag an. Das Schiff nahm Fahrt auf.
«Eure Männer sollen die Balliste laden, Thracius», befahl Sabinus dem Centurio der Marine. «Und sorgt dafür, dass die Matrosen den Corvus bemannen und mit Enterhaken bereitstehen.»
Thracius salutierte und machte sich daran, seine Befehle umzusetzen, während die Trireme mit jedem schnellen Ruderschlag an Schwung gewann. Um Sabinus herum entstand rege Geschäftigkeit: Die Balliste wurde gespannt, Matrosen gingen an dem Seilzug in Stellung, mit dem der Corvus heruntergelassen wurde, sodass der Sporn sich in das Deck des gegnerischen Schiffes bohrte und es festhielt, damit es geentert werden konnte. Marinesoldaten überprüften ihre Ausrüstung, Matrosen säumten die Reling und nahmen mit Enterhaken im Bug Aufstellung. Das angestrengte Ächzen der Ruderer verstärkte sich, während sie sich in die knarrenden Riemen legten, um das gewaltige Schiff schneller voranzutreiben. Zusammen mit den Lauten von den drei Biremen – eine zu jeder Seite und eine hinter ihnen – entstand eine Kakophonie menschlicher Anstrengung. Sabinus war sich der Gefahr bewusst, dass die Parther sie hörten, doch er machte sich weiter keine Gedanken darüber, denn es war ohnehin nicht zu ändern. So viele Männer konnten unmöglich lautlos rudern. Etwas anderes bereitete ihm Sorge: Sie mussten das feindliche Schiff entdecken, ehe es ihnen entkam. Er starrte voraus in die Nacht, während unter ihm der Bugsporn das schwarze Wasser zu grauem Schaum aufpflügte. Seine Übelkeit war vergessen.
Dann war es da, ein dunklerer Schatten auf einem dunklen Meer, die Umrisse schwach gegen den Schein der wenigen Laternen im Hafen dahinter abgezeichnet. Rufe von überall auf dem Schiff zeigten an, dass auch andere Mitglieder der Besatzung den Schemen entdeckt hatten. Mit jedem ächzenden Ruderschlag, der die Trireme ihrer Beute näher brachte, wurde er deutlicher. Sabinus hatte dem Trierarchus Anweisungen erteilt, die Gegner abzufangen und zu rammen. Jetzt fühlte er, wie das Schiff ein wenig den Kurs änderte, um ebendas zu tun. Er lächelte in sich hinein, da erkannte er schlagartig, dass der Schatten nicht ein einziges Schiff war – er teilte sich in drei dunkle Körper, von denen einer nach Steuerbord schwenkte, einer nach Backbord. Der dritte, mittlere, blieb auf Kollisionskurs mit der Trireme und war nun keine fünfzig Schritt mehr entfernt. Die Biremen zu beiden Seiten von Sabinus änderten ihren Kurs, um die zwei fliehenden Schiffe abzufangen.
«Abschuss!», rief Thracius. Mit einem Knall schnellten die beiden Arme der Balliste nach vorn und schleuderten den Bolzen dem herannahenden Schatten entgegen. Er schlug mit einem dumpfen Laut ein, doch es folgten keine Schreie.
«Bereit zum Rammen!», brüllte Thracius, da der Abstand zwischen den beiden Schiffen sich rapide verringerte. Seine Männer gingen auf ein Knie und stützten sich mit ihren Schilden und Wurfspeeren, den Pila, ab.
Vom Heck erscholl ein lautes Kommando, durch einen Schalltrichter verstärkt. Daraufhin wurden die Ruder scharrend eingeholt, damit sie nicht abbrachen, falls der Feind versuchen sollte, seitlich am Schiffsrumpf entlangzuschrammen. Sabinus klammerte sich an die Reling und kniete nieder. Der Schatten war jetzt so nah, dass die Umrisse einer zweiten Trireme von gleicher Größe erkennbar wurden. Die Planken ächzten, als die beiden Rümpfe mit der Steuerbordseite des Bugs zusammenprallten. Der Corvus wurde an kreischenden Flaschenzügen hinuntergelassen und durchschlug die Reling des Gegners, doch da die beiden Schiffe schräg aufeinandergetroffen waren, schrammte der einen Fuß lange Eisensporn außen am Rumpf entlang, statt sich in das Deck zu bohren. Der Schwung trieb die Schiffe weiter, ihre Bugsporne glitten an den gewölbten Rümpfen ab und versetzten sie in entgegengesetzte Drehung, jeweils nach Steuerbord. Sie waren außer Kontrolle, die Besatzungen auf das Deck gestürzt.
Sabinus hob den Kopf, um über die Reling zu spähen. Das römische Schiff drehte sich nach links um die eigene Achse, und sein Heck bewegte sich geradewegs auf das des Partherschiffes zu, das sich langsam, majestätisch, unausweichlich in die Gegenrichtung drehte wie in einem seltsamen nautischen Tanz. «Thracius, führt Eure Männer ans Heck und versucht, die beiden Schiffe beim Zusammenstoß mit Leinen zu verbinden.»
Der Centurio rappelte sich vom Deck hoch und rief den Matrosen mit Enterhaken und seinen Männern Kommandos zu, ihm zu folgen. Sabinus beobachtete mit kühlem Interesse, wie die beiden Schiffe sich weiter annäherten. Mit einem heftigen Ruck und dem schrillen Knirschen strapazierten Holzes prallten sie etwa an der Stelle zusammen, wo Sabinus sich vorhin erbrochen hatte. Thracius’ Männer stürzten aufs Deck, kamen jedoch im nächsten Moment auf die gebrüllten Befehle des Centurios wieder auf die Beine. Zugleich erschien aus dem Dunkel hinter der Trireme die dritte römische Bireme unter vollen Segeln und in Rammgeschwindigkeit. Das Stöhnen der Ruderer mit jedem schnellen Schlag war deutlich hörbar, der Bug pflügte durch das aufgewühlte Wasser direkt dem des Partherschiffes entgegen.
Ungebremst rammte das kleinere Schiff die Trireme. Der bronzeverstärkte Bugsporn stieß einen Fuß unter der Wasserlinie in den Rumpf des Gegners. Der Krach übertönte die Laute menschlicher Anstrengung und der Naturgewalten. Tief bohrte sich die zerstörerische Waffe der Bireme in die Eingeweide des Partherschiffes, bis der Bug in den Schiffsrumpf schmetterte und ein weiteres Eindringen verhinderte. Das Schiff schaukelte heftig knirschend, aufgespießt an dem Bugsporn, der das klaffende Loch mit jeder Bewegung weiter aufriss.
Dann flogen die Enterhaken, da Thracius und seine Männer sich anschickten, das Schiff zu stürmen. Während die Leinen befestigt wurden, schlugen die ersten gegnerischen Pfeile in die Schilde der Marinesoldaten ein oder pfiffen unsichtbar über die Trireme hinweg in die Schwärze. Da und dort wurde ein Schrei laut, und ein Matrose brach mit einem befiederten Schaft im Körper zuckend zusammen. Brüllend sprang Thracius auf die Reling und stürzte sich auf das feindliche Schiff. Seine Männer folgten ihm ohne Zögern, während auf dem Deck des Partherschiffes dunkle Gestalten versuchten, eine Verteidigungslinie zu bilden.
Sabinus richtete sich auf und ging wieder zum Heck. Er hatte keine Eile, denn er selbst brauchte nicht Leib und Leben zu riskieren bei der niederen Arbeit, ein feindliches Schiff zu stürmen. Im Übrigen schienen Thracius und seine Männer ihrer Aufgabe vollauf gewachsen. Sie hatten sich in zwei Reihen formiert und warfen sich den Verteidigern entgegen. Windböen peitschten den strömenden Regen über das schwankende Deck, sodass das Blut, das auf die nassen Planken floss, gleich wieder weggespült wurde. Eisen schepperte gegen Eisen, traf mit dumpfem Laut auf lederbezogenes Holz und schnitt in Fleisch und Knochen, begleitet von den gellenden Schreien der Verstümmelten und Sterbenden.
Hinter den Marinesoldaten lagen die parthischen Steuerleute und ihr Trierarchus bereits tot unter den Steuerrudern, daneben ein paar Bogenschützen, die sich nicht mehr rechtzeitig hatten zurückziehen können, als Thracius’ Männer das Schiff gestürmt hatten. Nicht weit von den Leichen entfernt bewachten ihre Gegner, ein halbes Dutzend Marinesoldaten, den Niedergang zum Ruderdeck. Mit langen Speeren stießen die Männer nach der panischen Besatzung des Partherschiffes, die versuchte, dem einströmenden Wasser zu entfliehen. Wären diese Leute heraufgekommen, dann hätten sie den Kameraden der römischen Soldaten in den Rücken fallen können, welche jetzt die Verteidiger zurückdrängten. Sie kämpften so erbittert und diszipliniert, wie Sabinus es von römischen Truppen erwartete. Da die Ruderer den Fluchtweg versperrt fanden, zwängten sich viele von ihnen durch die Ruderluken, um ihr Glück im Meer zu wagen. Dahinter fuhr die Bireme die Ruder wieder aus, um sich von dem gerammten Partherschiff, das bereits deutlich Schlagseite hatte, zu lösen. Die Ruderblätter peitschten das ohnehin schäumende Wasser noch mehr auf, sodass die darin treibenden Männer vergebens gegen die Wellen ankämpften und ihre Schreie verstummten. Viele wurden unter Wasser gesogen, andere von Rudern am Kopf getroffen und schwer verletzt. Das berstende Holz kreischte, dass es einem durch Mark und Bein ging, als die Bireme sich rückwärts in Bewegung setzte.
Sabinus sprang über die Reling auf das stark beschädigte Schiff. Er zog sein Schwert und marschierte auf die Linie der Kämpfenden zu, die jetzt fast den Hauptmast erreicht hatte, vorbei an den zahlreichen Toten und Verwundeten. Das Schiff schlingerte, als die Bireme es freigab, dann beruhigte es sich wieder und blieb mit deutlicher Schlagseite liegen. Sabinus stolperte, konnte sich jedoch abfangen; das plötzliche Schaukeln drehte ihm erneut den Magen um. Als er eine schwache Regung eines Sterbenden zu seiner Linken bemerkte, hielt Sabinus inne, stieß dem Mann sein Schwert in die Kehle und drehte die Klinge nach beiden Seiten. Er wollte nicht riskieren, dass ein Gegner, der sich vielleicht nur kampfunfähig stellte, ihm in den Rücken fiel. Als er seine Klinge zurückzog, quollen mit einem röchelnden Laut Blut und Luftblasen aus der Wunde. Sabinus wollte weitergehen, doch dann hielt er abrupt inne. Er schaute im schwachen Licht auf das Gesicht des Mannes hinunter. Es war bärtig, aber mit einem Vollbart nach griechischer Sitte, nicht kurz gestutzt wie bei den Parthern. Dann betrachtete Sabinus die Beine des Mannes: Er trug Hosen nach östlicher Manier, die jedoch nicht teilweise von einer langen Tunika verdeckt waren. Er schaute sich um. Alle toten Feinde waren mit Hosen bekleidet, doch keiner von ihnen trug eine Tunika oder einen Bart nach orientalischer Sitte. Sie waren auch nicht bewaffnet und gerüstet wie Parther – mit Schuppenpanzern, geflochtenen Schilden, Bogen, kurzen Speeren und Schwertern –, sondern eher nach der Art der Griechen am nördlichen Euxinus: ein ovaler Schild, Thureos genannt, Wurfspeer und kurzes Schwert. Sabinus fluchte leise, dann lief er zurück zu der Stelle, wo der feindliche Trierarchus lag. Der Bart des Mannes war kupferfarben, nicht gefärbt, sondern von Natur. Das war der Beweis: Er war definitiv kein Parther.
Dies war nicht das Schiff der Gesandtschaft.
Panik stieg ihm in die Kehle. Er stürzte zur Reling und hielt Ausschau. An Backbord konnte er erkennen, dass eines der Begleitschiffe von einer Bireme angegriffen worden war, doch an Steuerbord war nichts zu sehen. Hinter ihm brachen Thracius’ Leute gerade den letzten Widerstand der Schiffsbesatzung.
«Ich will Gefangene!», schrie Sabinus dem Centurio zu, der mit wuchtigen Schwerthieben gegen die zurückweichenden Gegner vorrückte, während seine Männer zu beiden Seiten eine blutige Ernte einbrachten. Er rannte los und drängte sich von hinten zwischen die Marinesoldaten, stieß und rempelte sie beiseite und schrie ihnen zu, Gefangene zu nehmen, bis er Thracius erreichte. «Gefangene! Ich brauche ein paar Gefangene!»
Der Centurio drehte sich zu ihm um und nickte, die Augen im Rausch des Tötens geweitet, Gesicht und Arme blutverschmiert. Er rief seinen Männern zu beiden Seiten Befehle zu, und sie stürmten vor, um den geschlagenen Feind zu verfolgen. Sabinus machte sich daran, unter den Gefallenen nach Verwundeten zu suchen, in denen noch genug Leben steckte, dass sie ihm die Information liefern konnten, die er jetzt verzweifelt dringend brauchte. Er verfluchte sich selbst dafür, dass er vor lauter Seekrankheit nicht geistesgegenwärtig genug gewesen war. In seiner geschwächten Verfassung hatte er angenommen, die parthische Gesandtschaft würde einfach versuchen, unbemerkt an seiner kleinen Flotte vorbeizukommen. An die Möglichkeit eines Ablenkungsmanövers hatte er gar nicht gedacht. Auf welchem der beiden anderen Schiffe befand sich die Gesandtschaft?
Dann hallte das Wort plötzlich in seinem Kopf wider: Ablenkungsmanöver, Ablenkungsmanöver. Galle stieg ihm in die Kehle, doch diesmal war der Grund nicht das Schwanken des Schiffes – er war überlistet worden. Die Parther befanden sich auf keinem dieser Schiffe. Er lief zum Bug, wo Thracius und seine Männer gerade die letzten rund zwei Dutzend Gegner entwaffneten, und hielt nach Norden Ausschau. Über ihnen färbten eben die ersten Vorboten der Morgendämmerung die dichte Wolkendecke.
«Wo wollt Ihr sie verhören, Herr?», fragte Thracius, zwang einen Gefangenen in die Knie, riss seinen Kopf an den Haaren zurück und hielt ihm eine blutige Klinge an die Kehle.
Sabinus starrte ernüchtert zu der wendigen kleinen Liburne hinaus, die, im ersten Dämmerlicht eben erkennbar, eine Viertelmeile entfernt unter vollen Segeln und Rudern an ihnen vorbeiglitt, mit einer Geschwindigkeit, die weder die Trireme noch die Biremen lange halten könnten. «Ich brauche sie nicht mehr. Beseitigt sie.»
Die entsetzten Gefangenen brachen in flehentliches Geschrei aus, als der erste getötet wurde. Sabinus empfand einen plötzlichen Abscheu vor sich selbst, dass er ihren Tod befahl, nur weil es ihn kränkte, überlistet worden zu sein. «Halt, Thracius!»
Der Centurio war gerade im Begriff, seine Schwertspitze in den Hals eines zweiten kreischenden Gefangenen zu bohren. Er hielt inne und schaute sich nach seinem Vorgesetzten um.
«Werft sie ins Wasser, sie können ihr Glück versuchen wie die Übrigen. Anschließend kommt mit Euren Männern wieder auf unser Schiff.»
Während die Marinesoldaten den Befehl ausführten, kehrte Sabinus auf die Trireme zurück. Er überlegte, wie er seinen äußerst heiklen Brief an Pallas anfangen sollte, der Claudius’ bevorzugter Freigelassener und die wahre Macht hinter dem Thron des sabbernden, leicht zu beeinflussenden Schwachkopfes war. Nicht einmal sein Bruder Vespasian, der dank Pallas’ Einfluss in Kürze Suffektkonsul für die letzten zwei Monate des Jahres werden sollte, würde ihn vor dem Zorn der Mächtigen schützen können.
Und ihr Zorn würde berechtigt sein.
Sabinus gab sich keinen Illusionen hin. Er hatte desaströs versagt. Die Gesandtschaft befand sich nun auf dem Weg zurück in die Hauptstadt Ktesiphon am Tigris, um dem Großkönig Bericht zu erstatten.
Er konnte seine Schuld unmöglich verhehlen. Zweifellos hatte Pallas auch unter den Dakern seine Mittelsmänner, und die Kunde von der Gesandtschaft und Sabinus’ Scheitern würde ihn binnen ein bis zwei Monaten erreichen. Ebenso gewiss war, dass die Freigelassenen Narcissus und Callistus davon erfahren würden. Sie waren Pallas’ Kollegen und Rivalen. Pallas hatte sie übertrumpft, indem er Agrippina zur Kaiserin gemacht hatte, und nun waren sie in Claudius’ unsteter Wertschätzung auf den zweiten Rang herabgestuft worden. Zweifellos würden sie Sabinus’ Versagen als politische Waffe in den erbitterten Rangkämpfen im Kaiserpalast benutzen.
Sabinus verfluchte die Schwäche des Kaisers, durch die eine solch entflammbare politische Lage zustande gekommen war, und er verfluchte die Männer und Frauen, welche diese Schwäche zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzten. Doch vor allem verfluchte er seine eigene Schwäche: die Seekrankheit, die ihn befiel, wann immer er an Bord eines Schiffes ging. Heute Nacht hatte sie ihm den Verstand vernebelt und dazu geführt, dass er einen Fehler begangen hatte.
Aufgrund dieser Schwäche hatte er in seinem Dienst an Rom versagt.
Teil I
I
Anhaltend und schrill hallte der Schrei von den Wänden und Marmorsäulen des Atriums wider, eine Folter für alle, die ihn ertragen mussten.
Titus Flavius Vespasianus biss die Zähne zusammen, entschlossen, sich von dem mitleiderregenden Klagelaut nicht erweichen zu lassen, der an- und abschwoll und gelegentlich von einem heiseren Atemzug unterbrochen wurde, ehe er mit neuer Kraft einsetzte. Das Leiden, von dem er zeugte, musste erduldet werden. Vespasian wusste, wenn er dazu nicht fähig wäre, würde er diesen Willenskrieg verlieren – und das konnte er sich nicht leisten.
Die Kakophonie der Verzweiflung ging von dem Bündel in den Armen seiner Frau aus, das er im flackernden Schein des Holzfeuers in der Feuerstelle des Atriums strampeln sah. Vespasian verkrampfte sich, dann hob er den Kopf und winkelte den linken Arm vor dem Körper an, während sein Leibsklave die Toga um seine muskulöse, stämmige Gestalt drapierte. Titus, Vespasians elfjähriger Sohn, beobachtete die Prozedur.
Als das schwere wollene Gewand endlich zu Vespasians Zufriedenheit gerichtet war, schien noch immer kein Ende der Schreie in Sicht. Er schlüpfte in die Senatorenschuhe aus rotem Leder, die sein Sklave ihm hinhielt. «Die Fersen, Hormus.»
Hormus fuhr mit dem Finger nacheinander um beide Fersen, bis die Schuhe seines Herrn richtig saßen, dann richtete er sich auf und zog sich ehrerbietig zurück. Titus trat vor seinen Vater hin.
Vespasian zwang sich, ruhig zu bleiben, während der Lärm einen neuen Höhepunkt erreichte. Er musterte Titus einen Moment. «Kommt der Kaiser noch immer jeden Tag, um sich zu vergewissern, dass sein Sohn Fortschritte macht?»
«An den meisten Tagen, Vater. Er stellt mir und den anderen Jungen auch Fragen, genau wie Britannicus.»
Ein besonders schriller Schrei ließ Vespasian zusammenzucken, doch er bemühte sich, ihn zu ignorieren. «Was geschieht, wenn ihr eine falsche Antwort gebt?»
«Dann schlägt Sosibius uns, sobald Claudius wieder gegangen ist.»
Vespasian ließ sich vor seinem Sohn nicht anmerken, dass er keine sonderlich hohe Meinung von dem Grammaticus hatte. Sosibius’ falsche Anschuldigungen, angestiftet von der Kaiserin Messalina, hatten vor drei Jahren eine Ereigniskette in Gang gesetzt, aufgrund deren Vespasian falsches Zeugnis gegen den vormaligen Konsul Asiaticus hatte ablegen müssen, um seinen Bruder Sabinus zu schützen. Doch Asiaticus hatte sich über das Grab hinaus gerächt und Vespasian dazu als williges Werkzeug benutzt. Messalina war hingerichtet worden, und Vespasian war zugegen gewesen, während sie ihren letzten schrillen Schrei, ihren letzten Fluch ausgestoßen hatte. Sosibius hingegen war noch immer im Amt, nachdem Vespasians Falschaussage seine erfundenen Anschuldigungen gestützt hatte.
«Schlägt er euch oft?»
Titus’ Gesicht verhärtete sich. Sein Ausdruck war dem von Vespasian in angespannten Situationen verblüffend ähnlich. Die breite Nase des Knaben war weniger ausgeprägt, das Kinn nicht so kräftig, seine Ohrläppchen waren nicht so lang, und er hatte einen dichten Schopf, wo sein Vater nur noch einen Haarkranz um den kahlen Scheitel hatte. Doch Titus war unverkennbar sein Sohn. «Ja, Vater. Aber Britannicus sagt, das tut er, weil seine Stiefmutter, die Kaiserin, es befohlen hat.»
«Dann verschaffe Agrippina das Vergnügen nicht und sorge dafür, dass Sosibius heute keinen Grund bekommt, dich zu schlagen.»
«Wenn doch, wird es das letzte Mal sein. Britannicus hat eine Idee, wie er Sosibius’ Entlassung erreichen kann und wie er zugleich dadurch seinen Stiefbruder beleidigt.»
Vespasian zauste Titus das Haar. «Lass dich nicht in eine Fehde zwischen Britannicus und Nero hineinziehen.»
«Ich halte immer zu meinem Freund, Vater.»
«Gib nur acht, dass du es nicht zu offensichtlich tust.» Vespasian fasste den Knaben mit einer Hand am Kinn und blickte ihm eindringlich in die Augen. «Das ist gefährlich, verstehst du?»
Titus nickte langsam. «Ja, Vater, ich glaube, ich verstehe.»
«Gut, und nun lauf. Hormus, begleite Titus hinaus zu seiner Eskorte. Sind Magnus’ Leute bereit?»
«Ja, Herr.»
Während Hormus mit Titus den Raum verließ, ging das Geschrei weiter. Vespasian wandte sich Flavia Domitilla zu, der Frau, mit der er seit zwölf Jahren verheiratet war. Sie saß da, starrte ins Feuer und unternahm keinen Versuch, den Säugling in ihren Armen zu beruhigen. «Falls meine Klienten dich wirklich für die Amme halten sollen, wenn ich sie zur morgendlichen Salutatio einlasse, meine Liebe, dann schlage ich vor, du legst den kleinen Domitian an die Brust und singst ihm gallische Schlaflieder.»
Flavia schnaubte und starrte weiter in die Flammen. «Wenigstens würden sie dann denken, wir könnten uns eine gallische Amme leisten.»
Vespasian beugte sich stirnrunzelnd vor. Er konnte nicht glauben, was er da eben gehört hatte. «Was redest du denn, Weib? Wir haben eine gallische Amme. Nur hast du heute Morgen offenbar beschlossen, nicht nach ihr zu rufen, sondern das Kind lieber hungern zu lassen.» Wie um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, nahm er ein Stück Brot von seinem kürzlich unterbrochenen Frühstück, tunkte es in die Schale mit Olivenöl und verspeiste es genüsslich.
«Sie ist nicht gallisch! Sie ist hispanisch.»
Vespasian unterdrückte einen ungeduldigen Seufzer. «Ja, sie ist aus Hispanien, aber sie ist Keltin, eine Keltibererin. Sie stammt vom selben Volk hünenhafter Stammeskrieger ab wie alle Ammen, von denen die vornehmsten Frauen Roms ihre Söhne stillen lassen. Nur dass ihre Vorfahren, nachdem sie den Rhenus überquert hatten, nicht in Gallien blieben, sondern weiter über die Berge bis nach Hispanien zogen.»
«Und deshalb ist ihre Milch so dünn, dass sie nicht einmal ein Kätzchen am Leben erhalten könnte.»
«Ihre Milch ist nicht anders als die anderer Keltinnen.»
«Deine Nichte schwört auf ihre Allobrogerin.»
«Wie Lucius Iunius Paetus seine Frau verwöhnt, ist seine Sache. Aber einen Säugling hungern zu lassen, weil seine Amme nicht einem der angeseheneren keltischen Stämme angehört, ist in meinen Augen der Akt einer verantwortungslosen Mutter.»
«Und eine Ehefrau im Schmutz und Elend des Quirinal leben zu lassen und ihr dann nicht einmal zu gestatten, das nötige Personal zu kaufen, um die Familie zu versorgen, ist in meinen Augen der Akt eines hartherzigen und gefühllosen Ehemannes und Vaters.»
Vespasian verbiss sich ein Schmunzeln. Nun waren sie beim Kern des Problems angekommen. Zweieinhalb Jahre zuvor hatte er seine guten Beziehungen zu Pallas genutzt, nachdem der Freigelassene sich selbst in die höchste Machtposition an Claudius’ Hof manövriert hatte. Mit seiner Hilfe hatte Vespasian Flavia und die Kinder aus ihrer Wohnung im kaiserlichen Palast geholt, wo sie den größten Teil der vier Jahre gelebt hatten, in denen er als Legatus der II Augusta in Britannien gewesen war. Claudius hatte damals angeboten, sie im Palast aufzunehmen. Vorgeblich damit ihre Söhne zusammen erzogen werden konnten und damit Messalina, Claudius’ damalige Frau, eine Gesellschafterin bekam. Doch Vespasian wusste, dass in Wahrheit Messalinas Bruder Corvinus den Kaiser zu der Einladung angestiftet hatte, sodass Flavia und die Kinder Vespasians altem Feind auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Nach Messalinas gewaltsamem Ende hatte Pallas sein Wort gehalten und dafür gesorgt, dass Claudius Vespasian gestattete, seine Familie in ein Haus an der Granatapfelstraße auf dem Quirinal umzusiedeln, nahe dem seines Onkels, des Senators Gaius Vespasius Pollo. Flavia hatte das nicht gefallen.
«Wenn du es herzlos nennst, dass ich meine Familie vor den Gefahren der kaiserlichen Politik beschützen will, und wenn du es gefühllos nennst, dass ich sparsam wirtschafte und mich nicht jeder Mode unterwerfe, dann hast du mein Wesen vollkommen durchschaut, meine Liebe. Es ist schlimm genug, dass Titus jeden Tag in den Palast geht, um gemeinsam mit Britannicus unterrichtet zu werden. Doch das war Claudius’ Bedingung dafür, dass ich euch aus dem Palast holen durfte. Nach der Hinrichtung von Britannicus’ Mutter wollte er nicht, dass sein Sohn auch noch seinen kleinen Spielgefährten entbehren musste. Dass unser Sohn mit dem des Kaisers zusammen erzogen wird – trotz der Gefahr, in der er dadurch schwebt –, muss doch wohl genügen, um deine Eitelkeit zu befriedigen? Das muss dich doch über all dieses Elend hinwegtrösten?» Er wies mit einer lässigen Handbewegung auf das weitläufige Atrium, das sie umgab. Zwar hätte er freimütig eingeräumt, dass die Ausstattung nicht den Maßstäben des Palastes entsprach – das Haus war hundertfünfzig Jahre zuvor erbaut worden, in der Zeit von Gaius Marius. Das Bodenmosaik zeigte ein geometrisches Muster in Schwarz und Weiß, und die Wände waren von verblichenen Fresken bedeckt, welche die Illusion erzeugen sollten, der Betrachter schaue durch Fenster nach draußen. Doch was dem Haus an Prunk fehlte, das machte Vespasians Frau mit ihrer Extravaganz wett: Es war mit den Möbeln und Ziergegenständen ausgestattet, die Flavia in ihrer verschwenderischen Zeit unter dem Einfluss der ausschweifenden Messalina gekauft hatte.
Vespasian schauderte noch immer jedes Mal, wenn er den Raumschmuck ansah. Um das Impluvium in der Mitte, den Teich mit einem Springbrunnen in Gestalt der Venus, standen niedrige polierte Marmortischchen auf vergoldeten Beinen mit allerlei Ziergegenständen aus Glas und Silber darauf, Statuetten aus edler Bronze oder bearbeitetem Kristall, Sofas und Stühle, geschnitzt, bemalt und gepolstert. Es war nicht so sehr das Vulgäre, woran er Anstoß nahm – darüber hätte er hinwegsehen können, auch wenn er, auf dem Land geboren und aufgewachsen, einen schlichten Stil bevorzugte. Was ihn jedoch wirklich schmerzte, war das viele verschwendete Geld.
«Gewiss gibt es dir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, wenn all die anderen Frauen eifersüchtig darüber streiten, ob Agrippina Titus zugleich mit Britannicus töten wird, um ihrem Sohn Nero den Weg zur Nachfolge seines Stiefvaters zu ebnen. Dadurch stehst du doch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wie jede Frau mit Selbstachtung es sich nur wünschen kann?»
Flavia drückte ihren zwei Monate alten Sohn so fest an sich, dass Vespasian für einen Moment fürchtete, der Säugling könnte Schaden nehmen. Dann entspannte sie sich und stand auf, das Kind an der Brust, Tränen in den Augen. «Nach allem, was ich für dich getan habe, für uns, solltest du mir ein wenig Respekt zollen, Vespasian. Du bist einer der amtierenden Konsuln. Ich sollte leben können wie die Frau eines Konsuls, nicht wie die eines kleinen Emporkömmlings aus dem Ritterstand.»
«Was wir bei Licht betrachtet beide sind.»
Flavia öffnete den Mund, brachte jedoch keinen Ton heraus.
«Und nun, meine Liebe, werde ich meinen Klienten die Tür zu all diesem Elend öffnen. Sie werden mich nicht nur als den Herrn dieses Elends begrüßen, sondern auch als den Konsul von Rom, der ihnen große Vergünstigungen verschaffen kann, und sie werden über die Tatsache hinwegsehen, dass ich aus einer sabinischen Familie stamme, die vor mir und meinem Bruder nur einen Senator hervorgebracht hat. Auch meinen derben sabinischen Akzent werden sie überhören. Nachdem ich im Privaten meine Angelegenheiten als Patron dieser Leute geregelt habe, werde ich als Konsul von Rom dem Kaiser öffentlich einen der größten Feinde Roms zur Bestrafung übergeben. Wenn du möchtest, kannst du mit unserer Tochter kommen und zuschauen, zusammen mit all den anderen Frauen, und ihre heuchlerischen Schmeicheleien genießen. Aber vielleicht scheust du dich auch, dich zu zeigen, weil dein Mann dir eine Amme aus einem so unmodischen Stamm gekauft hat, dass sie nicht einmal anständige Milch hervorbringt.»
Vespasian wandte sich ab und gab dem Türhüter ein Zeichen zu öffnen. Mit einiger Erleichterung hörte er über das Geschrei seines jüngsten Sohnes hinweg, wie Flavias Schritte sich hastig entfernten.
Vespasian saß auf seinem kurulischen Stuhl vor dem Impluvium in der Mitte des Atriums. Hinter ihm plätscherte leise das Wasser aus einer Vase auf der Schulter der Venus, deren lebensecht bemalter nackter Körper zunächst noch im sanften Schein der Öllampen warm schimmerte; nach und nach wirkte er dann im zunehmenden Licht der Morgendämmerung kühler. Hinter Vespasian stand Hormus und machte Notizen auf einer Wachstafel. Zu beiden Seiten Vespasians hatten die zwölf Liktoren Aufstellung genommen, die ihn als Konsul überall in Rom begleiteten. Sie trugen die Fasces, die Rutenbündel mit einem Beil darin, Symbole seiner Macht, zu befehlen und Hinrichtungen anzuordnen. Doch im Augenblick übte Vespasian nicht seine Amtsgewalt aus, sondern seine Macht als Privatmann. Eben begrüßte ihn der letzte und unbedeutendste seiner etwa zweihundert Klienten.
Vespasian nickte dem Mann zu. «Ich habe heute keine Verwendung für dich, Balbus. Du kannst deiner Wege gehen, nachdem du mich zum Forum begleitet hast.»
«Es ist mir eine Ehre, Konsul.» Balbus rückte seine schlichte weiße Toga des römischen Bürgers zurecht und trat beiseite.
«Wie viele warten auf ein Gespräch unter vier Augen, Hormus?», fragte Vespasian. Er schaute sich im Raum um, der nun voller Menschen war. Die Männer unterhielten sich leise untereinander, während sie respektvoll darauf warteten, dass ihr Patron das Haus verließ.
Hormus brauchte nicht seine Wachstafel zu konsultieren. «Drei, die Ihr gebeten habt zu bleiben, und weitere sieben, die um eine Audienz ersucht haben.»
Vespasian seufzte. Es würde ein langer Morgen werden. Doch da der Senat an diesem Tag nicht zusammentrat, hatte er ausnahmsweise einmal Zeit, sich um persönliche Angelegenheiten zu kümmern, ehe die Pflicht seines öffentlichen Amtes rief – und dieser Pflicht blickte er heute mit großem Interesse entgegen.
«Und dann ist da noch ein Mann, der nicht Euer Klient ist, aber ebenfalls um ein Gespräch bittet.»
«Tatsächlich? Wie heißt er?»
«Agarpetus.»
Der Name sagte Vespasian nichts.
«Er ist ein Klient des kaiserlichen Freigelassenen Narcissus.»
Vespasian zog die Augenbrauen hoch. «Ein Klient von Narcissus will mich sprechen? Hat er eine Botschaft zu überbringen, oder will er sich um meine Gunst bemühen?»
«Das hat er nicht gesagt, Herr.»
Vespasian dachte kurz darüber nach, ehe er sich erhob. Die Sitte gebot, dass er diesen Mann zuletzt empfing, nach seinen eigenen Klienten. Es würde also noch einige Zeit dauern, ehe seine Neugier befriedigt wurde.
Zuerst zum Geschäftlichen.
Gefolgt von seinem Sklaven schritt er langsam und würdevoll, wie es dem obersten Magistrat Roms geziemte, an den Männern vorbei, die seiner Gunst harrten, zum Tablinum, dem Raum am hinteren Ende des Atriums, der mit einem Vorhang abgeteilt war. Er ließ sich hinter seinem Schreibpult nieder. «Zuerst möchte ich die drei sprechen, von denen ich Gefälligkeiten benötige, Hormus. In der Reihenfolge ihres Ranges.»
«Was der Kaiser getan hat, als er vor vier Jahren das Amt des Censors innehatte, kann nicht rückgängig gemacht werden, Laelius», erklärte Vespasian, nachdem er das Anliegen des Bürgers angehört hatte. Der Mann war fast kahl, und er trug unter seiner schlichten weißen Toga eine karminrote Tunika aus sehr edlem Stoff. An seinem Hals glänzte eine schwere Goldkette.
«Das ist mir bewusst, Patronus. Allerdings hat sich die Lage geändert.» Laelius zog ein Schriftstück aus dem Faltenbausch seiner Toga und trat näher an das Schreibpult, um es Vespasian zu reichen. «Dies ist eine Empfangsbestätigung vom Bankgeschäft der Brüder Cloelius auf dem Forum Romanum. Der Betrag beläuft sich auf genau einhunderttausend Denar, die Vermögensschwelle für den Aufstieg in den Ritterstand. Als Claudius mich vor vier Jahren des Ritterstandes enthob, war das vollkommen berechtigt, da durch eine Reihe ungeschickter Investitionen mein Gesamtvermögen an Geld und Gut deutlich unter diese Schwelle gesunken war. Doch inzwischen hat sich mein Glück gewendet, nachdem Euer Bruder mir auf Euer Betreiben zu dem Vertrag verholfen hat, die Flotte auf dem Danuvius mit Kichererbsen zu beliefern. Somit erfülle ich nun die finanziellen Voraussetzungen, um erneut in den Ritterstand erhoben zu werden.»
Vespasian warf einen Blick auf das Dokument. Es war echt. «Der Kaiser wird vielleicht erst in ein paar Jahren wieder über die Anwärter entscheiden.»
Laelius rang die Hände, und seine Stimme nahm einen verzweifelten Ton an. «Mein Sohn ist jetzt siebzehn. Nur als Ritter kann ich hoffen, ihm einen Posten als Militärtribun zu verschaffen, damit er den Cursus Honorum beginnen kann. In zwei oder drei Jahren wird es zu spät sein.»
So selbstsicher sein Klient äußerlich wirken mochte – Vespasian erkannte, dass Laelius nur einer von vielen Männern mittleren Alters war, denen davor graute, alt zu werden, ohne im Leben etwas Vorzeigbares erreicht zu haben. Wenn er jedoch seinem Sohn den Eintritt in die Ämterlaufbahn ermöglichte, die militärische und politische Karriere, durch die er einmal einen Sitz im Senat erlangen würde, dann könnte der Vater zu Recht von sich behaupten, die Ehre seiner Familie gemehrt zu haben. Vespasian verstand seine Lage sehr gut. Der Ehrgeiz seiner eigenen Eltern für die Familie hatte ihn selbst und seinen Bruder bis in das höchste Amt gebracht, das ein Bürger erreichen konnte – natürlich abgesehen vom Amt des Kaisers, das einer einzigen Familie vorbehalten war.
«Wenn ich recht verstehe, erbittest du zwei Gefallen von mir: erstens dass ich meinen Einfluss auf das Kaiserhaus geltend mache, damit Claudius dich in den Ritterstand erhebt. Und zweitens dass ich meinen Bruder bitte, deinen Sohn als Militärtribun in eine seiner beiden Legionen in Moesien aufzunehmen. Nachdem er dir bereits den Vertrag über die Kichererbsen verschafft hat.»
Laelius, sichtlich zutiefst verlegen, zog ein weiteres Schriftstück aus seiner Toga. «Mir ist bewusst, dass ich viel erbitte, Patronus, aber ich gebe im Gegenzug auch viel. Ich weiß, Senatoren dürfen keinen Handel treiben, jedoch wüsste ich keinen Grund, weshalb ein Senator nicht von den Geschäften anderer profitieren sollte. Dieses Dokument würde Euch zum stillen Teilhaber an meinem Gewerbe machen, mit einer Gewinnbeteiligung von zehn Prozent.»
Vespasian nahm das Schriftstück entgegen, las es und reichte es über die Schulter an Hormus weiter, der hinter ihm stand. «Also schön, Laelius, wenn du zwölf Prozent daraus machst, will ich sehen, was ich tun kann.»
«Lasst Hormus die Änderung an dem Vertrag vornehmen, Patronus.»
«Es wird ihm ein Vergnügen sein.»
Laelius neigte mehrmals dankbar den Kopf, rieb sich die Hände und beschwor den Segen sämtlicher Götter auf seinen Patron herab, während Hormus ihn durch den Vorhang hinausgeleitete.
Vespasian trank ein paar Schlucke verdünnten Wein und erwartete den letzten Bittsteller des Morgens. Währenddessen überlegte er, was wohl ein Klient von Narcissus von ihm wollen könnte.
«Tiberius Claudius Agarpetus», kündigte Hormus an und führte einen glattrasierten, drahtigen Mann herein. Er schien sehr wohlhabend zu sein, denn er trug an allen Fingern einschließlich der Daumen Ringe, die mit großen Edelsteinen besetzt waren. Seine Haut, olivfarben wie die der Nordgriechen, spannte über den hohen Wangenknochen und der ausgeprägten, schmalen Nase. Seinen zwei römischen Namen zum Trotz trug er selbst zu diesem förmlichen Anlass keine Toga.
Vespasian forderte ihn nicht auf, sich zu setzen. «Was kann ich für dich tun, Agarpetus?»
«Die Frage ist vielmehr, was ich für Euch tun kann, Konsul.» Der Grieche sprach gewählt und in ruhigem Ton, die dunklen Augen, die keinerlei Gefühle verrieten, fest auf Vespasian gerichtet.
«Was kann ein Freigelassener wohl für mich tun? Ich nehme an, du bist Narcissus’ Freigelassener, da du seine Namen trägst, die er wiederum bei seiner Freilassung von Claudius angenommen hat.»
«Das ist richtig, Konsul. Narcissus hat mich vor zwei Jahren aus der Unfreiheit entlassen, und seither habe ich für ihn eine Vielzahl heikler Aufgaben übernommen, darunter auch das Sammeln von Informationen.»
«Ich verstehe. Du spionierst also für ihn?»
«Nicht direkt. Ich beziehe Informationen von seinen Mittelsmännern in den östlichen Provinzen und schätze ihre Glaubhaftigkeit und Bedeutung ein, sodass mein Patron nur erfährt, was er erfahren muss.»
«Ah, du bist also einer, der anderen Zeit erspart.»
«So ist es.»
«Und der über Wissen verfügt.»
«Ja, Konsul, ich bin einer, der Zeit spart und über Wissen verfügt.»
Vespasian ahnte, worauf es hinauslief. «Wissen, das für mich von Wert sein könnte?»
«Von großem Wert.»
«Und was ist der Preis dafür?»
«Ein Treffen: Ihr und Euer Onkel mit meinem Patron.»
Vespasian runzelte die Stirn und strich sich mit einer Hand über den fast kahlen Kopf. «Warum bittet uns Narcissus nicht einfach selbst darum? Zwar ist er bei Claudius in Ungnade gefallen, aber er ist noch immer der kaiserliche Sekretär und besitzt die Macht, einen Konsul und einen Senator zu einem Gespräch zu bestellen.»
«Das ist richtig, doch er wünscht, dass das Treffen geheim bleibt. Deshalb muss es an einem anderen Ort als im Palast stattfinden, wo die Kaiserin und ihr Liebhaber überall Augen und Ohren haben.»
«Pallas?»
«Wie Ihr wisst, stehen die Dinge zwischen meinem Patron und Pallas nicht zum Besten …»
«Und wie du weißt, pflege ich eine gute Beziehung zu Pallas. Ich werde mich an Narcissus’ Intrigen gegen ihn nicht beteiligen.»
«Nicht einmal wenn Pallas wissentlich zuließe, dass die Kaiserin Eure Karriere behindert?»
Vespasian schnaubte verächtlich. «Meine Karriere behindert? Sieht es etwa danach aus? Ich bin Konsul.»
«Aber weiter werdet Ihr es nicht bringen. Ihr werdet keine Provinz bekommen, kein militärisches Kommando, nichts. Ihr werdet politisch in Bedeutungslosigkeit versinken. Mein Patron bittet Euch, einmal dies zu überdenken: Warum wurdet Ihr nur für die letzten zwei Monate dieses Jahres Konsul?»
«Weil mein zweiundvierzigster Geburtstag im November war, also konnte ich das Amt nicht früher antreten. Es war eine große Ehre, der Amtskollege des Kaisers zu sein.»
«Zweifellos dachte dieser Niemand Calventius Vetus Carminius genau dies, als er für den September und Oktober Claudius’ Kollege wurde. Ich vermute sogar, er fühlte sich noch geehrter als Ihr, da er nichts geleistet hatte, um sich das Amt zu verdienen.»
Vespasian öffnete den Mund, um zu widersprechen, schloss ihn jedoch gleich wieder. Seine Gedanken rasten.
Agarpetus argumentierte weiter. «Aber gewiss wäre es für den siegreichen Legatus der Zweiten Augusta eine größere Ehre gewesen, im Januar des nächsten Jahres Konsul zu werden? In wenigen Tagen hättet Ihr der zweite Konsul für ganze sechs Monate werden können, vielleicht sogar mit dem Kaiser als Eurem Kollegen, und das Jahr wäre nach Euch beiden benannt worden. Aber nein, Ihr habt nach all Euren treuen Diensten in Britannien nur einen Brosamen bekommen. Eine Amtszeit von zwei Monaten, genau wie der Mann, dessen Nachfolger Ihr seid und von dem niemand jemals gehört hat – und wisst Ihr, warum?»
Vespasian antwortete nicht, er war zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.
«Die Kaiserin hasst Euch, weil Euer Sohn mit Britannicus befreundet ist. Pallas kann nichts für Euch tun, gegen eine solche Feindin ist er machtlos. Sie hat ihrem gefügigen Gemahl eingeredet, es wäre eine überaus große Ehre für Euch, zum Konsul ernannt zu werden, sobald Ihr das Mindestalter erreicht hättet. Und sie wird auch verhindern, dass Ihr irgendeinen Euch vielleicht zugedachten Posten antreten könnt, wenn Ihr am ersten Januar, in drei Tagen, Euer Amt niederlegt. Eure einzige Hoffnung, weiter voranzukommen, wäre ihr Ableben, und das werdet Ihr nicht herbeiführen, indem Ihr zu Pallas haltet. Narcissus hingegen …» Agarpetus verstummte und ließ die Andeutung im Raum stehen.
Vespasian sagte noch immer nichts. Sein Verstand arbeitete, und ihm dämmerte, dass es stimmte, was sein Besucher da sagte. Tief in seinem Inneren hatte er es wohl immer gewusst; tief im Inneren war er gekränkt gewesen, das Amt des Konsuls für die letzten zwei Monate eines Jahres zu bekommen. Tief im Inneren war ihm klar gewesen, dass das einer Missachtung gleichkam. Das Gefühl der Ehre, Konsul zu sein, war insgeheim immer von Groll getrübt gewesen. Doch er hatte all das eben in sich vergraben. «Wie wird sie mein Fortkommen verhindern?»
«Euer Bruder hat jüngst in seinem Dienst an Rom in geradezu spektakulärer Weise versagt.»
«Wie meinst du das?»
«Das sind die Informationen, von denen wir dachten, sie würden Euch interessieren. Narcissus wird Euch die Angelegenheit erklären, wenn Ihr Euch mit ihm trefft. Vorerst muss es genügen, wenn ich sage, dass Sabinus’ Fehler als Vorwand genügt, um die Karriere sämtlicher Mitglieder Eurer Familie zum Stillstand zu bringen. Pallas kann Euch nicht helfen, somit bleibt Euch nur eine Option.»
Narcissus verstand sich wirklich darauf, verborgene Wahrheiten zu erkennen und Leute zu manipulieren. Vespasian schaute Agarpetus an, und seine Entscheidung war bereits gefallen – die Wahl zwischen Bedeutungslosigkeit und Treulosigkeit fiel nicht schwer. «Also gut, ich werde mich mit Narcissus treffen.»
Agarpetus deutete ein Lächeln an, als fände er seine Voraussage bestätigt. Es war das erste Mal, dass sein Gesicht eine Regung verriet. «Er schlägt vor, der sicherste Ort wäre die Taverne der Bruderschaft vom südlichen Quirinal. Er geht davon aus, dass Euer Freund, der Klient Eures Onkels, Marcus Salvius Magnus, noch immer deren Patron ist.»
«Allerdings.»
«Sehr gut, seine Diskretion ist gewiss. Narcissus und ich werden heute Nacht zur siebten Stunde dort sein, wenn die Stadt die Hinrichtungen des heutigen Tages feiert.»
«Guten Morgen, mein lieber Junge!», rief Gaius Vespasius Pollo mit dröhnender Stimme. Er watschelte eilends herbei, um sich neben seinem Neffen einzureihen, wobei sein umfangreicher Bauch, das Gesäß, die hängenden Brüste und das Kinn heftig wabbelten, anscheinend alle in unterschiedlichem Takt. «Danke, dass du mich zu der Ehre eingeladen hast, die Gefangenen zum Kaiser zu führen.» Hinter ihm gesellten seine Klienten sich zu denen Vespasians, sodass sie beide auf ihrem Weg den Quirinal hinunter nun ein Gefolge aus insgesamt weit über fünfhundert Mann hatten.
Vespasian neigte den Kopf. «Ich danke dir, Onkel, dass du mir deine Klienten leihst und damit meine Ankunft auf dem Forum eindrucksvoller machst.»
«Es ist mir ein Vergnügen – eine hübsche Abwechslung, wieder einmal von Liktoren angeführt zu werden.»
«‹Abwechslung erfreut›», zitierte eine Stimme dicht hinter Gaius. «Und für mich und die Jungs ist es eine hübsche Abwechslung, Euch einmal nicht den Weg durch die Menge bahnen zu müssen, da das heute professionell für Euch erledigt wird. Machen sie ihre Sache nicht wirklich gut?»
«Allerdings, und wie mir scheint, mit größerer Befriedigung, Magnus», bemerkte Gaius. Trotz der würdevollen Gangart und des frostigen Winterwindes begann er zu schwitzen. «Schließlich wird ein Liktor bezahlt, also verbindet er die Pflicht mit dem Vergnügen.»
Magnus’ von den Narben seiner Boxerlaufbahn gezeichnetes Gesicht nahm einen entrüsteten Ausdruck an, und er warf seinem Patron mit dem verbliebenen gesunden Auge einen schiefen Blick zu. Die bemalte Glaskugel in seiner linken Augenhöhle starrte indessen weiter blicklos geradeaus. «Wollt Ihr damit sagen, meine Jungs hätten kein Vergnügen daran, für Euch den Weg freizuknüppeln, Senator? Denn bezahlt werden wir doch gewiss von Euch, wenn auch zugegebenermaßen nicht so, wie das Kollegium der Liktoren seine Mitglieder entlohnt. Ihr zeigt Euch uns auf subtile und viel lukrativere Arten erkenntlich, sodass unser Gewerbe weitaus befriedigender ist, wenn Ihr versteht, was ich meine?»
Vespasian klopfte seinem Freund lachend auf die Schulter. Zwar war Magnus neunzehn Jahre älter als er und stand gesellschaftlich weit unter ihm, doch sie waren Freunde, seit Vespasian als Jüngling von sechzehn Jahren erstmals nach Rom gekommen war. Er und sein Onkel wussten besser als die meisten anderen, wie befriedigend Magnus sein Gewerbe in der kriminellen Unterwelt Roms fand, als Anführer seiner Bruderschaft der Straße an der Kreuzung am südlichen Quirinal. «Gewiss, mein Freund. Und es freut mich, dass du auch in deinem Alter noch Befriedigung aus deiner Arbeit ziehst.»
Magnus fuhr sich mit einer Hand durchs Haar, das altersgrau, aber noch immer dicht war. «Jetzt macht Ihr Euch über mich lustig, Herr. Ich mag die sechzig überschritten haben, doch in mir steckt noch immer Kampfkraft und Manneskraft – auch wenn ich nicht mehr so gut sehe, seit ich das Auge verloren habe. Ich muss allerdings zugeben, das wird allmählich zum Problem. Ich bin nicht mehr ganz der Alte, und ein paar Bruderschaften aus der Gegend haben Wind davon bekommen.»
«Vielleicht ist es an der Zeit, dich zur Ruhe zu setzen und das Leben zu genießen. Sieh dir zum Beispiel deinen Patron an: Er hat nun schon seit drei Jahren keine Rede mehr im Senat gehalten.»
Gaius strich sich eine sorgfältig gekräuselte und gefärbte Locke aus dem Gesicht und sah Vespasian erschrocken an. «Mein lieber Junge, du fragst dich doch nicht etwa, warum das so ist? Als ich das letzte Mal genötigt wurde, im Senat zu sprechen, musste ich eine Liste aller Senatoren und Ritter verlesen, die verbrecherischer Handlungen mit Messalina beschuldigt und zum Tode verurteilt waren. Durch eine solche Enthüllung zieht man eine Menge Aufmerksamkeit auf sich, und davon habe ich mich auch nach drei Jahren noch nicht erholt. In all der Zeit konnte ich nicht einmal die Vorstellung ertragen, eine Meinung zu haben, geschweige denn eine solche zu äußern.»
«Nun, ich fürchte, du wirst möglicherweise aus deinem selbstauferlegten Rückzug wiederkehren müssen, Onkel.»
Der Schrecken in Gaius’ Miene nahm zu. «Wofür in aller Welt?»
«Die Frage ist nicht für was, sondern für wen, Onkel.»
«Pallas?»
«Ich wünschte, es wäre so, aber leider nein.»
«Ist das denn klug?», fragte Gaius, nachdem Vespasian von seinem Gespräch mit Agarpetus berichtet hatte. «Wenn du dich weigerst, ihn zu treffen, besteht noch immer die Möglichkeit, dass Pallas auf Agrippina Druck ausüben kann. Vielleicht könnte er sie dazu bringen, ihre Haltung zu ändern oder sich wenigstens nicht so entschieden gegen dich zu stellen, nur weil dein Sohn zufällig der beste Freund ihres Stiefsohnes ist. Wenn du dich jedoch hinter Pallas’ Rücken mit Narcissus triffst, sind alles Vertrauen und aller Zusammenhalt dahin, und wir verlieren den besten Verbündeten unserer Familie im Palast.»
«Aber dieser Verbündete ist der Liebhaber meiner Feindin.»
«Und somit ist Pallas dein Feind, während Narcissus, da er Agrippinas Feind ist, zu deinem Freund wird? Lieber Junge, denk einmal nach: Pallas hat nichts weiter getan, als seine eigene Stellung abzusichern, indem er sich mit Agrippina verbündete. Er hat die vernünftige Wahl getroffen, da Nero weit besser als Britannicus dazu geeignet ist, Claudius’ Nachfolger zu werden, einfach weil er drei Jahre älter ist. Claudius hat nicht mehr länger als zwei, vielleicht drei Jahre zu leben – denkst du wirklich, ein Knabe könnte herrschen?»
Vespasian überdachte die Frage. Die Gesellschaft zog jetzt durch einen Säulengang auf das Augustusforum, das vom Tempel des Mars Victor mit seinen prächtigen Farben Tiefrot und leuchtend Goldgelb dominiert wurde. Auf Sockeln an den Rändern des Forums standen ebenso farbenfroh bemalte Statuen, teils mit Togen, teils in Militäruniform. Ihre Augen – weit lebensechter als Magnus’ billiges Glasauge – schienen den Leuten auf dem Platz zu folgen, als lenkten die Männer, deren Andenken hier geehrt wurde, noch immer die Geschicke der Stadt. «Nein, Onkel, nicht ohne einen Regenten», räumte Vespasian schließlich ein.
«Und wer wäre das in Britannicus’ Fall? Seine Mutter ist tot, den Göttern sei Dank. Somit bliebe sein Onkel Corvinus oder Burrus, der Präfekt der Prätorianergarde. Niemand würde einen der beiden an der Macht sehen wollen, also neigen die meisten zu Nero, nachdem er an seinem vierzehnten Geburtstag vor fünfzehn Tagen die Toga virilis angelegt hat. Sollte Claudius morgen sterben, so hätten wir einen Mann, der seinen Platz einnehmen könnte.»
«Wenn Nero Kaiser wird, sorgt Agrippina gewiss dafür, dass ich nie wieder ein Amt bekleide.»
«Dann halte Titus künftig von Britannicus fern, und schon ist das Problem gelöst.»
«Ist es das? Claudius wäre beleidigt. Und was, wenn er uns alle überrascht und noch zehn Jahre lebt?»
Nun war es an Gaius, nachdenklich zu schweigen, während sie weiter auf das Caesarforum schritten. Hier, im Schatten eines Reiterstandbildes des einstigen Herrschers, konnten Bittsteller sich an den Stadtpräfekten und niedere zivile Magistrate wenden. «Das wäre ungünstig», räumte Gaius ein, «aber höchst unwahrscheinlich.»
«Dennoch nicht unmöglich. Nachdem ich mir nun schon Agrippinas Feindschaft zugezogen habe, würdest du es da für weise halte, wenn ich versuche, mir ihre Gunst zu erkaufen, indem ich mir auch noch Claudius zum Feind mache?»
«Wenn du so fragst, nein.»
«Also was bleibt uns anderes übrig, als heute Nacht zu dem Treffen mit Narcissus zu gehen?»
Massenhafter Jubel brach aus, als Vespasians zwölf Liktoren auf das Forum Romanum hinausmarschierten und durch ihr Erscheinen die Ankunft eines der Konsuln beim Senatsgebäude ankündigten. Die Bürger waren zu Tausenden zusammengeströmt, um den größten Tag Roms seit der Ovatio für Aulus Plautius vor vier Jahren mitzuerleben. Dies war der Tag, an dem Roms größter Feind für seine Kühnheit bezahlen und vor den Augen des Kaisers sterben würde – der Häuptling, der den Widerstand gegen den jüngsten Eroberungsfeldzug angeführt hatte.
Doch zuvor hatte Vespasian in Abwesenheit des ersten Konsuls die Aufgabe, das Opferritual zu vollziehen und die Auspizien einzuholen. Sein kaiserlicher Kollege wartete derweil im Lager der Prätorianer vor der Porta Viminalis. Es war von größter Wichtigkeit, dass die Götter den Tag für die bevorstehenden Geschäfte der Stadt für günstig erklärten. Vespasian zweifelte nicht daran, dass dies der Fall sein würde.
Blut strömte in einem pulsierenden Schwall in das Kupferbecken unter dem aufgeschlitzten Hals des weißen Stieres. Das Tier blickte benommen, da der Vater des Hauses es mit einem Hammerschlag gegen die Stirn betäubt hatte, ehe Vespasian, eine Falte seiner Toga über den Kopf gezogen, das Messer führte. Die blutüberströmten Vorderbeine und Schultern des Opfertieres begannen zu zittern. Die Zunge hing ihm aus dem Maul, und seine Gedärme entleerten sich in einem dampfenden Schwall, während ihm die Knie einknickten. Die fünfhundert amtierenden Senatoren der Stadt, die nach der Rangfolge geordnet auf den Stufen vor dem Senatsgebäude standen, verfolgten ernst die altehrwürdige Zeremonie, die seit undenklichen Zeiten im Herzen Roms ausgeführt wurde.
Vespasian war zurückgetreten und hielt sicheren Abstand von den diversen Absonderungen des Stieres. Es hätte als schlechtes Omen gegolten, wenn die Toga des Konsuls besudelt worden wäre, und das gesamte Ritual hätte deshalb erneut durchgeführt werden müssen. Jetzt nahmen zwei Sklaven unter der Aufsicht des Vaters des Hauses das gefüllte Becken fort, unmittelbar bevor das Tier zusammenbrach. Sein Herzschlag wurde rasch schwächer, und aus lebendigem Fleisch wurde ein Kadaver.
Vespasian wiederholte über dem toten Tier die rituelle Beschwörung des Jupiter Optimus Maximus, die Stadt zu segnen. Seit der Gründung der Republik hatten die Inhaber seines Amtes diese Formel angestimmt. Dann wälzten vier andere öffentliche Sklaven den toten Stier auf den Rücken und zogen die Gliedmaßen auseinander, damit der Körper aufgeschnitten werden konnte.
Der Gestank dampfender Eingeweide schlug Vespasian entgegen, als seine scharfe Klinge die Gabe an den Schutzgott Roms aufschlitzte. Die Menge auf dem Forum und in den angrenzenden Straßen hielt den Atem an. Nach einer Reihe sorgfältig und kundig geführter Schnitte nahm Vespasian das noch warme Herz heraus, zeigte es zuerst seinen Senatorenkollegen, dann den Rittern im vorderen Teil der riesigen Menge und legte es schließlich zischend in das Feuer auf Jupiters Altar vor der offenen Tür zur Curia.
Von beiden Seiten bogen je zwei öffentliche Sklaven den Brustkorb auf, und Vespasian machte sich an die schwierige Arbeit, die Leber zu entnehmen, ohne seine Toga zu beflecken. Aus seiner vielfältigen Erfahrung mit Opfern wusste er, dass es entscheidend war, geduldig und methodisch zu arbeiten. Bald war das Organ unversehrt herausgetrennt und auf dem Tisch neben dem Altar abgelegt. Mit dem bereitliegenden Tuch wischte Vespasian das Blut von der Leber ab, dann strich er mit der Hand über die Oberfläche. Im nächsten Moment erstarrte er. Er hatte das Gefühl, als wollte das Herz ihm aus der Brust springen. Ein paar krampfhafte Atemzüge lang starrte er wie gebannt auf ein fast purpurrotes Mal auf dem rotbraunen Organ. Im Unterschied zu einem gewöhnlichen Makel hatte dieses Mal – anscheinend durch zwei Adern verursacht, die dicht unter der Oberfläche zusammenliefen – eine klar definierte Form. Es erinnerte an die Brandzeichen, mit denen Sklavenhalter ihren Besitz kennzeichneten: ein einzelner Buchstabe, klein, aber deutlich hervortretend. Das war es, was ihn so erschreckt hatte. Es war der Buchstabe, mit dem sein eigener Name anfing, ein «V». Mehr noch, das Zeichen befand sich fast genau in der Mitte der Leber, knapp links des dünnen Mittellappens – in dem Bereich, der nach der Lehre der alten Etrusker seinem Schutzgott Mars geweiht war.