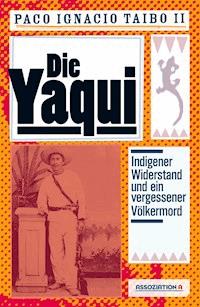7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit einem Nachwort von Thomas Wörtche. Über das Buch: Die Journalisten Greg und Julio wollen vierhändig den großen Revolutionsroman des 20.Jahrhunderts schreiben – aber ehe es sich die beiden komischen und traurigen Romantiker versehen, sind sie in einer ultrageheimen Operation eines ultrageheimen US-Geheimdienstes gelandet, der so geheim ist, dass er selbst noch nicht einmal weiß, dass es ihn gibt. Nur sein Name ist bekannt: SD, das Shit Department. Da darf es auch niemanden wundern, wenn Leo Trotzki als Kriminalautor auftritt, außerdem Stan Laurel und Houdini, Sandokan und Max Klee. In seinem Opus magnum verschmilzt Paco Ignacio Taibo II Triviales, Revolutionslegenden, Mythen des Alltags und harte Realitäten zu einem vergnüglichen, spannenden und bunt glitzernden Monumentalpuzzle von literarischem Rang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über das Buch
Die Journalisten Greg und Julio wollen vierhändig den großen Revolutionsroman des 20. Jahrhunderts schreiben – aber ehe sich die beiden komischen und traurigen Romantiker versehen, sind sie in einer ultrageheimen Operation eines ultrageheimen US-Geheimdienstes gelandet, der so geheim ist, dass er selbst noch nicht einmal weiß, dass es ihn gibt. Nur sein Name ist bekannt: SD, das Shit Department. Da darf es auch niemanden wundern, wenn Leo Trotzki als Kriminalautor auftritt, außerdem Stan Laurel und Houdini, Sandokan und Max Klee.
In seinem Opus magnum verschmilzt Paco Ignacio Taibo II Triviales, Revolutionslegenden, Mythen des Alltags und harte Realitäten zu einem vergnüglichen, spannenden und bunt glitzernden Monumentalpuzzle von literarischem Rang.
»Ein ›großer‹ Roman und eine Orgie des Erzählens – wollüstig, undogmatisch, amüsant, witzig, menschlich, rührend, spannend, bösartig, intelligent, kein Gran elitär, populär, kunstvoll gemacht, bild- und sprachmächtig.«
Thomas Wörtche
»Der Mexikaner Paco Ignacio Taibo II hat mit ›Vier Hände‹ mehr einen atemberaubenden Kinofilm als einen Roman aufs Papier gebracht. Ständig springt er hier- und dorthin, vor und zurück, durch Welt und Zeit als seien ihm Chronologie und Raum egal. Trotz dieser Hunderten von Geschichten verliert man nie den Faden. Denn am Ende führt Taibo sein Chaos souverän zusammen, und aus einer Collage wird ein prächtiges Gemälde der lateinamerikanischen Gesellschaft sowie eine Hommage an die Fabulierlust ihrer größten Literaten.«
a Vela – Das Kunstmagazin
»›Vier Hände‹ ist wohl ein opulenter Kriminalroman, strahlt aber weit über das Genre hinaus. Diese überbordende Erzählung ist ein grandioses Lesevergnügen.«
Frank Rumpel
»Taibo ist ein Erzähler, der das Schreiben als Spiel begreift, als Vergnügen, dessen Gegenpart der Leser ist. Taibo ist, im wahrsten Sinn des Wortes, ein Dirigent von Geschichten, ein Erbauer unterschiedlicher Welten.«
Topodrilo
Über den Autor
Paco Ignacio Taibo II wurde 1949 in Gijon (Spanien) geboren und kam im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern nach Mexiko. Er studierte Literatur, Soziologie und Geschichte ohne Abschluss, arbeitete als Journalist, Universitätsdozent und Sachbuchautor. Als Kriminalschriftsteller weltweit bekannt und erfolgreich wurde er durch seinen »unabhängigen« Detektiv Hector Belascoaran Shayne, der in Mexico City seine Fälle bearbeitet.
Paco Ignacio Taibo II
Vier Hände
Roman
Aus dem Spanischen von Annette von Schönfeld
CulturBooks Verlag
www.culturbooks.de
Inhaltsverzeichnis
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2014
www.culturbooks.de
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Originalausgabe, »Cuatro Manos«, erschien 1990 im Verlag Vanguardia in Managua.
Die deutsche Printerstausgabe erschien 1996 im Verlag der Buchläden Schwarze Risse/Rote Straße, Berlin / Verlag Libertäre Assoziation, Hamburg
Diese Ausgabe erscheint mit freundlicher Genehmigung des Verlags Assoziation A, Berlin
© by Paco Ignacio Taibo II 1990
© by Unionsverlag 2004
eBook-Cover: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 1.12.2014
ISBN: 978-3-944818-69-6
Erster Teil
Dienste und Berufe
1
Stan in Parral
Am 19. Juli 1923, gegen halb sechs abends, überquerte der Mann die internationale Brücke, die El Paso (Texas) mit Ciudad Juárez (Chihuahua) verbindet. Es war heiß. Vier Karren, die Stacheldraht nach Mexiko transportierten, hatten Staub in die Luft gewirbelt. Der mexikanische Zöllner betrachtete aus seiner Baracke heraus flüchtig den dünnen, grau gekleideten Mann mit einem schäbigem Lederkoffer und schwarzer Melone auf dem Kopf. Er maß dem Mann, der auf ihn zukam, keinerlei Bedeutung bei und vertiefte sich wieder in den Gedichtband von Rubén Darío. Er versuchte, eines der Gedichte auswendig zu lernen, denn er wollte es, in Kissen versunken, einer französischen Hure vortragen, die er gewöhnlich aufsuchte und der solche Dinge gefielen.
Der klapprige Dünne ging durch Wolken aus Baumwollstaub zum Schreibtisch des mexikanischen Zöllners und legte seinen Koffer sanft auf den Tresen, so als wolle er sich in niemandes Leben einmischen, nicht einmal in das eigene. Der Zöllner hob den Kopf voller Gedanken an Bärenklau und Vögel mit prächtigem Gefieder und betrachtete den Gringo aufmerksam. Das Gesicht kam ihm bekannt vor. Jemand, der oft die Grenze überschritt? Ein Händler? Nein, das war es nicht. Extrem blasses Gesicht, abstehende Ohren, kleine und bestürzte Augen und ein Mund, der nach einem Lächeln schrie, das nicht gelingen wollte. Er verspürte den Impuls, ihn zu beschützen, ihn einzuladen, zu zweit Gedichte zu rezitieren. Der dünne Gringo sah den mexikanischen Beamten nicht einmal an, der ihn mit seinem Blick musterte. Der Zöllner erinnerte sich an seinen Beruf und öffnete den Koffer: acht Flaschen Genever, sorgfältig verpackt, sonst nichts. Nicht einmal ein Paar Socken oder Unterhosen. Dieser durchgeknallte Gringo wollte sich totsaufen. Warum soff das Arschloch nicht zu Hause? Aber er schaffte es nicht, sich in eine nationalistische Wut hineinzusteigern. Der Gringo, beschloß er, war ein Leidensgenosse in Sachen Liebeskummer. Noch ein Typ, den seine Alte verrückt machte. Und er fühlte in sich eine tiefe und überschwengliche Solidarität wachsen. Er klappte den Koffer zu und machte mit weißer Kreide das Zeichen für freien Durchgang. Der Gringo betrat Mexiko mit einem Koffer in der Hand, ohne ein einziges Wort gesagt zu haben. Der Zöllner sah ihm nach, wie er über die staubigen Straßen von Ciudad Juárez entschwand, und als er sich erneut in sein Buch vertiefen wollte, fiel ihm ein, warum ihm das Gesicht des segelohrigen Dünnen so bekannt vorkam. Er erinnerte sich sogar an den Namen: Stan Laurel, einer, der in den Filmen zu sehen war, die im Kino Trinidad gezeigt wurden, ein Komiker. Er folgte ihm mit dem Blick, bis er ihn an der Ecke aus den Augen verlor.
Stan wanderte ziellos durch die Stadt und hielt inne, als er direkt vor dem Bahnhof stand.
»Wohin?« fragte der Fahrkartenverkäufer.
»South, anywhere.«
»Bis wohin in den Süden hätten Sie’s denn gern, mein Freund?«
Stan zuckte mit den Achseln.
»Wäre Ihnen Parral recht, mein Herr?«
Stan zuckte erneut mit den Achseln.
»Der Zug geht um acht Uhr abends und kommt um sieben Uhr morgens an, es ist ein Güterzug mit zwei Personenwaggons.«
Einen Augenblick später ließ sich Stan mit seiner Fahrkarte in der Hand auf eine grün gestrichene Metallbank auf dem Bahnhofsvorplatz von Ciudad Juárez fallen und sah den Packern und Süßigkeitenverkäufern zu, und manchmal sah er in sich hinein.
Er zählte ein paar offensichtliche Wahrheiten zusammen: Die Sache mit Mae konnte so nicht weitergehen. Sie machten sich kaputt. Ganz ruhig, so als ob keiner dabei die geringste Eile hätte. Sie verletzten sich und stocherten in der offenen Wunde herum, je nach Uhrzeit und Laune mit einem Zahnstocher, einer Gabel, einem Küchenmesser. Es gab Momente, in denen sie es nicht einmal mehr aus Wut taten, sondern nur aus Neugier, so als wollten sie die Grenzen des Leidens, die Grenzen der Langeweile ausprobieren. Mae hatte ihre Gründe. Sie dachte, du seiest gerade dabei, sie über Bord zu werfen, sie links liegen zu lassen, um deine Karriere zu machen. Fünfundzwanzig Kurzfilme in nur einem Jahr. Nach so vielen Morgendämmerungen auf der Flucht vor Hotelportiers, die die Bezahlung der Rechnung einforderten, nach traurigen Besäufnissen – oft waren ihre Mägen ebenso leer wie die Theater, in denen sie spielten – ging jeder seines Weges. Aber das war es nicht. John hatte Recht. Sie war Charakterschauspielerin, keine Komödiantin, und du konntest sie nicht auf deinem Weg mitziehen. Sie mußte ihren finden, oder sie gingen beide unter, müßten wieder auf Theatertournee in verlorene Dörfer des Mittleren Westens gehen.
Stan weint. Er weiß nicht, ob wegen des Staubes, der durch die Luft wirbelt, oder wegen Mae Dahlberg, dieser Frau, in die er verliebt und nicht verliebt ist, Sängerin, Tänzerin, Trapezkünstlerin im Zirkus, Australierin, die er vor vier Jahren in New York geheiratet hat.
Um halb acht am Morgen des 20. Juli 1923 überquerte Stan Laurel die Plaza Juárez von Parral und betrat das Hotel Neptun. Er erhielt für zwei Pesos ein Zimmer, das normalerweise 1,20 kostete. Er betrat den Raum: ein Bett mit Eisengestell, ein winziger Schreibtisch vor dem Fenster, ein abgetretener Teppich auf dem Boden. Er stellte den Koffer auf den Schreibtisch und öffnete ihn.
Die Sonne schien durchs Fenster. Er nahm die Bols-Flaschen und stellte sie in einer ordentlichen Reihe auf. Er öffnete die erste. Unter dem Fenster wischte sich ein Mann ein ums andere Mal mit einem großen, bunten Tuch den Schweiß ab. Es war eine seltsame Geste, eher ein Zeichen. Stan setzte die Flasche an die Lippen und trank in einem einzigen Zug ein Viertel des Inhalts. Er schüttelte sich, räusperte sich. Ein metallischer Lichtreflex in etwa hundert Metern Entfernung erregte seine Aufmerksamkeit. Er sah genauer hin. Die Straße vor dem Hotel endete bei zwei Häusern direkt am Fluß. Von dort kam der Lichtreflex. Ein Gewehr? Mehrere. In den Fenstern der Häuser waren bewaffnete Männer zu sehen. Was ging hier vor? Ein Auto, Marke Dodge Brothers, in dem sieben Männer saßen, fuhr vor den Türen des Hotels vorbei. Das Zeichen des Mannes mit dem roten Tuch wurde von den neun Heckenschützen erkannt, die sich hinter den Türen und Fenstern der Häuser Nummer sieben und neun in der Gabino-Barreda-Straße versteckt hielten. Die Männer waren mit Gewehren Kaliber 30-30, 30-40, mit halb automatischen Winchestern und mit 45er-Pistolen bewaffnet. Als das Auto bis auf zwanzig Meter an die beiden Häuser herangekommen war, öffneten sich Türen und Fenster, und es hagelte Blei. Die erste Salve zerstörte die Windschutzscheibe und tötete auf der Stelle Rosalío, der außen auf dem Trittbrett gefahren war und vom Wagen fiel. Oberst Trillo, der vorn beim Fahrer saß, krümmte sich schrecklich und blieb mit nach unten baumelnden Armen im Fenster hängen. Die Heckenschützen schossen weiter. Von zahlreichen Schüssen verwundet, ließ der Fahrer das Steuer los. Wenige Meter vom Haus entfernt, aus dem gefeuert wurde, prallte das Auto gegen einen Baum. Als den Heckenschützen die Gewehrmunition ausging, machten sie mit Pistolen weiter. Vom Rücksitz des Autos kam schüchtern Antwort. Einer der Männer, die aus dem Haus schossen, wurde tödlich getroffen und stürzte aus dem Fenster. Zwei entkamen aus dem Auto und versuchten, durch den Kugelhagel zu fliehen. Beide waren verwundet, einer starb eine Woche später, der andere verlor einen Arm.
In weniger als einer Minute waren zweihundert Schüsse auf den Dodge Brothers mit Nummernschild aus Chihuahua abgefeuert worden. Plötzlich Stille. Niemand im Wagen rührte sich mehr. Drei Heckenschützen kamen heran und entluden ihre Winchester-Gewehre auf die leblosen Körper. Die Mörder holten ohne Eile und unmaskiert ihre Pferde von den Höfen der Häuser und stiegen auf. Ein Mann näherte sich und überreichte ihnen dreihundert Pesos pro Kopf. Dann trabten sie seelenruhig aus Parral fort.
Von seinem Fenster aus beobachtete Stan mit aufgerissenen und geröteten Augen ihren Abgang. Er war unfähig, sich zu rühren. Eine seiner Hände versuchte, nach dem Flaschenhals zu greifen.
Ein Kind lief auf das Auto zu und betrachtete die Toten.
»Sie haben Pancho Villa umgebracht!« schrie es.
Der Schrei brach den Bann, und Stan konnte den Genever an die Lippen heben. Er trank. Trank, bis die Flasche leer war. Es war zwei Minuten nach acht am Morgen des 20. Juli 1923.
2
Geschichten von Journalisten (Greg erzählt)
Als ich Julio von weitem sah, wußte ich, daß er versuchen würde, den Zöllner zu betrügen. Er hatte das hölzerne Gesicht Buster Keatons, nicht den unschuldigen Blick Stan Laurels. Julio schien seine prototypischen Gesten aus den Komödien von Hal Roach übernommen zu haben. An unzähligen Grenzen hatte ich ihn mit diesem undurchdringlichen Blick distanzierter Unschuld gesehen. Mein mexikanischer Buster Keaton war dicker. Ich nahm die Brille ab, und die Wirklichkeit verschwand. Was aus seinem Koffer konnte den Buster aus dem DF zur Schauspielerei bewegen? Es konnte fast alles sein: sechs Flaschen Rioja, die er im Duty-free-Shop des Flughafens Benito Juárez gekauft hatte, ein Bund Zwiebeln, eine Ausgabe der gesammelten Gedichte von Efraín Huerta, zwei Kilo Marihuana als Geschenk für den Hausmeister des Odeón-Kinos, sechzig Schachteln kubanische Zigaretten, ein halbes Dutzend Fläschchen spanisches Kölnischwasser ... Fast alles.
Ich setzte mir die Brille wieder auf, und die Wirklichkeit des Pan-Am-Saales im Flughafengebäude von Los Angeles nahm um mich herum Formen an. Der Zöllner, ein stämmiger Mann asiatischer Herkunft, stellte Julio die rituellen Fragen: »Obst? Lebensmittel?« Der Dicke antwortete darauf sicher und mit vollendetem Zynismus. Als der Nisei ihn mit einer Handbewegung weiterwinkte, lächelte er endlich.
»Verrückter Kerl«, sagte er zu mir, »I love you.«
Sein Englisch war so primitiv wie immer. Es schien, als habe er es nach einer Methode gelernt, die von Tarzan unter Mithilfe Erich von Stroheims entwickelt worden war.
Meine Rippen wurden in der brutalen Umarmung Julios butterweich.
In diesem Land, in dem die Privatheit, die Angst vor Keimen und das Privateigentum am Körper dazu führen, daß alle Welt persönlichen Kontakt meidet und die Leute sich so wenig wie möglich berühren, genoß es der Dicke, Zärtlichkeit im Überfluß zu verteilen: Schulterklopfen, feuchte Küsse und überall Umarmungen. Wir gaben mit unserer Bärenumarmung ein ungewöhnliches Schauspiel ab und unterbrachen so den Fluß der leitenden Angestellten mit ihren Handkoffern. Das letzte Mal hatten wir uns vor drei Monaten auf dem Trittbrett eines Krankenwagens des Roten Kreuzes in Santiago de Chile umarmt, als ich ihm durch blutige Lippen und zwei kaputte Zähne hindurch zugelächelt hatte, während er mich mit seinem Körper vor einer Tränengaswolke beschützte. Sicher, damals weinten wir beide, der Dicke, weil er beinahe immer losheult, wenn die Situation es erlaubt und rechtfertigt, ich, der ich mich sonst doch zurückhalte, weil ich nur noch süßliches Tränengas schmeckte.
»Du bist dick, Julio«, sagte ich ihm, nicht in Santiago, sondern viel später, im April, auf dem Flughafen von Los Angeles.
»Seit zwei Wochen esse ich wie verrückt und trinke mexikanisches Bier, als sei es geweihtes Wasser. Was willst du? Wie mein General Zapata sagte, der Wanst dem, der ihn bearbeitet.«
»Julio Fernández, mein Bruder«, sagte ich auf spanisch.
»Your big brother, wie der von Orwell«, sagte Julio lächelnd.
»Laß uns hier weggehen, hier sieht es verdammt nach einem Flughafen aus«, sagte ich zu Julio.
Der Dicke ließ die Flaschen klingeln, die er im Handgepäck trug. Julio hatte sich mit einer Krakenumarmung meiner angenommen, und wie betrunkene Seeleute schwankten wir über die Gänge.
Wir kannten die Namen Dutzender Flughäfen und wußten, wann wir dort gewesen waren, Boyeros, Linate, Benito Juárez, Marco Polo, Schiphol, Ranón, Eceiza, Barajas, Fiumicino, Sandino, La Guardia. Mit den Städten war es genauso. Die tumultartigen Demonstrationen, die an Gewehren vorbeizogen, in deren Läufen rote Nelken steckten; der gebratene Fisch gleich beim Strand, die heiseren Stimmen derer, die aus der letzten, noch offenen Diskothek kamen, die Musik, die sich mit dem Geräusch der 105-mm-Mörsergranaten vermischte; das einsame Bordell mitten im Nichts, auch wenn die Landkarten sagten, es läge im Dschungel von Honduras; die klapprigen Jeeps, das Fotolabor, das im Badezimmer eines drittklassigen Hotels untergebracht war, die Kakerlaken, die zwischen den Negativen herumliefen; die Flugzeuge, die bei Rückenwind beängstigend knarrten; Landschaften der exklusiven Scoop-Religion. Gesichter der Wahrheit und die Wahrheit, die ihnen Gesichter gab, wenn man auf der Schreibmaschine tippte und dabei Unsterbliche schuf, indem man mühsam auf Straßen, in Vorzimmern und auf Plätzen verfolgte Geschichten in der Zeit festhielt. Die Flughäfen mochten sich ähneln und alle gleich aussehen, aber man wußte, daß alle verschieden waren.
Eine Stunde später, als wir vor der Tür meines Hauses in StudioCity hielten, sagte Julio zu mir:
»Mir gefallen diese Häuser, weil sie alle gleich aussehen, du kannst dich besaufen, und es ist egal, du kommst immer nach Hause. Ich vermute, daß nicht nur der Fernseher am selben Ort steht und dasselbe Buch auf dem Tisch liegt und dieselbe Zahnpastamarke benutzt wird, sondern daß du auch dieselbe Frau im Bett hast.«
Ich verzieh ihm den flachen Witz. Julio wird ein bißchen simpel, wenn er in eine neue Stadt kommt. Das ist seine defensive Art, mit dem anderen umzugehen. Und ich verzieh ihm doppelt, als er aus einem Koffer einen waschechten spanischen Serrano-Schinken holte. Er mußte die Bewunderung an meinem Gesicht abgelesen haben, denn er sagte:
»Du bist der einzige Jude auf der Welt, der angesichts eines Serrano-Schinkens in Verzückung gerät.«
»Ich habe auch etwas für dich, well, is somewhere over there.«
Als ich die zwei Dutzend Videos vor ihn hinlegte, verging Julio beinahe vor Glückseligkeit. Ich ließ ihn wühlen und konnte mich der Betrachtung des Serrano-Schinkens widmen. Dann öffnete ich seine Reisetasche, und es kamen Weinflaschen, Bücher und Büchsen mit asturischem Bohneneintopf zum Vorschein. Der Dicke streichelte seine Videokassetten, als ob sie eine Freundin beim ersten Rendezvous wären, und ich umarmte meinen Schinken. Meine Nachbarn wären sehr überrascht gewesen. Sie gehören zu einer Generation, die sich so viele Gefühle auf einmal nicht erlaubt.
»Carajo, du bist ein Genie, mein Junge, wie bist du da dran gekommen? Wo hast du diese wundervollen Dinge aufgetrieben?« fragte Julio und rieb sich die beginnende Glatze, die in einen Kranz nackenlanger Haare überging.
»Blackhawk films, ein Vertrieb der alten Sachen der Hal Roach.
Er liegt in einer little town in Iowa, Davenport.«
Während ich einen Korkenzieher und die beiden einzigen in meinem Haushalt heil gebliebenen Gläser besorgte, war der Dicke so gerührt, daß er sich weigerte, die Videos loszulassen. Sechsundsechzig der besten Filme von Stan Laurel und Oliver Hardy, direkt von den Originalversionen kopiert. Eine halbe Stunde später hielt er noch immer die Videokassetten an die Brust gedrückt und ließ sie nicht einmal los, als ich ihm die Ausgabe des Rolling Stone zeigte, in der unsere letzte Geschichte erschienen war.
3
Der Zugang zum SD ist ...
... ausgesprochen kompliziert. Das hat nichts mit einem Sicherheitstick zu tun. Alex würde so etwas nicht zulassen, es würde die snobistische Heiterkeit, die intellektuelle Grazie zerstören, die die Jungs brauchten. Er ist so beschaffen, weil der Lauf des Lebens am laufenden Band Komplikationen schafft und das SD grundsätzlich nicht daran interessiert ist, ihn zu begradigen, zu lösen, sondern daran, ihn weiter zu verwirren. Nichts Subtiles, einfach ein Spiel.
1977 mußte wegen einiger Reparaturen der zentrale Flur geschlossen werden. So ergab sich der Zugang zum SD zufällig durch die Bibliothek, was einen sonderbaren Umweg notwendig machte. Lorelei fand heraus, daß es noch komplizierter wäre, wenn man durch den Putzmittelschrank ging. Ein armenischer Architekt, der das Gebäude vor neunzig Jahren entworfen hatte, hatte ihn zur Platzersparnis zufällig mit doppelten Türen ausgestattet. Also mußte man den Hutladen an der Madison Avenue betreten, die Damentoilette aufsuchen, den zweitürigen Schrank durchqueren und dann im Lastenaufzug hinauffahren.
1979 verkomplizierte Dr. Washington B. Douglas die Angelegenheit weiter, indem er die Treppe des Notausgangs vom zweiten Stock benutzte, um ins Büro des Chefs zu gelangen. Alex spielte mit und stellte seinen Schreibtisch vors Fenster, damit die Hereinkommenden auf den Arbeitstisch des Vorgesetzten treten, einen eleganten Sprung machen und durch sein Büro zur Tür gehen mußten, die in den Versammlungsraum führte, den alle »das Klo« nannten.
1980 schenkte Sharon, der einen Doktortitel der Columbia-Universität für Journalismus besaß, in seinem ganzen Leben aber niemals eine Reportage geschrieben hatte, Alex einen Läufer für seinen Schreibtisch. So konnten die Hereinkommenden sich die Füße abtreten, bevor sie vom Tisch sprangen. Alex, offensichtlich ein Spieler, aber ein praktisch veranlagter, benutzte den Schreibtisch nicht, um zu arbeiten, sondern lediglich als weitere Barriere in diesem merkwürdigen Hindernislauf, als Baustein des Labyrinths, durch das man zum SD kam.
Alex arbeitete in einem Winkel seines Büros, in den er einen Sessel gestellt hatte. Der war von zwei kleinen Beistelltischen umgeben, solchen, auf denen normalerweise große Lampen standen. Er hatte nicht viele Papiere. Dennoch waren die Wände des Zimmers über und über behängt: Nachrichten, Notizen auf gelbem Papier, Memoranden, die mit Stecknadeln festgesteckt waren. Mario Estrade fand 1982 hinter der Tür eine Notiz von Alex mit einem sechs Jahre alten Datum, die den Leser kryptisch daran erinnerte, daß er sich jeden Morgen beim Aufstehen den Grundsatz Malrauxs ins Gedächtnis rufen müsse, daß es Helden nur in Büchern gebe. Auf der Notiz stand am Rand rot unterstrichen das Wort »Philippinen«.
Aber das SD besteht nicht nur aus einem komplizierten Zugang und dekorativer Rhetorik an den Wänden, sondern besitzt auch die Tugend der Nicht-Existenz. Es gibt kein Archiv, kein Schild an der Tür, keine Sekretärin, die Auskunft gibt, wo man sich befindet, keine in Manhattan registrierte Telefonnummer, keine eingetragene Firma, kein Papier mit Briefkopf ...
Statt dessen bewahrt es peinlich genau die Erinnerungen an die Reisen seiner Angestellten, denn eine weitere der Tausenden von Alex aufgestellten ungeschriebenen Regeln lautet, daß jeder, der reist, ein Erinnerungsstück mitbringen muß. Natürlich durfte das kein Brief sein, da das SD nicht existiert und keine Adresse hat, bei der die Post ankommt, selbst wenn man die Briefkästen hätte nutzen können; wohl aber zum Beispiel das Etikett einer australischen Bierflasche, ein Kondom mit kyrillischer Beschriftung, eine Postkarte aus den bayerischen Alpen, ein Straßenbahnticket aus Jalapa, die unbezahlte Rechnung eines Kindergartens in Rangun, eine Serviette aus einem japanischen Restaurant, ein in Chalatenango aufgenommenes Polaroidfoto.
Das Material wurde zusammen mit den Erinnerungen und Nachrichten und den Vergißmeinnicht-Notizen an den Wänden aufbewahrt. Anfangs hing das Zeug nur im Büro von Alex, dann bedeckte es die Wände des »Klos« und die hölzernen Trennwände zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen. Zu den Besonderheiten des SD gehört es, daß es keine festen Arbeitszeiten gibt. Die dort arbeitenden Personen kommen und gehen, wann sie wollen. Ihre einzige formelle Verbindung besteht in von Alex auf grünem Papier verschickten Notizen, die Aufgaben, spezielle Arbeiten, Untersuchungsstränge beschreiben.
Selten kommt es zu einem rituellen Ereignis wie einer Versammlung. Alex kündigt sie meist zwei, drei Tage vorher an, und es ist nicht einmal besonders klar, wie verpflichtend sie sind, obwohl es eher die Ausnahme ist, daß jemand fehlt.
Es ist auch überhaupt nicht klar, wie und wieviel Geld verdient wird. Wenn die Versammlung die Ideen, die Sichtweise einer Person aufgreift, enthält die monatliche Lohntüte mehr Geldscheine als gewöhnlich. Aber nie wird ersichtlich, wieviel mehr und warum. Niemand weiß, wer die Gehaltszulagen festlegt. Vielleicht ist es Alex selbst, vielleicht holt er deshalb während der Versammlungen ein kleines Notizbuch heraus. Man kann nicht einmal vermuten, was er notiert; vielleicht überläßt er es einfach den Ergebnissen der Pferderennen in Yonkers oder einem Zufallsprogramm, die Gehälter festzulegen. Es ist auch überhaupt nicht klar, wer das SD finanziert. Jemand hat einmal die Behauptung aufgestellt, die Lohntüten kämen direkt vom Nationalen Sicherheitsrat. Aber wenn es so wäre, kommen sie auf einem seltsamen Weg, weiße Briefumschläge, auf die mit Bleistift eine Zahl geschrieben ist und die man nach Herausnahme der Geldscheine abzeichnen und an Leila zurückgeben muß (Sekretärin? Geliebte? Tante? Psychiaterin? Köchin von Alex?).
Im April 1989 arbeiteten außer Alex siebzehn Personen im SD. Alle hatten ein eigenes Telefon am Arbeitsplatz und per Computer Zugang zu mehreren Informationsnetzen sowie zu öffentlichen und privaten Datenbanken. Jedes Telefon ist eine eigene Welt und an die Tarnung angepaßt, die ihr Benutzer als SD-Angestellter mit Alex in den Tagen nach seiner Anstellung erarbeitet hat. Alle wissen, daß sie automatisch entlassen werden, falls ihre Tarnung zufällig auffliegen sollte. So ist Aram »Holzspielzeug Lingrave«, Julie »Pazifikversicherung, Reklamationsabteilung« und Martin Greenberg »Beratungsdienste Greenberg«. Und wenn sie ihre Telefone nicht persönlich abheben, wiederholen ihre Anrufbeantworter die Litanei. Niemand benutzt oder geht an ein fremdes Telefon, niemand rührt fremde Korrespondenz an, niemand nimmt Bücher oder Papiere von einem anderen Arbeitsplatz. Niemand lädt niemanden zum Essen ein. Niemand ist völlig sicher, ob Eve immer Eve ist oder nur dann, wenn sie dort ist.
Alex scheint Alex zu sein. Es ist ein Spiel, das für geschlossene Räume entworfen ist, ein begrenztes Spiel; ein Spiel, das außerhalb des Bürohauses über einem Hutgeschäft in der Madison Avenue, fast an der Ecke zur 46th Street, im Zentrum Manhattans, im Herzen New Yorks, wo, so sagt man, der Wurm sitzt, der den Apfel vergiftet hat, nicht weitergeht.
Alex glaubt, daß eines Tages ein bürokratischer Schachzug dem SD den Garaus machen wird, daß dieselbe Bürokratie in ihrer dauerhaften Verrücktheit es aber vergessen wird, ihn darüber zu informieren, und daß sie weiterspielen werden. Sein Psychiater, den er mit absoluter Regelmäßigkeit belügt, was seinen Beruf und sein Arbeitsleben angeht (er hat sogar eine Familie in der Krise erfunden, mit der er sein Schicksal teilt und über die er seinen »Seelenklempner« pünktlich und genau informiert), denkt, daß sein Patient Alex nur wenige Millimeter von einer klinischen, paranoiden Schizophrenie entfernt ist. Wenn der Psychiater die Befragung weiterführt, daran hat Alex nicht den geringsten Zweifel, ist er bald völlig von seiner absoluten Verrücktheit überzeugt. Aber solange sie ihn lassen, beherrscht er das SD weiter als Herr und Gebieter, als allmächtiger Zar und Herrscher über seine seltsamen Ziele. Und es stört ihn nicht, Gott eines Büros zu sein, in das man durch ein Hutgeschäft, eine Damentoilette, einen Putzmittelschrank, einen Lastenaufzug, über eine Feuerleiter, durch ein Fenster und über den Schreibtisch des Chefs kommt. Mehr noch, er betet es an. Das ist seine Vorstellung von himmlischer Bürokratie.
4
Der Kopf Pancho Villas
Arthur Stanley Jefferson (seit 1920 auf Anraten von Mae Dahlberg unter dem Namen Stan Laurel bekannt, da sie fand, Stan Jefferson sei ein gefährlicher, dreizehnbuchstabiger Name) war ein Engländer, der glaubte, gleich nach dem Paradies käme das Kino. Bei seinen schlimmsten Besäufnissen rückte das Paradies auf den zweiten Platz.
Stan war der wahre Erbe seiner Eltern. Sein Vater, als A. J. bekannt, war mit seinem Handwerk verschmolzen und hatte in England landauf und -ab geschauspielert, Drehbücher und Sketche geschrieben und als Theaterunternehmer, Komiker, Theaterdirektor und -dekorateur gearbeitet. Seine Mutter hieß Madge und war Schauspielerin in tränenreichen Melodramen. Stan hatte das Hämoglobin einer Tänzerin, eines Komikers. Das Blut, so wußte er, fließt nur auf der Bühne, das wirkliche Leben existiert nur, wenn es hinten ein Bühnenbild und unter den Füßen Bretter gibt.
Einem Journalisten, der daran interessiert war, der Vergangenheit nachzuspüren, die den Zauber einer Persönlichkeit ausmacht, sollte Stan einmal folgendes erzählen:
»Ich bin als Komödiant geboren. Ich kann mich an keinen Augenblick meiner Kindheit erinnern, in dem ich nicht geschauspielert habe. Pa und Ma zogen immer umher, und ich ging in öffentliche Schulen, in denen ich, um die Einsamkeit zu lindern, in den Schulkameraden ein dankbares Publikum für meine Clownerien fand. Das muß ein ererbtes Talent sein. Meine Helden waren Komödianten, Clowns, Darsteller aus der Music Hall. Ich war ein miserabler Schüler, aber ich hatte meinen Spaß. Mit sechzehn gab ich mein Debüt als Profi.«
1910 reiste er zusammen mit Charles Chaplin und der Karno-Truppe in die Vereinigten Staaten. 1912 wurde die Tournee wiederholt. Als Chaplin von Mack Sennet unter Vertrag genommen wurde, löste sich die Gruppe auf, und Stan begann das schwierige Geschäft eines Vaudeville. Zehn Jahre zog er durch Dörfer, Nester, Städte, schmuddelige Theater, zweit- und drittklassige Hotels, Herbergen mit Halbpension. Er heiratete die Australierin Mae Dahlberg, wurde Stan Laurel. Ab 1917 fand er Zugang zum Kino und feierte ab 1923 als Komödiant seine ersten großen Erfolge mit dem Produktionsunternehmen Hal Roach. Gegen Ende 1926 traf er einen Komödienschauspieler wieder, mit dem er 1917 zusammengearbeitet hatte. Norvell Hardy, bekannt als Oliver, ein verarmter Sohn einer Adelsfamilie aus Georgia, kämpfte darum, sich im Kino und in der Komödie durchzusetzen, um ein für alle Mal gut essen zu können. (Oliver war einmal aus einer Militärschule geflohen, weil sie ihn dort nicht ausreichend ernährt hatten, und weigerte sich zurückzukehren, bis seine Mutter ihm zwanzig Torten gab, die er auf einmal verspeiste.)
45 minutes from Hollywood [Diese Dame ist ein Kerl] hieß der Film. Oliver spielte einen Hoteldetektiv, der von seiner Frau verfolgt wurde. Die meiste Zeit versuchte er, in ein Handtuch gewickelt, aus dem Badezimmer zu entkommen. Stan verkörperte in einer einzigen Szene einen arbeitslosen Schauspieler, »zu hungrig, um zu schlafen, und zu müde, um aufzustehen«.
Nach Abschluß der Dreharbeiten entdeckten die beiden, die zusammen das Elend und das Wanderleben der Komödien- und Filmschauspieler kennengelernt hatten (1917 hatten sie gemeinsam in einem anderen Film gearbeitet, und davor hatte Oliver in einer Komödie gespielt, in der Stan Regie geführt hatte), eine neue Gemeinsamkeit: ihr Vergnügen, sich in eine Hotelhalle zu setzen, in ein Café mit großen Fenstern, in das Wartezimmer eines Krankenhauses, um die Leute zu beobachten, ihre Gesten und Gewohnheiten zu studieren.
Das war die optimale Schauspielschule.
Ende 1926 und Anfang 1927 arbeiteten Oliver und Stan in weiteren sieben Komödien von Hal Roach zusammen, bis sie in einem Spielfilm, bei dem Yates die Regie führte, den Stil fanden, den sie nie wieder aufgaben. Er hieß Hats off [Hut ab].
Von Klaviermusik begleitet, begann der Film mit einem schwarzen Schild, auf dem zu lesen war: »Die Geschichte zweier junger Männer, die glauben, die Welt schulde ihnen einen Arbeitsplatz. Mit fünfunddreißig Jahren Lohnzahlung rückwirkend!« Dann erzählt er die Geschichte zweier Hausierer, die erfolglos treppauf und versuchen, eine Geschirrspülmaschine zu verkaufen. Die Geschichte erreicht ihren Höhepunkt in einer absurden Schlägerei auf der Straße, in der jeder den Hut des anderen auf die Straße schleudert und Dutzende von Schaulustigen und Vorbeikommenden miteinbezogen werden. Mitten auf der Straße sitzend, Stan mit seinem traurigen Blick und Oliver mit abweisendem Gesicht, tauschen sie in der Schlußszene die Hüte. Es war die Geburtsstunde ihres Ruhms.
Stan betrat Mexiko in den Jahren, die auf den Tod Pancho Villas folgten, nicht mehr. Auch wenn ihm oft das Bild des Jungen, der rennend den Tod des mexikanischen Führers verkündete, durch den Kopf ging und er häufig Besäufnisse mit Genever mit Pancho Villa in Verbindung brachte, hatte er nie wieder Lust, die Route nach Süden einzuschlagen. Mexiko war sehr weit weg von Hollywood. Im Februar 1926, ein Jahr vor der Entdeckung der Formel, die sie berühmt machen sollte, fand Pancho Villa jedoch auf seltsame Weise erneut Zugang zu seinem Leben.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar 1926 drangen Unbekannte ins Pantheon von Parral ein, verwüsteten das Grab des Anführers der Landreform im Norden, trennten den Kopf der Leiche ab und raubten ihn. Die Angelegenheit ließ in der nordamerikanischen Presse Ströme von Tinte fließen, denn in den Vereinigten Staaten pflegte man noch immer den Mythos des ruchlosen Banditen, der es 1916, während der einzigen ausländischen Invasion, die es in der modernen nordamerikanischen Geschichte gab, gewagt hatte, den Ort Columbus anzugreifen. Die Presse von Los Angeles gab die Nachricht und ihrem Fortleben breiten Raum. Die mexikanischen Gerüchte überquerten schnell die Grenze und legten den verloren Kopf an einem Tag in die Hände der Witwe eines reichen Farmer, den Villa ermordet hatte, an einem anderen tauchte er in einem Zirkus auf, der durch Texas zog und die Beute zur Schau stellte, am folgenden den Tag legten sie ihn in die Hände einer Gruppe Verrückter, die aus einer Irrenanstalt in Chihuahua ausgebrochen waren, dann in die Hände einer alten Jungfer aus Oklahoma, die in das mexikanische Militärgenie verliebt war und eine Bande von professionellen Dieben aus San Francisco mit der Aktion beauftragt hatte.
Stan verfolgte die Nachrichten mehrere Wochen lang sorgfältig im Herald und kratzte sich bei jeder neuen Nachricht mit der ihm eigenen Geste am Kopf, die das Kino in ein Denkmal für Unentschlossenheit und Verwirrung verwandeln sollte. Als er mit Oliver seinen ersten Film aus der Reihe drehte, die als Stan und Ollie bekannt werden sollte, schloß er mit seinem Gefährten innige Freundschaft. Dennoch erzählte er ihm nie Einzelheiten über seinen Abstecher in den Süden an dem Tag, als Pancho Villa starb. Erst recht erzählte er ihm nichts über sein seltsames Interesse an dem verschwundenen Kopf.
5
Geschichten von Journalisten (Julio erzählt)
»Als ich sechzehn war, wollte ich Basketballspieler werden, aber die anderen wuchsen weiter«, sagte ich zu Greg und wartete auf seine Reaktion. Der Kerl sah mich über die Brille hinweg an, während er weiter das Kameragehäuse mit einer kleinen Bürste säuberte, die mit einer birnenförmigen Gummipumpe zur Luftzufuhr ausgestattet war. Dann schenkte er mir ein halbes Lächeln. Mehr verdiente meine Erklärung anscheinend nicht.
Aber ich fuhr fort: »Am Tag, als ich entdeckte, daß ich die 1,82 nicht erreichen würde, so sehr ich mich auch im Schrank an den Füßen baumeln ließ, verließ ich die Schulmannschaft. Als meine Mutter mich so verzweifelt sah, übergab sie mir beim Abendessen bedeutungsvoll das Notizbuch des Großvaters.«
Greg blieb weiter in die Kamera versunken, als ob es ihm einen Scheißdreck bedeutete, warum mein ganzes Leben im Notizbuch meines Großvaters vorherbestimmt war, bevor ich es lebte. Er hatte seine zerlegte Kamera auf dem Tisch ausgebreitet, auf einem rubinroten Flanelltuch. Ich weiß nicht, was mir besser gefiel, die Farbe und Struktur des Flanelltuches oder die peinliche Genauigkeit, mit der er wie ein mittelalterlicher Kunsthandwerker arbeitete. Irgendwann würde ich ihm ein Stück davon klauen, um mir einen Schal zu machen.
»How much is 1.82?«
»In Fuß?«
»Sicher.«
»Was ist das für eine Scheiß-Frage?«
Greg zuckte mit den Schultern.
»Fast sechs Fuß, etwa 5,11.«
Ich ließ fünfzehn Minuten Schweigen vergehen und fing wieder mit meiner Geschichte an.
»Als ich im Morgengrauen des nächsten Tages das Notizbuch zu Ende gelesen hatte, war mir Basketball absolut scheißegal; es bedeutete mir einen Dreck, daß die anderen größer wurden. Wie mein Leben verlaufen würde, hatte mein Großvater in seinen Geschichten aufgeschrieben. Dort war der Schlüssel für alles, was ich die kommenden Jahrhunderte zu tun hatte. Ich mußte mich nur danach richten, wie die Geschichten auszulegen sind und wie sie in die Gegenwart übersetzt werden müßten. Warst du irgendwann mal Kabbalist? Hast du mal Bücher gelesen, in denen Geschichten verborgen waren, die man entdecken und mit dem eigenen Leben in Verbindung bringen mußte? Hast du irgendwann mal Kreuzworträtsel gelöst?«
Greg machte sich keine Mühe zu antworten. Einmal, als wir fünf Tage im Gefängnis von Asunción eingesperrt waren, ließ er mich sechs Stunden reden, ohne zu antworten. Entweder interessierte ihn meine Geschichte einen Dreck, oder er wollte sie nicht verderben, indem er sie unterbrach. Falls es überhaupt eine Geschichte über einen achtzehnjährigen Jugendlichen, der Basketballspieler werden wollte, und über das Notizbuch seines Großvaters zu erzählen gab. Greg, daran besteht kein Zweifel, war ein ausgezeichneter Zuhörer. Ein so guter Zuhörer, daß er mir den Rücken zukehrte und in einer Plastikkiste wühlte, die jede Menge Fächer für verschieden große Schrauben hatte.
»Ich weiß nicht, wie in dieser Scheiß-Stadt der Tag anbricht, aber in Mexiko-City ging damals wirklich die Sonne auf, nicht wie jetzt, wo die Sonne mitten im verschissenen Smog wie das Gelbe vom Spiegelei aussieht. Und das mußt du dir vorstellen, wie ich mit dem Notizbuch in der Hand da stehe, mitten in einer mystischen Erfahrung, und rufe: »Zur Hölle mit dem Basketball, es lebe der Journalismus.«
Greg drehte sich um und sah mich wieder über die Brille hinweg an. Das Lächeln war zu einem schelmischen Blick geworden, zu einer spöttischen Geste. Ich beachtete ihn nicht und machte mich daran, die Flasche Rioja zu suchen; ich glaubte, ich hätte sie hinter dem Sessel gelassen.
»Hast du ein gutes Foto von deinem Großvater? A good one, not a close up.«
Wie hatte er das erraten? Ich wühlte in der Brieftasche und holte das gefaltete Stückehen Karton hervor, den Abzug von einem Abzug: der Großvater stehend, nahe beim Meer, mit dreiteiligem Anzug und Hut, dichtem Schnurrbart und träumerischem, ein bißchen verlorenem Blick. Ich reichte es ihm.
»Er hatte nie die Gelegenheit, Basketballspieler zu werden. He’s about my size. Really klein der Großvater ..., sagte Greg, der das Foto aufmerksam betrachtete. Dann sah er mich erneut an und fragte: »Was stand in dem Heft? Das ist das einzige, was ich noch nicht weiß, den Rest der Geschichte hast du mir schon zweimal erzählt ...«
Da ich die halbleere Weinflasche gefunden hatte, machte ich mir nicht die Mühe zu antworten. Sollte er sich’s doch ausdenken, das Arschloch.
6
Die erste »Denkergruppe« ...
... von Alex spielte 1965 eine komplizierte Lotterie. Man mußte elf Dollar setzen und ein Land notieren. Wenn das Land, das du aufschreiben wolltest, schon von jemand anderem getippt worden war, mußtest du genauer bestimmen, welche Region in diesem Land gemeint war. Es konnte nur einer gewinnen. Die festen Mitglieder der Gruppe setzten fast alle (vier von fünf) auf lateinamerikanische Länder: Dominikanische Republik, Peru, Venezuela und Argentinien. Die unregelmäßigen Mitglieder, die weniger in das Dickicht der Desinformation und der Spiegelspiele verstrickt waren, wagten etwas mehr. Einer schlug auf einer kaffeebefleckten Karte vor, daß Ernesto Che Guevara sich an einem Ort in Schwarzafrika aufhalte, und bot Mosambik und Rhodesien zur Auswahl an (als man ihn verpflichtete, nur ein Land vorzuschlagen, wählte er ersteres); ein anderer ging noch weiter und schlug Frankreich vor, wo Che in den Pyrenäen die Guerilla ausbilde, die das frankistische Spanien erschüttern sollte. Alex wählte keinen der Vorschläge aus.
Die stichhaltigen Informationen, auf die Alex zurückgreifen konnte und die den Teilnehmern als erster Spielzug angeboten wurden (nur diese erhielten sie, denn spekulative Analysen konnten sie sehr viel fundierter als die offiziellen Analysten der Agency erstellen), umfaßten nicht mehr als ein siebenseitiges Dossier, mit breitem Seitenrand und reichlich leerem Raum am oberen und unteren Ende der Blätter.
Es kamen achtundachtzig Dollar zusammen, die Alex persönlich in einer Schachtel aufbewahrte und Jahre später für die New Yorker Lotterie ausgab (und natürlich verlor), aber er maß dem keine weitere Bedeutung bei. Das SD gab es noch nicht, aber Alex war schon Alex, obwohl er erst sechsundzwanzig Jahre alt war und gerade für die ausgesprochen prosaische Aufgabe eines Hilfsanalysten in Langley rekrutiert worden war. Er sollte die Presse linker Parteien im amerikanischen Cono Sur durchsehen: Chile, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die Paraguayer machten ihm die wenigste Arbeit, die Argentinier die meiste. Sie schienen zu denken, daß alles, was nicht geschrieben wurde, nicht in die Geschichte einginge.
Die acht Mitglieder der »Denkergruppe«, die bei der Lotterie mitspielten, bildeten eine absolut informelle Struktur, die aus fünf Mitgliedern des Informationsapparates und drei externen Beratern bestand, mit denen Alex Arbeitsbeziehungen pflegte. Alles war hochgradig nebensächlich, Spielmaterial.
Es spielte keine Rolle, daß Alex den Einsatz der Lotterie um die Frage, wo Che Guevara sich 1965 aufhielt, schon ausgegeben hatte, denn als Che Anfang 1967 in Bolivien wieder auftauchte, konnte kein Spieler den Gewinn einfordern, da Bolivien nicht auf der Liste stand.
Aufgrund der ständigen Versetzungen und des Informationskarussells in der Welt des nordamerikanischen, professionellen Geheimdienstes erinnerte sich ein Lotteriespieler, der Jahre später einen hochrangigen Posten besetzte, doch noch an die Geschichte und spürte in den Datenbanken die Informationen auf, die Alex ihnen 1965 gegeben hatte. Er überprüfte sie sorgfältig, suchte dann Alex auf und fragte ihn, woher er gewußt habe, daß Che Guevara sich im April 1965 in Kongo-Leopoldville aufgehalten habe. Alex zuckte mit den Achseln. Er wußte bereits, daß niemand in diesen geistlosen Büros und in diesen unendlichen Gängen voller Gerüchte und Geflüster die Logik zu bewundern schien, insbesondere seitdem die offizielle Logik so regelmäßig scheiterte. Deshalb beschränkte er sich achselzuckend auf ein Lächeln, wohl wissend, daß man in dieser Zeit in Langley gerade die Intuition bewunderte.
7
Geschichten von Journalisten (Greg erzählt)
Ich schrieb alles in dasselbe Heft, das ich schon seit sechs Jahren benutzte. Julio hingegen kam wie immer mit seinem Durcheinander aus Schecks, auf Visitenkarten geschriebenen Notizen, an veröffentlichte Artikel gehefteten Papieren und dem üblichen lückenhaften Gedächtnis an. Es störte mich nicht im geringsten. Julio glaubte wohl, daß er meinen Ordnungstick störte, aber Julio scheint zu ignorieren, daß meine Ticks absolut demokratisch sind, privat, und daß ich nicht versuche, sie irgend jemandem aufzudrücken. Um den Schein zu wahren, beschwerte ich mich trotzdem über den Scheiß, den er auf dem Tisch ausbreitete; ich benutzte meinen besten Madrider Akzent, um auf die Hure zu scheißen, die ihn geboren hatte, und drohte damit, mir einen Sozius zu suchen, der Schweizer und intelligent sei.
Julio erwartet von der Welt eine Mischung aus Staunen, mißlungener Vaterbeziehung, Erbarmen und Entzücken. Ich beschränke mich darauf, ihm dosierte Solidarität anzubieten. Damit ein Team funktioniert, muß einer pragmatisch sein. Eine wirkliche Person, keine Filmfigur, ein Ernüchterter, ein Mann, der keine Illusionen kauft und dem weder Clowns noch Zauberer oder die Kinderkirmes gefallen.
»Du vertrittst bei diesen Treffen die Wohlstandsgesellschaft, das ist dein Problem«, sagte mir Julio sehr ernst und suchte einen Scheck, den er verknittert in seinem Paß mitgebracht hatte. »Dann vertrittst du die Ramschverkäufer auf dem Markt von Casablanca. Die schlimmsten Traditionen der Dritten Welt, stimmt’s?«
Julio ärgert es, daß mein Spanisch merklich besser wird, wenn wir uns streiten. Er verliert dann einen seiner wenigen Vorteile. Er hat nicht die sprichwörtlich mimetischen Fähigkeiten eines Juden aus Los Angeles, der in einem Waisenhaus für katholische Kinder und später in einem Schwarzenviertel aufwuchs und schließlich eine High School besuchte, auf die aus seltsamen Gründen lauter Koreaner gingen.
»Ich habe die Reportage aus Beirut an Interviú Spanien verkauft, das Interview mit denen von der Frente Patriótico an Pagina 12 aus Buenos Aires und an La Jornada aus Mexiko, die haben noch nicht bezahlt. Ich habe zwei Schecks der bundesdeutschen Agentur und einen dicken für die Fotos aus Armenien, die der Spiegel bezahlt hat. Die Fotos sind auch in einer polnischen Zeitschrift erschienen, die sechzig Dollar gezahlt hat, wie Ana in ihrem Brief schreibt. Sie haben mir die Autorenrechte für Bajando la Frontera in Portugal geschickt, nichts, Kleingeld. Und zweitausend Dollar Zulagen von Herederos in Spanien, die vom B-Verlag. An Júcar in Spanien habe ich die Biographie von Jim Thompson verkauft, dafür haben sie mir tausend Dollar gezahlt, und neunhundert für die Übersetzung, und irgendwo habe ich noch ... warte, diesen Scheck von Herederos aus Mexiko und sechzigtausend Pesos für den Artikel über die Jugendlichen in Disneyland, den die Zeitschrift Encuentro in Mexiko abgedruckt hat ...«, sagte er sehr stolz und drehte weiter Papiere um. Über kurz oder lang würde er noch zwei oder drei irgendwo hervorholen.
»Ich nehme die Hälfte des Gesagten zurück, Mister Fernández«, antwortete ich ihm.
»Das mit dem Markt?«
»Nein, das mit den schlechtesten Traditionen, brother. Sie vertreten die besten kommerziellen Traditionen. How did you do it?«
Julio rieb sich die Hände.
»Ich bin von Pontius nach Pilatus gelaufen. Nicht schlecht für vier Monate, oder?«
»Ich müßte mehr Geld haben als du, denn wenn du die mexikanischen Pesos in Dollars umtauschst ... Ich habe eine Pauschalzahlung der Agentur in Kanada, einen Scheck über sechstausend Pfund von den Engländern für das Buch und das ganze Geld für die letzten drei Artikel in Mother Jones, im Playboy und in der Village Voice.«
»Zähl zusammen, Junge«, sagte Julio und entkorkte die letzte Flasche Rioja.
»Elftausendsechshundert Dollar nach Abzug der Reserve für die Steuern.«
»Ich habe achttausendzweihundertfünfzig und viertausend Bolivares, von denen ich nicht weiß, was das für ein Scheiß ist«, sagte er.
»Und du hast wieder Pech, du siehst, es ist besser, mexikanischer Schriftsteller zu sein. Da zahlen wir keine Steuern.«
Ich stellte ihm über die Differenz einen Scheck zu seinen Gunsten aus, wie gewohnt. Der englischsprachige Markt zahlte mehr als der Rest der Welt zusammen, obwohl Julio sich in der letzten Zeit wie ein verrückt gewordener Derwisch bewegte. Als wir uns kennenlernten, hatte er ein paar seltsame Vorurteile, die er inzwischen abgelegt hat. Er dachte tatsächlich, daß ein ehrlicher Journalist keinen Scheck in DM von der konservativen deutschen Boulevard presse annimmt und daß man bei Empfängen der russischen Botschaft keinen Kaviar ißt und daß man, um der Korruption zu entgehen, ein zwar blutarmes, aber dafür makelloses Leben führen müsse.
Er überreichte mir sehr förmlich meine zweitausend Bolivares.
»Was machen deine Schulden?« fragte er mich.
»So lala.«
»Du könntest ein paar Monate nach Mexiko kommen, da ist es immer noch billiger, und du kannst bei mir wohnen«, bot der Dicke an.
Wir wußten beide, daß ich nein sagen würde. Wenn ich annähme, würden wir schlimmer als ein Ehepaar enden und unsere ausgezeichnete Arbeitsbeziehung, die jährlich ein halbes Dutzend Gewitter durchmachte, würde zum Teufel gehen. Wir lebten ohnehin schon zu viele Stunden zusammen.
»Viel zu viele Mäxikanus in diesem Countri«, sagte ich zu ihm und schüttelte den Kopf.
»Ja doch, mir gefallen die Vereinigten Staaten auch, das Bescheuerte sind nur die vielen dusseligen Gringos, die überall rumlaufen«, antwortete der Dicke.
»Du siehst, brother, jeder seines Weges.«
Julio nahm es philosophisch, er hatte seine Pflicht erfüllt und mir sein Haus und sein Geld angeboten. Wir wußten beide Bescheid. Ich steckte mir eine Delicado mit Filter an, von denen mir der Dicke riesige Mengen mitgebracht hatte, und zog den Rauch ein.
»Ah, verdammt, ich habe noch einen Gutschein über tausendvierhundert kubanische Pesos, die man in Kuba ausgeben muß; für die Serie, die von uns in der Zeitschrift Enigma veröffentlicht wurde, die über Mengele, aus der sie jetzt ein Buch machen.«
»Was kriegt man dafür?«
»Drei Wochen in Varadero. Anderthalb Wochen für zwei. Hotel und Verpflegung.«
»Und der Flug?«
»Nein, den muß man in Devisen bezahlen. Die Kubaner sind schon moderner geworden, sie zahlen Autorenrechte. aber keine Flüge, mein Freund.«
»Wie teuer ist ein Flug von Mexiko?«
»Ungefähr dreihundert Dollar hin und zurück. Ich habe der ALL die Artikel der Frente überlassen, sie sagten, sie könnten sie in einem Büchlein mit Reportagen zusammenfassen. Wenn das klappt, können wir warten und am Ende des Jahres Urlaub in Havanna machen.«
Ich dachte daran, was wohl meine Großmutter Karen über Urlaub in Havanna sagen würde. Schließlich hatten ihre Freundinnen vom Pokerclub Gardenia und ihre drei Brüder 1980 und 1984 Reagan gewählt. Aber wenn sie ihren Enkel im Waisenhaus allein gelassen hatte, konnte sie ihn auch nach Kuba reisen lassen, dieses Miststück. Das wäre meine elfte Reise auf die Insel; die von der Einreisebehörde in Florida würden meinen Paß wie den der Hündin Laika betrachten, aber es wäre das erste Mal, daß ich nicht zum Arbeiten hinführe.
»Vielleicht können wir zwei oder drei gute Interviews und irgend eine Reportage aus dem Urlaub rausholen«, redete Julio mir zu.
»Ich würde gerne nach Havanna fahren, nur um Mojitos im El Floridita zu trinken und mich einen Moment vor das Schwimmbad von Hemingways Haus in San Francisco de Paula zu setzen und auszuruhen, weiter nichts, brother.«
»Und auf der Terrasse des Hotels Saint John Boleros hören und mit deinen Freunden von der G2 bei der Zeitschrift Moncada Domino mit neun Steinen spielen.«
Julio schenkte Wein in beide Gläser. Ich stand auf, um den Fernseher auszuschalten, der uns mit einem dumpfen Geräusch im Rücken begleitete, und nutzte die Gelegenheit, um in die Küche zu gehen. Der Boden war kalt. Ich nahm zwei Büchsen geräucherten Lachs und ein Paket Kekse. In meiner Erinnerung waren die Freunde von der G2 bei der Zeitschrift Moncada Freunde von uns beiden, und sie waren sicher nicht von der G2, sondern Journalisten, die manchmal in olivgrüner Uniform herumliefen. Aber Julio konnte nicht anders, er mußte einem Nordamerikaner diese Rechnung präsentieren, auch wenn es sein bester Freund war ... Ich hatte kalte Füße, die Welt war groß, und der Dicke hielt mit Sicherheit einen Haufen Verrücktheiten bereit. Er würde überrascht sein, auch ich verwahrte einen weiteren Berg Verrücktheiten in meinem Heft mit den ordentlichen Notizen. Die Welt war groß, und im Augenblick hatte ich keine Angst. Nicht mehr als nötig. Am Abend könnten wir in der Bar von Sidney in La Brea ein paar Cognacs trinken und dann ins Kino gehen; das Problem bestünde nur darin, Julio zu überzeugen, daß der letzte Film von Oliver Stone besser als der erste von Harry Langdon war.
8
Dissertationsvorhaben, eingereicht von Elena Jordán, abgelehnt
Wer die gigantischen Wandmalereien in den Bergen von San Borja, San Juan, San Francisco und Guadalupe in der Wüste von Baja California betrachten konnte, weiß, daß er Bruchstücke einer anderen Welt erblickt hat. Diese Menschen, die in rotschwarzen Farben auf den Fels und kreuz und quer über Rentiere und Hirsche gezeichnet sind und die hohen Steinwände in den erstaunlich gut erhaltenen Höhlen bedecken, haben keinen Platz in der Geschichte Mexikos. Figuren, die sechs, sieben Meter über dem Boden gemalt sind, Menschen, zwischen 1,80 und zwei Meter groß, mit erhobenen Armen: stilisierte Personen aus einem Tanz, zu dem wir nicht eingeladen sind.
Diese kaum erforschte Welt der mexikanischen Höhlenmalerei konnte in keinen Zusammenhang mit den Spuren der prähispanischen Welt gebracht werden, die dank der Arbeit der intellektuellen Elite der kirchlichen Gemeinden in der kolonialen Epoche ausführlich dokumentiert wurden (Hambleton/Von Borstel: Cuarta semana Estudios Hist. BCS).
Die Völker, zu denen die Spanier bei ihrer Ankunft auf der Halbinsel Baja California hauptsächlich Kontakt hatten, bewahrten scheinbar keine Erinnerung an diese Ureinwohner. Weder die Guaycuras noch die Cochimi noch die Pricues konnten den Spaniern mehr als einige unzusammenhängende und eher sagenhafte Informationen über die »großen Menschen, die Felswände bemalten« geben. Die sich über zwei Jahrhunderte erstreckende Dauer der Kolonialisierung in Baja California (León Portilla: I semana Est. Hist. BCS) und die Abgeschiedenheit der Kolonialsiedlungen und Missionsstationen waren wohl Faktoren, die dazu beitrugen, die Spuren dieses Jägervolkes zu verwischen, das Hunderte von Beispielen seiner bildnerischen Fähigkeiten hinterließ.
Das ist die offizielle Geschichte, so wie sie bis in unsere Tage überliefert wird. Fügen wir ein neues Element hinzu: In der Gegend, in der heutzutage einige der wichtigsten bemalten Höhlen von Baja California existieren, müßten auch die Überreste der Missionsstation von Santa Isabel zu finden sein. Unter Historikern ist sie als »die verlorene Mission« bekannt, die nach dokumentarischen Angaben zwischen den Missionsstationen von Calamajue und San Borja lag (Jordán, S. 188).
Bei der Durchsicht der Chroniken der Jesuiten und der Register des Vizekönigs über diese verlorene Missionsstation habe ich im Nationalen Generalarchiv, Vizekönigliche Abteilung, Sektion Inquisition, ein Manuskript mit indianischen Erzählungen gefunden, das vom Jesuitenpater Francisco Osorio niedergeschrieben wurde. Auf den letzten Seiten findet sich ein Dokument, das sich nicht nur auf die verlorene Missionsstation von Santa Isabel bezieht, sondern auch auf die Vorfahren der indianischen Völker, die die Spanier kennenlernten. Diejenigen, wie Cota (S. 16) sagt, die »vor Schreck starben, als sie eine Glocke läuten hörten«.
Das Dokument besteht aus sieben Seiten, und es gibt einige Stellen, die zerstört oder zweifelhaft sind. Es handelt sich um einen auf spanisch verfaßten Beichtbrief (ich bedauere, daß dies dem Roman La Sexta Isla von Daniel Chavarria ähnelt, aber wie wir sehen werden, entfernt sich die Realität von der Fiktion und überflügelt sie), der auf die ersten Jahre des achtzehnten Jahrhunderts datiert ist. Da er sich auf die Teilnahme des Jesuiten an der Expedition von Diego de Vargas bezieht, ist es möglich, die Daten exakt festzulegen.
Es ergibt sich, daß das Dokument aus den Jahren kurz nach dem Versuch von Vargas stammt, die Grenzen von Neu-Mexiko nach Norden zu verschieben, was im übrigen dem Erzähler 1692 den Arm gekostet hat. So heißt es in meiner armseligen Abschrift, die dem Spanisch entspricht, das ich beherrsche (zudem hatte ich in Paläographie nur eine Zwei minus):
»Der ich in diese Gegenden gekommen bin, um den Tod aus Überdruß oder die Einsamkeit in der Wüste zu suchen, Mann ohne Gott, den ich in der Militärexpedition des Gouverneurs Vargas verlor, wie im Gefecht mit den Indios den Arm, habe schon alles gesehen, was meine Augen sehen konnten. Es bleibt mir nur, die Geschichte zu erzählen, wie ich ein anderer geworden bin und warum, und sie im Sand der Wüste zurückzulassen, für den Fall, daß ein anderer, ebenso Glücklicher, die Absicht haben sollte, meinem Beispiel zu folgen.
Nachdem ich auf meinen Irrwegen zur Missionsstation von San Francisco gekommen war und der Missionspriester namens Benito sein spärliches Essen mit mir geteilt hatte, berichtete er mir von den Spuren der riesigen Malereien, die die Indios vor langer Zeit auf die Felsen in der Umgebung der Mission gemalt hatten. Er bot mir an, mich in Begleitung der Einheimischen am nächsten Tag dahinselbst zu führen. Diese Eingeborenen bezeichneten sich nicht als Erben der wunderbaren indianischen Maler und lebten friedlich in der Missionsstation. Seit alten Zeiten waren sie Menschen von Völkern anderen Denkens und anderer Götter als die indianischen Maler und lebten jetzt durch die Hand der Jesuiten im Schoße der Kirche.
An den folgenden Tagen besuchte ich die Höhlen und war angesichts der Großartigkeit und des Geheimnisses jener wunderbaren Wände überwältigt. Der Missionar verleugnete mit einfachen Erklärungen des Glaubens, was er sah, während ich an die Vernunft appellierte, um zu begreifen, was sich vor den Augen auftat: wundervolle Tiere mit Geweihen und Hörnern, tanzende Männer und Frauen, manchmal über die Figuren der Tiere gemalt, so als ob sie eins mit ihnen werden wollten, oder, im Gegenteil, die Tiere wollten Männer und Frauen werden, ohne zu wissen, was das für sie bedeutete.
Stundenlang streifte ich zwischen den Göttern dieses Ortes umher, verzehrte mich in meinem Staunen und erahnte eine Größe, die jenseits der Wahrnehmungsfähigkeiten des Soldatenlebens lag, das ich seit dem Ende meiner Kindheit geführt hatte. Bruder Benito erzählte mir später am warmen Feuer von den Legenden, in denen es hieß, die Indios, die die Höhlen bemalt hatten, oder ihre direkten Nachfolger lebten in jenen Gegenden weiter, aber sie hätten sich für die übrigen Sterblichen unsichtbar gemacht. Am Tag darauf, vor Morgengrauen, machte ich mich allein in die Wüste auf. Ich glaubte der Legende blind, denn es blieb mir nichts Angenehmeres zu glauben.
Wenige Schritte von der Höhle entfernt warf ich meine wenigen Habseligkeiten zu Boden und entblößte mich wie ein neugeborenes Kind. Unter der Sonne verblieben nur meine Nacktheit und meine Narben, mein verstümmelter Arm und mein ergrauender Bart. Wenn sie vor aller Augen unsichtbar sein wollten, konnte nur meine absolute und nackte Sichtbarkeit, ohne die Verstecke und Gaukeleien der Kleidung, sie um eine Begegnung bitten. So, wie ich jetzt war, konnte ich nichts verbergen, nicht das Intimste, nicht einmal meine verwirrte Seele; so machte ich mich daran, sie zu erwarten.
Es vergingen zwei Tage und eine Nacht in der Einsamkeit der Wüste. Der Körper begann, der Erschöpfung nachzugeben, dem Schmerz, der Müdigkeit und der Verrücktheit, deren Dämpfe wegen der starken Hitze durch meine Glieder aufstiegen und von meinem Kopf herabströmten. Ich starb nicht, denn der Tod bedeutete mir nichts, und wenn einer seinen zermarterten Resten sagt, das Leben könne gehen, man erteile ihm die Erlaubnis dazu, klammert es sich aus Widersinn fest.
Bei Einbruch der zweiten Nacht kamen die unsichtbaren Menschen aus den Steinen und Büschen hervor, die Indios ohne Gott, und nahmen mich auf.«
Ich besitze nur diese kurze Notiz, deren Stil und Zeichensetzung ich so wenig wie möglich verändert habe; lediglich zwei kurze Lücken von sechs und drei Worten habe ich ergänzt. Zu dieser überraschenden Geschichte kann man einige Legenden hinzufügen, die von den akkulturierten Einheimischen in den Missionsstationen der Jesuiten überliefert wurden. Diese besagen, daß »die Unsichtbaren«, »die großen Menschen«, in der Verrücktheit lebten, so als ob das die Vernunft der Klugen wäre, und bei ihren Festen die sexuelle Freiheit praktizierten und danach zur Normalität zurückkehrten, und sie hatten keine Anführer und führten keine Kriege und hatten weder Götter noch feste Wohnsitze (Cabrera, 147, 190 bis 198,212).
Foucault hätte gesagt: »Der Wahnsinn endlich in seinen Rechten bestätigt«.
Die Geschichte bedarf eines Exkurses. Das moderne Wissen über die bemalten Höhlen von Baja California, oder besser gesagt, seine Verbreitung, ist unter anderem dem nordamerikanischen Krimiautor Erle Stanley Gardner zu verdanken, in dessen literarischen Machwerken der Held Perry Mason die Region häufig als Tourist bereist.
Gut, wir befinden uns an einem einzigartigen Ausgangspunkt, der sich mit einer Felderfahrung verbindet, die die Autorin dieses Dissertationsvorhabens gemacht hat.
Aufgrund der Umgestaltung bei den Bauarbeiten zum inneren Ring im Eingangsbereich des Chapultepec-Parks und der Einmündung der Calzada de Tacubaya wurde der alte Park, in dem man Rollschuh lief und Fahrrad fuhr, in viele winzige Parzellen aufgeteilt, die von Panoramabrücken, Schnellstraßen, Kleeblattkreuzungen und Fahrbahnen auf unterschiedlichen Höhenniveaus umgeben sind. Diese kleinen Gärten, werktags verlassen, weil sie so schlecht zu erreichen sind, werden Samstag und Sonntag morgens zu Treffpunkten ethnischer Gruppen aus der mexikanischen Provinz.
Mit überraschender Präzision treffen sich, als Antwort auf die unvorstellbare Größe der Stadt, die Hausangestellten aus Amealco auf einem Dreieck von fünfzehn Quadratmetern Rasen, Dutzende von Zimmerleuten aus Huajapan de León auf einem anderen, fünfundzwanzig zacatecanische Bäcker auf einem weiter drüben, ein halbes Dutzend Straßenhändler, die aus Santiago, Nayarit, stammen, auf dem letzten usw. Die Stadt verteilt sie während der ganzen
Woche auf Gegenden, die Dutzende von Kilometern auseinanderliegen, und ihre finanziellen Verhältnisse lassen Kommunikation untereinander nicht zu.
Das Leben trennt sie fünf oder sechs Tage, manchmal zwei oder drei Wochen, aber die Existenz des festen Bezugspunktes, des Ortes der Wiederbegegnung, erlaubt es ihnen, sich immer in diesem Raum wiederzufinden, der eine Erweiterung des ursprünglichen Geburtsortes ist. Dort gestaltet man das Leben erneut nach Kriterien der Verwandtschaft und der Sehnsucht, und in ihrer Verschiedenheit gegenüber der Umwelt wird die Freundschaft zum Bollwerk. Städtische Zonen werden gerettet und mitten in einer Stadt mit 20 Millionen Einwohnern in zurückeroberte Räume umgewandelt, in Fragmente eines Dorfes aus Chiapas, in eine kleine ländliche Gemeinschaft aus Puebla, in einen erfundenen See aus Michoacan.
Das Grundlegende an diesen in die Stadt verpflanzten Existenzen ist ihre Unsichtbarkeit. In einer Umfrage, die die Autorin unter 372 Autofahrern durchgeführt hat, die regelmäßig die Gegend durchfahren (12. April bis 18. Mai), konnte die Existenz eines seltsamen Phänomens präzisiert werden. Diese Gruppen von »städtischen Sippen« sind für sie unsichtbar. Sie werden nicht wahrgenommen, existieren nicht.
Wie Sie anhand dieser Skizzen feststellen können, die ein Dissertationsvorhaben umreißen, wird dies eine Arbeit über die Mimesis werden, aber vor allem wird es sich um eine Arbeit über die Unsichtbarkeit der »Anderen« im Sartreschen Sinn des Begriffs handeln (Sartre, Werke II, 118).
Die Arbeitshypothese ist folgende: Den geographischen Raum bestimmen, den die unsichtbarste der unsichtbaren Gruppen besetzt. Versuchen herauszufinden, ob es Migrationsphänomene indigener Bevölkerung aus Baja California aus dem Gebiet der Sierra in den Hauptstadtdistrikt gibt und welchen Beruf die Migranten vor allem gewählt haben. Versuchen, die alten mit den neuen Unsichtbaren zu identifizieren. Schließlich die Gründe ihrer Unsichtbarkeit herauszufinden. Ich hoffe, daß ein so unorthodoxes Vorhaben wie dieses wenigstens das Recht auf objektive Würdigung und eine leidenschaftslose Prüfung erhält und der Autorin erlaubt wird, die Untersuchung fortzusetzen. Ich hoffe, die (Vor-)Urteile werden auf die spätere Auswertung der Ergebnisse begrenzt. Grundlegende Bibliographie im Anhang.
Elena Jordán, Mexiko DF, April 1988
9
Am Tag, als ...
... sich die Beatles trennten, befand sich Alex jenseits des Weltgeschehens. Während am 10. April 1970 über die Fernschreiber aller Zeitungen der Welt tickerte, daß die britische Gruppe sich aufgelöst hatte, erholte sich Alex von einem drei Tage und vier Nächte langen Besäufnis. Es hatte ihn an den Rand einer tödlichen Alkoholvergiftung gebracht. Und das war keine Metapher. Alex hatte in Acapulco an der Schwelle zum Tod gestanden, und vielleicht war ihm deshalb die Trennung der verdächtig unsterblichen Jungs aus Liverpool gleichgültig.
Paul McCartney sagte, er bereite sich auf eine Reihe von Aufnahmen mit einer neuen Gruppe vor, und Alex versuchte, den Kopf aus einem Ozean von Erbrochenem zu heben. Erst später sollte er versuchen, sich an die drei Tage und vier Nächte zu erinnern. Im Augenblick beschränkte er sich auf den Versuch, die Bewegungen des Bodens und die aufsteigende Gallenflüssigkeit unter Kontrolle zu bringen und mit Hilfe der Sonne im Zimmer im Hotel Tortuga den Alkohol aus seinem Körper auszuschwitzen. Wenn er bei voller Beleuchtung unbeweglich liegen bliebe, dachte er, würden die pralle Sonne, die durchs Terrassenfenster schien, die ausgeschaltete Klimaanlage und vier Aspirin im Magen dazu führen, daß er das Kleinhirn ausschwitzte.
Paul ging seiner Wege. John Lennon hatte das Ende des rosa Frühlings und den Aufbau der »John and Yoko Mobile Political Plastic Ono Band Fun Show« angekündigt. Ringo versprach eine Ausstellung mit Skulpturen, und George Harrison informierte die Weltpresse, daß er sich mit seiner Frau in die transzendentale Meditation zurückziehe.
Alex wollte einfach nur in die andere Wirklichkeit zurückkehren, auch wenn sie ebenfalls vollständig verschwommen war, authentisch durch ihre Unvollkommenheit, und im wesentlichen aus einer Verquickung unklarer Träume und wirklicher Alpträume bestand.
Dienstagabend hatte er aus geschäftlichen Gründen zu trinken begonnen, und weil ihm die beiden mexikanischen Polizisten, mit denen er zu tun hatte, nicht sonderlich gefielen. Es waren düstere, schlüpfrige Gestalten. Es war schwer einschätzbar, wo bei ihnen der schwarze Humor anfing und wo die Anspielung aufhörte, denn sie benutzten eine Sprache, die nur so strotzte vor halb ausgesprochenen Worten und abgebrochenen Sätzen, die sonstwo hinführen konnten.
Alex hatte eine Weile damit zugebracht, ihnen vorzuführen, daß der Schmerz nicht existiert, daß es ihn nur im Kopf desjenigen gibt, der ihn spürt. Es war eine seiner üblichen Routinevorführungen, die ihm einen kleinen Vorteil gegenüber den Vandalen verschaffte, mit denen er es manchmal zu tun hatte. Er verbrannte sich mehrmals mit einer Zigarette den Unterarm und lächelte dabei. Einer der Typen versuchte, es ihm nachzutun, und verbrannte sich mit der Flamme seines vergoldeten Ronson-Feuerzeugs die Handfläche. Doch es bereitete ihm Unbehagen, und er zertrümmerte einem Korallenkettenverkäufer, der sich mit seinen Waren genähert hatte, mit einem Schlag den Kiefer und schlug ihm ein Auge aus. Der andere trank schweigend und veränderte im Laufe der Stunden kaum seinen Gesichtsausdruck.