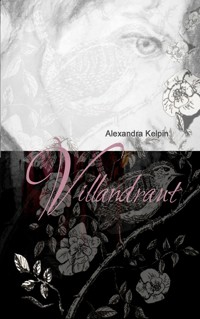
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein verwunschener Ort. Ein stiller Gastgeber. Und ein Fluch, der bis in die Gegenwart reicht. Nach dem Ende einer enttäuschenden Liebe reist Marie ziellos durch Frankreich, bis sie in dem verschlafenen Dorf Villandraut strandet. Dort begegnet sie dem scheuen, seltsam entrückten Jacques, der sie in seinem alten Haus aufnimmt. Doch die friedliche Fassade trügt. Unheimliche Träume, rätselhafte Geräusche und eine uralte Legende über die Schwester eines Ritters ziehen Marie immer tiefer in ein Netz aus Erinnerung und Magie. Gemeinsam mit der eigensinnigen Louanne beginnt sie, die Wahrheit über Jacques' Vergangenheit zu entschlüsseln - und einen Fluch, der längst vergessen schien, endlich zu brechen. Ein poetischer Roman über Liebe, Verlust - und das, was zwischen den Zeiten verloren gegangen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Villandraut, Aquitaine, 1985
Das kleine Dorf träumte den spätsommerlichen Schlaf der französischen Provinz. Lauernde, schwere Luft erstickte jedes Leben, jede Bewegung. Selbst die Katze hinter dem Fenster schien zu einem Standbild erstarrt, einem Symbol bleierner Trägheit.
Während Marie aus dem Auto stieg und auf die gewaltige Burganlage Villandrauts zuging, schien die lautlose, graue Gewitterluft selbst ihre Schritte zu schlucken, sie wie eine unsichtbare Mauer zurückzuhalten. Sie sah zu den Türmen auf, an denen Geißblatt emporkroch und dachte, hier mußte es gewesen sein, wo Dornröschen seinen hundertjährigen Schlaf geschlafen hatte, hier in einem dieser zerbrochenen Türme hatte die Fee mit dem Spinnrad gesessen, hier und nirgendwo sonst war der Schlaf, die Verzauberung, hundertjähriges Warten und Vergessen zuhause.
Die Frau an der Kasse war das erste menschliche Wesen, das ihr hier begegnete. Sie überreichte ihr eine Taschenlampe und nahm das Eintrittsgeld entgegen, um sich sogleich wieder einem zerfledderten Roman mit reißerischem Titelbild zu widmen. Niemand sonst schien auf die Idee gekommen zu sein, an einem gewittrigen Nachmittag im September diese Burgruine zu besichtigen. Eine Welt aus dunklen Gängen, Kellern und engen Treppen wartete.
Als sie die Wendeltreppe zum ersten Turm erstieg, kam eine Bö auf, ließ das Blattwerk an der Mauer leise aufrascheln. Am Ende der Treppe fand sich eine runde Kammer mit einem Kreuzgewölbe, dessen angeschlagene Rippen symmetrisch über den Raum griffen. Die tote Feuerstelle gähnte ihr dunkel entgegen, der Rauch erloschener Feuer hatte ein wolkiges Muster auf die kahle Wand gemalt. Eine Steinbank vor dem hohen, leeren Fenster ließ erneut an vergessene Dornröschen gemahnen, die sich die Spitzen aller Spindeln dieser Welt ins Fleisch gebohrt hatten, um diesem Leben zu entkommen, einem Leben des Wartens und Hinnehmens. Sie trat ans Fenster und blickte auf die verlassenen Grundmauern einer Halle hinab. Wieder ergriff eine Bö das Geißblatt, trieb ein paar Blätter herein, erste, trockene Vorboten des Herbstes. Der Himmel war fast schwarz und in der lauernden Stille schien das Blätterrascheln und das Aufkrächzen eines Rabenschwarmes wie eine Erlösung. Sie lief über die Wehrgänge, beleuchtete die Nischen der Kellergewölbe, wanderte durch ehemalige Küchen und Weinkeller.
Dann, als sie gerade von einer der hohen Mauern auf das Örtchen Villandraut herabsah, krachte der erste Donner los und nur wenige Sekunden später ergoß sich Regen über den dampfenden Stein. Sie eilte zum nächstgelegen Turm, der jedoch verschlossen war und ihr nur hinter einem Dornengestrüpp ein wenig Schutz in Form eines überhängenden Daches bot.
Während sie sich das nasse Haar aus dem Gesicht schob und sich an die Mauer lehnte, schien es plötzlich, als bewege sich diese, gebe ein Stück nach... Marie wand sich um und entdeckte eine kleine Tür, die hinter dem Gestrüpp kaum auszumachen war. Eilig öffnete sie diese und machte einen vorsichtigen Schritt ins Innere, das ihr in völliger Finsternis begegnete. Sie knipste die Taschenlampe an, doch nichts geschah. Daraufhin schüttelte sie die Lampe ein wenig, nahm die Batterien heraus und legte sie wieder ein, doch es blieb dunkel. Was sie dennoch erahnen konnte, war, daß es sich um einen kleinen Raum zu handeln schien, kleiner noch als die runden Kemenaten der anderen Türme. Der Regen klatschte gegen den Turm und spritzte in die Kammer, sodaß sie die Tür ein wenig schloß und einige Minuten bewegungslos in der schwarzen Kemenate stehenblieb. Es roch muffig, so als ob seit Jahren niemand mehr hiergewesen wäre. Langsam strich sie über die Mauer zu ihrer Rechten und bemühte sich angestrengt, etwas im Raum zu erkennen. Doch ihr zeigten sich nicht mehr als Schemen, die sie für die gegenüberliegenden Wände hielt. Das Wasser floß durch den Türspalt über den Boden herein und sie ging unwillig einen Schritt zurück, weiter in die ungewisse Finsternis. Etwas Kaltes, Spitzes ließ sie erschrocken auffahren und in ihrer Bewegung innehalten. Nach einer ewig scheinenden Zeit wagte sie es, sich umzudrehen und ihre Hände nach dem Etwas auszustrecken... Es war kalt und hart, Stein. Und dennoch war es kein Mauerstein... Der aufgekommene Sturm ließ die Tür gegen die Mauer krachen und schließlich zuschlagen. Nun war sie vollkommen eingeschlossen in dieser merkwürdigen, düster-kalten Welt, hörte das Rütteln des Windes, das Klatschen des Regens nur mehr wie durch dumpfen Nebel. Mit gerunzelter Stirn wandte sie sich wieder dem Steingebilde zu, ertastete einen Arm, eine Schulter, beides von seltsamer, grober Struktur, das an die eines Kettenhemdes erinnerte, bis sie schließlich an einem Gesicht angelangt war... eine lange, gerade Nase, tiefliegende Augen und sogar steinerne Locken, die unter einer Haube hervorquollen... es fühlte sich so echt an, daß sie erschrocken zurückwich. Ihr Herz klopfte, als befände sie sich nicht allein in diesem Raum, hätte durch diese unerlaubte Berührung einen jahrtausendealten Zauber gelöst, einen Zauber, der für die Ewigkeit bestimmt gewesen war... Dennoch konnte sie nicht anders, als in ihrer Erforschung der seltsamen Skulptur fortzufahren. Das Kettenhemd, das Schwert in der Hand der hohen Gestalt ließen auf das Bildnis eines Ritters schließen, doch in seiner Naturtreue konnte es nicht aus dem Mittelalter stammen. Sie strich über die Schultern und wagte es, sich für einen kurzen Moment an die Gestalt aus Stein zu lehnen, die ihr trotz ihrer Kälte und Starrheit ein Gefühl des Schutzes gab, so wie es nur Stein vermag.
Sie wußte nicht, wie lange sie so dagestanden hatte, merkwürdig still und abwesend, als hätte sie diese Welt komplett verlassen... Doch schließlich löste sie sich vom Ritter, öffnete die Tür und blickte wie im Traum in den feuchten Septembernachmittag. Der Regen tropfte von den Zinnen, glitt über’s Geißblatt hinab bis zu den Wasserspeiern und ergoß sich glucksend in den Hof.
»Was machen Sie da oben?« rief die Kassiererin plötzlich. Sie stand mit einem großen schwarzen Schirm mitten im Burghof und sah ärgerlich zu der einzigen Touristin auf. »Dieser Turm ist gesperrt!«
»Es tut mir leid...« begann Marie und sah sich noch einmal zu der Kammer um, doch ihre Schwärze blieb undurchdringlich. Eilig schloß sie die Tür und stieg in den Hof hinab. »Danke.« meinte sie, als sie der Kassiererin gegenüberstand, und überreichte ihr die Taschenlampe. »Ich fürchte, die Batterie ist leer.«
Die Kassiererin knipste prüfend die Lampe an und ein Lichtkegel malte sich aufs Gras.
»Seltsam, als ich es eben versuchte, ging es nicht.« Marie sah zum Turm hoch.
»Vielleicht ein Wackelkontakt.«
»Ja, möglich. Sagen Sie-« fragte Marie mit einem Blick auf ihre Uhr, »gibt es hier in der Nähe ein günstiges Restaurant?«
»Im Ort, ja. Gehen Sie die Straße runter, an der Kirche vorbei. Bistro D’Aubreville, ist ganz gut.«
»Danke.«
Der Regen setzte wieder ein und sie eilte über die Holzbrücke, die enge Straße hinunter, vorbei an dem Haus, in dessen Fenster nun keine Katze mehr saß, sondern ein nikotingelber Gardinenfetzen herauswehte.
Bistro D’Aubreville war eine Mischung aus Bistro und Lottoannahmestelle und besaß eine Karte mit hunderfünfundzwanzig Gerichten aus aller Herren Länder, von denen ungefähr achtzig gestrichen waren, so als hätte der Besitzer die Attraktivität eines Ortes wie Villandraut weit überschätzt. Sie setzte sich an einen der kleinen Marmortischchen mit der karierten Plastiktischdecke und bestellte ein warmes Baguette mit Kaffee.
Während der Besitzer es ihr servierte, um sich dann wieder dem Sportprogramm im Fernsehen zuzuwenden, blickte sie gedankenverloren aus dem tropfenschimmernden Fenster hinaus auf den Platz mit den Linden. Der Regen strömte noch, als sie ihr Baguette verspeist hatte. Halb sechs.
Ein dünner, krummer alter Mann betrat das Bistro und schüttelte seinen Schirm im Gang aus, was der Besitzer nicht zur Kenntnis zu nehmen schien. Er setzte sich an den Tisch ihr gegenüber, schlug eine zerknitterte Zeitung auf und begann, zu lesen, ohne Anstalten zu machen, irgendetwas zu bestellen.
»Kann man hier irgendwo übernachten?« fragte sie den Besitzer, der seinen Blick nur unwillig vom Bildschirm nahm und fragend grunzte.
»Hier? In Villandraut? Nein, nicht im Moment. Im nächsten Ort allerdings,« fuhr er fort, »wenn Sie der Straße folgen, dann-«
Sie sah ihn an, harrend der Erklärungen, die da kommen mußten, während er mit geöffnetem Mund den schicksalhaften Weg eines Fußballs auf dem Bildschirm verfolgte.
»Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische, aber es gibt am Rande dieses Ortes eine gute und günstige Unterkunft.« mischte sich der seltsame Alte leise ein. »Wenn Sie an der Burg vorbeifahren und links in die Allee einbiegen, dann müssen Sie nur der Straße folgen und Sie werden an ein großes Haus gelangen... der Eigentümer vermietet Zimmer.«
»- dann sehen Sie ein Schild,« fuhr nun der Besitzer fort, als hätte der krumme Mann gar nichts gesagt, doch sie bedankte sich nur, zahlte und trat in den Regen hinaus.
Als sie wenig später die breite Allee erreicht hatte, schien das letzte Licht des Tages mit einem Schlag erloschen zu sein. Blätter wirbelten auf, verfingen sich in den Scheibenwischern. Nach wenigen Kilometern schimmerte plötzlich ein schwacher Lichtschein durch das dämmrige Gehölz. Ein großes Haus, umgeben von mächtigen Bäumen und einer Mauer, die aus dem Mittelalter zu stammen schien, tauchte hinter einer Einfahrt auf, die von Rhododendren und Hortensien gesäumt wurde.
Marie parkte vor dem Eingang und stieg zögernd die Stufen zur Eingangstür hoch. An der linken Seite befand sich ein großes Fenster, durch das man in eine hell erleuchtete Küche blicken konnte. Auf einem großen, runden Eichentisch stand eine dampfende Teekanne aus Silber, auf deren Deckel ein Steinbock thronte. Unwillkürlich empfand sie eine tiefe Sehnsucht danach, in dieses Haus einzutreten und eine Tasse Tee aus der Steinbockkanne zu trinken, sich zu wärmen und auszuruhen... Sie versuchte, im dämmrigen Licht den Schriftzug unter der Klingel zu entziffern, konnte aber nur ein verschnörkeltes J. de Villandraut ausmachen.
Es dauerte nicht lange, bis man auf ihr Klingeln reagierte. Sie hörte Schritte, dann wurde die Tür geöffnet. Vor ihr stand ein Mann in einem Wollpullover, einen Becher Tee in der Hand und das leicht gelockte Haar etwas zerwühlt. Das gestrenge Antlitz eines Heiligen, schmal und blaß, mit großen, grauen, umnächtigten Augen, tief umschattet, ließ sie mit den mittelalterlichen Kirchengesängen, die aus dem Hintergrund tönten, für einen seltsamen Augenblick in eine andere Zeit gleiten, sie um nächtliches Asyl in einem Kloster ersuchen.
Sie hatte einen älteren, gediegenen Herren erwartet oder eine Art französische Miss Marple, die sich mühsam von ihrem Strickzeug erhoben hatte, um einen abendlichen Besucher zum Tee hereinzulassen... Und nun fühlte sie plötzlich, wie der Regen in den Kragen ihrer Jacke rann und ihr das Haar an die Wangen drückte.
»Hallo... ich hoffe, ich störe nicht-« begann sie und dachte für einen Moment daran, ihr Vorhaben aufzugeben.
Der Mann musterte sie und trotz des Ernstes und einer unbestimmten Traurigkeit, die in seinen Zügen lag, entdeckte sie die Andeutung eines Lächelns darin: »Ja?«
»Ich hörte, Sie vermieten Zimmer?«
Wieder musterte er sie mit einem nachdenklichen, aber auch leicht amüsierten Ausdruck. »Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Platz hätte ich schließlich genug.«
Unsicher, ob dies nun ein Scherz war oder nicht, wollte sie sich schon wieder zum Gehen wenden, als er in ernsthafterem Ton hinzufügte:
»Darf ich fragen, woher Sie diese Information haben?«
»Von einem alten Mann in einem Bistro in Villandraut. Ich wußte ja nicht... es tut mir leid.«
»Nein, entschuldigen Sie... natürlich vermiete ich Ihnen ein Zimmer. Kommen Sie doch herein!«
Marie betrat zögernd die Halle, deren große Steinfliesen gierig den Regen aufsogen, der von ihr tropfte. Kein Wunder, daß sie sich an der Pforte eines Klosters geglaubt hatte. Die hohen, schmucklosen Wände mit gotischen Fenstern, schlanke Steinsäulen und zahllose Kerzenhalter, in denen dicke Kerzen brannten, gaben diesem Raum etwas Mystisches, Zeitloses, durch das die Musik wie Weihrauch schwelte.
»Wahrscheinlich möchten Sie gleich Ihr Zimmer sehen?«
»Ja, ich hole nur eben mein Gepäck...«
»Das kann ich doch gleich machen. Folgen Sie mir bitte.«
Wie unwirklich war es, durch die strenge Halle zu gehen, vorbei an der Küche, in die sie einen kurzen, sehnsüchtigen Blick warf, dann eine breite Treppe hinauf, die aus Granitblöcken gehauen schien. Am Ende eines schmalen Ganges öffnete der Mann eine Tür, hoch und gotisch wie die Fenster. Der Raum, der sich dahinter befand, hatte jedoch wenig Ähnlichkeit mit der Klausnerzelle, die sie erwartet hatte. Wohl waren Wände und Boden aus nacktem Stein, aber die Einrichtung ließ keine Errungenschaft der Weltlichkeit vermissen. Es gab einen herrlichen, dicken Berber, der fast den ganzen Boden bedeckte, eine Sitzbank, die direkt in den Fenstererker eingelassen und mit großen Kissen bedeckt war, und nur wenige, aber sicherlich wertvolle und uralte Möbel, deren Schlichtheit sie jedoch weder verstaubt noch erdrückend wirken ließ. Der Raum war erstaunlich persönlich für ein Gästezimmer.
»Ich hoffe, es gefällt Ihnen.« erkundigte sich der Mann mit seltsamem Nachdruck und sie nickte lächelnd, wobei sie sich lieber keine Gedanken über den Preis für die Übernachtung an einem solchen Ort machen wollte.
»Dann hole ich jetzt Ihr Gepäck, wenn Sie wollen.«
»Danke – wäre es wohl möglich, noch eine Tasse Tee zu bekommen?«
Er schien kurz zu zögern. »Wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie doch noch auf einen Tee herunter. Natürlich können Sie auch hier oben etwas bekommen...« Er brach ab, so als wisse er nicht, ob es zu gewagt gewesen war, solch einen Vorschlag zu machen.
Als sie heiß geduscht und sich trockene Kleidung angezogen hatte, ging sie zum Fenster ihres Zimmers, kämmte ihr Haar und sah über die dunklen Hügel und Felder hinaus. Der Regen klatschte noch immer gegen die Scheibe und ein stürmischer Wind ließ das altersschwache Holz des Hauses aufstöhnen. Irgendwo weit hinten glaubte sie die Türme Villandrauts zu erkennen. Sie ging in die Halle hinunter, blickte in die Küche, aus der die Teekanne nun verschwunden war.
»Möchten Sie nicht in die Bibliothek kommen?« hörte sie plötzlich die Stimme des Mannes hinter sich und wandte sich um. Dann folgte sie ihm in einen mit Büchern, Papieren und Rollen überhäuften Raum, in dem ein Kaminfeuer prasselte - ganz so, wie sie es aus alten Filmen kannte. Auch die Bibliothek war aus grob behauenem Stein und die Wände zeigten kaum anderen Schmuck als Regale, die einmal um den Raum verliefen. Rechts und links befanden sich zwei lange, dunkle Tische, auf denen einige Glasvitrinen standen, die ansonsten aber von übereinandergetürmten, teilweise aufgeschlagenen Büchern begraben wurden. In der Mitte, nah beim Kamin, standen zwei Sessel. Sie hatte das Gefühl, daß der zweite sich noch nicht lange an diesem Platz befand. Die Zweige eines Baumes peitschten gegen das hohe Fenster und eine Sturmbö ließ den Kamin auflodern. Und zu ihrem großen Vergnügen entdeckte sie auf einem kleinen Tischchen neben den Sesseln die silberne Teekanne mit dem Steinbockdeckel.
»Darf ich?« fragte der Mann und goß ihr Tee in einen großen Becher. Während sie ihn dabei beobachtete, fielen ihr seine Hände auf, schlank und schmal, aber gleichzeitig stark und ausdrucksvoll, die Hände eines Künstlers. Dazu schienen jedoch die Schrammen und Spuren von verheilten Verletzungen nicht ganz zu passen, die sie überzogen, so als sei er durch Dornengestrüpp gelaufen oder hätte sich durch dichtes Unterholz vorwärtsbewegt. Vor allem an den Handgelenken war die Haut von Narben überzogen, so als hätte es dort tiefe Einschnitte und Verletzungen gegeben, die nie behandelt worden waren. Ohne es zu wollen kam in ihr der Gedanke auf, wie es wohl war, von diesen Händen berührt zu werden, und sie wechselte schnell den Blick zu ihrer Tasse.
»Es kommen wohl zu dieser Zeit nicht oft Gäste hier vorbei?« fragte sie und nahm am Kamin Platz.
»Um ehrlich zu sein, nein.« erwiderte er und ließ sich in den anderen Sessel fallen, nahm einen Schluck Tee und betrachtete sein Gegenüber kurz aus seinen ernsten, grauen Augen.
»Warum eigentlich nicht?« fuhr sie fort und ließ ihren Blick über den Raum schweifen.
»Naja... ich denke, das ist recht offensichtlich. Wer macht schon gerne Urlaub an einem Ort, der eher einem Kloster oder einer Festung gleicht als einem Hotel...« Er fuhr sich über das Gesicht, so als würde ihn diese Tatsache selbst ermüden.
»Ich weiß nicht – ich vielleicht.«
Er sah mit gerunzelter Stirn zu ihr herüber. »Wieso das?«
»Es beruhigt mich. Vielleicht hat dieser Ort genau das, was viele suchen, was ich suche...«
Nun war sein Blick ganz offen und von einer Intensität, die beunruhigend wirkte. »Was ist es denn, was Sie suchen?«
Eine lange Zeit hörte man nichts außer dem Prasseln des Feuers und Regens, und sie senkte ihren Blick verwirrt auf die eigenen Hände, die sich beinahe nervös um den Becher klammerten. Was suche ich, was suche ich... warum hatte sie diese Frage aufgebracht, vor der sie nun seit Monaten davongelaufen war? Sie wußte es nicht, wollte es nicht wissen, konnte nur sagen, was sie nicht mehr suchte, was sie enttäuscht und ausgebrannt hatte, was sie dazu getrieben hatte, bis hierher zu fahren, um sich in Burgruinen ein Stück der Märchen wiederzuholen, die unwiderruflich in ihr gestorben waren.
Und dann, sie wußte nicht, wieso, erzählte sie dem Mann davon, erzählte ihm alles, was sich in den letzten Monaten abgespielt hatte. Die uralte Geschichte vom verheirateten Mann, der diese kleine, unbedeutende Tatsache allerdings monatelang erfolgreich vor ihr verheimlicht hatte. Die Selbstvorwürfe und der Schmerz, als sie endlich doch dahintergekommen war. Hatte sie seine Frage damit beantwortet? Hatte sie sie sich selbst beantwortet? Oder war es nur eine Anekdote, die sie am Kaminfeuer zum Besten gab, die Anekdote einer enttäuschten Liebe? Der Mann hörte jedenfalls zu, was immer er davon halten mochte, ganz aufmerksam, nur hin und wieder einen Schluck Tee zu sich nehmend.
Schließlich war ihr Bericht beendet, es gab nichts mehr zu sagen. Sie lächelte und fragte sich, warum sie soeben einem Wildfremden diese Geschichte erzählt hatte, eine Geschichte, die zu persönlich war, um ihn wirklich interessieren zu können. Aber es war so leicht und natürlich gewesen, sie ihm zu erzählen, wie es bei einem alten Freund der Fall gewesen wäre. Sie hatte es immer für ein Klischee gehalten, wenn von Menschen die Rede war, die plötzlich jemanden trafen, der ihnen auf seltsame Weise vertraut war, so als würden sie ihn schon ewig kennen. Aber nun fühlte sie es selbst, und es befremdete und erschreckte sie gleichermaßen.
»Entschuldigen Sie, so genau wollten Sie es vermutlich gar nicht wissen.« stammelte sie etwas peinlich berührt. »Nun kennen Sie meine halbe Lebensgeschichte, ohne daß ich mich vorgestellt habe. Marie Bernard.« Sie beugte sich etwas vor und streckte ihm ihre Hand entgegen.
»Jacques de Villandraut.« erwiderte er und sah auf ihre Hand herab, als käme er von einem Erdteil, in dem dieses Begrüßungsritual vollkommen unbekannt war. Erst nach langem Zögern ergriff er diese schließlich und hielt sie dann etwas länger fest, als es gemeinhin üblich war. Marie stellte fest, daß diese Tatsache nicht nur ihn, sondern auch sie selbst leicht erröten ließ wie ein Schulkind.
»Villandraut? Haben Sie etwas mit der Burg zu tun?« fragte sie eilig.
Er wirkte plötzlich in sich gekehrt. »Ja...«. Dann aber setzte er hinzu: »Ja, ich habe mit der Burg zu tun. Genauergesagt bin ich wohl der letzte, der darauf Anspruch hätte, wenn ich denn unbedingt wollen würde. Die Burg gehört natürlich längst dem Staat - keiner meiner Vorfahren in jüngster Zeit hätte es sich leisten können, selbst darin zu wohnen. Sie zogen schon vor einigen Jahrhunderten in dieses Haus.«
»Und Sie sind... der letzte Villandraut?«
»Ja. Deshalb habe ich vielleicht dieses seltsame Hobby auf mich genommen.« Er warf einen Blick auf die Bücherberge, die sich auf den Tischen häuften. »Vielleicht denke ich, ich bin den Villandrauts irgendetwas schuldig, wenn ich sie schon aussterben lasse.«
Er lächelte und sie fragte sich, wie es dazu kommen konnte, daß er dieser Meinung war. Er wirkte kaum älter als sie selbst, vielleicht sogar jünger, und er hatte eine Ausstrahlung, die sicher auf einige Frauen anziehend wirken mußte.
»Wieso-« begann sie unsicher.
»Vermutlich, weil ich verrückter bin, als es im Moment vielleicht den Anschein hat.« erklärte er leichthin und erhob sich dann. »Aber vielleicht ist das ganz gut so. Denn sonst hätte ich wohl keine Lust dazu gehabt, mich mit all dem hier zu beschäftigen.«
Irgendetwas an seinen Worten, seinem Tonfall, der gespielten Gleichmut, die dahinter lag, machte sie seltsamerweise gleichzeitig wütend und traurig. Sie entdeckte eine Karaffe mit Whisky und ein halb geleertes Glas neben seinem Sessel und deutete mit dem Kopf darauf.
»Kann ich auch etwas davon haben?«
»Ja, natürlich.« meinte er überrascht und amüsiert und holte ihr ein Glas. In dieser Zeit hatte sie sich wieder gefaßt und holte tief Luft.
»Was ist denn nun mit Ihrem Hobby?«
Jacques schien unschlüssig, ob es wirklich richtig war, jetzt noch davon zu erzählen, aber sie begegnete seinem Zögern nur mit einem erwartungsvollen Blick, sodaß er schließlich begann:
»Also gut... der erste Villandraut, der diesen Namen tragen durfte, war, wie Sie vielleicht wissen, der Herzog von Villandraut, ein Ritter, der im 14. Jahrhundert die Burg bewohnte. Wie es der Zufall will, hieß er ebenfalls Jacques. Als ich noch ein Kind war, sagte man mir, man habe mich nach ihm benannt, obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich stimmt. Es hieß, er sei ein mutiger Ritter gewesen und das reichte mir, ihn mir zum Vorbild und Helden meiner Jugend zu machen. Ich wollte nichts mehr, als es ihm gleichzutun; ein Ritter sein, mit allen Tugenden, die ich in meiner jugendlichen Einfalt für die Tugenden eines wahren Ritters hielt: Mut, Ehrlichkeit, Treue, Schutz der Schwachen... Ich verschlang jeden Roman, in dem ein Ritter auch nur in einer Zeile erwähnt wurde. Eines Tages dann... schwanden meine Ideale ein wenig. Mir erschien das alles nicht mehr wichtig und ich beschäftigte mich lange Zeit nicht mehr damit. Aber dann... kehrte meine Begeisterung für die Ritter zurück. Nicht so, wie es in meiner Jugend gewesen war, sondern eher rein historisch, aber ich begann wieder, mich mit Jacques de Villandraut zu befassen. Es war schwer, etwas über ihn zu finden, aber ich habe inzwischen schon eine beachtliche Sammlung zusammen. Nicht nur über ihn,« erklärte er mit wachsender Begeisterung, »sondern auch über alles andere, was mit dem Rittertum zusammenhängt. Historische Fakten, die mir meine damaligen Vorstellungen ziemlich idealistisch erscheinen lassen, aber auch Geschichten, Mythen, Betrachtungen, alles, aus jedem Bereich.« Er machte eine ausladende Geste und seine Wangen waren leicht gerötet.
»Das klingt hochinteressant.« gab sie zurück und fragte sich, warum sie stets so verhalten klingen mußte, auch wenn sie weitaus begeisterter war. »Gibt es auch eine Geschichte über den steinernen Ritter von Villandraut?«
»Den steinernen Ritter?« fragte er und wurde blaß.
»Ich meine den, der in einem dunklen Raum im fünften Turm steht.«
»Woher wissen Sie davon?« murmelte er, »Dieser Turm ist immer abgesperrt.«
»Es war Zufall...« erwiderte sie entschuldigend, ohne zu wissen, weshalb sie sich eigentlich entschuldigen sollte. »Was ist denn mit diesem Ritter?« wollte sie verwirrt wissen, doch Jacques gab ihr lange keine Antwort. Dann fuhr er sich erneut müde übers Gesicht, lehnte sich an einen der Tische und sah mit großen Augen aus dem hohen Fenster.
»Es gibt in der Tat eine Geschichte über diesen Ritter... es ist eine Sage, die seit etlichen Jahrhunderten hier in der Gegend kursiert. Eine Art Dornröschensage, wenn man so will, nur mit vertauschten Rollen.«
Sie lehnte sich in den Sessel zurück und blickte ihm gespannt entgegen. Ein Regenschwall klatschte gegen die Scheibe und Jacques schien aus seiner Abwesenheit aufzufahren. Mit gerunzelter Stirn wandte er sich den Bücherbergen zu und durchsuchte sie mit den Worten: »Ich habe ein Buch darüber, hier irgendwo...« Dann gab er es seufzend auf und zuckte mit den Achseln. »Egal, ich werde die Geschichte so erzählen.«
Er nahm wieder im Sessel Platz, betrachtete eine Weile zögernd das Glas in ihren Händen und goß sich dann ebenfalls einen Whisky ein, um kurz darauf fortzufahren:
»Der Ritter, den die Statue darstellen soll, ist... laut der Legende kein Anderer als mein Vorfahr Jacques, ein edler und vielversprechender junger Mann, ein ebenso guter Kämpfer wie ein hilfsbereiter und mutiger Freund. Wie es damals so war, hielt er jedoch manche Dinge für heilig, die alles andere als das waren - naja, das ist wohl auch heute noch oft so - und als man ihm den Kreuzzug als gute Sache darstellte, war er wohl einer der Wenigen, die wirklich aus idealistischen Gründen mitzogen.
Was er dort erlebte... kann man sich nur dann vorstellen, wenn man weiß, wie verändert er zurückkehrte. Die Leute sagten, er sei verflucht, denn er schien um Jahre gealtert, wie eine Blüte, die vom Frost überzogen wurde. Sein Haar war von schlohweißen Strähnen durchwirkt, die Augen tief und in sich gekehrt, das Gesicht eingefallen und hager. Doch nicht nur sein Äußeres war kaum wiederzuerkennen, auch sein Wesen schien das eines Fremden. Er suchte die Einsamkeit hinter den Burgmauern, ließ Falken steigen und folgte ihrem Flug mit leerem Blick. Er wanderte über die Wehr der Burg und starrte nächtelang über das Land. Alles, was gut in ihm gewesen war, hatte sich ins Gegenteil verkehrt und er sah auch in der Welt und im Menschen nur noch das Übel. Es gab aber noch etwas, was seinem Leben Sinn verlieh - seine Schwester Adèlaïde, die er mehr liebte als sein eigenes Leben. Seine Strenge und Härte jedoch schienen ihn von ihr entfremdet zu haben und er konnte nicht mehr erkennen noch berücksichtigen, was sie fühlte und wünschte. Adèlaïde aber war ein übermütiges Geschöpf mit einem starken Willen, das schwer zu lenken oder gar zu beherrschen war. Eines Tages begegnete sie einem jungen Mann, der zwar von Adel, aber verarmt war, und verliebte sich in ihn. Jacques verbat ihr strikt den Umgang, doch sie fand stets Wege, seinen Anordnungen zu entgehen. So versuchte Jacques es auf eine andere Art... er nahm den jungen Mann als Krieger in seiner Garde auf, schickte ihn aber bei der erstbesten Gelegenheit in eine Schlacht, aus der er nicht lebend zurückkehrte. Als Adèlaïde den Leichnam im Burghof aufgebahrt sah, stürzte sie sich vom Turm. Und Jacques... konnte den Tod seiner Schwester nicht verwinden und auch nicht die Schuld, die er daran trug. Man sagt, daß er seinen engsten Vertrauten den Befehl gab, ihn lebendig mit Stein zu umschließen. Man schlug einen steinernen Sarkophag, in dem er stand, in der höchsten Kammer des äußersten Turmes, und dort wartete er, bis er die Kälte in sein Herz kriechen spürte. Doch er konnte nicht sterben. Und so blieb er, gefangen in sich selbst, die Augen und Ohren noch immer in der Welt und dennoch unfähig, mit ihr in Berührung zu gelangen...«
Jacques schien für einen Moment vergessen zu haben, wo er sich befand und wem er all dies erzählte. Dann plötzlich sah er auf und lächelte entschuldigend.
»Dann war es die wirkliche Geschichte Jacques de Villandrauts?«
»So sagt man.«
»Aber die Statue wurde nicht im Mittelalter angefertigt, nicht wahr? Sie ist so realistisch... fast so, als würde der Ritter jeden Augenblick die Augen aufschlagen.«
»Wer weiß, vielleicht haben Sie ihn ja erlöst.«
»Kann man das denn?« Sie mußte an das seltsame Gefühl denken, daß sie in Gegenwart des Steinritters beschlichen hatte und beantwortete ihre Frage dann selbst. »Aber was wäre das für ein Fluch, wenn es keine Erlösung gäbe? Selbst für Dornröschen gab es schließlich eine, auch wenn mir Dornröschens Schicksal um einiges angenehmer erscheint...«
Sie blickte beinahe traurig auf ihr Glas herab, dann zu Jacques herüber, der sie nachdenklich betrachtet hatte, um nun eilig den Blick zu senken. Der Whisky rann ihr brennend die Kehle hinunter. Unwillkürlich sah sie auf ihre Uhr und seufzte lächelnd. Sie hatte das Gefühl, fortzumüssen, jetzt gleich und auf der Stelle, und gleichzeitig schien sie wie festgewachsen an ihrem Platz, in der leicht benommenen Behaglichkeit des Zimmers, des Whiskys, der sanften Stimme Jacques de Villandrauts, der ihr in solch schöner, etwas altmodischer Ausdrucksweise von Rittern und Flüchen erzählte, von einer Welt, die es nicht mehr gab, nie gegeben hatte. Sie hatte das Bedürfnis, mehr zu hören von jenen längst zu Staub zerfallenen Männern, deren Welt aus Kampf und Tod bestanden hatte und die sie dennoch niemals verletzen konnten. Trotzdem stellte sie das Glas entschieden auf das Tischchen und erhob sich.
»Es ist schon spät... und ich habe morgen noch eine lange Fahrt vor mir.«
»So? Wohin wollen Sie denn?«
»Nach Bordeaux und dann in Richtung Norden.« erwiderte sie mit schwerer Zunge und spürte, wie der Alkohol ihre Bewegungen lähmte. Auch Jacques erhob sich nun und begleitete sie bis zum Treppenabsatz.
»Gute Nacht - und träumen Sie gut.« meinte er mit einem seltsamen Unterton, bevor er ihr einen nicht minder seltsamen Blick nachsandte.
Sie glitt im Traume aus dem Fenster, das weit offen stand, hinaus in den Regen. Dort, wo noch heute abend ein Ort gelegen hatte, erstreckte sich ein Wald bis hin zum blauschwarzen Horizont und dahinter die Burg, die Festung, das Gefängnis Villandraut, gehauen aus Granit und Blut. Das lange Kleid eng am Körper hatte sie sich an die Mauern des Turmes gedrückt, den Blick starr hinab gesenkt. Im Hof stand eine Reitertruppe, Krieger in Kettenhemd und Surcotte, den Helm in der Hand. Und einer von ihnen sah zu ihr hinauf, das dunkle Haar in nassen Strähnen unter der Kettenhaube, der Blick hoffnungslos. Der Regen glitt über sein Gesicht, ließ die jungen Züge verschwimmen... ich kenne dich und habe dich nicht vergessen, nie werde ich dich vergessen...
Ein Krachen ließ sie auffahren. Das Fenster stand offen und ein Regenschwall klebte die Vorhänge an die Scheiben. Sie stand auf und zog die Stoffbahnen zurück. Im Garten bewegte sich etwas, es schien, als laufe jemand zwischen den Bäumen hindurch und etwas blitzte auf. Sie drückte sich an den Rand des Fensterrahmens, um ungesehen beobachten zu können, was dort vor sich ging. Eine Gestalt teilte das hohe Gras; verschwand hinter einer Mauer. Dann, nach einer Weile, kehrte sie zurück, blieb unbeweglich unter ihrem Fenster stehen und schien hinaufzustarren. Sie konnte nicht viel erkennen, doch ein Schauer jagte ihr den Rücken herunter.
Erst im Morgengrauen war Marie eingeschlafen, um wenige Stunden später die Augen erneut einem grauen Himmel zu öffnen. Es regnete nicht mehr, doch der Sturm schien sich verstärkt zu haben, die Wolken jagten wie im Zeitraffer über den Garten, in dem sich gestern nacht jene seltsame Gestalt herumgetrieben hatte.
Neugierig trat sie ans Fenster und betrachtete die Wildnis, die nun aus den nächtlichen Schemen ins matte Tageslicht herausgetreten war. Von hier oben ließ sich die Ordnung erkennen, der der Garten einstmals unterworfen gewesen sein mußte, die Unterteilung in Rosenbeete, Kräutergärtlein, Wege, Obstwiesen und eine Laube. Bemooste Mäuerchen aus Naturstein grenzten die Wiese mit dem hohen Gras vom Obstgarten und einem kleinen Viereck ab, was sie für einen lauschigen Lustgarten hielt. Die Mauer, die jenen umgab, war höher und von Geißblatt und Efeu bedeckt, so als hüte sie ein größeres Geheimnis als die dicht ineinander verwobenen Obstbäume, deren Früchte seltsam unwirklich zu ihr heraufleuchteten. Blätter wirbelten durch das wilde Grünbraun, segelten auf die stumpfglänzende Oberfläche eines Teiches. Sie wandte sich ab, duschte im angrenzenden Bad mit den flauschigen rosa Handtüchern und packte ihre Tasche.
Als sie herunterkam, erfüllte der Duft von Tee und Toast die Halle. Sie stellte ihre Tasche neben dem Treppenabsatz ab und sah in die Küche, in der sie einen gedeckten Tisch vorfand, dessen krönenden Mittelpunkt die Kanne mit dem Steinbockdeckel darstellte. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, daß Jacques de Villandraut sich weder hier noch in der Bibliothek befand, setzte sie sich zögernd an den Eichentisch und nahm ein stilles Frühstück ein.
Sie hatte damit gerechnet, daß Jacques im Laufe der Mahlzeit auftauchen würde, aber als sie sich die letzte Tasse Tee eingeschenkt hatte und noch immer keine Spur von ihrem Gastgeber zu sehen war, erhob sie sich, räumte das Geschirr unschlüssig zusammen und begann, nach ihm zu suchen.
Konnte sie abreisen, ohne sich verabschiedet zu haben? Sollte sie eine ihr angemessen erscheinende Summe auf dem Küchentisch hinterlassen? Nach der Unterhaltung am gestrigen Abend hatte sie das Gefühl, ihm einen persönlichen Abschied schuldig zu sein. Sie hatten über Dinge gesprochen, die weit über das hinausgegangen waren, was zwei Fremde einander anvertrauten, und sie verspürte den Wunsch, sich für einen Abend zu bedanken, der ihr ein Stück der Traurigkeit genommen hatte, die nun seit einigen Wochen ihr ständiger Begleiter gewesen war.
Er befand sich in keinem der unteren Räume und sie wußte nicht, wie vermessen es war, die oberen zu betreten. Aber es gab ja noch den Garten...
Am Ende der Halle entdeckte sie eine Tür, die offensichtlich hinausführte. Sie stellte fest, wie warm es war, schwerblütig wie ein erdiger Wein, der Himmel grau, doch alle anderen Dinge von zwielichtiger Farbigkeit. Der Wind ergriff ihr Haar und das Tuch, das sie sich um die Schultern geschlungen hatte. Und als sie die ersten Schritte durch das Gras machte, war es ihr, als verlasse sie die reale Welt, als betrete sie einen verwunschenen Garten, in dem die seltsam grobgehauenen Statuen aus heimischem Gestein ihre zeitzerfressenen Fratzen unter schamvollen Efeuschleiern versteckten, in dem die Disteln wie hohe, schlanke Wächter standen, die Stacheln ausgefahren, wispernd im Wind. Sie entdeckte einen Trampelpfad, der an einer Eiche vorbei zu einer der Mauern führte, die das Viereck umgaben. Und als sie an der Mauer mit dem im Winde raschelnden Geißblatt angelangt war, sah sie ihn.
Hinter einem rostigen schmiedeeisernen Törchen, das stets offen zu stehen schien, fest verankert in Erde, Gras und Efeu, erstreckte sich das Innere des Vierecks - kein lauschiges Liebesnest, kein Rosengarten, sondern ein Friedhof. Über eine leichte Anhöhe standen verteilt uralte Kreuze und Grabplatten, unter denen Generationen von Villandrauts ruhen mochten.
Jacques stand vor einem moosüberwucherten Steinkreuz inmitten der anderen, mit dem Rücken zu ihr und offensichtlich so sehr in Gedanken versunken, daß er nichts um sich herum wahrzunehmen schien. Er bildete in seiner Unbeweglichkeit einen seltsamen Gegensatz zum stürmischen Wetter, das seine Locken zerwühlte, die Blütenblätter der Rosen, welche er in der Hand hielt, ergriff und über den Boden wirbeln ließ... Sie hatte sich an die Mauer gedrückt, eigenartig berührt von diesem Anblick, und unfähig, diesen beinahe magischen Moment durch einen Laut zu zerstören.
Doch dann, plötzlich, wandte er den Kopf, als hätte er etwas gehört, was es nicht zu hören gab, oder als fühlte er, daß jemand ihn beobachtete. Sie schlich an der Mauer entlang und eilte über das Gras zurück ins Haus. Kaum war sie jedoch in der Halle angelangt, als die Gartentür aufgerissen wurde und auch Jacques hereintrat, begleitet von einer Windbö und einem Schwarm rostroter Blätter. Seine aufgewühlte Miene glitt von ihm ab, sobald er seinen Gast bemerkte und löste sich in die sanften Züge und das zurückhaltende Lächeln auf, das sie vom Vorabend kannte.
»Guten Morgen!« rief er aus und strich seine Locken glatt.
»Guten Morgen... gut, daß ich Sie noch treffe, ich wollte gerade aufbrechen.«
»Aufbrechen, so... wohin denn, wenn ich fragen darf?« meinte er zerstreut und ging an ihr vorbei auf die Küche zu.
»Nun, ich wollte wie gesagt nach Bordeaux, aber um ehrlich zu sein, weiß ich eigentlich nicht recht, ob ich Lust auf eine Großstadt habe...«
»Villandraut ist ein sehr guter Ausgangspunkt für viele Ausflüge.« erwähnte Jacques wie beiläufig, während er sich einen Tee in der Küche eingoß.
Sollte sie zugeben, daß genau dies ihr Plan gewesen war? Daß sie das Gefühl hatte, die Burg, der Garten, der Friedhof und nicht zuletzt die eigenartige Person des letzten de Villandrauts selbst bargen genug Geheimnisse, um einen längeren Aufenthalt zu rechtfertigen? Daß sie neugierig war, vielleicht sogar ein wenig verzaubert? Daß es ihr schien, als hätte der verbotene Turm der Burgruine sie zu ihrem ganz persönlichen hundertjährigen Schlaf gebracht, einem sanften Schlaf, in dem sie träumte und vergaß und gleichzeitig wacher schien als je zuvor?
»Sie haben schon gefrühstückt?«
»Ja. Wäre es denn in Ordnung, wenn ich noch etwas hierbleiben würde? Und wie lange könnte ich denn bleiben?«
»Solange Sie wollen. Ich erwarte keine weiteren Gäste. Und wenn es Sie interessiert, erzähle ich Ihnen heute abend mehr von meinen Nachforschungen.«
»Es interessiert mich sogar sehr.«
Der Morgen verging und sie sah Jacques nicht mehr. Sie stieg ins Auto und fuhr durch vergessene Dörfer, die im Bannkreis des Dornröschenfluches zu stehen schienen. Moosbedeckte Steinmauern, zerfressene Heilige an windschiefen Kirchen, Bauern mit braunen, knotigen Gesichtern. Eine lauernde Stille unter dem Herbstmond.
Sie erreichte Villandraut in der Dämmerung, als nur noch ein paar Blätter über den Marktplatz krochen. Vor der Burg hielt sie kurz und betrachtete die trutzige Silhouette vor dem Abendhimmel. Krähen kreuzten das Bild, eine Frau saß auf einer Bank und wiegte ihr Kind im Wagen. Sie lächelte und schien vor sich hinzusummen. Doch irgendetwas an ihrem Lächeln war nicht gut. Als sie zu ihr herübersah, spürte Marie, wie ihre Nackenhaare sich aufstellten. Sie startete den Motor und fuhr mit einem Satz los, weiter zum großen, hellerleuchteten Haus, der Silberkanne mit dem Steinbockdeckel. Zu Jacques de Villandraut.
Sie aßen zusammen und anschließend tranken sie einen Kaffee in der Bibliothek. Nachdem sie ihm von ihrem Ausflug berichtet hatte, erzählte er ihr von seinen Nachforschungen über Chrétien de Chêne, den Ritter, der in der Chronik der Villandrauts eine große Rolle gespielt haben mußte. Den Ritter, in den Adèlaïde sich verliebt und den ihr Bruder in den sicheren Tod geschickt hatte.
»Der Name taucht immer wieder auf. Er war ein armer Verwandter, von Adel, aber ohne Geld. So ähnlich wie ich, würde ich sagen.« erklärte er mit einem amüsierten, aber etwas abwesenden Lächeln. »Es gibt auch ein Märchen, in dem sein Name auftaucht. Ich habe aber inzwischen herausgefunden, daß der Held darin absolut nichts mit dem historischen Chrétien zu tun hat. Das Ganze basiert wohl auf einem Schreibfehler.«
»Ein Märchen? Wollen Sie es nicht erzählen?«
Wieder der amüsierte Blick, hinter dem jedoch eine unergründliche, beinahe feierliche Stille lag. »Wenn Sie gerne Märchen hören... es heißt »Die Glasprinzessin« - ich hab's in einem Buch über Legenden aus der Bretagne gefunden.«
Sie zog ihre Beine hoch auf den Sessel und blickte erwartungsvoll zu Jacques herüber, der ein mit keltischen Ornamenten verziertes Buch heranzog, einige Zeit darin blätterte, dann eine Brille aufsetzte und schließlich aufsah, ihren Blick erwiderte, kurz, unsicher, so als wolle er sich noch einmal vergewissern, ob das Interesse an der Geschichte noch immer bestand. Dann aber begann er einfach, vorzulesen, mit ruhiger, sanfter Stimme.
»In einer Zeit, in der es für junge adlige Damen in legendären Gegenden üblich war, sich in Waldeslichtungen zu begeben, um dort auf den Ritter zu warten, der ihnen bestimmt war, machten sich an einem besonders schönen Frühlingstag einige kichernde Prinzessinnen in ihren schönsten Gewändern auf den Weg zum Feenspiegel. Dieses stille Gewässer befand sich mitten im Walde von Brocéliande, von dem man sich zu jener Zeit Geheimnisvolles zu erzählen wußte. Sie passierten den in einen Baum gehexten Merlin, machten einen ehrerbietigen Knicks und flüsterten sich einige Vermutungen darüber zu, wie es nur dazu kommen konnte, daß eine Fee den großen Zauberer überlisten konnte. Schließlich hatten sie den See erreicht und verteilten sich sogleich in großen Abständen an seinem Ufer. Eine Jede warf nun ein kleines Leinenbeutelchen ins spiegelglatte Wasser, in welchem sich ein ganz spezielles Gemisch befand, das jedes Mädchen selbst zusammengestellt hatte: Die Blume, die ihr besonders am Herzen lag, das Farbpulver ihrer Lieblingsfarbe, eine Haarlocke und manches andere. Kaum aber hatten sie die Beutelchen in den Tiefen versenkt, als sie sich auch schon aufgeregt einander Zeichen machten und sich neugierig am Ufer niederließen, um einen Blick in den Feenspiegel zu werfen. Denn hier erschien, ganz verschwommen zuerst, dann immer klarer werdend, das Bild ihres jeweiligen zukünftigen Gemahls. Natürlich waren es allesamt Ritter von edelstem Geblüt und tapferster Gesinnung, dennoch unterschieden sie sich alle voneinander, wie es Männer nur voneinander können. Der Eine war groß und dunkel, der Andere eher zart und rothaarig, ganz entsprechend den Ingredienzen der Beutelchen, welche die jungen Damen zusammengestellt hatten.
Manch eine lächelte dem Zauberbild erwartungsvoll zu oder klatschte erfreut in die Hände. Dann begaben sich alle in einem lustig schnatternden Zug durch den Wald, um sich in den Lichtungen zu verteilen. Man ließ sich im hohen Farnkraut nieder und wand Kränze, um nur ja nicht so zu wirken, als hätte man nichts anderes zu tun als vorbeireitende Ritter zu erwarten.
Bald schon erschien der erste Ritter, ein junger Mann names Gawain, der nach dem berühmten Ritter der Tafelrunde benannt worden war. Langsam ritt er durch den Sonnenschein, der sein rotblondes langes Haar schimmern ließ wie flüssiges Kupfer. Als er die ihm erwählte Prinzessin erblickte (denn auch die Ritter mußten sich der Schicksalsmacht beugen), stieg er vom Pferd und verneigte sich. Dann zog er das Schwert, küßte es und legte es der Dame zu Füßen. Er reichte ihr die Hand und hob sie aufs Pferd. So geschah es nach und nach mit allen Prinzessinnen im Wald. Einzelne Ritter durchkämmten die Lichtungen und erblickten mit klopfendem Herzen die schönen jungen Damen inmitten blühender Gräser, die ihnen scheinbar vollkommen überrascht zulächelten.
Nur eine der Prinzessinnen mußte vergebens auf ihren Ritter warten. Die Nächte wurden bereits kühler und auch die letzte ihrer Kameradinnen hatte die Hand ihres Prinzen ergriffen, um mit ihm davonzureiten. Der Wald war leer, die Blätter fielen. Unruhig warf sie den Kranz beiseite, an dem sie so lange geflochten hatte, daß die Frühlingsblumen darin verwelkt waren, und hielt nach jeder Richtung Ausschau. Doch nirgendwo war ein Pferd, geschweige denn ein Reiter, zu erkennen. Müde nahm sie wieder im Farnkraut Platz, das sich bereits braun färbte, und wand einen weiteren Kranz aus Nüssen und harten Zweigen. Doch auch als dieser fertig war und die ersten Schneeflocken vom Himmel fielen, war von ihrem Ritter keine Spur zu entdecken. Sie zog den Umhang fester um sich und versuchte, sich an den Feenspiegel zu erinnern, an den kühnen Recken mit blondem Haar und frostblauen Augen, dessen Haut so hell war wie die Wintersonne. Und dann schien es ihr, als verlasse sie die Hoffnung jeden Tag ein bißchen mehr und als fühle sie sich schwächer und schwächer. Jede Anstrengung ermüdete sie und gleichzeitig hatte das angespannte Warten und Horchen ihre Sinne so geschärft, daß jedes Rascheln im Blattwerk ihr wie das Wüten des Windes im Geäst der riesigen Bäume erschien und das wirkliche Wüten wie das Tosen der Brandung. Sie begann, die Sprache der Tiere zu erlernen und sich mit den Bäumen zu unterhalten. Ihre Knochen schienen ihren Körper nicht mehr tragen zu wollen und auch ihre Haut wurde so dünn, daß jeder Grashalm sie schmerzte. So saß sie dort, empfindlicher und ausgezehrter mit jedem Tag, bis sie zu zerbrechlichstem Glas erstarrte. Der Wind, der aus den nordischen Ländern kam, betrachtete sie voller Mitleid und beschloß, sie von ihrem Leid zu erlösen. So jagte der Wind in einer Nacht, der letzten des Winters, durch die Lichtung, und ließ die Prinzessin in tausend Scherben zerspringen.
Am nächsten Morgen aber kam der Frühling und mit ihm ein junger Ritter, der in wildem Gallopp durch den Wald sprengte. Es war der junge Chrétien de Chêne, auf der Suche nach seiner jungen Dame. Wohl hatte er sich sehr verspätet, doch dies nicht aus böser Absicht; vieles war ihm dazwischengetreten, manch ein Kampf und manch ein Abenteuer, bis er den Weg nach Brocéliande fortsetzen konnte. Doch schließlich hatte ihn die Ungeduld, die Auserwählte zu treffen, jeden Störenfried und jeden Drachen beiseite liegen lassen. Verzweifelt durchkämmte er den Wald und jede Lichtung, doch ohne Erfolg. Schließlich fand er auch die Lichtung, in der seine Dame gewartet hatte, und stieg vom Pferd ab. Sein Fuß traf auf eine der Scherben und er hob sie mit gerunzelter Stirn auf. Es wollte ihm nicht recht einleuchten, was dieser Glasscherbenhaufen mitten im Wald bedeuten mochte, aber da es ein besonders schönes, schillerndes Glas war, sammelte er es auf und füllte es in einen Beutel, den er am Gürtel trug. Dann schwang er sich erneut aufs Pferd und setzte seine Suche fort, den ganzen Frühling und manch einen Winter lang.«
Als Jacques so plötzlich aufhörte, das Buch zuklappte, die Brille abnahm und sich streckte, war es, als würde sie aus einem warmen, behaglichen Zugabteil geworfen, in dem sie durch die Dämmerung gefahren war, einem unbekannten Ziel entgegen. Noch eine Geschichte über das Warten, dachte sie. Aber die Glasprinzessin konnte dabei nicht einmal schlafen. Was hätte sie in das Leinenbeutelchen getan? Etwas Wind, einen kleinen Granit, grau und fest wie die Mauern einer Burg?
Sie unterhielten sich noch lange über Chrétien de Chêne, sowohl den Ritter aus dem Märchen als auch den historischen, dann ging sie in ihr Zimmer hoch. Doch sie konnte nicht schlafen. Immer wieder glitt ihr Blick zum Fenster, hinter dem der Garten lag. Die Szene vom Morgen vermischte sich mit den Geschichten über den verarmten Ritter und dem Regen, der nun wieder gegen die Scheiben klatschte, zu einem traumähnlichen Zustand. Sie sah Jacques mit zerzausten Haaren vor dem Grab stehen, in der Hand keine Rosen, sondern ein Schwert, von dem das Blut tropfte...
Prinzessinnen lagen in blaugrünen Gemächern, die langen Ärmel mottenzerfressen, das Haar stumpf und grau. Wo bist du? Ich höre den Regen aus den Gräsern steigen und denke an dich, dich in deinen Kleidern aus Taugespinst, dem wogenden Blättermantel. Wo bist du, hast du den Turm verlassen, bist in die Täler hinabgestiegen, hinab zu den Menschen, die ihre Gesichter abwenden, wenn sie etwas erblicken, das so vollkommen ist wie du? Hinter den Wolken lebt ein Wille, mein Wille, der nie sterben wird, meine Liebe, die dein Atem nährt, mein Traum, der dein Tag ist...
Oder war es doch ein Traum, hatte sie geschlafen? Auf jeden Fall schien sie plötzlich erwacht zu sein, in etwa zu derselben Zeit wie gestern nacht. Es war heller als gestern, der Regen hatte aufgehört und das Mondlicht warf ein milchiges Netz über den Garten. Und dort, an genau demselben Platz wie gestern, stand erneut die Gestalt und sah zu ihrem Fenster auf... es war ein Mann, doch seine Züge waren von hier aus nicht zu erkennen. Wohl aber seine Kleidung, die aus einem Kettenhemd und einer Surcotte bestand. Eine Kettenhaube verbarg das Haar. Für einen Moment war es, als blicke sie in einen Traum, eine andere Welt, den Traum im Traum. Ihr Herz klopfte ihr bis zum Halse und sie fühlte sich wie gelähmt. Einige Minuten stand sie nur da, beinahe ebenso starr wie der Ritter, dann gaben ihre Beine zitternd unter ihr nach und sie setzte sich aufs Bett. Er war fort, als sie einen erneuten Blick hinaus wagte.
Marie stand früh auf, früher, als sie es gewöhnlich tat, und trat in einen verregneten Garten hinaus. Schon nach wenigen Schritten durch das hohe Gras waren ihre Schuhe naß. Es gab keine Abdrücke, die erkennen ließen, ob jemand letzte Nacht hier gestanden hatte, aber das Netz aus Regentropfen war zerrissen, Grashalme zur Seite gebogen. Die Spur führte jedoch nicht zum Friedhof, sondern in die Tiefe des Obstgartens, in dem sie nach wenigen Schritten die von Rosen umwucherte Gartenlaube erkannte und darin einen Mann im Regenmantel. Sein Haar war naß und der Regen tropfte ihm in den Kragen, auf die Bank, den Boden und das, was er in der Hand hielt, einen Brief, dessen tintene Zeilen langsam zu einem großen, wortlosen Blau zerflossen. Er schien auf etwas zu warten, das er selber nicht verstand, Wahrheit oder nur das Fallen einer weiteren Frucht? Es duftete nach vergorenen Äpfeln und vergorenen Träumen, deren Fruchtfleisch vom Regen zerteilt und verwässert wurde. Sie hielt den Atem an, so als könne er dieses Bild zerplatzen lassen wie eine Luftblase. Aber Jacques schien sie dennoch bemerkt zu haben, er sah ganz unerwartet auf und schien einige Zeit zu brauchen, um von da zurückzukehren, wo er gewesen war.
»Guten Morgen....« brachte er leise hervor, um sich dann über das regennasse Gesicht zu fahren und lauter fortzufahren: »Sie sind früh auf.«
»Sie auch.«
»Ja...«
»Ich habe in den beiden letzten Nächten jemanden im Garten gesehen. Waren das Sie?«
»Ich? Wie kommen Sie darauf?« fragte er und sah ihr verwundert entgegen. Sie konnte nicht sagen, ob diese Verwunderung echt war.
»Es war auf jeden Fall ein Mann. In einem Kettenhemd.«
Nun schien doch eine Veränderung in seine Züge zu treten, die Furche zwischen seinen Brauen, die sowieso schon recht tief war, vertiefte sich noch mehr. Aber er sagte nichts, erhob sich nur und schob den aufgeweichten Brief in die Jackentasche.
»Kommen Sie mit frühstücken?«
Sein Ton war leicht und freundlich, die Schwermut von ihm abgefallen wie der Regen, der ihm vom Mantel perlte. Es war offensichtlich, daß er nicht über den Mann im Garten reden wollte, vermutlich, weil er diesen nächtlichen Besucher nur allzu gut kannte. Warum er nachts im Kettenhemd durch den Garten strich, würde sie vielleicht ein anderes Mal herausbekommen.
Beim Frühstück schien er unbeschwert und hilfsbereit; er machte ihr Vorschläge für Ausflüge und versorgte sie mit Karten und Prospekten, die allerdings nicht gerade auf dem neuesten Stand zu sein schienen. Sie wagte nicht, ihn zu fragen, ob er sie nicht einfach begleiten wollte. Was machte er den ganzen Tag? Verließ er nie das Haus? Er stand am Hauseingang und sah ihr nach, als sie losfuhr, einem weiteren graubewolkten Septembertag entgegen.
Aber sie war kaum aus der Ausfahrt heraus, als sie wieder zurückfuhr und mit einer plötzlichen Entschlossenheit vor dem Eingang parkte. Sie klingelte und schlug dem überraschten Gastgeber eine gemeinsame Tour vor. Ihre Idee verwunderte sie selbst, doch alles andere war ihr plötzlich unnatürlich erschienen.
Jacques zögerte wie ein Schmetterling, der den schützenden Kokon bei Frost verlassen soll. Seine grauen Augen blickten in einer Mischung aus Verwunderung und Belustigung, so wie beim ersten Mal, als er ihr die Tür geöffnet hatte, doch dahinter lag eine tiefe Verunsicherung.
»Das ist ein sehr verlockendes Angebot,« begann er schließlich und sie wußte, daß er sich dagegen entschieden hatte. Ob seine Angst ihr galt oder der Welt außerhalb dieser Mauern, die ihr wohl nicht zu unrecht wie Klostermauern erschienen waren, vermochte sie nicht zu sagen. Doch ihre eigene Scheu löste sich in diesem Moment auf und hinterließ ein fades Gefühl der Enttäuschung und seltsamerweise auch des Zorns. Noch bevor er weiterreden konnte, hatte sie verstehend genickt, sich umgedreht und war zum Auto gegangen. Jacques stand wie versteinert; es schien ihm offenbar unmöglich, in irgendeiner Form spontan zu reagieren. So sah er ihr nur zu, wie sie den Motor anließ und ihm flüchtig zuwinkte, um eilig die Zufahrt zu verlassen.
Als sie auf der Hauptstraße war, atmete sie auf und kurbelte die Scheibe herunter, um ihre heißen Wangen zu kühlen. Sie hatte plötzlich das Gefühl, sich dumm benommen und dramatischer auf eine Situation reagiert zu haben, als es nötig gewesen wäre. Ohne es recht zu merken, trat sie aufs Gaspedal und raste die Landstraße entlang, vorbei an den groben Natursteinmauern, den Eichen und Feldern, über die der Wind jagte. Ein Schwarm Krähen begleitete sie ein Stück, um dann abzudrehen, sich in den Wind fallen zu lassen, auf einer entlaubten Esche Platz zu nehmen.
Schließlich hielt sie an einem Feldweg, stieg aus und marschierte, die Hände in den Taschen, in das unbekannte Dorf, dessen Kirche aus der Ferne gelockt hatte, ein kauernder Bau, grau vor Alter und abgefressen von Autoabgasen. Als sie davorstand, den Blick auf die verstümmelten Fabeltiere geheftet, welche sich um den Eingang schlängelten, krächzte urplötzlich eine Stimme in ihr Ohr.
»Wollen Sie hinein?«
Sie fuhr zusammen und blickte sich um, wo ein verwachsenes Männlein stand und ein Schlüsselbund aus der Cordjackentasche fummelte. Sie nickte nur und folgte dem Wurzelmännlein zum Portal und schließlich in die Kirche. Der Geruch, der ihr entströmte, war kälter als der Tod. Ein schwarzer, unebener Boden, dunkle, schwere Bänke und eine Reihe von Sarkophagen und Grabplatten zierten diesen Ort der Freude. Eine Kanzel ragte in den Raum, zersetzt von Holzwürmern und dem Gift spätromanischer Predigten. Durch keines der Fenster drang mehr als nur die Ahnung von Tageslicht, der Welt außerhalb dieser klammen, entsagungsvollen Gruft. Sie drehte sich um, hatte es eilig, diesen Ort möglichst schnell wieder zu verlassen.
Draußen holte sie tief Luft. Sie mußte an Jacques denken, an den Mann, der im Kettenhemd unter ihrem Fenster stand, den Mann, der inmitten eines verregneten Obstgartens saß und einen aufgeweichten Brief in der Hand hielt. Der regungslos vor einem Grab stand, das sich in seinem eigenen Garten befand. War er verrückt? Oder nur exzentrisch? Und zählte es überhaupt? Sie fühlte eine Beklemmung, die ihr die Brust zuschnürte.
Zurück in Villandraut begegnete ihr erneut die Frau mit dem Kinderwagen. Sie schob ihr Kind mit jenem selbstvergessenen Lächeln die Straße hinunter, das das Blut zu Eis gefrieren ließ. Der Wagen war verhangen von Deckchen und Vorhängen, ein eigener kleiner Kokon der totalen Sicherheit, eine Trutzburg gegen Licht und Luft.
Jacques empfing sie kühl. Er saß in der Bibliothek, die Brille auf der Nase, den Kopf über eins seiner Bücher gebeugt, und wies sie darauf hin, daß sie sich gern selbst einen Tee in der Küche zubereiten könne, ohne dabei aufzusehen.
Sie kochte eine Kanne und wollte sich dann sogleich mit ihrer Tasse nach oben zurückziehen, als Jacques in die Halle trat und sie bat, doch später noch auf ein Glas Wein in die Bibliothek zu kommen. Sie war leicht erstaunt, konnte aber auch ein gewisses Gefühl der Freude nicht unterdrücken und willigte sofort ein, um einige Stunden später wieder in der Halle zu stehen. Als Jacques sie bemerkte, sprang er von seinem Stuhl hinter dem Schreibtisch auf und erklärte in leicht entschuldigendem Ton:
»Es tut mir leid, ich war heute nachmittag vielleicht etwas unhöflich... Im gesellschaftlichen Umgang bin ich wohl ziemlich aus der Übung. Ich hoffe nicht, daß... Sie bleiben doch trotzdem noch?«
Seine Unsicherheit versetzte ihr einen Stich. »Ja, ich würde sehr gern bleiben, aber wenn ich stören sollte, dann sagen Sie es mir bitte einfach.«
»Aber nein! Bitte sehen Sie einem Einsiedler seine Launen nach.«
Sie war zur Türschwelle getreten und er ließ sie lächelnd an sich vorbei in den Raum ein. Der Wein, den er ihr einschenkte, war sehr gut und hob die Stimmung merklich. Sie beschloß, diese nicht wieder zu zerstören, indem sie auf den Vorfall vor ihrem Ausflug zurückkam. Es würde besser sein, diesen ungeschickten und mißlungenen Versuch, aus Jacques mehr als einen Gastgeber zu machen, zu vergessen.
»Welches Märchen lesen Sie mir heute vor?« fragte sie schließlich.
Er sah kurz zu ihr herüber, langte nach einem Hefter mit verschiedenen Zetteln und hielt dann plötzlich inne.
»Eigentlich...« begann er zögernd und legte das Heft langsam wieder auf den Schreibtisch, »würde ich lieber etwas von Ihnen hören. Ich meine, falls das nicht zu -« Leicht verlegen brach er ab, sodaß Marie eilig erwiderte:
»Aber nein, keineswegs.« Sie lächelte und ließ sich auf dem Sessel hinter sich nieder. »Was wollen Sie hören? Ich fürchte nur, es wird nicht halb so spannend und märchenhaft wie Ihre Geschichten sein.«
»Dafür ist es vielleicht wenigstens wahr.« gab er nur etwas lapidar zurück.
»Ich dachte, ich hätte Sie bereits genug gelangweilt mit den wahren Anekdoten aus meinem Leben.«
Erneut fragte sie sich, wie sie ihm gleich am ersten Abend von ihrem mißlungenen Liebesleben hatte erzählen können.
»Glauben Sie mir, es gehört einiges dazu, um mich zu langweilen. An einem Ort wie diesem, wo der Gesang eines bislang unbekannten Vogels im Garten oder das Aufschlagen der ersten Seite eines neuen Buches bereits den Höhepunkt des Tages darstellt, können Sie nicht viel falsch machen. Also, stellen Sie mich einfach auf die Probe.«
Sie erwiderte seinen Blick mit einem Lächeln und stellte zu ihrer Irritation fest, daß sie so nervös war, als ginge es darum, ihn mindestens ebenso gut mit ihrer Erzählung zu unterhalten, wie er es mit seiner getan hatte. Und sie wußte, daß das von vornherein aussichtslos war. »Naja, es gibt nicht viel zu erzählen.« begann sie denn auch wenig einfallsreich.
»Was haben Sie heute gemacht? Auf Ihrem Ausflug?« wollte er wissen und ließ sich in den anderen Sessel fallen. Und sie berichtete ihm von der Kirche, dem Männlein und der schaurigen Atmosphäre des Gebäudes, vom Kinderwagen in Villandraut und dem seltsamen Gefühl, das sie an diesem Ort beschlich. Jacques nippte an seinem Wein und hörte zu. Und wie von selbst ertappte Marie sich erneut dabei, Dinge aus ihrem Leben zu erzählen, die sie sich noch nicht einmal selbst so klar vor Augen geführt hatte, wie sie es nun in Worten vor Jacques tat.
Sie erzählte ihm von ihrem ziellosen Leben, das jeder Beständigkeit und Richtung entbehrte, jeglichen Sinnes, der es zusammenhielt. Von ihrem Traum, ewig unterwegs zu sein, die Welt zu bereisen und ihre Wunder zu sehen, der Angst vor und gleichzeitigen Sehnsucht nach Wurzeln, die sie irgendwo, irgendwann daran erinnern würden, wer sie wirklich war, dazu zwingen würden, innezuhalten in ihrer Flucht und sich dem zu stellen, was sie war und niemals sein konnte.
Und während sie erzählte, ferne Länder beschrieb und ihre ständigen Wechsel der Arbeitsplätze, die zahlreichen Umzüge von jener Stadt in diese, sah sie ihm an, daß dies für ihn mindestens genauso aus dem Märchenreich zu entstammen schien wie seine Geschichten, genauso fern von seinem Leben lag wie seine Ritterlegenden von ihrem.
»Tja, ich sagte ja, daß die Anekdoten aus meinem Leben nicht viel hergeben.« schloß sie dann und nahm einen Schluck Wein, plötzlich besorgt, daß sie sein Mißfallen erregt hatte, daß er enttäuscht, desillusioniert, was immer sein mochte und einen Grund finden würde, seinen Gast möglichst schnell loszuwerden. Und offenbar hatte sie bereits genug Wein getrunken, um in dieser Möglichkeit eine beinahe unerträgliche Tragik zu sehen.
»Stimmt.« kommentierte Jacques nur und schien damit ihre Befürchtung zu bestätigen. Er goß sich noch etwas Wein ein, bemerkte dann ihr leeres Glas und füllte auch dieses nach einem abwartenden Blick wieder auf. Dann jedoch fuhr er fort: »Ihre Erzählungen geben leider nicht genug her, um mich zu langweilen – ganz im Gegenteil. Ich muß Sie enttäuschen.«
»Dann hatten Sie wohl recht damit, daß Sie hart im Nehmen sind, wenn es um das Langweilen geht.« erwiderte sie lachend.
»Glauben Sie, jemand, der so lebt wie ich, hat das Recht, das Leben irgendeines Anderen zu beurteilen oder gar als langweilig zu betrachten?«
In seiner Stimme schwang eine Resignation, die sie nachdenklich und sonderbarerweise auch wieder ein wenig wütend machte.
»Ich glaube irgendwie nicht, daß Ihr Leben so ereignislos ist, wie Sie es darstellen.« erklärte sie und dachte an den Auftritt des Ritters und all die anderen seltsamen Vorgänge im Hause, deren Urheber ihr Gastgeber zu sein schien. Auch sie schwenkte nun ihr Glas, hielt es sich vor die Augen und betrachtete das verschwommene Bild eines Jacques mit vom Alkohol erhitzten Wangen und unordentlichem Haar. Es war erstaunlich, wie wenig sie ihn einordnen konnte.
Als er sie nachahmte und ebenfalls durch das Weinglas betrachtete, mußten sie lachen und senkten die Gläser. Ihre Blicke trafen sich erneut, doch ohne den Schutz der Gläser fühlte sie sich nackt und ausgeliefert. Ihm schien es nicht anders zu gehen, denn er senkte eilig den Blick.
Plötzlich schien sie wieder nüchtern zu sein. Sie stand auf und wanderte im Zimmer umher, machte Bemerkungen zu diesem oder jenem Gegenstand. Dann entdeckte sie ein Regal, auf dem verschiedene bunte Glasscherben lagen. Sie mußte an die Glasprinzessin denken und fragte sich, ob er hoffte, daß diese Glasstücke sich eines Tages in eine Prinzessin verwandeln würden. Sie mußte gehen, konnte, wollte nicht. Trotzdem stellte sie ihr Glas mit einer entschiedenen Geste ab und verabschiedete sich für die Nacht.
In dieser Nacht schien der Ritter nicht vor ihrem Fenster zu stehen. Sie fühlte beinahe Enttäuschung und sank in ihre Kissen zurück. Es war schon nach drei; jetzt würde nichts mehr passieren.
Als sie die Augen aufschlug, wußte sie, daß jemand im Zimmer war. Sie sah zur Tür und spürte, wie ihr Magen sich verkrampfte: Vor ihrem Bett stand der Ritter aus dem Garten, bewegungslos wie immer. Doch nun konnte sie ihn erkennen, die grauen Augen, welche in tiefen Schatten ruhten, das leicht gelockte Haar unter der Haube. Sein Blick schien gänzlich aus einer anderen Welt zu kommen und es fröstelte sie. Die blasse Haut, das zerschlissene Tuch der Surcotte ließen ihn wie einen auferstandenen Toten erscheinen. Sie konnte sich nicht bewegen, nicht rufen oder fortlaufen. Was hätte es auch gebracht? Sie spürte, daß ihr in jedem Fall keine Gefahr drohte. Er würde dort stehen und irgendwann gehen, vielleicht würde er sich auch in Luft auflösen... sie schloß die Augen, doch als sie sie öffnete, war er noch immer da, mit jenem ernsten Blick, hinter dem sich Abgründe aus Verzweiflung zu befinden schienen. Wieder fühlte sie sich an die Kirche erinnert, die wurmzerfressene Kanzel, die Fenster ohne Licht...





























