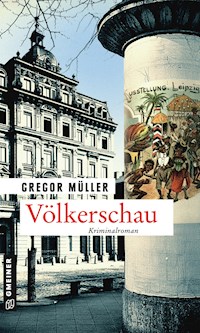
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Joseph Kreiser
- Sprache: Deutsch
Leipzig 1898: Eigentlich hat Kriminalcommissar Joseph Kreiser mit dem verschwundenen Afrikaner aus dem Zoo schon alle Hände voll zu tun. Dieser sollte dort in der Völkerschau zu bestaunen sein. Doch dann wird kurz darauf die Leiche des Industriellen Carl August Georgi im Lindenauer Vergnügungslokal Charlottenhof gefunden. Besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen? In einer von Umbruch geprägten Zeit sucht Kreiser nach Antworten und stößt dabei auf menschliche Abgründe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gregor Müller
Völkerschau
Kriminalroman
Zum Buch
Tod im Charlottenhof Kriminalcommissar Kreiser kann sich vor Aufgaben kaum retten: Aus der Leipziger Völkerschau verschwindet ein Afrikaner und kurz darauf bekommt er seinen ersten Mordfall zugewiesen. Bei dem Toten handelt es sich um den stadtbekannten Fabrikanten Carl August Georgi. Mit dem kauzigen Staatsanwalt Möbius und der scharfsinnigen Vermieterin Hannah an seiner Seite macht er sich auf die Jagd nach dem Mörder. Schnell gerät der vermisste Afrikaner unter Verdacht. Ist er geflohen, um einer Strafe zu entgehen? Als klar wird, dass Georgi bei seinen Mitmenschen alles andere als beliebt war, steigt die Zahl der Verdächtigen. Die Suche nach dem Täter führt Kreiser in die stark hierarchisierte Gesellschaft einer Großstadt während der Hochindustrialisierung. Zwischen sozialem Wandel und technischem Fortschritt versuchen die Ermittler zu ergründen, wen hier die Schuld trifft …
Gregor Müller wurde 1987 in Lichtenstein geboren und lebt seit über 10 Jahren in Leipzig. Nach einem Studium der Klassischen Archäologie arbeitete er mehrere Jahre als Rechercheur und Redaktionsassistent für Fernsehdokumentationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. „Völkerschau“ ist seine erste Publikation und der Auftakt zu einer Reihe historischer Kriminalromane, die in Leipzig an der Wende zum 20. Jahrhundert angesiedelt sind.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Teresa Storkenmaier
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z0008413.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_roe-neg_0006580_014_Bild_Litfaßsäule_mit_Filmplakaten_für_%22Ernst_Thä.jpg; Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inventarnummer PK 3003
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6370-9
Widmung
Für Hilenia
PROLOG
Er stand unter einer alten Linde in der Sonne und schaute einem Vogelschwarm hinterher, der aufgeschreckt davonflatterte. Sein Blick folgte den Vögeln, bis sie im Süden hinter den Bäumen verschwanden, und er fragte sich, ob sie wohl in seine Heimat fliegen würden, die er schon so lange nicht mehr gesehen hatte. Ein bitteres Lächeln legte sich um seine Lippen, als er daran dachte, dass in dieser Richtung nicht nur seine Vergangenheit, sondern auch seine Zukunft lag. Einzig wenige Kilometer trennten ihn von dem Mann, den er nun schon fast sein ganzes Leben lang suchte, und er bildete sich ein, ihn beinahe riechen zu können.
Den Gedanken als widersinnig verwerfend, wandte er sich schließlich ab und ließ seinen Blick fast wehmütig über seine Leidensgenossen gleiten, die eingeschüchtert vor ihren Hütten standen. Noch vor wenigen Monaten hatte er keinen aus der Gruppe gekannt, doch im Laufe ihrer Reise waren sie ihm zu Brüdern und Schwestern geworden. Zu Beginn hatten sie viel untereinander gestritten und gekämpft. Schnell hatten sie begriffen, dass sie ihr gemeinsames Ziel nur erreichen würden, wenn sie zusammenhielten und sich gegenseitig unterstützten. Noch bevor sie ein Viertel der Wegstrecke hinter sich gebracht hatten, war die Gruppe auf weniger als die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Jetzt waren nur noch die Stärksten und Zähesten übrig: Neben den Männern umfasste die Gemeinschaft nur noch eine einzige Alte, wenige Frauen und eine Handvoll Kinder.
Er hatte nicht zu den Stärksten gehört, aber dennoch überlebt. Allein seine Willenskraft hatte es ihm erlaubt, sich so lange zu behaupten und weit genug zu kommen, dass sein Ziel nun fast zum Greifen nah war. Sein ganzes Leben hatte er darauf hingearbeitet, in dieses Land, diese Stadt zu kommen. Um in Leipzig den zu treffen, der dafür verantwortlich war, dass er nun hier unter der Linde stand.
Als er den großen hageren Mann in dem weißen Leinenanzug seinen Namen rufen hörte, kam er schlagartig ins Hier und Jetzt zurück. An dem wutverzerrten Gesicht des Weißen sah er sofort, dass er heute Abend Schläge würde ertragen müssen. Anscheinend hatte er wieder einmal nicht gleich gehört, dass sein Name aufgerufen worden war.
Er wusste, dass er die Züchtigungen aushalten würde, dass sie seinen Willen unmöglich brechen konnten, nicht so kurz vor dem Ziel. Aber da er für sein Vorhaben körperlich in bester Verfassung sein musste, musste er sich hüten, den Hageren nicht noch weiter zu reizen. Keinesfalls durfte er es so weit kommen lassen wie vor einem Jahr, als er fast unter dem Stock krepiert war.
Also drehte er sich um und ging bedrohlich auf den Zaun zu, vor dem die dumpfe Masse stand, die ihn mit offenen Mündern angaffte. Breitbeinig stellte er sich vor den Zaun und ging ganz leicht in die Hocke, als wollte er mit einem Satz darüberspringen. Er biss die Zähne zusammen, bis sie knirschten, und riss die Augen so weit auf, dass sie schmerzten.
Er stierte zurück, musterte den Mob auf der anderen Seite und kostete den Augenblick aus. Immerhin würde es das letzte Mal sein, dass ihn ein Zaun von den davorstehenden Menschen trennte. Morgen früh würde er in ihre Welt abtauchen und unbekannt darin herumschleichen, bis er sein Ziel erreicht hatte. Die Schmach, angestarrt und beschimpft zu werden, würde er sicherlich nicht vermissen. Aber sie war in den letzten Monaten ein so großer Bestandteil seines Alltags geworden, dass er sich ein Leben ohne kaum noch vorstellen konnte.
Je länger er den wilden Blick auf die Gruppe gerichtet hielt, umso mehr stachen einzelne Gesichter daraus hervor. Hier und da sah er ein Augenpaar, das ihm keine Sekunde standhalten konnte und fast sofort beschämt auswich. Weitaus häufiger waren jedoch die, die jede seiner Bewegungen mit kaltem, emotionslosem Interesse verfolgten.
Und dann gab es da die Gruppe der Gesichter, die ihn mit unverhohlener Abscheu anstarrte. Sie stellte nicht die Mehrheit dar, aber sie war groß genug, um ihm Schauer über den Rücken zu jagen. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn und jede Faser seines Körpers schrie förmlich danach, sich endlich abzuwenden, wegzurennen und irgendwo zu verstecken.
Er dachte an eine Geschichte zurück, die er als Kind einmal gehört hatte: Ein mächtiger Krieger seines Stammes hatte behauptet, einen Löwen allein mit wildem Blick und Gebrüll in die Flucht geschlagen zu haben. Also riss er selbst die Augen noch weiter auf und bleckte seine Zähne. Die Muskeln, die seine Kiefer aufeinanderdrückten, waren bis zum Bersten gespannt und mit einem einzigen markerschütternden Schrei schleuderte er seinen Betrachtern ihren Hass zurück über den Zaun.
Wie jedes Mal verfehlte der Auftritt seine Wirkung nicht. Die Menge wich erschrocken zurück und eine zierliche Dame fiel auf der Stelle in Ohnmacht. Während sie von den einfühlsameren Herren umsorgt wurde, rückten die gewaltbereiten unter Drohgebärden noch näher an den Zaun heran.
Gerade als die Stimmung zu kippen drohte, sprang der Hagere zwischen ihn und die tobende Menge und sprach besänftigend auf sie ein. »Meine Herren, bitte beruhigen Sie sich. Es wird Ihnen nicht gelingen, diesen Wilden zu bändigen, da er dem Tier doch näher steht als dem Menschen. Was sagen Sie, Sie glauben nicht, dass er eine Bestie ist? Dann will ich es Ihnen beweisen! Betrachten wir einmal ganz genau sein Gebaren.«
Der Hagere drehte sich um und gab ihm ein für die anderen unsichtbares Zeichen. Er beendete seinen wilden Schrei, streckte den Rücken durch und sog die Luft durch die Nase, als würde er eine Witterung aufnehmen. Dann lief er an dem Zaun auf und ab, wobei er die Arme wild an seinen Seiten schwingen ließ – eine Bewegung, die er sich von den Menschenaffen im Nachbargehege abgeschaut hatte.
Plötzlich traf ihn etwas Nasses im Gesicht: Einer der noch immer aufgebrachten Besucher hatte ihn angespuckt!
Unwillkürlich bohrten sich seine Füße in den Boden und er hielt in seinen Bewegungen inne. Die Anspannung kroch seine Beine herauf und nahm seinen ganzen Körper in Besitz. Unter Mühen kämpfte er den Instinkt zurückzuspucken schnell wieder hinunter. Er konnte es sich nicht erlauben, den Hageren zu sehr zu verärgern – nicht heute. Also vergaß er seinen Stolz, machte auf dem Absatz kehrt und ging an dem Zaun zurück, als hätte er die Beleidigung nicht bemerkt.
Ein letztes Mal ließ er sich noch demütigen, bevor er morgen ein neues Leben beginnen würde. Ein Leben, in dem er nicht mehr Mawuwe, der wilde Neger vom Stamm der Ewe sein würde, den man im Zoologischen Garten begaffen konnte, sondern ein richtiger Mensch. Alles, was ihn davon noch trennte, war ein einziges Treffen.
Er hatte keine Ahnung, wie sehr er sich irrte.
EINS – Montag, 12.09.1898
Ein sanfter Abendwind ließ die spitzengesäumten Gardinen an dem geöffneten Fenster in der Leipziger Dufourstraße leise rascheln. Hannah Faber hob ihren Kopf und spürte der Wärme der Sonne auf ihrem Gesicht nach. Mit ihren Fingerspitzen strich sie Zeile für Zeile über das in ihrem Schoß liegende Buch und versuchte, die Stelle wiederzufinden, an der sie mit dem Lesen innegehalten hatte.
Gerade als ihre Finger über die vertrauten Zeichen glitten, schlug die Standuhr in der Tiefe des Wohnzimmers die Stunde und Hannah zählte die Schläge mit. Sie klappte ihr Buch zusammen, legte es auf einen kleinen Beistelltisch, der neben ihrem bequemen Korbsessel stand, und erhob sich. Mit vorgestreckten Händen tastete sie sich zu dem offenen Fenster, das sie eilig schloss. In wenigen Momenten würden die Kinder der nahe gelegenen Dritten Realschule Unterrichtsschluss haben und lärmend durch die Straßen ziehen.
»Gretchen«, rief Hannah in das Innere der Wohnung und begann, sich umständlich zu ihrem Sessel zurückzutasten. Sie konnte hören, wie die ersten Schulkinder einen Reifen jagend um die Hausecke bogen. Ihr Jauchzen drang immer deutlicher in die Stille des Wohnzimmers ein, die nur von dem Ticken der Uhr akzentuiert wurde.
»Margarete«, wiederholte Hannah, diesmal mit zitternder Stimme.
Ihr Ruf wurde von hektischem Gepolter beantwortet, das sich schnell näherte.
Kurz darauf öffnete Hannahs Dienstmädchen die Tür. »Es tut mir so leid, Fräulein Faber«, entschuldigte sie sich etwas außer Atem. »Ich war gerade die Bettdecken klopfen und da habe ich Sie nicht gehört.«
»Es ist schon gut«, antwortete Hannah erleichtert. »Jetzt bist du ja da. Bitte spiele mir doch ein wenig Musik.«
»Ist es wieder schlimm?«, fragte Gretchen mitfühlend und ging, ohne eine Antwort abzuwarten, zu dem Pianino, das sich an die Wohnzimmerwand schmiegte.
»Das Wetter ist so schön«, seufzte Hannah. »Die Kinder werden wohl kaum zu bändigen gewesen sein.«
Wortlos begann Gretchen, ein ruhiges Klavierstück zu spielen, um ihre Herrin auf andere Gedanken zu bringen. Wann immer Hannah Kinderlachen hörte, fühlte sie sich schmerzhaft in ihre Zeit als Volksschullehrerin zurückversetzt und Musik war oft das Einzige, was sie trösten konnte. Hannahs Eltern waren früh verstorben, ohne ihr eine verlockende Mitgift zu hinterlassen, und da Hannah auch nicht besonders schön gewesen war, hatte sie kaum auf eine gute Partie hoffen können. Ihr Onkel war als ihr Vormund bestimmt worden und hatte entschieden, dass sie das Lehrerinnenseminar besuchen sollte. Der Verdienst als Volksschullehrerin sollte es ihr einmal ermöglichen, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, bis sie irgendwann hoffentlich einen geeigneten Ehemann fand.
Dies gelang ihr auch zunächst ganz gut, zumal der Onkel unerwartet und vor allem kinderlos gestorben war und ihr unter anderem die Wohnung in der Leipziger Südvorstadt hinterlassen hatte, die sie immer noch bewohnte.
Die Zeit als Lehrerin sah Hannah als die glücklichste ihres Lebens an. Nie würde sie das Funkeln in den Kinderaugen vergessen, wenn sie ihnen etwas Neues zeigen konnte. Aber auch die Zeit nach Unterrichtsschluss verging für Hannah wie im Fluge, wenn sie zusammen mit ihren Freundinnen aus dem Lehrerinnenkollegium Konzerte besuchte oder Ausflüge machte.
Doch eine Infektion hatte Hannah zunächst ihr Augenlicht gekostet und später auch ihre Stelle als Lehrerin, die sie als Blinde nicht mehr ausfüllen konnte. Nachdem sie in den Ruhestand versetzt worden war, wurde sie plötzlich wieder von Geldsorgen geplagt.
Um einen Ehemann zu finden, war sie nun endgültig zu alt und außerdem hätte sie das auch noch ihr Ruhegehalt gekostet. Denn selbst im Ruhestand durften Lehrerinnen das einmal abgelegte Zölibat nicht brechen.
Um sich dennoch ein einigermaßen standesgemäßes Leben zu sichern, hatte Hannah sich schließlich gezwungen gesehen, einen Untermieter zu nehmen. Obwohl ihre Wohnung klein war, entschloss sie sich, das sowieso ungenutzte Herrenzimmer zu einem weiteren Schlafzimmer umzubauen und das Dienstbotenzimmer als zweites Bad herzurichten. Dass sie sich neben Esszimmer und Salon auch das Badezimmer mit dem Mitbewohner teilen sollte, ging nun wirklich nicht an.
Als alles so weit war und sie ein Hausmädchen gefunden hatte, das nicht nur bereit war, ab und zu Blindenführer für ihre Herrin zu spielen, sondern auch einen Untermieter zu versorgen, musste sie diesen nur noch finden. Nach langem Suchen war ihre Wahl schließlich auf einen jungen Polizisten gefallen, der einmal einer ihrer besten Schüler gewesen war. Damals hatte sie noch nicht an der Volksschule unterrichtet, sondern war als Privatlehrerin für ein bürgerliches Geschwisterpaar angestellt. Der Junge hatte sich schon früh durch einen regen Geist und erlesene Manieren ausgezeichnet, und das Zusammenleben hatte sich von Anfang an sehr harmonisch gestaltet. Mittlerweile hatte er in der Leipziger Polizei Karriere gemacht und hätte es sich eigentlich längst leisten können, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Aber bisher hatte er noch keine derartigen Anstalten gemacht, was Hannah nur recht war.
Zunächst hatte sie angenommen, dass der Polizist sie verlassen würde, wenn er die geeignete Frau kennenlernen würde, doch mit der Zeit waren ihr immer mehr Zweifel gekommen, ob dies überhaupt seinem Naturell entsprach. Zwar ging er an den Wochenenden hin und wieder aus, aber nie hatte er von einer Herzensdame schwadroniert oder versucht, eine seiner möglichen Bekanntschaften heimlich in sein Zimmer zu schmuggeln. Tatsächlich schien er kaum einen privaten Umgang mit Damen zu pflegen, sein Freundeskreis bestand hauptsächlich aus Männern aller Schichten.
Hannah schrak auf, als sie plötzlich an der Schulter gepackt wurde. Schnell stellte sie jedoch fest, dass es sich nur um ihr Hausmädchen handelte, das versuchte, sie sanft zu wecken. Der Schlaf musste sie übermannt haben, was in letzter Zeit immer häufiger geschah und Hannah vor Augen führte, dass sie nun wohl eine alte Frau war.
Sie ließ sich von Gretchen in das Esszimmer führen, wo ihr ehemaliger Schüler bereits am Tisch saß.
»Einen erlesenen Abend wünsche ich, mein verehrtes Fräulein«, tönte Kriminalcommissar Joseph Kreiser gewohnt fröhlich. Seine Stimme hatte fast immer etwas Ironisch-Leichtes, so als würde er jeden Augenblick erwarten, dass jemand den Vorhang schloss und zugab, dass das Leben doch nur eine Farce war.
»Ihnen das Gleiche, mein lieber Herr Commissar«, erwiderte Hannah. »Ich hoffe, Sie haben nicht zu lange warten müssen. Sie haben sicher einen ganz ordentlichen Hunger, nehme ich an?«
»Den habe ich tatsächlich«, gab Joseph Kreiser zu. »Heute gibt es nämlich eine ganze Menge zu berichten. Aber Sie sind nicht zu spät, ich habe soeben erst abgelegt.«
Hannah ließ sich von ihrem lieben Herrn Commissar, wie sie ihn zu nennen pflegte, nach dem gemeinsamen Abendessen immer jeden Fall, den er gerade untersuchte – mochte er auch noch so unbedeutend und routinemäßig sein –, in allen Details schildern. So hatte sie in den langen einsamen Stunden etwas, um ihre Gedanken zu beschäftigen.
Der Commissar hatte diese Abmachung zu Beginn als Teil des viel zu niedrigen Mietzinses angesehen, aber mit der Zeit schätzen gelernt, nach dem Abendessen die Geschehnisse des Tages noch einmal Revue passieren zu lassen. Mit den Jahren war er ein immer besserer Erzähler geworden und Hannah war es schon mehrmals gelungen, in seinen Schilderungen eines besonders verfahrenen Falles den entscheidenden Hinweis zu entdecken.
Doch da Hannah bei Tisch keine Ablenkung vom Essen billigte, musste er sich noch eine Weile gedulden, bevor er sein Herz ausschütten konnte. Nachdem Gretchen die zu ihrer Zufriedenheit leer geputzten Teller abgeräumt hatte, ließ sich Hannah von ihrem Untermieter aufhelfen und zu ihrem Korbsessel im Wohnzimmer führen.
Der Commissar setzte sich in einen tiefen Ledersessel vor den Kamin und stopfte sich eilig eine Pfeife. Das Pfeiferauchen war eine der wenigen Leidenschaften, denen er sich hingab, und auch diesem Laster frönte er nur abends, wenn er Hannah seinen Tagesbericht gab. Sie erlaubte es, untersagte ihrem Untermieter aber auf das Strengste, in seinem Schlafzimmer zu rauchen.
»Nun, dann fangen wir besser gleich an, heute war ein ausnehmend ereignisreicher Tag«, kündigte Joseph an und paffte seine Pfeife mit einem Streichholz an. »Als ich heute Morgen in mein Büro kam, wartete auf meinem Schreibtisch schon mein erster Fall. Ich sah jedoch gleich, dass es sich wieder einmal um einen reinen Vermisstenfall handelte, was mir die Stimmung gleich zum Anfang der Woche ordentlich vermieste. Sie wissen ja, dass Vermisste entweder irgendwann ihren Rausch ausschlafen und von selbst wiederauftauchen oder tot auf dem Bauch schwimmend in der Elster gefunden werden. Aber diesmal hatte ich mich wohl zu früh geärgert, denn so gewöhnlich war der Fall gar nicht.«
Joseph Kreiser begann seine Erzählung und vor dem geistigen Auge Hannahs erwachte die brodelnde Metropole Leipzig mit all ihren Licht- und Schattenseiten zum Leben. Die Straßenzüge, die der Commissar so geschickt aus dem Dunkel auftauchen ließ, wurden nach und nach von den Menschen bevölkert, die sich jetzt, da in Leipzig Herbstmesse war, zu Massen in der Stadt befanden.
*
Wieder einmal war mir also ein Vermisstenfall zugeteilt worden. Während die beiden anderen Commissare der Leipziger Kriminalpolizei regelmäßig Morde aufklären durften, wurden mir weiter die kleinen Fische hingeworfen. Ich musste mich zwingen, die Anzeige aufmerksam zu lesen, als es mich wie ein Schlag traf. Ich konnte zunächst gar nicht glauben, was ich da sah, und las die Personenbeschreibung des Vermissten noch einmal von Anfang an. Geschlecht: männlich, Alter: ungefähr 20 Jahre, Größe: ein Meter und 85 Zentimeter, Haare: schwarz, kraus, Augenbrauen: schwarz, Augen: braun, Nase: platt, Mund: groß, Angesicht: oval, Statur: schlank, besondere Kennzeichen: Neger!
Ich schaute nach, wer die Anzeige aufgegeben hatte, da ich dachte, es handele sich vielleicht um einen schlechten Scherz. Aber ganz unten auf dem Blatt hatte ein mir gut bekannter Wachtmeister unterzeichnet, dem man nun wirklich keinen ausgeprägten Sinn für Humor nachsagen konnte. Also musste ich zunächst davon ausgehen, dass die Anzeige ernst gemeint war, und las weiter.
Der Vermisste war am Samstag um 22 Uhr das letzte Mal im Zoologischen Garten gesehen worden. Ein gewisser Johannes Klein, der Impresario der Völkerschau, hatte die Anzeige am folgenden Morgen aufgegeben.
Ich selbst habe schon seit Jahren keine Völkerschau mehr besucht, da ich diese Zurschaustellung ganzer Dörfer als grausam empfinde. In Hamburg habe ich einmal eine Gruppe Eskimos vom Polarkreis gesehen, die trotz der sommerlichen Augusthitze in ihren Pelzmänteln eine Jagd nachstellen mussten. Die armen Kerle haben so geschwitzt, dass mir die Lust an den Völkerschauen für immer vergangen ist. Aus der Zeitung wusste ich, dass im Zoologischen Garten momentan eine Volksgruppe von der Sklavenküste ausgestellt wird, die zu jeder vollen Stunde ein großes Schauspiel mit Kriegstanz und Hetzjagd darbietet.
Die einzige logische Erklärung, die sich anbot, war also, dass es sich bei dem Vermissten um einen Angehörigen dieser Völkerschau handeln musste.
Um sicherzugehen, wollte ich aber trotzdem noch den unterzeichnenden Wachtmeister zur Rede stellen. Da die Wachablösung bevorstand, eilte ich zur Tür, die ich mit Elan öffnete. Dahinter prallte ich gegen die massive Gestalt des Polizeirates Laakmann, die fast die gesamte Breite des Türrahmens ausfüllte.
»Kreiser, können Sie denn jetzt schon Gedanken lesen?«, versuchte Laakmann seine Überraschung mit einem verzweifelten Scherz zu überspielen.
Ich gab zu, dass ich die Tür weniger aus seherischen Fähigkeiten heraus geöffnet hatte als aus dem Willen, mehr über den Vermissten zu erfahren.
»Ah ja, der geflohene Neger aus der Völkerschau.« Der Polizeirat winkte ab. »Ein kurioser Fall. Aber er dürfte sich – wie die meisten Vermisstenfälle – wohl sozusagen von selbst lösen. Wie lange kann ein Neger in Leipzig schon verschwunden bleiben?« Er lachte heiser, bevor er fortfuhr: »Aber das wird jetzt warten müssen. Es ist ja gerade fürchterlich viel los: Commissar Fincke jagt die Trickbetrüger vom Naschmarkt, und Noël ist den Pelzdieben vom Brühl auf der Spur. Ja und damit bleiben dann nur noch Sie übrig.«
Mein Unverständnis musste sich inzwischen auch auf meinem Gesicht abbilden, doch der Polizeirat nahm es nicht als solches wahr und fuhr hektisch fort: »Das sollten Sie als ganz große Chance begreifen, nicht bloß als Herausforderung! Ich verspreche Ihnen: Wenn Sie diesen Fall lösen, wird sich das sehr positiv auf Ihre Karriere auswirken.«
»Sehr geehrter Herr Polizeirat«, schaffte ich es endlich, ihn in einer der seltenen Atempausen zu unterbrechen. »Ich versichere Ihnen, mit dem gebotenen Eifer an die von Ihnen angedeutete Aufgabe heranzugehen. Jedoch würde ich gern erst einmal erfahren, um was genau es sich dabei handelt.«
»Ach, habe ich das noch gar nicht erwähnt? Bitte entschuldigen Sie, ich habe mich so gefreut, Ihnen diese Chance geben zu können.«
Laakmann log natürlich, doch ich sah es ihm nach. Zu lange hatte ich schon darauf gewartet, die nun folgenden Worte zu vernehmen: »Es geht um Mord. Mord im Charlottenhof!«
*
»Mord?«, fragte Hannah überrascht. »Mein lieber Commissar, das ist ja wirklich eine große Ehre, dass man Ihnen – endlich auch einmal – einen Mordfall zugeteilt hat. Darauf müssen wir doch anstoßen!«
Joseph klopfte seine Pfeife aus und ging gehorsam zu dem kleinen Serviertischchen, wo einige Flaschen bereitstanden. Nach ein wenig Klirren und Glucksen hielt Hannah ein bauchiges Glas in der Hand, aus dem ein deutliches Pflaumenaroma strömte.
Nachdem Hannah ein paar wohlwollende Worte verloren hatte, stieß der Commissar sein Glas an das ihre, und für einen Moment herrschte Stille, als beide den feinen Holznoten nachspürten, die der Kognak in ihren Mündern entfaltete.
»Jetzt muss ich Sie aber bitten, mich nicht noch länger auf die Folter zu spannen«, verlangte Hannah schließlich. »Bitte, fahren Sie mit Ihrer Erzählung fort.«
Der Commissar setzte sich wieder an seinen angestammten Platz und stopfte sich eine zweite Pfeife, während er seine Gedanken sammelte.
»Nun gut«, sagte er schließlich. »Nachdem ich den vermissten Afrikaner zur Fahndung ausgeschrieben hatte, ließ ich mich nach Lindenau fahren, um die Untersuchungen in meinem ersten Mordfall aufzunehmen.«
*
Eine seltsame Stille lag über dem Charlottenhof, den ich bisher nur voller Leben und Leidenschaft kannte. Von der Straße konnte ich lediglich eine Horde Kinder hören, die einem Wasserwagen hinterhertobte, der den Staub auf der Kirchstraße besprengte. Zögernd betrat ich das Etablissement durch das angelehnte Eisentor.
Der gekieste Hauptweg führte mich vorbei an geschlossenen Verkaufsständen, einem Musikpavillon und verschiedenen Wirtschaftsgebäuden bis zu dem flachen Teich, der die Hauptattraktion des Charlottenhofs war. Früher hatte dieser Teich allein der Eisproduktion im Winter gedient: Wenn der See zugefroren war, wurden die Eisblöcke mit großen Sägen herausgeschnitten und bis zum Sommer im Kühlhaus auf der Insel in der Mitte des Teiches gelagert.
Damit der Teich aber auch bei warmer Witterung Profit abwarf, hatte der findige Eiswerkbesitzer vor ein paar Jahren zuerst ein Restaurant vor das Kühlhaus gebaut und das Gelände dann um eine Attraktion nach der anderen erweitert. So waren im Laufe der Jahre am Ufer unter anderem die Fassade eines Schlosses, eine Konzertbühne und ein Bootsanleger entstanden.
Als ich mich dem Wasser näherte, sah ich an dem Bootsanleger die vertrauten Uniformfarben eines Schutzmannes, der sich sehr konzentriert mit einem jungen Arbeiter unterhielt.
Etwas abseits stand eine voluminöse Gestalt mit einem imposanten Schnauzbart, die auf einen hochgewachsenen, modisch gekleideten Mann einredete. Der Dicke verstummte, als er meiner gewahr wurde, und der Große wandte sich zu mir um. Zu meiner Freude erkannte ich, dass es sich um den Staatsanwalt Gustav Möbius handelte. Er beendete hastig das Gespräch mit dem Dicken und kam fröhlich lächelnd auf mich zu.
Sein vorheriger Gesprächspartner schaute sich verdutzt um und erkor dann den Schutzmann zum nächsten Opfer seines Redeschwalls.
»Soso«, tönte Möbius, als wir uns am Rande des Teiches trafen. Sein lockerer Gang und die noch lockerere Umgangsart erstaunten mich immer wieder und ich fragte mich nicht zum ersten Mal, wie er hatte Staatsanwalt werden können, und vor allem, wie er es blieb. »Ist der alte Laakmann also endlich über den gewaltigen Umfang seines Schattens gesprungen und hat Ihnen einen Fall gegeben, der Ihren Intellekt auch verdient?«
»Was für eine angenehme Überraschung!«, exklamierte ich und streckte dem Staatsanwalt meine Hand zur Begrüßung entgegen. »Ich wusste gar nicht, dass Sie die Ermittlungen leiten. Laakmann – dem Sie übrigens ein wenig mehr Respekt entgegenbringen sollten – hat gar nichts davon gesagt.«
»Weil es ihm nicht passt, wenn wir zusammenarbeiten«, versetzte Möbius mit einem verschwörerischen Funkeln in den Augen. »Er hat Angst, dass Sie ihm mit meiner Hilfe den Posten streitig machen, bevor er sich zur Ruhe setzen kann.«
»Na, dann sollten wir besser gleich anfangen, so weit ist der Polizeirat ja nicht mehr vom Ruhestand entfernt«, scherzte ich.
»Sie können es wohl kaum erwarten?«, fragte Möbius ernst. »Aber ist schon recht, der erste Mord ist etwas Besonderes, da will ich Sie nicht länger zurückhalten. Der Tote liegt auf einer kleinen Insel auf der anderen Seite des Teiches, der Leichenbeschauer ist bereits bei ihm.«
»Verstehe«, sagte ich und zog mein kleines Notizbuch aus der Jackentasche. »Und wer ist das da drüben auf dem Bootsanleger?«
»Schutzmann Welm spricht gerade mit dem Wirt – dem korpulenten Herrn dort drüben –, der den Besitzer des Geländes vertritt, und einem gewissen Norbert Henne – das ist der Jüngere: Er arbeitet als Aushilfskraft im Charlottenhof.«
»Wer hat die Leiche gefunden?«, fragte ich, während ich mir hastig Notizen machte.
»Henne ist auf den Toten gestoßen, als er das Restaurant für die Öffnung vorbereiten wollte. Er hat dann die Polizei und leider auch gleich den Wirt gerufen. Beide haben nicht viel Brauchbares zu sagen, ich habe bereits informell mit ihnen gesprochen. Ich würde daher vorschlagen, wir nehmen zuerst die Leiche in Augenschein.«
»Gut, da kann mir Schutzmann Welm auch gleich Bericht erstatten, während er uns zu dem Toten rudert.«
Ich stellte mich kurz den beiden Angestellten des Restaurants vor und wies den Schutzmann an, eines der an dem Anleger vertäuten Boote vorzubereiten.
Kurz darauf sank ich neben dem Staatsanwalt auf die Achterducht, während der Hilfsarbeiter Henne das Boot abmachte und ihm einen kräftigen Schubs gab, der uns weit über das fast kristallblaue Wasser des Teiches brachte.
Welm ließ die Ruder umständlich zu Wasser. Er war anscheinend kein erfahrener Ruderer und brachte das Boot immer wieder ins Schlingern. Wieder und wieder musste er sich umdrehen, um die Richtung neu zu taxieren.
Da ich Mitleid mit dem jungen Schutzmann hatte, versuchte ich, ihn mit einem Gespräch über unsere Untersuchung abzulenken. »Sie waren anscheinend als Erster von der Truppe vor Ort. Berichten Sie uns doch bitte, was Sie wissen.«
»Gern, Herr Kriminalcommissar«, antwortete Welm atemlos zwischen den Paddelschlägen, die jetzt schon gleichmäßiger und zielgerichteter kamen. »Heute Morgen um kurz nach halb acht war ich auf Streife und lief gerade vom Lindenauer Markt zur Kirche runter, als aus der Wettiner Straße Norbert Henne gelaufen kam und laut nach der Polizei rief.«
Während er sprach, kamen wir der Brücke zwischen der Insel mit dem Kühlhaus und dem Festland immer näher. Sie war eine der Hauptattraktionen des Charlottenhofes und wie das Gesicht eines asiatischen Drachen mit zum tödlichen Biss aufgerissenem Maul gestaltet. Mit jedem Paddelschlag verstärkte sich in mir das Gefühl, dass uns die handtellergroßen schwarzen Augen angriffslustig entgegenstarrten. Doch anstatt der Vernunft zu folgen und Reißaus zu nehmen, steuerten wir genau auf den Verderben bringenden Schlund des Drachen zu.
»Ich folgte Henne unverzüglich hierher zum Charlottenhof, wo er mir vom Ufer aus etwas am Grund des Teiches zeigte«, riss mich Welm aus meinen Gedanken. »Es bestand kein Zweifel, dass wir auf einen Toten blickten. Zuerst dachte ich, dass es sich wohl um einen Unfall oder vielleicht Selbstmord handelt. Ich ließ mich von Henne zu der Leiche rudern. Unter größten Anstrengungen schafften wir es vermittels einer langen Stange, den Toten zum Ufer der Insel zu manövrieren, da diese viel näher lag als das Festland. Als wir die Leiche an Land gezogen hatten, sah ich jedoch gleich, dass er solch schwere Verletzungen an Gesicht und Händen trug, dass Selbstmord und Unfall ausgeschlossen waren. Ich ließ also unverzüglich die Finger von ihm, schnappte mir Henne, und wir ruderten zum Kühlhaus, wo ich mittels des Telefonanschlusses Meldung machte.«
Der Schutzmann verstummte, da wir an der Drachenbrücke angekommen waren und er sich auf die schmale Durchfahrt konzentrieren musste. Während wir von dem asiatischen Drachen mit den rot bemalten Lippen und den spitzen weißen Zähnen verschlungen wurden, schob sich plötzlich eine einzelne dunkle Wolke vor die Sonne. Die Dunkelheit, die durch die Brückendurchfahrt noch verstärkt wurde, machte meinen Augen schwer zu schaffen. Trotz der angenehmen spätsommerlichen Wärme lief mir ein Schauer über den Rücken. Möbius schien mein Unbehagen zu bemerken und legte mir beruhigend die Hand auf die Schulter. Mit der anderen deutete er nach vorn, wo die Öffnung des kurzen Tunnels den Blick auf eine kleine Insel freigab, die kaum größer war als die Krone der Linde, die sie zierte. Unter dem Baum stand ein Mann in einem weißen Kittel und machte sich Notizen auf einem Schreibblock.
Plötzlich zog die Wolke, die den Himmel verdunkelt hatte, weiter und ich wurde von der grellen Sonne geblendet, die ihre Strahlen durch das Geäst der Sommerlinde wie gelbe Finger nach unserem Boot ausstreckte.
*
Joseph legte seine erloschene Pfeife beiseite und schenkte sich noch einen Kognak ein. Hannah, die spürte, wie er die Flasche in ihre Richtung schwenkte, schüttelte den Kopf und lehnte dankend ab.
»So was«, seufzte sie. »Dass Sie bis nach Lindenau fahren mussten … Ich habe Lindenau das letzte Mal gesehen, als es noch ein Dorf war, das das Glück hatte, an die Pferdebahn angebunden zu sein.«
»Seitdem ist viel geschehen«, gab der Commissar einfühlsam zurück. »Die Straßenbahn ist mittlerweile in ganz Leipzig elektrifiziert, das ehemalige Dorf nur noch ein Stadtteil von Leipzig und die Bevölkerungszahlen sind explodiert.«
»Es kommt einem so vor, als ob jeden Tag mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit in unsere Stadt kommen«, seufzte Hannah. »Und die produzierten Waren verlassen Leipzig wieder, während die Menschen in den Fabriken gefangen bleiben, um bis zum Ende ihres kurzen Lebens in Dreck und Elend zu schuften.«
»Na, ganz so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht«, widersprach Joseph. »Gerade Lindenau ist ja nicht nur Arbeiterviertel, sondern für ganz Leipzig ein beliebtes Ausflugsziel! Der Charlottenhof ist nur eine der Attraktionen und schon nächstes Jahr wird mit dem Palmengarten eine weitere ihre Pforte öffnen.«
»Aber für wen denn?«, hielt die alte Dame dagegen. »Wie man hört, soll der Zugang nur den besseren Schichten vorbehalten sein, während sich die Arbeiter an den Fenstern die Nasen platt drücken mögen!«
Joseph kannte seine Vermieterin gut genug, um zu wissen, dass es keinen Zweck hatte zu widersprechen, und setzte stattdessen seine Erzählung fort.
»Also, wo war ich stehen geblieben?«, fragte er, als er sich in seinen Sessel zurücksinken ließ. »Ach richtig, wir ruderten also zu der Insel, auf der neben dem Toten und dem untersuchenden Arzt nur noch wenig Platz war.«
*
Als sich der Kiel des Ruderbootes mit einem Knirschen in das steinige Ufer bohrte, wies ich den Schutzmann an, im Boot zu bleiben und es abfahrtbereit zu halten.
Der Leichenbeschauer hatte sich aufgerichtet und verfolgte unsere Ankunft mit ernstem Gesichtsausdruck.





























