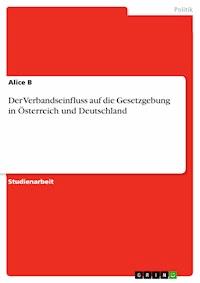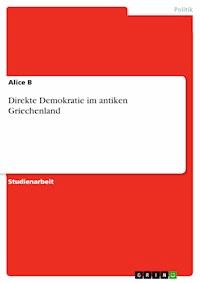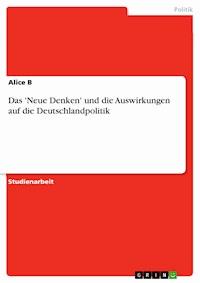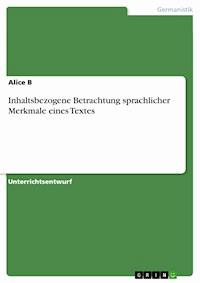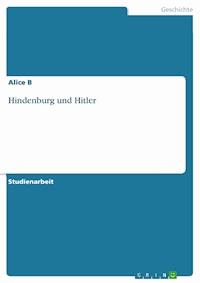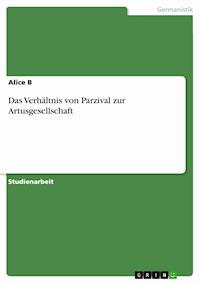Volksgericht und Volksversammlung im demokratischen Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr. E-Book
Alice B
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, Note: 1,0, Universität Mannheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Frauen waren im antiken Griechenland nicht rechtsmündig, d.h., sie durften sich vor Gericht nicht selbst verteidigen und mussten sich von einem Vormund vertreten lassen. Frauen war eine politische Beteiligung untersagt. Ebenso konnten die Zeugenaussagen von Sklaven nur verwendet werden, wenn sie unter Folter erfolgten. Das Urteil in Gerichtsprozessen fällten erloste Bürger, ohne jegliche juristische Ausbildung.Aus unserer heutigen Sicht fällt es schwer, das Rechts- und Demokratieverständnis der Antike nachzuvollziehen, denn wir setzten unser heutiges politisches System wie auch unser Rechtssystem auf einen höheren Sockel als das der Antike. Aber besteht dazu überhaupt Anlass? Wir haben größtenteils nur Grundkenntnisse über die athenische Verfassung, wissen nichts über die Motive einiger Verfahrensweisen. Diese Arbeit hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Zusammenhänge der einzelnen Institutionen im antiken Athen - besonders der Volksversammlung und der Volksgerichte - aufzuzeigen, um das Verständnis über die athenische Verfassung zu stärken. Anhand der Erläuterungen über das demokratische Athen soll es möglich sein, eine Gerichtsrede (zum Beispiel die Rede gegen die Stiefmutter) zu verstehen. Zudem möchte die Arbeit versuchen, Unterschiede bzw. Zusammenhänge zu modernen demokratischen Verfassungen zu finden. Inwiefern beruht die Praxis der Schöffengerichte in Deutschland oder die Geschworenengerichte in den USA auf den athenischen Geschworenengerichten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Universität Mannheim
Philosophische Fakultät
Lehrstuhl für Alte Geschichte
Volksversammlung und Volksgericht im demokratischen Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr.
Wissenschaftliche Arbeit im Fach Geschichte vorgelegt von:
Page 3
Page 4
Page 4
I. Einleitung
Frauen waren im antiken Griechenland nicht rechtsmündig, d.h., sie durften sich vor Gericht nicht selbst verteidigen und mussten sich von einem Vormund vertreten lassen. Frauen war eine politische Beteiligung untersagt. Ebenso konnten die Zeugenaussagen von Sklaven nur verwendet werden, wenn sie unter Folter erfolgten. Das Urteil in Gerichtsprozessen fällten erloste Bürger, ohne jegliche juristische Ausbildung.
Aus unserer heutigen Sicht fällt es schwer, das Rechts- und Demokratieverständnis der Antike nachzuvollziehen, denn wir setzten unser heutiges politisches System wie auch unser Rechtssystem auf einen höheren Sockel als das der Antike. Aber besteht dazu überhaupt Anlass? Wir haben größtenteils nur Grundkenntnisse über die athenische Verfassung, wissen nichts über die Motive einiger Verfahrensweisen. Diese Arbeit hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Zusammenhänge der einzelnen Institutionen im antiken Athen - besonders der Volksversammlung und der Volksgerichteaufzuzeigen, um das Verständnis über die athenische Verfassung zu stärken. An-hand der Erläuterungen über das demokratische Athen soll es möglich sein, eine Gerichtsrede (zum Beispiel die Rede gegen die Stiefmutter) zu verstehen. Zudem möchte die Arbeit versuchen, Unterschiede bzw. Zusammenhänge zu modernen demokratischen Verfassungen zu finden. Inwiefern beruht die Praxis der Schöffengerichte in Deutschland oder die Geschworenengerichte in den USA auf den athenischen Geschworenengerichten?
Hierbei muss man sich vergegenwärtigen, dass sich das Demokratieverständnis der Antike und das der Gegenwart unterscheiden. Der Begriff Demokratie taucht zum ersten Mal bei Herodot1auf und bedeutet die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Die Vorzüge der Demokratie seien die Besetzung aller Ämter durch Los, die Rechenschaftspflicht der Amtsträger und die Pflicht, alle Beschlüsse der Gesamtheit vorzulegen.2Nach Platon3ist eine Verfassung demokratisch, wenn in ihr die Armen die
1Herodot, Sohn des Lyxes, wurde nicht lange vor 480 v. Chr. (vielleicht 484) in Halikarnass geboren.
Im Zusammenhang mit dem Versuch, den Tyrannen Lygdamis zu stürzen, floh Herodot nach Samos.
Heimgekehrt, beteiligte sich Herodot am Sturze des Tyrannen. Sein Werk (neun Bücher) behandelt
die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Persern und Griechen von den Anfängen bis zur Schlacht
von Platää. Vgl. Walter Pötscher 1979: Herodotos, Sp. 1099f. In: Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike
in fünf Bänden, Bd. 2. Hrsg. von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer, München: DTV, Sp. 1099 - 1103
2Günther Bien 1972: Demokratie, Sp. 50. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2, hrsg.
von Joachim Ritter, Basel, Stuttgart: Schwabe & Co Verlag, Sp. 50 - 51
Page 5
Ämter besitzen bzw. die Oberherrschaft ausüben. Dabei gibt es in dieser Verfassung zwei Hauptmerkmale: Die Besetzung der Ämter durch Los und das Prinzip, nach dem jeder lebt, wie er leben will.4
Aristoteles5entwarf ein Sechs-Verfassungs-Schema durch die Kombination des numerischen Prinzips des zahlenmäßigen Verhältnisses der Regierenden zu den Regierten mit dem normativen der Intention der Herrschaftsausübung.6Für Aristoteles war die Demokratie als politische Ordnungsform eine entartete Form der Politie. Das heißt, Demokratie war eine Herrschaft der Vielen mit Rücksicht auf den Nutzen der Regierenden. Demnach war für Aristoteles die Demokratie kein erstrebenswertes Ideal.
Heute bezeichnen wir eine Staatsform als Demokratie, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Die Regierung wird nach allgemeinen, freien und geheimen Wahlen direkt oder indirekt vom Volk für eine bestimmte Zeitdauer gewählt. Bei der Ausübung der ihr anvertrauten Macht wird die Regierung durch das Volk oder durch die von ihm befugten Organe kontrolliert. Alle Handlungen des Staates müssen mit der Mehrheit des Volkswillens sowie mit der Verfassung übereinstimmen. Ausgehend von der Gleichheit aller Bürger, hat der Staat die Menschen- und Bürgerrechte als Grundrechte des Bürgers zu achten, zu gewährleisten und zu schützen. Ferner erwarten wir nach unseren heutigen Demokratievorstellungen, dass in einer Demokratie Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gerichte, eine wirksame Opposition als Alternative zur Regierung sowie Meinungs-, Presse- und Organisationsfreiheit vorhanden sind.7
Sowohl bei der Betrachtung des antiken Rechtssystems als auch bei den übrigen Institutionen sei darauf hingewiesen, dass die athenische Verfassung ein hypothetisches Gebilde darstellt, das auf inhomogenen Quellen aufgebaut ist. In einigen Bereichen steht uns heute allerdings ein dichtes Informationsnetz zur Verfügung. Das, was wir heute über Athen wissen, wissen wir aus Gerichtsreden, Bodenfunden und die Papyrusfunde, die die Schrift „Über den Staat der Athener" von Aristoteles ent-
3Platon,Sohn des Ariston von Athen, entstammte einer vornehmen Familie Athens. Er lebte von
428/27 bis 349/48. Platon war Schüler Sokrates`, er gründete etwa 387 v. Chr. eine Akademie in
Athen.
4vgl. Andreas Milios-Nikolaou 1986: Die Beteiligung der Bürger an der öffentlichen Verwaltung Athens
zur Zeit des Perikles. Frankfurt am Main, Bern, New York: Land (= Europäische Hochschulschriften,
Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften; Bd. 290), S. 13
5Aristoteles, Sohn des Nikomachos, in Stageira 384 v. Chr. geboren, 322. v. Chr. gestorben.
Griechischer Philosoph und Mitglied der Akademie Platons.
6Bien 1972: Sp. 50
7vgl. Bernd Guggenberger 1991: Demokratie/Demokratietheorie, S. 70f. In: Wörterbuch Staat und
Politik, hrsg von Dieter Nohlen, München: Pieper, S. 70 - 79
Page 6
hielten. Ebenso sind historische Quellen mit Bedacht zu lesen, da die Autoren meistens eine Intention übermitteln wollten. So versuchten die Redner einer Gerichtsrede beispielsweise die Laienrichter, die über das Urteil entschieden, für sich zu gewinnen. Allerdings kann man aus einer Gerichtsrede auch viele Dinge über die athenischen Institutionen und Verfahrensweisen erfahren. So auch in der Rede gegen die Stiefmutter. Diese Quelle bietet ein erkenntnisreiches Bild der Lebenswelt im antiken Athen und zeigt den Aufbau einer Gerichtsrede. Die Quelle „Die Rede gegen die Stiefmutter" von Antiphon verfasst, stammt aus den Jahren zwischen 420 und 411 v. Chr.
Die Arbeit beginnt mit den Reformen Kleisthenes’. In dem Kapitel Bürger-Nichtbürger wird die Frage thematisiert, wer überhaupt an der Politik teilnehmen durfte. Das dritte Kapitel widmet sich den wichtigsten athenischen Institutionen - Rat der 500, Volksversammlung und Volksgericht. Danach werden die Logographen und Sykophanten charakterisiert. Im 5. Kapitel wird ein genauerer Blick auf den Ablauf eines Gerichtsprozesses geworfen. Darauf wird die politische Bedeutung der Volksgerichte erläutert. Im siebten Kapitel werden die Aufgaben der Magistrate für die Institutionen dargestellt. Das achte Kapitel dient der Zusammenfassung. Anschließend findet sich die schon erwähnte Quelle. Im zehnten Kapitel finden sich Erläuterungen zur antiken Rhetorik. Im Schlusskapitel wird auf die in der Einleitung aufgeworfenen Fragen wieder eingegangen.
Zu dem Thema dieser Arbeit gibt es eine Fülle an Büchern und Aufsätzen. Hervorzuheben sind an dieser Stelle „Die Athenische Demokratie im Zeitalter des Demosthenes“ von Mogens Herman Hansen sowie „Die athenische Demokratie“ von Jochen Bleicken. Beide Werke liefern einen umfassenden Überblick über das demokratische Athen.
Page 7
II. Hauptteil
1. Die Reformen Kleisthenes’ als Ausgangslage für die Entwicklung der
Demokratie
Kleisthenes8verwirklichte wenige Jahre nach dem Sturz der Tyrannis9neue Reformen. Diese Reformen schufen ein neues Phylensystem, das dann zum Grundraster der politischen Organisation des Bürgerverbandes wurde. Man vermutet, dass sie in den Jahren 508/7 durchgeführt wurden.10Die Grundlage der Phylenreformen waren die 139 Demen (Gemeinden), die Bürgerlisten führten und Aufgaben lokaler Selbstverwaltung besaßen. Mehrere Demen wurden zu Trittyen (Bezirke) zusammengefasst, von denen dann wiederum je drei eine Phyle bildeten.11Den Phylen wurden je eine Trittys aus dem städtischen Zentrum Athens, dem Landesinneren und der Küstenregion zugelost. Die Grundgedanken, die Kleisthenes verfolgte, waren einmal die Einteilung der Bevölkerung nach rein territorialen Gesichtspunkten und zum zweiten die Durchmischung der Bevölkerung, welche das Gemeinschaftsgefühl der Bürger festigen und ihr politisches Zusammenwirken über alle lokalen Bindungen hinweg ermöglichen sollte.12Kleisthenes schuf außerdem eine neue Institution, den Rat der 50013, die auf der Neueinteilung beruhte. Somit gelangten der Rat sowie das Heer außer Reichweite der alten aristokratischen Einflüsse.14Jede Phyle stellte
8Kleisthenes war Sohn des Alkmeoniden Megakles und der Agariste. Seine Lebensdaten lassen sich
ebenso wenig wie seine amtliche Stellung genau belegen. Kleisthenes war in der Zeit der Tyrannis
des Peisistratos und seiner Söhne zeitweise verbannt. Nach seiner Rückkehr begann er mit seinen
Reformen, die er aber erst nach der Vertreibung seines Gegners Isagoras beenden konnte. Vgl. Hans
Gärtner 1979b: Kleisthenes, Sp. 234. In: Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike in fünf Bänden, Bd. 3.
Hrsg. von Hrsg. von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer, München: DTV, Sp. 233 - 234
9Tyrannis ist eine unbegrenzte Gewaltherrschaft eines unumschränkten Gewaltherrschers. Vgl. Hans
Volkmann 1979b: Tyrannis, Sp. 1024. In: Der Kleine Pauly, Lexikon der Antiken in fünf Bänden, Bd. 5,
hrsg. von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer, Hans Gärtner, München: DTV, Sp. 1024 - 1026
10vgl. Jochen Bleicken 1995: Die athenische Demokratie. 4. Aufl.; Paderborn, München, Wien, Zürich:
Schöningh, S. 42
11vgl. Michael Stahl 2003: Gesellschaft und Staat bei den Griechen: Klassische Zeit. Paderborn,
München, Wien, Zürich: Schöningh, S. 29
12vgl. Peter Funke 1999: Athen in klassischer Zeit. München: Beck (= C.H. Beck Wissen in der
Beck´schen Reihe; Bd. 2074), S. 20
13Der Rat der 500 bestand aus fünfzig Bürgern von jeder der zehn Phylen und wurden für ein Jahr
aus Kandidaten erlost, die in den 139 Demen (Gemeinden) nominiert worden waren. Mogens Herman
Hansen 1995: Die Athenische Demokratie im Zeitalter des Demosthenes: Struktur, Prinzipien und
Selbstverständnis. Dt. von Wolfgang Schuller, Berlin: Akademie Verlag, S. 371, siehe dazu Kapitel 3
14vgl. ebd., S. 49
Page 8
zukünftig eine Abteilung des Heeres, an deren Spitze je ein Stratege15aus jeder Phyle stand.
Die politischen Folgen scheinen ganz offensichtlich zu sein: Die Macht des Adels wurde gebrochen und die adlige Gesellschaft war im Aufbau der Stadt nicht mehr präsent. Dies ist insofern bemerkenswert, da die adligen Geschlechter, die Phratrien, im sechsten Jahrhundert noch das gesellschaftliche Gerüst Attikas bildeten. Die Phratrien ließen sich auf gentilizische, das heißt mehr oder weniger fiktive verwandtschaftliche Beziehungen zurückführen und wurden von einigen Adelshäusern dominiert.16
Bis zu den Reformen Kleisthenes’ war man nur attischer Bürger, wenn man einer Phratrie angehörte. Somit war der politisch soziale Status jedes Nichtadligen von den Geschlechtern abhängig.17Die Adligen kontrollierten das Bürgerecht, den Rechtschutz sowie die Rechtsprechung; zudem besaßen nur die Geschlechter Kulte, so dass das Volk auch nur über den Adel Zugang zum Kult hatte. Die kleisthenische Phylenorganisation zerstörte die alten gentilizisch-lokalen Abhängigkeitsverhältnisse. Die Adligen mussten sich für die Unterstützung ihrer politischen Ziele zukünftig neue Anhänger suchen. Somit ermöglichten die Reformen gleiche Ausgangspositionen für alle, die politisch handeln wollten. Dies bedeutete jedoch nicht die Einebnung der sozialen Unterschiede. Der Adel blieb eine besondere Ständegruppe, die sich ihrer Tradition bewusst war, einen außergewöhnlichen Lebensstil pflegte und die politische Führung in der Hand behielt, da sie in der politischen und militärischen Ausbildung einen Vorsprung besaß.18Die Adelsherrschaft wurde durch die Neuordnung zerstört, wobei der einzelne Adlige aber immer noch politisch aktiv sein konnte, wenn auch nur im Rahmen dieser Ordnung. Kleisthenes führte diese Reformen allerdings nicht mit der Absicht durch, eine Demokratie zu errichten, sondern bezweckte damit, sich gegenüber seinen adligen Rivalen mit einer neuen Gefolgschaft zu behaupten.19Man muss diese Reformen als einen Prozess ansehen, denn die unbemittelten und weniger vermögenden Bürger wuchsen erst mit den Jahren in ihre neue politische
15Die Strategen waren somit die Oberkommandierenden von Heer und Kriegsflotte. Sie besaßen im
Krieg die Befehlsgewalt über das Heer. Die Strategen waren immer ein Gremium von zehn, das für ein
Jahr von der Volksversammlung gewählt wurde, mit keiner Beschränkung zur Wiederwahl. Vgl. ebd.,
S. 372
16vgl. Funke 1999: S. 17
17vgl. David Stockton 1990: The classical Athenian Democracy. Oxford, New York: Oxford University
Press, S.24f.
18vgl. Jochen Martin 1974: Von Kleisthenes zu Ephailtes. Zur Entstehung der athenischen
Demokratie, S. 18. In: Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des
deutschen Archäologischen Instituts; Bd. 4; München: C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung, S. 5 - 42
19vgl. Bleicken 1995: S. 42