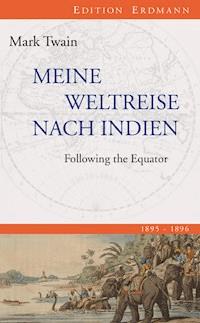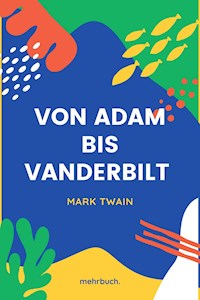
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. "Von Adam bis Vanderbilt" ist eine Sammlung von 13 Erzählungen. Samuel Langhorne Clemens, besser bekannt unter seinem Pseudonym Mark Twain - war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er war ein Vertreter des amerikanischen Realismus und ist besonders wegen seiner humoristischen, von Lokalkolorit und genauen Beobachtungen sozialen Verhaltens geprägten Erzählungen sowie aufgrund seiner scharfzüngigen Kritik an der amerikanischen Gesellschaft berühmt. In seinen Werken beschreibt er den alltäglichen Rassismus; seine Protagonisten durchschauen die Heuchelei und Verlogenheit der herrschenden Verhältnisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Twain
Von Adam bis Vanderbilt
Adams Tagebuch
Vorbemerkung: Ich habe einen Teil dieses Tagebuches bereits vor mehreren Jahren übersetzt, und ein Freund von mir hat ein paar Exemplare meiner Arbeit in unvollständigem Zustand gedruckt; doch ist nichts davon ins Publikum gedrungen. Seitdem habe ich noch etwas mehr von Adams Hieroglyphen entziffert, und ich glaube, daß er nachgerade als öffentlicher Charakter eine genügende Bedeutung besitzt, um die Herausgabe dieser Uebersetzung zu rechtfertigen.
Mark Twain.
Montag. Dieses neue Geschöpf mit dem langen Haar fängt an, mir sehr im Wege zu sein. Es ist immer hinter mir her und lungert beständig um mich herum. Ich mag das nicht; ich bin nicht an Gesellschaft gewöhnt. Ich wünschte, es bliebe bei den übrigen Tieren . . . Es ist heute umwölkt; denke, wir werden Regen haben. Wir? Wer ist wir? Woher habe ich das Wort? Ich erinnere mich jetzt, – das neue Geschöpf braucht es immer.
Dienstag. Habe den großen Wasserfall untersucht. Er ist das Beste auf dem ganzen Grundstück, sollt' ich meinen. Das neue Geschöpf nennt ihn den ›Niagara-Fall‹, – habe auch nicht die blasseste Ahnung, weswegen. Wenn es sagt, das Ding sehe aus wie ›Niagara‹, so hat das keinen Sinn. Es ist nur so ein Einfall, nur leeres Geschwätz. Ich selber komme gar nicht mehr dazu, irgend etwas zu benennen. Das neue Geschöpf tauft alles, was uns gerade in die Quere kommt, ehe ich auch nur den geringsten Einwand dagegen erheben kann. Und das immer unter einem und demselben Vorwand, daß es so ›aussehe‹.
Mittwoch. Habe mir einen Unterschlupf gegen den Regen gebaut. Aber ich konnte ihn nicht friedlich für mich behalten. Das neue Geschöpf war gleichfalls sofort drinnen. Als ich es hinauszudrängen versuchte, vergoß es Wasser aus den beiden Löchern, mit welchen es sieht, wischte es mit dem Rücken seiner Pfoten fort und gab dabei Töne von sich, wie verschiedene der andern Tiere, sobald ihnen etwas weh tut oder sie sich fürchten. Wenn es nur nicht sprechen wollte! Es schwatzt beständig. Das klingt fast wie Hohn und Spott, als wollte ich mich über das arme Geschöpf lustig machen. Aber die Absicht liegt mir fern. Ich habe die menschliche Stimme nie zuvor gehört, und jeder neue und fremde Laut, welcher das feierliche Schweigen in dieser träumerischen Einsamkeit unterbricht, beleidigt mein Ohr, wie eine falsche Note. Und obendrein ist dieser neue Laut immer so nahe bei mir, er ist dicht an meiner Schulter, dicht an meinem Ohr, erst auf dieser, dann auf der andern Seite; und ich war nur gewöhnt Laute zu hören, die mehr oder weniger entfernt von mir sind.
Freitag. Das Benennen geht unaufhaltsam weiter, ich mag dagegen tun was ich will. Ich hatte für das große Grundstück hier einen sehr guten Namen erfunden, der hübsch war und musikalisch zugleich – Garten von Eden. Ich gebrauche den Namen jetzt noch, aber nicht öffentlich, nur verstohlen. Das neue Geschöpf sagt, man sehe in der ganzen Landschaft nur Wald, Felsen und Wasser; sie erinnere nicht im mindesten an einen Garten, sondern sehe aus wie ein Park und wie nichts anderes. So hat es ihm denn, ohne mich weiter zu fragen, den Namen Niagarafall-Park gegeben. Das ist eigenmächtig genug, sollte ich meinen. Und schon kann man auf dem Grase eine Tafel mit der bekannten Warnung sehen: »Es ist verboten den Rasen zu betreten!«
Mein Leben ist nicht mehr so glücklich wie früher.
Samstag. Das neue Geschöpf ißt zu viel Früchte. Wir werden wahrscheinlich bald Mangel daran haben. Schon wieder ›Wir‹ – das ist sein Wort und meins jetzt auch bereits vom ewigen Hören . . . Ziemlich neblig heute früh. Ich selbst gehe nicht in den Nebel hinaus. Aber das neue Geschöpf tut es. Es geht in allen Wettern aus und kommt dann mit schmutzigen Füßen wieder hereingehopst. Dabei spricht es fortwährend, und früher war es hier so angenehm und ruhig.
Sonntag. Hab ihn glücklich hinter mir. Dieser Tag wird immer ermüdender. Der Sonntag wurde im letzten November zum Ruhetag gewählt und abgesondert. Früher hatte ich in jeder Woche schon sechs solche Tage. Und heute? Heute morgen fand ich das neue Geschöpf, wie es mit Erdklumpen nach dem verbotenen Baum warf, um die Äpfel herunterzuholen.
Montag. Das neue Geschöpf sagt: sein Name sei Eva. Das ist ganz recht, und ich will nichts dagegen einwenden. Es sagt, der Name sei dazu da, damit ich es rufen könne, wenn ich es bei mir zu haben wünsche. Darauf erwiderte ich, daß der Name dann überflüssig sei. Dies Wort hob mich augenscheinlich in der Achtung des neuen Geschöpfs. Und wirklich das Wort ›überflüssig‹ ist sehr gut und von allgemeiner Bedeutung; es verdient bei jeder Gelegenheit wiederholt zu werden. Darauf sagte mir das Geschöpf, daß es gar kein ›Es‹, sondern eine ›Sie‹ sei. Das ist zum mindesten zweifelhaft; aber mir ist's einerlei; sie mag sein was sie will, wenn sie nur ihrer Wege gehen und nicht beständig reden wollte!
Dienstag. Sie sagt, dieser Park würde eine äußerst erquickende und reinliche Sommerfrische abgeben, für den Fall sich Gäste dafür finden ließen. Sommerfrische – was heißt das? Offenbar wieder so 'ne neue Erfindung ihres rastlosen Hirns und ihres noch ruheloseren Mundes – Worte ohne jeden Sinn. Was ist eine Sommerfrische? Aber besser, ich frage sie gar nicht erst danach – sie hat ohnehin eine wahre Sucht alles zu erklären.
Freitag. Sie hat es für gut befunden, mich zu bitten, nicht mehr über den Wasserfall zu gehen, wie ich es mir angewöhnt hatte. Wem geschieht denn damit etwas zuleide? Sie sagt, es mache sie schaudern. Ich möchte nur wissen warum? Ich habe es immer getan, seit ich hier bin. Das Hineinspringen, das Untertauchen und die Aufregung dabei macht mir den größten Spaß. Und dann die Kühle, wenn es sonst heiß ist! Ich habe auch immer gedacht, daß der Fall gerade deswegen da wäre. Wenigstens hat er – soweit ich sehen kann – sonst keinen Zweck, und irgend einen Zweck muß er doch haben. Und jetzt kommt sie und sagt, die ganze Geschichte wäre nur um der malerischen Szenerie willen da – wie das Rhinozeros und das Mastodon.
Bin darauf in einem Faß über den Fall hinuntergesegelt, – auch das war nicht nach ihrem Geschmack. Dann in einer Waschbutte, – sie war noch immer nicht zufrieden. Ich schwamm durch den Strudel unterhalb des Falls und durch die Stromschnellen oberhalb des Falls in einem nagelneuen Schwimmanzug von Feigenblättern, der dabei fast in Fetzen ging. Da bekam ich endlose Vorwürfe wegen meiner Verschwendungssucht. Ich fühle mich hier von allen Seiten eingeengt. Ein Ortswechsel wird mir gut tun.
Samstag. Am Abend des letzten Dienstag bin ich durchgebrannt und habe mir dann, nachdem ich zwei Tage drauflosgewandert war, einen neuen Unterschlupf gebaut, an einer ganz abgelegenen Stelle. Aber wie sehr ich auch bemüht gewesen war, meine Spuren zu verwischen und zu verbergen, – sie hat mich doch aufgespürt, mit Hilfe eines Tieres, welches sie gezähmt hat und ›Wolf‹ nennt: sie stürzte plötzlich zu mir herein, machte wieder das klägliche Geräusch, das ich nicht hören mag, und ließ das Wasser aus den beiden Löchern, mit denen sie sieht, hervorschießen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mit ihr zurückzugehen, – aber ich werde sofort wieder ausreißen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Sie gibt sich mit allerlei ganz überflüssigen Dingen ab. Unter anderm versucht sie, herauszubekommen, warum die Tiere, welche Löwen und Tiger heißen, auf diesem großen Grundstück von Gras und Blumen leben, während sie doch nach ihrer Meinung eine Art Zähne haben, die deutlich beweist, daß sie bestimmt sind einander aufzufressen. Das ist einfach Narrheit.
Sonntag. Habe ihn glücklich hinter mir.
Montag. Ich glaube jetzt dahintergekommen zu sein, wozu die Woche da ist: sie soll einem Zeit geben, um sich von der Ermüdung des Sonntags zu erholen. Das ist gar keine schlechte Idee . . . Ich habe Eva schon wieder an dem verbotenen Baum erwischt. Sie war hinaufgeklettert und ich warf mit Erdklumpen nach ihr, bis sie herunterkam und sagte, es hätt' es ja niemand gesehen. Ich glaube, sie hält das für eine genügende Rechtfertigung, um die gefährlichsten Dinge zu tun. Sagte ihr es auch ins Gesicht. Das Wort Rechtfertigung erregte ihre Bewunderung und zugleich, wie mir schien, ihren Neid, der immer sehr leicht erregt ist. Es ist aber auch ein sehr gutes Wort.
Dienstag. Das Neueste, was sie mir gesagt hat, ist, daß sie aus einer von meinem Körper genommenen Rippe gemacht sei. Das scheint mir eine gewagte Behauptung. Mir hat doch nie eine Rippe gefehlt! Besonderes Kopfzerbrechen macht ihr seit einiger Zeit der junge Habicht, mit dem sie sich so viel abgibt. Sie sagt, er könne kein Gras vertragen, und fürchtet daher, ihn nicht aufziehen zu können, weil er, wie sie sich einbildet, verwestes Fleisch zur Nahrung haben müsse. Ein Habicht sollte sich, meiner Meinung, mit dem begnügen was vorhanden ist. Man kann doch nicht bloß dem Habicht zuliebe die ganze Ordnung der Dinge umkehren.
Samstag. Gestern fiel sie in den Teich, als sie sich zu weit vorbog, um sich im Wasser zu betrachten. Sie tut das immer, sobald sie an einen Teich kommt, nur ist sie bis jetzt noch nicht hineingefallen. Sie hat so viel Wasser geschluckt, daß sie beinahe erstickte. Das sei ein höchst unbehagliches Gefühl, erklärte sie, als sie wieder draußen war. Es machte sie auch traurig wegen der Geschöpfe, welche im Wasser leben müssen, und die sie Fische nennt. Sie hat nämlich noch immer nicht aufgehört, allen möglichen Dingen ganz unnütze Namen anzuhängen. Sie kommen gar nicht, wenn sie den Namen ruft, aber das verschlägt ihr nicht das geringste; sie ist nun einmal solche Törin! Die Folge war, daß sie gestern abend eine ganze Menge Fische einfing, hereinbrachte und, damit sie warm werden möchten, in mein Bett tat. Aber ich habe sie seitdem beobachtet und die Wahrnehmung gemacht, daß sie durchaus nicht glücklicher schienen als vordem. Nur viel stiller sind sie den ganzen Tag gewesen. Und wenn es wieder Nacht wird, werde ich sie einfach vor die Türe werfen und nicht wieder mit ihnen schlafen, denn sie sind unangenehm schleimig und naßkalt, und das Liegen zwischen ihnen ist, namentlich wenn man nichts anhat, höchst unbehaglich.
Sonntag. Habe ihn glücklich hinter mir.
Dienstag. Jetzt hat sie sich mit einer Schlange eingelassen. Die andern Tiere sind froh, weil sie beständig an ihnen herumhantierte und sie nicht in Ruhe ließ – auch ich freue mich darüber, weil die Schlange gleichfalls spricht und ich mich etwas erholen kann.
Freitag. Sie sagt mir, die Schlange habe ihr geraten, die Frucht von dem Baum zu kosten, und ihr versprochen, daß das Ergebnis eine große, schöne und edle Fortentwicklung sein werde. Ich sagte ihr, es würde noch etwas anderes daraus entstehen – der Tod würde in die Welt kommen. Aber das war ein großer Mißgriff von mir, und ich hätte ungleich besser getan, die Bemerkung für mich zu behalten. Es brachte sie nur auf den Gedanken, daß sie dann den kranken Habicht gesund machen und den trübselig einherschleichenden Löwen und Tigern frisches Fleisch zur Nahrung verschaffen könnte. Ich riet ihr noch einmal aufs dringendste, von dem Baum fortzubleiben. Sie sagte, sie wollte es nicht. Ich sehe allerlei Unannehmlichkeiten voraus und denke wieder ans Auswandern.
Mittwoch. Ich habe eine bunte Zeit hinter mir. An jenem Abend bin ich ausgerissen und die ganze Nacht hindurch geritten so schnell mein Pferd nur laufen konnte, in der Hoffnung, aus dem Park herauszukommen und ein anderes Land zu erreichen, bevor die ganze Not hereinbrach. Aber das sollte mir nicht gelingen. Eine Stunde nach Sonnenaufgang hatte ich die Grenze noch immer nicht erreicht. Dafür befand ich mich auf einer grasigen, mit Blumen bedeckten Ebene, auf der Tausende von Tieren versammelt waren, teils schlafend, teils weidend, teils miteinander spielend, wie das bei den Tieren Brauch war. Aber plötzlich stießen sie allesamt ein entsetzliches Gebrüll und Geheul aus, und schon im nächsten Augenblick lief auf der ganzen Ebene alles wirr durcheinander. Wie rasend fielen die Tiere über einander her und zerfleischten sich gegenseitig. Ich hätte so etwas nie für möglich gehalten, doch wußte ich sofort, was es zu bedeuten hatte – Eva hatte von der verbotenen Frucht gegessen, und im selben Augenblick war auch der Tod in die Welt gekommen! Die Tiger stürzten sich auf mein Pferd und zerrissen es, ohne sich weder an meine Bitten noch an meine Befehle zu kehren. Ja, sie würden mich selber gefressen haben, hätte ich mich nicht schnell aus dem Staube gemacht. Jenseits der Grenze des Parks fand ich diesen Platz und hier habe ich mich seitdem auch ein paar Tage äußerst behaglich befunden, bis – sie mich auch hier entdeckt hatte und plötzlich vor mir stand. Das Merkwürdigste dabei war, daß mir das eigentlich gar nicht so unangenehm schien, wie ich es mir vorher vielleicht vorgestellt hatte. Auch sie fand den Platz gar nicht übel und hatte natürlich wieder sofort einen Namen für ihn, – weil er gerade so aussah. Schließlich war ich sogar ganz froh, daß sie mich gefunden hatte, da es hier herum weder Früchte noch Beeren gab, wie drüben im Park, und sie ein paar von den Äpfeln des verbotenen Baumes mitgebracht hatte. Ich war so hungrig, daß ich mich genötigt sah, sie zu verspeisen. Eigentlich ging es gegen meine Grundsätze – aber ich habe damals entdeckt, daß der Mensch seinen Grundsätzen nur treu zu bleiben pflegt, wenn er genug zu essen hat.
Auch etwas Neues habe ich an ihr entdeckt. Sie kam in einer Art Umhüllung von Zweigen und Laubgewinden, und als ich sie fragte, was dieser neue Unsinn bedeuten solle, ihr das ganze grüne Zeug herunterriß und es auf die Erde warf, – da zitterte sie an allen Gliedern, und wurde rot im Gesicht. Ich hatte noch nie jemanden zittern und rot werden sehen, es schien mir nicht nur unschön, sondern geradezu blödsinnig. Sie sagte aber auf meine Frage nur: ich würde das bald an mir selbst erfahren. Und darin hatte sie recht. Denn trotz meines Hungers legte ich den Apfel halb angebissen beiseite – es war obendrein der feinste, den ich je gekostet habe, noch dazu bei so vorgeschrittener Jahreszeit – und fing an, mich selber mit dem Grünzeug zu behängen, das ich ihr eben vom Leibe gerissen hatte. Dann sah ich sie an, wie sie so dastand und befahl ihr mit Entrüstung, noch mehr Zweige und Blätter zu holen, weil es sonst ein wahrer Skandal sei. Sie gehorchte mir mit Eifer und dann schlichen wir beide nach dem Platz zurück, wo die wilden Tiere vorher die Vernichtungsschlacht gekämpft hatten, und sammelten einige von den Fellen. Ich befahl ihr, daraus für uns ein paar Anzüge zusammenzunähen, in denen wir uns öffentlich zeigen könnten. Sie sind hart und unbequem, aber jedenfalls nach der neuesten Mode, und das ist ja schließlich bei Kleidern die Hauptsache.
Ich finde neuerdings auch, daß sie eine ganz gute Gesellschafterin ist. Ohne sie würde ich jetzt recht einsam und traurig sein, nachdem ich meinen Grundbesitz verloren habe. Überdies hat sie mir eben gesagt, daß wir nach der neuen Ordnung der Dinge fortan für unsern Lebensunterhalt arbeiten müssen. Da kann sie sich nützlich machen. Sie wird arbeiten und ich werde die Aufsicht führen.
Nächstes Jahr. Wir haben es Kain getauft, sie hat es eingefangen, während ich weiter draußen im Land war, um zu jagen und Fallen zu stellen. Sie fing es, wie sie mir bei meiner Rückkehr erzählte, im Tannengehölz, ein paar Meilen südlich von der Erdwohnung, die wir uns angelegt haben. Es sieht uns gewissermaßen ähnlich und ist vielleicht irgendwie mit uns verwandt. Wenigstens glaubt dies Eva, aber meiner Meinung nach ist es ein Irrtum. Der gewaltige Unterschied in der Größe allein rechtfertigt schon die Annahme, daß es nur eine andere, noch neue Art Tier ist, – vielleicht ein Fisch. Als ich es aber ins Wasser warf, um mir Gewißheit zu schaffen, sank es sofort unter, worauf sie ihm nachsprang und es herauszog, ohne mir die nötige Zeit zu lassen, die Sache durch meinen Versuch zu entscheiden. Ich bin aber noch immer der Überzeugung, daß es ein Fisch ist, während es ihr so gleichgültig zu sein scheint, was es ist, daß sie es mir um keinen Preis zu einem neuen Versuch überlassen will. Das verstehe ich nicht. Mir ist an ihr neuerdings überhaupt mancherlei unverständlich. Seit sie das Geschöpf im Hause hat, scheint ihre Natur verändert. Auf Versuche läßt sie sich schlechterdings nicht mehr ein. Sie hat auch noch nie auf ein Tier so große Stücke gehalten, wie auf dieses, doch weiß sie mir keinen Grund dafür anzugeben. Ich glaube wirklich sie hat ihre fünf Sinne nicht mehr beisammen. Bisweilen trägt sie den Fisch halbe Nächte lang in ihren Armen umher, wenn er jammert und winselt, weil er ins Wasser will, und wenn ich ihn dann nach dem nächsten Teich tragen und hineinwerfen möchte, so wehrt sie sich so sehr dagegen, wie nur je, als sie noch bei Verstande war. Bei solchen Gelegenheiten kommt ihr dann wieder das Wasser aus den Gucklöchern in ihrem Gesicht; sie drückt den Fisch an ihre Brust, klopft ihn leise auf den Rücken, macht mit ihrem Munde allerlei Töne, die ihn beruhigen sollen, und ist ganz närrisch vor Sorge und Angst um das Geschöpf. Ich habe sie früher dergleichen nie mit einem andern Fisch, oder sonst irgend einem Tiere tun sehen, und ich mache mir viel Kopfzerbrechens darüber. Ehe wir von unserem Grundstück vertrieben wurden, hat sie wohl auch von Zeit zu Zeit junge Tiger herumgetragen und ihr Spiel mit ihnen getrieben, aber doch nicht immerfort und niemals bei Nacht. Auch hat sie sich's nie so zu Herzen genommen, wenn ihnen das Frühstück nicht gut bekam.
Sonntag. Am Sonntag scheint sie sich's zur Regel zu machen, nicht zu arbeiten, sondern ganz erschöpft von der Wochenarbeit dazuliegen und den Fisch auf sich herumkriechen zu lassen. Dabei bringt sie allerlei Töne mit dem Munde hervor und behauptet, das belustige ihn; sie steckt sich auch seine kleinen Pfoten oder Vorderflossen in den Mund und er fängt an zu lachen. Mein Lebtag habe noch keinen Fisch lachen sehen, und dabei kommen mir allerlei Zweifel. Der Sonntag gefällt mir jetzt selber ganz gut. Es ermüdet ja Körper und Geist zugleich, wenn man die Woche über fortwährend die Arbeit anderer beaufsichtigen muß. Da sollte es noch mehr Sonntage geben. In den früheren Zeiten, auf dem großen Grundstück, waren die Sonntage kaum zum Aushalten, jetzt fangen sie an, mir ganz gelegen zu kommen.
Mittwoch. Es ist kein Fisch. Das weiß ich jetzt – aber darum kann ich noch lange nicht begreifen, was es eigentlich ist. Wenn es was haben will und bekommt es nicht gleich, macht es den tollsten und abscheulichsten Lärm. Wenn es aber hat, was es will, oder sonst zufrieden ist, sagt es ›Gugu‹ oder etwas der Art. Es ist kein Mensch, denn es kann nicht gehen; es ist kein Vogel, sonst könnte es fliegen; es ist kein Frosch, denn es hüpft nicht; und auch keine Schlange, weil es nicht kriechen kann. Daß es kein Fisch ist, weiß ich ebenfalls ganz bestimmt, obgleich ich nicht dazu kommen kann, es schwimmen zu lassen. Wenn Eva es nicht auf den Armen hat, liegt es meist am Boden auf dem Rücken und streckt die Füße in die Luft. Das habe ich noch bei keinem Tier gesehen. Ich glaube es muß ein Riesenkäfer sein. Wenn es stirbt will ich es auseinandernehmen, um seine innere Einrichtung zu untersuchen. Ich muß der Sache doch auf den Grund kommen.
Drei Monate später. Die Geschichte wird immer rätselhafter. Ich kann kaum noch schlafen, weil sie mir so im Kopfe herumgeht. Das Geschöpf liegt nicht mehr am Boden, sondern kriecht nun auf seinen vier Füßen herum. Aber es unterscheidet sich wesentlich von den übrigen Vierfüßlern, denn seine Vorderbeine sind ungewöhnlich kurz. So ragt denn der Hauptteil seiner Person ganz unverhältnismäßig in die Höhe, was durchaus nichts Anziehendes hat. Im übrigen ist es ganz so gebaut wie wir, doch beweist schon die Art seiner Fortbewegung, daß es nicht zu unserer Gattung gehört. Die Kürze der Vorder- und die Länge der Hinterbeine deuten darauf hin, daß es aus der Känguruh-Familie stammt. Doch unterscheidet es sich auch hier wieder von dem wirklichen Känguruh, denn es kann nicht hüpfen wie dieses. Es muß eine seltsame und interessante Abart sein, die bisher noch nicht katalogisiert worden ist. Da ich dieselbe entdeckt habe, halte ich mich auch für berechtigt, mir den Ruhm dieser Entdeckung für alle Zeiten dadurch zu sichern, daß ich dem neuen Geschöpf meinen Namen beilege. Ich habe es Kaengurum Adamiensis getauft.
Es muß ein ganz junges Exemplar gewesen sein, als Eva es in dem Tannengehölz fing, denn es ist seitdem beständig gewachsen. Jetzt ist es wohl fünfmal so groß wie damals, und wenn es etwas haben will und es nicht gleich bekommt, macht es dreißigmal mehr Lärm als früher. Zwang und Gewalt vermögen nichts dagegen auszurichten, im Gegenteil, sie machen die Sache immer nur schlimmer. Darum habe ich das Zwangs-System, mit dem ich es eine Zeit lang versuchte, wieder aufgegeben, zumal ich ihr gegenüber ohnehin damit einen besonders schwierigen Stand hatte. Sie besänftigt es immer mit Zureden und Schöntun und meistens damit, daß sie ihm alles gibt, was sie ihm zuerst rundweg abgeschlagen hat.
Wie ich schon bemerkt habe, war ich nicht zu Hause, als sie es brachte. Sie sagte mir, sie habe es im Walde gefunden. Es ist unbegreiflich, daß es das einzige seiner Art sein sollte, aber ich habe mich die ganze Zeit über müde und lahm gesucht, um ein zweites Exemplar zu finden, teils um es unserer Sammlung hinzuzufügen, teils als Spielgefährten für unseres. Es würde dann gewiß stiller sein und sich leichter zähmen lassen. Aber ich kann keines entdecken; auch nicht die leiseste Spur habe ich aufgefunden. Merkwürdig! Es kann doch gar nicht anders leben als auf dem Erdboden und wenn es sich vorwärts bewegt, müßte es doch eine Fährte hinterlassen. Ich habe wohl ein Dutzend Fallen und Schlingen gelegt, aber nichts dadurch erreicht. Alle kleinen Tiere kann ich fangen, nur dieses nicht. Sie gehen meistens aus Neugierde in die Falle, nur um zu sehen, wozu die Milch eigentlich dort aufgestellt ist, glaube ich. Trinken tun sie die Milch nie, sie werfen sie höchstens um.
Drei Monate später. Unser adamitisches Känguruh wächst noch immer fort, was höchst seltsam und beunruhigend ist. Ich habe noch nie gesehen, daß ein Känguruh solange braucht, um seine volle Größe zu erreichen. Es hat jetzt einen Pelz auf dem Kopf; gar nicht wie ein Känguruhpelz, sondern viel eher wie unser eigenes Haar, nur daß es sich feiner und weicher anfühlt, und statt schwarz rot ist. Wenn das noch lang so fort geht, verliere ich nächstens den Verstand über die tollen und unberechenbaren Sprünge in der Entwicklung dieses unklassifizierten zoologischen Naturspiels. Könnte ich nur ein zweites fangen, – doch das ist eine ganz vergebliche Hoffnung. Es ist eine neue Art und von dieser das einzige Exemplar, – soviel steht jetzt fest. Seit vorgestern ist mir auch noch der letzte Zweifel geschwunden. Ich hatte ein wirkliches Känguruh gefangen und mit nach Hause gebracht, in dem Gedanken, daß das unserige in seiner Einsamkeit froh sein würde, wenigstens einem ihm einigermaßen verwandten Tier zu begegnen. Unter Wildfremden, die nichts von seiner Art und Weise und seinen Wünschen und Begierden verstehen, mußte es doch darin, wie ich glaubte, einen kleinen Trost finden. Aber welchen Mißgriff hatte ich begangen. Es fiel bei dem bloßen Anblick des eingefangenen Känguruhs in solche Krämpfe, daß ich sofort wußte, es habe noch kein derartiges Geschöpf gesehen. Mir tut das kleine Tier leid, denn es schreit bei der geringsten Gelegenheit und ich kann nichts tun, um es glücklich zu machen oder zu sorgen, daß es sich bei uns wie unter seinesgleichen fühlt – und doch möchte ich es selbst jetzt gar nicht mehr missen. Wenn ich es nur wenigstens zähmen könnte, – aber auch das ist ganz außer Frage. Und je mehr ich es versuche, um so schlimmer scheine ich es zu machen. Es schneidet mir geradezu ins Herz das kleine Ding bei seinen Anfällen von Kummer und stürmischer Leidenschaft zu sehen. Eigentlich möchte ich, wir wären es wieder los; doch wage ich gar nicht den Wunsch auszusprechen. Denn erstens ist es mir doch nicht ganz ernst damit und zweitens würde Eva von einem solchen Vorschlag kein Wort hören wollen. Das scheint sehr grausam und selbstsüchtig von ihr, – aber vielleicht hat sie doch recht. Es würde dann am Ende noch einsamer sein als vorher. Ist es mir nicht gelungen ein zweites Exemplar seiner Gattung zu finden, so müßte es selber gewiß auch vergebens danach suchen.
Fünf Monate später. Es ist kein Känguruh! Nein, es kann sich seit wenigen Tagen selbst auf den Hinterbeinen aufrecht erhalten, wenn es sich gleichzeitig mit einer seiner Vorderpfoten an ihrem hingestreckten Finger festhält. Über ein paar Schritte kommt es dabei freilich noch nicht hinaus, sondern fällt dabei jedesmal bald wieder auf alle Viere zurück. Aber das genügt, um uns die Gewißheit zu verschaffen, daß es kein Känguruh ist. Viel wahrscheinlicher, daß es eine Art Bär ist. Nur hat es keinen Schwanz und – wenigstens bis jetzt – kein haariges Fell, außer auf dem Kopf. Übrigens sind die Bären gefährlich – ich weiß das von jener Vernichtungsschlacht her. Ich werde diesem hier, so gerne ich ihn auch manchmal habe, nicht mehr lange erlauben, sich ohne Maulkorb herumzutreiben. Neulich habe ich wieder einen Versuch gemacht, Eva ein richtiges, ausgewachsenes Känguruh zu versprechen, für welches sie dann dieses laufen lassen könnte. Aber alles, was ich damit erreichte, war, daß es aus den Sehlöchern in ihrem Gesicht förmlich wie Feuer sprühte und sie seitdem den kleinen Bären noch weniger als je von der Hand läßt. Ich fürchte sie wird uns durch ihre Torheit in neue Gefahr bringen. Seit sie den Verstand verloren hat, ist sie wie umgewandelt.
Vierzehn Tage später. Ich habe seinen Mund untersucht. Noch ist es unschädlich; es hat erst einen Zahn. Auch einen Schwanz hat es noch immer nicht. Aber dafür macht es mehr Lärm als je zuvor. Und namentlich in der Nacht. In den letzten beiden Nächten war es so arg, daß ich ausgezogen bin. Aber morgen gehe ich zum Frühstück hinüber, und dann sehe ich nach, ob es noch mehr Zähne bekommen hat. Wenn es erst einmal den ganzen Mund voll Zähne hat, wird es die höchste Zeit sein, Maßregeln zu ergreifen, – Schwanz oder nicht Schwanz, denn ein Bär braucht keinen Schwanz, um gefährlich zu sein.
Vier Monate später. Ich bin wieder auf einem längeren Jagd- und Fischausflug fortgewesen. Etwa einen Monat lang. In der Zwischenzeit hatte der Bär gelernt, sich ohne Hilfe und auf den Hinterbeinen allein fortzuhelfen und etwas, das wie ›Poppa‹ und ›Momma‹ klang, zu sagen. Es ist sicherlich eine ganz neue Art. Diese Töne, die sich ganz wie Worte anhören, mögen etwas rein Zufälliges sein und an sich gar nichts zu bedeuten haben. Aber selbst dann ist die Sache noch immer merkwürdig genug, und jedenfalls etwas, was kein anderer Bär kann. Diese Ähnlichkeit mit menschlicher Rede, dazu das Fehlen des Pelzes und der vollständige Mangel eines Schwanzes, beweisen zur Genüge, daß es nicht nur eine besondere, sondern ganz neue Art Bär ist. Inzwischen beabsichtige ich, seinetwegen auf eine neue Forschungsexpedition auszugehen und die großen Wälder weiter im Norden nach einem zweiten Exemplar zu durchsuchen.
Drei Monate später. Es war ein langer und langweiliger Jagdausflug, von dem ich da eben zurückgekehrt bin. Aber er war ganz und gar erfolglos. Was hat sie aber in der Zwischenzeit getan? Ohne sich vom Platz zu rühren und sich im mindesten anzustrengen hat sie unterdessen gerade auf dem neuen Grundstück ein zweites Exemplar eingefangen! Hat man je von solchem Glück gehört?
Tags darauf. Ich habe das neue Geschöpf genau mit dem alten verglichen, und es ist gar kein Zweifel, daß sie vom gleichen Schlage sind. Ich äußerte den Wunsch, eines von ihnen für meine Sammlung auszustopfen. Aber sie ist gegen das Ausstopfen im allgemeinen eingenommen, und in diesem Falle wollte sie erst recht nichts davon wissen. So habe ich denn die Absicht wieder aufgeben müssen, obgleich ich denke, daß ich unter allen Umständen darauf hätte bestehen sollen. Man denke sich, daß sie plötzlich wieder abhanden kämen, und stelle sich den Verlust für die Wissenschaft vor, wenn nichts von ihnen zurückbliebe!
Das ältere von beiden ist auch das weitaus zahmere. Es kann sogar plappern und lachen, wie ein Papagei. Und da auch Papageien so viel um uns herum sind, bin ich überzeugt, daß es das alles, und die Gabe der Nachahmung überhaupt von ihnen gelernt hat. Na, wer weiß, – vielleicht kommt es zuletzt noch heraus, daß es selbst eine Art Papagei ist. Ich würde mich gar nicht darüber wundern, wenn ich bedenke, was es alles schon gewesen ist seit jenen ersten Tagen, als ich es für einen Fisch hielt. Das neue ist grade so häßlich wie das andere zuerst war; es hat gelblich-rote Fleischfarbe und auf dem Kopf nur hier und da einen ganz leisen Ansatz von Pelz. Sie hat ihm auch schon einen Namen gegeben – Abel nennt sie es.
Zehn Jahre später. Es sind Jungens! Wir wissen das jetzt seit geraumer Zeit. Nur ihre anfängliche Winzigkeit und Gestaltlosigkeit hat uns so lange irre geführt. Wir hatten es noch nicht erlebt, daher unsere lange Ungewißheit. Jetzt haben wir uns bereits daran gewöhnt – auch ein paar Mädel sind schon angekommen.
Abel ist ein guter Junge. Aber wenn Kain ein Bär geblieben wäre, so würde das besser für ihn gewesen sein.
Was mich anlangt, so sehe ich nach allen diesen Jahren ein, daß ich Eva im Anfang unrecht getan habe. Es ist besser, außerhalb des Gartens mit ihr zu leben, als im Garten ohne sie. Ich meinte zuerst, sie spräche zuviel. Aber jetzt würde es mich aufs tiefste betrüben, wenn diese Stimme verstummen und ich sie mein Lebtag nicht mehr hören sollte. Gesegnet sei der Apfelbiß, der uns zuerst einander so nahe gebracht hat, daß ich ihre Holdseligkeit und die Güte ihres Herzens erkennen lernte!
Der Roman einer Eskimo-Maid
Ja, Herr Twain, ich will Ihnen von meinem Leben alles erzählen, was Sie gerne hören möchten,« sagte sie mit ihrer sanften Stimme und dabei sah sie mir mit ihren unschuldigen Augen ruhig ins Gesicht; »denn es ist lieb und nett von Ihnen, daß Sie mich leiden mögen und etwas über mich wissen wollen.«
Sie hatte, in Gedanken versunken, mit einem beinernen Messerchen Walfischfett von ihren Wangen geschabt und es an ihrem Pelzärmel abgewischt und dabei auf das Nordlicht am Himmel geblickt, das seine flammenden Strahlen in reichen Regenbogenfarben über die einsame Schneeebene und die Dome der Eisberge ergoß – ein Schauspiel von fast unerträglich glänzender Schönheit. Aber jetzt schüttelte sie die träumerische Stimmung von sich ab und schickte sich an, mir die einfache kleine Geschichte zu erzählen, um die ich sie gebeten hatte. Sie setzte sich bequem auf dem Eisblock zurecht, der uns als Sofa diente, und ich nahm die Haltung eines aufmerksamen Zuhörers an.
Sie war ein schönes Geschöpf. Ich spreche vom Eskimostandpunkt. Andere hätten sie für ein bißchen reichlich fett halten mögen. Sie war gerade zwanzig Jahre alt und galt für das weitaus bezauberndste Mädchen ihres Stammes. Sogar hier in der freien Luft, in ihren schwerfälligen und unförmlichen Pelzröcken, Pelzhosen und Pelzstiefeln und unter der großen Kapuze war wenigstens die Schönheit ihres Gesichtes erkennbar; die Schönheit ihrer Gestalt mußte man allerdings auf Treu und Glauben annehmen. Unter allen aus- und eingehenden Gästen hatte ich an ihres Vaters gastlichem Eßtrog kein Mädchen gesehen, das man ihrer ebenbürtig hätte nennen können. Und dabei war sie unverdorben! Sie war lieblich und natürlich und aufrichtig, und wenn sie wußte, daß sie eine Schönheit war, so ließ doch nichts in ihrem Gehaben darauf schließen, daß sie diese Kenntnis besaß.
Sie war nun seit einer Woche meine tägliche Kameradin gewesen, und je besser ich sie kennen lernte, desto besser gefiel sie mir. Sie war zärtlich und sorgfältig aufgezogen worden, in einer Lebensluft, die in den Polargegenden als eine außerordentlich verfeinerte gelten konnte, denn ihr Vater war der einflußreichste Mann seines Stammes und stand auf der Höhe der Eskimokultur. Ich machte mit Lasca – so hieß sie – lange Spazierfahrten im Hundeschlitten über die mächtigen Eisfelder und fand ihre Gesellschaft stets liebenswürdig und ihre Unterhaltung angenehm. Ich ging mit ihr auf den Fischfang, aber nicht in ihrem lebensgefährlich schwachen Boot, sondern ich spazierte bloß am Eisrande entlang und sah zu, wie sie mit ihrem unfehlbar treffenden Speer ihr Wild erlegte. Wir segelten miteinander; mehreremale stand ich dabei, wenn sie und ihre Familie von einem gestrandeten Wal den Speck ernteten, und einmal begleitete ich sie ein Stück Weges auf die Bärenjagd; ich kehrte aber um, ehe es zum Schuß kam, denn im Grunde habe ich Angst vor Bären.
Nun, wie gesagt, sie wollte mir ihre Geschichte erzählen. Hier ist sie:
»Unser Stamm war nach uraltem Brauch wie die anderen Stämme über das gefrorene Meer von Ort zu Ort gewandert, aber vor zwei Jahren wurde mein Vater des Wanderns müde und baute sich dieses große Schloß aus Schneeblöcken – sehen Sie es nur an! Es ist sieben Fuß hoch und drei- oder viermal so lang als irgend ein andres Haus. Hier haben wir seither immer gewohnt. Er war sehr stolz auf sein Haus und das mit Recht; denn wenn Sie es sich aufmerksam ansahen, so müssen Sie bemerkt haben, wieviel schöner und vollständiger es ist als die üblichen Wohnungen. Haben Sie noch nicht darauf geachtet, so müssen Sie es unbedingt tun, denn Sie werden darin eine luxuriöse Ausstattung finden, die sich hoch über das Gewöhnliche erhebt. Zum Beispiel, an dem Ende, das Sie den ›Empfangssalon‹ genannt haben, da ist die erhöhte Plattform, woran meine Familie und ihre Gäste es sich beim Essen bequem machen. Diese Plattform ist die größte, die Sie je in einem Hause gesehen haben – nicht wahr?«
»Ja, Sie haben vollkommen recht, Lasca; es ist die größte. Wir haben selbst in den schönsten Häusern der Vereinigten Staaten nichts Ähnliches.«
Bei dieser Anerkennung funkelten ihre Augen voll Stolz. Ich bemerkte es und schrieb es mir hinter die Ohren.
»Ich dachte mir's, daß die Plattform Sie überrascht hätte,« sagte sie. »Und noch eins: Der Boden ist viel dicker mit Pelzen belegt als sonst üblich ist. Alle Arten Pelzwerk – vom Seehund, Seeotter, Silberfuchs, Bär, Marder, Zobel – alle Arten Pelzwerk sind im Überfluß vorhanden. Dasselbe gilt von den Eisblockschlafbänken an der Wand, die Sie ›Betten‹ nennen. Sind bei Ihnen zu Hause Plattformen und Schlafbänke besser ausgestattet?«
»Das sind sie wirklich nicht, Lasca – man denkt noch gar nicht mal daran.« Das gefiel ihr wieder. Sie dachte bloß an die Zahl der Pelze, die ihr feinsinniger Vater sich die Mühe nahm aufzubewahren, nicht an deren Wert. Ich hätte ihr sagen können, daß diese Massen von kostbarem Pelzwerk ein Vermögen bedeuteten – oder wenigstens in meiner Heimat bedeuten würden – aber sie hätte das nicht verstanden; solche Sachen galten bei ihrem Volk nicht als Reichtümer. Ich hätte ihr sagen können, daß die Kleider, die sie anhatte, oder die Alltagskleider der gewöhnlichsten Person ihrer Umgebung, zwölf- oder fünfzehnhundert Dollars wert seien, und daß ich bei uns zu Hause keine Dame kenne, die in Zwölfhundert-Dollars-Toiletten fischen ginge. Aber auch dies hätte sie nicht verstanden. Deshalb sagte ich nichts. Sie fuhr fort:
»Und dann die Spülzuber! Wir haben zwei im Empfangssalon und außerdem noch zwei andere im Hause. Es kommt sehr selten vor, daß jemand zwei im Empfangssalon hat. Haben Sie zwei in Ihrem Salon daheim?«
Der bloße Gedanke an diese Spülzuber benahm mir den Atem; ich sammelte mich aber wieder, bevor sie etwas merkte, und sagte voll Wärme:
»Hören Sie, Lasca, es ist schlecht von mir, daß ich meine Heimat bloßstelle, und Sie dürfen es nicht weiter sagen, denn ich spreche zu Ihnen im Vertrauen – ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß nicht mal der reichste Mann in der Stadt New York zwei Spülzuber in seinem Salon hat.«
Sie schlug in unschuldigem Entzücken ihre pelzbekleideten Hände zusammen und rief:
»O, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, das kann nicht Ihr Ernst sein!«
»Ja, es ist wirklich mein Ernst, Liebste! Da ist Vanderbilt. Vanderbilt ist ungefähr der reichste Mann auf der ganzen Welt. Nun, und wenn ich auf dem Totenbett läge, so könnte ich Ihnen sagen, daß nicht mal er zwei in seinem Salon hat. Ja, nicht mal einen hat er – ich will auf der Stelle sterben, wenn's nicht wahr ist!«
Ihre lieblichen Augen standen vor Erstaunen weit aufgerissen, und sie sagte langsam, mit einem gewissen Beben in der Stimme: »Wie seltsam – wie unglaublich – man kann es sich gar nicht vorstellen. Ist er geizig?«
»Nein – das ist er nicht. Auf die Ausgabe kommt's ihm nicht an, aber – hm – wissen Sie, es würde protzig aussehen. Ja, das ist es – so denkt er. Er ist ein einfacher Mann auf seine Art und hat eine Abneigung gegen Entfaltung von Pomp und Prunk.«
»Nun, solche Demut ist ja recht anerkennenswert,« sagte Lasca, »wenn man sie nicht zu weit treibt – aber wie sieht denn nun der Salon aus?«
»Na, natürlich ziemlich kahl und unvollständig, aber . . .«
»Das kann ich mir denken. So was habe ich noch nie gehört! Ist es ein schönes Haus – ich meine, abgesehen davon?«
»Ziemlich schön, ja. Man hat 'ne sehr gute Meinung davon.«
Das Mädchen saß eine Weile schweigend da und knabberte träumerisch an einem Lichtstumpf. Augenscheinlich versuchte sie sich auf das Gehörte einen Vers zu machen. Zuletzt schüttelte sie leise den Kopf und sprach frank und frei ihre Meinung aus:
»Nun, nach meiner Ansicht gibt es eine Art von Demut, die, wenn man ihr auf den Grund geht, doch nur eine Prahlerei ist. Und wenn ein Mann, der sich zwei Spülzuber in seinem Salon leisten kann, es nicht tut, so ist er vielleicht wirklich demütig, aber hundertmal wahrscheinlicher ist es, daß er gerade die Blicke der Welt dadurch auf sich lenken will. Nach meiner Meinung weiß Herr Vanderbilt genau, was er damit bezweckt.«
Ich versuchte diesen Urteilsspruch zu mildern, denn ich fühlte, daß der Besitz von zwei Spülzubern nicht für jedermann der richtige Prüfstein sei, obgleich man in der Eskimogegend nichts dagegen einwenden kann. Aber das Mädchen hatte seinen eigenen Kopf und ließ sich nichts einreden. Plötzlich fragte sie: »Haben die reichen Leute bei Ihnen auch so gute Schlafbänke wie wir, aus so hübschen breiten Eisblöcken gemacht?«
»Na, sie sind ziemlich gut – gut genug – aber aus Eisblöcken sind sie nicht gemacht.«
»Ach gar! Warum sind sie denn nicht aus Eisblöcken?«
Ich erklärte ihr die Schwierigkeiten und machte sie darauf aufmerksam, wie teuer das Eis in einem Lande ist, wo man auf seinen Eismann scharf aufpassen muß, damit die Eisrechnung nicht schwerer wird als das Eis selber. Da rief sie:
»Herrje! Kaufen Sie Ihr Eis?«
»Ganz gewiß, mein liebes Kind.«
Sie brach in ein stürmisches, harmloses Lachen aus und sagte: »O, so was Albernes habe ich noch nie gehört! Es ist ja doch massenhaft vorhanden, ist kein kleinstes bißchen wert! Ich gäbe keine Fischblase für das Ganze!«
»Nun, Sie wissen eben den Wert nicht zu beurteilen, Sie kleine Provinzpflanze Sie! Wenn Sie das Eis hier im Hochsommer in New York hätten, so könnten Sie alle Walfische dafür kaufen, die am Markt sind.«
Sie sah mich zweifelnd an und sagte:
»Sprechen Sie die Wahrheit?«
»Die reinste! Ich leiste meinen Eid darauf.«
Das machte sie nachdenklich. Auf einmal sagte sie mit einem kleinen Seufzer:
»Ich wollte, da könnte ich wohnen!«
Ich hatte ihr nur zum Vergleich Werte nennen wollen, von denen sie sich einen Begriff machen konnte; aber meine Meinung war mißgedeutet. Ich hatte ihr damit nur den Eindruck erweckt, daß in New York Walfische reichlich vorhanden und billig seien, und hatte ihr den Mund wässern gemacht. Es schien am besten zu sein, wenn ich den begangenen Fehler zu mildern versuchte; so sagte ich denn:
»Aber Sie würden sich aus Walfischfleisch nichts machen, wenn Sie in New York wohnten. Kein Mensch dort fragt etwas danach.«
»Was?!«
»Nein, wirklich nicht.«
»Aber warum denn nicht?«
»T–scha, das weiß ich nicht recht. Es ist ein Vorurteil, denke ich. Ja, das ist's – einfach ein Vorurteil. Wahrscheinlich hat mal irgendwo und irgendwann irgend einer, der nichts Besseres zu tun hatte, ein Vorurteil dagegen aufgebracht, und Sie wissen ja, wenn so eine Einbildung mal eingewurzelt ist, so dauert es eine endlose Zeit, bis sie wieder ausgetrieben wird.«
»Das stimmt – das stimmt vollkommen!« sagte das Mädchen nachdenklich. »Gerade so war es hier mit unserem Vorurteil gegen Seife – wissen Sie, unsere Stämme hatten anfangs ein Vorurteil gegen Seife.«
Ich sah sie an. Sprach sie im Ernst? Augenscheinlich ja. Ich zögerte einen Augenblick, dann fragte ich vorsichtig, mit einer gewissen Betonung:
»Entschuldigen Sie: Sie hatten ein Vorurteil gegen Seife? Hatten?«
»Ja. Aber das war bloß im Anfang. Kein Mensch wollte sie essen.«
»Ach so, ich verstehe. Ich wußte nur nicht gleich, was Sie meinten.«
Sie fuhr fort: »Es war einfach ein Vorurteil. Als zum erstenmal Seife von den Fremdländischen hierhergebracht wurde, da mochte keiner sie. Sobald sie aber in Mode kam, hatte jeder sie gern und jetzt hat jeder welche, der es sich nur leisten kann. Lieben Sie Seife?«
»O ja, gewiß! Ich würde umkommen, wenn ich keine haben könnte – besonders hier. Haben Sie sie gerne?«
»Ich bete sie geradezu an. Mögen Sie Lichte?«
»Ich betrachte sie als unentbehrliche Notwendigkeit. Lieben Sie sie?«
Ihre Augen tanzten geradezu und sie rief:
»O, sprechen Sie nicht davon! . . . Lichte! . . . und Seife!«
»Und Fischeingeweide . . .!«
»Und Lebertran . . .!«
»Und Bratenfett . . .!«
»Und Walfischspeck . . .!«
»Und recht altes Fleisch von gestrandetem Wal! und Sauerkraut! und Bienenwachs! und Teer! und Terpentin! und Syrup! und . . .«
»O bitte, nicht mehr! Halten Sie ein! Mir bleibt die Luft weg vor Wonne . . .«
»Und dann alles zusammen in einer Trantonne angerichtet und die Nachbarn dazu eingeladen und dann . . .«
Aber dieses Zauberbild eines idealen Festes war zu viel für sie, und sie fiel in Ohnmacht, das arme Ding. Ich rieb ihr das Gesicht mit Schnee und brachte sie wieder zu sich, und nach einer Weile kühlte ihre Erregung sich ab. Allmählich kam sie wieder so weit, daß sie in ihrer Geschichte fortfahren konnte:
»So begannen wir also hier in dem schönen Hause zu wohnen. Aber ich war nicht glücklich. Der Grund war dieser: Ich war zur Liebe geschaffen; ohne Liebe konnte es für mich kein wahres Glück geben. Ich wollte um meiner selbst willen geliebt sein. Ich wollte anbeten und wollte von meinem Angebeteten angebetet werden; nichts Geringeres als gegenseitige Anbetung konnte meine glühende Natur befriedigen. Ich hatte Freier genug – ja übergenug – aber in allem und jedem Fall hatten sie einen verhängnisvollen Mangel; früher oder später entdeckte ich diesen Mangel – kein einziger von ihnen vermochte ihn vor mir zu verhehlen: sie wollten nicht mich, sondern meinen Reichtum!«
»Ihren Reichtum?«
»Ja; mein Vater ist der allerreichste Mann in unserem Stamm – und überhaupt unter allen Stämmen dieser Gegend.«
Ich fragte mich neugierig, worin wohl ihres Vaters Reichtum bestehen möchte. Das Haus konnte es nicht sein – ein jeder konnte sich so eins bauen. Die Pelze waren's auch nicht – denn die waren hier nichts wert. Der Schlitten, die Hunde, die Harpunen, das Boot, die beinernen Fischhaken, Nadeln usw., das alles konnte es nicht sein – nein, das war alles kein Reichtum. Was konnte es denn also sein, das diesen Mann so reich machte und den Schwarm von habgierigen Freiern in sein Haus brachte? Schließlich dünkte mich, es wäre, um dies herauszufinden, das beste, wenn ich sie fragte. Ich tat es. Das Mädchen war durch diese Frage so augenscheinlich geschmeichelt, daß ich sah, sie hatte sich schmerzlich danach gesehnt. Ihr Mitteilungsbedürfnis brannte sie ebenso sehr wie mich meine Neugier. Sie schmiegte sich traulich an mich an und sagte:
»Raten Sie, wie schwerreich er ist – Sie kriegen es niemals heraus!«
Ich tat, als dächte ich tief über die Sache nach, und sie beobachtete den Ausdruck meiner Denkanstrengungen auf meinem Gesicht mit atemlosem und entzücktem Interesse. Und als ich es endlich aufgab und sie bat, meine Sehnsucht zu stillen und zu mir selbst zu sagen, wieviel dieser Vanderbilt des Nordpols wert sei, da legte sie ihren Mund dicht an mein Ohr und wisperte eindrucksvoll:
»Zweiundzwanzig Angelhaken – keine beinernen, sondern fremdländische – aus echtem Eisen!«
Dann sprang sie mit dramatischer Gebärde zurück, um die Wirkung zu beobachten. Ich gab mir die allergrößte Mühe, sie nicht zu enttäuschen. Ich erbleichte und murmelte:
»Gott Strambach!«
»Es ist so wahr, wie Sie leben, Herr Twain!«
»Lasca, Sie machen mir was weis – Sie können es nicht im Ernst meinen!«
Sie wurde furchtsam und verwirrt und rief aus:
»Herr Twain, jedes Wort davon ist wahr – jedes Wort. Sie glauben mir – Sie glauben mir doch, bitte, nicht wahr? Sagen Sie, daß Sie mir glauben – bitte, bitte, sagen Sie, daß Sie's glauben.«
»Ich . . . hm . . . na ja, ich glaube – ich bemühe mich, es zu glauben. Aber es kam gar so plötzlich. So plötzlich und so verblüffend. Sie sollten so was nicht so mit einemmal machen. Es . . .«
»O, es tut mir so leid! Hätte ich nur gedacht . . .«
»Nun, es ist schon gut . . . und ich mache Ihnen keine Vorwürfe mehr, denn Sie sind jung und gedankenlos, und natürlich konnten Sie nicht voraussehen, was für 'ne Wirkung . . .«
»Ach ja. Bester, ich hätte ganz gewiß besser daran denken sollen. Aber wie . . .«
»Sehen Sie, Lasca, wenn Sie mit fünf oder sechs Angelhaken angefangen hätten und dann allmählich . . .«
»O, ich verstehe, ich verstehe . . . dann allmählich einen hinzufügen, und dann zwei und dann . . . Ach, warum habe ich denn auch nicht daran gedacht!«
»Nun, gleichviel, Kind; es ist schon recht. Ich fühle mich jetzt besser . . . binnen kurzem werde ich darüber weg sein. Aber . . . einem unvorbereiteten und gar nicht sehr kräftigen Menschen mit sämtlichen zweiundzwanzig auf einmal ins Gesicht springen . . .!«
»O . . . es war eine Sünde! Aber Sie verzeihen mir – sagen Sie, daß Sie mir verzeihen! Bitte!«