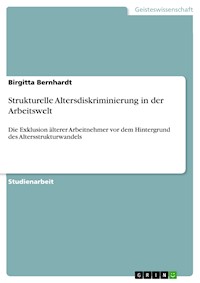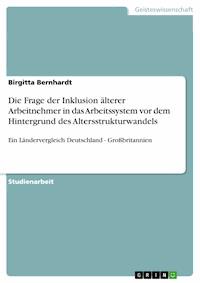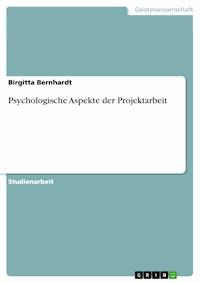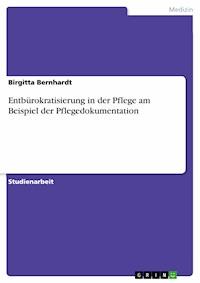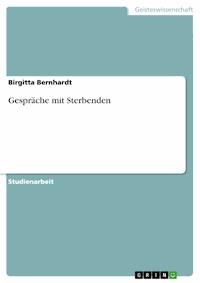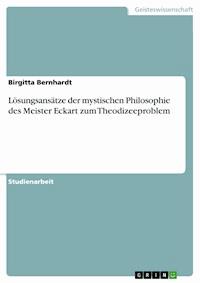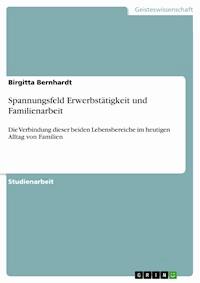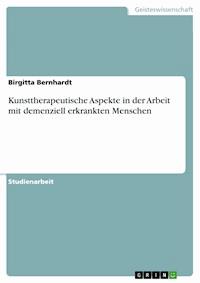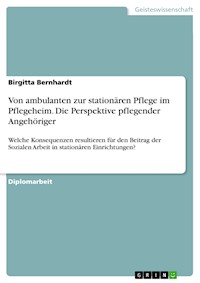
Von ambulanten zur stationären Pflege im Pflegeheim. Die Perspektive pflegender Angehöriger E-Book
Birgitta Bernhardt
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,0, Katholische Hochschule Freiburg, ehem. Katholische Fachhochschule Freiburg im Breisgau, Sprache: Deutsch, Abstract: „Ambulant vor stationär“ - so lautet eines der Grundprinzipien der 1995 als fünfte Säule des Sozialversicherungssystems eingeführten Pflegeversicherung. Unter diesem Leitsatz werden verschiedene Instrumente zur Förderung ambulanter Versorgungskonzepte subsumiert. Der mit der aktuellen Altersentwicklung verbundene Anstieg von Multimorbidität und demenziellen Erkrankungsbildern wird inzwischen von zahlreichen Teilsystemen der Gesellschaft als eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahrzehnte realisiert. Dabei hat sich im Diskurs um die Versorgung der wachsenden Anzahl alter und hochaltriger pflegebedürftiger Menschen eine deutliche Stärkung ambulanter Strukturen durchgesetzt. Ein Motiv für die Präferenz ambulanter Konzepte ist die Suche nach Lösungen für den steigenden Kostendruck, der aus der rasanten Zunahme der Lebenslage „Pflegebedürftigkeit“ resultiert. Dabei wird seitens der Entscheidungsträger der Institution „Familie“ als Ressource für häusliche Versorgung und Betreuungsleistungen die größte Bedeutung zugeschrieben. Familienangehörige sind innerhalb der Pflegelandschaft nach wie vor die wichtigsten Leistungserbringer. Trotz sich wandelnder Familienstrukturen und veränderten weiblichen Erwerbsbiografien steigt infolge des demografischen Trends die absolute Anzahl der häuslichen Pflegearrangements seit Jahren kontinuierlich an. Oftmals investieren Angehörige über Jahre hinweg ein enormes Maß an Zeit, Kraft und Energie für die Versorgung des Pflegebedürftigen. Eigene Bedürfnisse und Interessen werden nur noch reduziert bzw. gar nicht mehr gelebt und die Sorge um den Pflegebedürftigen kann sich zum alltagsbestimmenden Thema entwickeln. Bisweilen kann die Diskrepanz zwischen Pflegeaufwand und eigenen Ressourcen für pflegende Angehörige so groß werden, dass trotz Ausschöpfung ambulanter Hilfsangebote ein Umzug des Pflegebedürftigen in eine vollstationäre Einrichtung als Lösungsoption angebracht erscheint. Die forschungsleitende Frage in der vorliegenden Diplomarbeit ist die Frage nach der Erlebensperspektive der pflegenden Angehörigen bei der Umstellung eines ambulanten auf ein stationäres Pflegesetting sowie nach den Konsequenzen, die sich daraus für den Auftrag der Sozialen Arbeit in stationären Einrichtungen ergeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
Einleitung
Teil I „Die Familie ist der größte Pflegedienst der Nation“ – Wer sind die Leistungserbringer häuslicher Alten- und Krankenpflege und wen pflegen sie?
1 „Pflegende Angehörige“
1.1 Begriffsklärung
1.2 Profil der Pflegenden
2 „Pflegebedürftige“
2.1. Begriffsklärung
2.2 Profil der Pflegebedüftigen
Teil II Anlage und Methodik der empirischen Untersuchung
3 Fragestellung
4 Forschungsdesign: Einzelfallanalyse
5 Feldzugang
6 Datenerhebung: Leitfadengestütztes, problemzentriertes Interview
7 Leitfaden
8 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse auf der Basis der kommentierten Transkription
9 Darstellung der Interviewergebnisse
Teil III Der Umzug des Pflegebedürftigen ins Pflegeheim im Spannungsfeld zwischen Verlusterfahrung und Chance: Erfahrungen von pflegenden Angehörigen Darstellung der Untersuchungsergebnisse
10 Die Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger in häuslichen Pflegearrangements
10.1 Pflegealltag, Belastungserleben
10.1.1 Erfahrungen aus der Alltagssituation pflegender Angehöriger
10.1.2. Belastungserleben im Zusammenhang mit der häuslichen Pflegesituation
10.1.3. Entlastende Faktoren innerhalb der häuslichen Pflegesituation
10.2. Motive für die Betreuungsübernahme und Pflege
10.2.1. Sozial-normative Verpflichtung
10.2.2. Emotionale Bindung
10.2.3. Mangelnde Alternativen
10.2.4. Materielle Motive
10.2.5. Familiärer Druck
10.2.6. Sinnstiftung und Glaubensüberzeugung
10.3. Beziehungsqualität innerhalb der häuslichen Pflegesituation
10.3.1. Beziehungsqualität zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen
10.3.2. Beziehungsqualität innerhalb des Familiensystems
10.4. Zusammenfassung
11. Entscheidung für das Pflegeheim als adäquate Versorgungsform
11.1. Beweggründe für die Beendigung der häuslichen Versorgung
11.2. Akteure des Entscheidungsprozesses
11.2.1. Pflegebedürftige
11.2.2. Soziales Umfeld
11.2.3. Hausärzte
11.2.4. Nichtmedizinische professionelle Beratungsinstanzen
11.3. Emotionen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung
11.3.1. Gefühle bei den Angehörigen
11.3.2. Gefühle bei den Pflegebedürftigen
11.4. Gründe für die Auswahl der konkreten Einrichtung
11.5. Alternative Lösungsoptionen
11.6. Zusammenfassung
12. Umstellungsphase von der häuslichen Pflege auf die stationäre Versorgung
12.1. Aufnahmesituation
12.1.1. Ansprechpartner beim Einzug
12.1.2. Gestaltungsmöglichkeiten des Zimmers
12.2. Subjektives Erleben des Einzugstags
12.2.1. Atmosphäre und Emotionen beim Umzug
12.2.2. Entlastende Faktoren am Einzugstag
12.3. Umstellungsphase und Neuorientierung des Pflegenden Angehörigen
12.3.1. Emotionen in der ersten Zeit nach Beendigung der häuslichen Pflegesituation
12.3.2. Integration des Pflegebedürftigen ins Heim
12.3.3. Entlastende Faktoren und Unterstützung während der Umstellungsphase
12.4. Zusammenfassung
13. Die stationäre Einrichtung als Teil der Lebenswirklichkeit pflegender Angehöriger
13.1. Konsequenzen des Umzugs ins Pflegeheim für das Alltagserleben des Pflegenden Angehörigen
13.1.1. Kontakt zum Pflegebedürftigen – Besuchsgewohnheiten
13.1.2. Emotionen im Zusammenhang mit aktueller Pflegesituation
13.1.3. Entlastung in der aktuellen Lebenssituation
13.2. Beziehungsqualität pflegender Angehöriger/Pflegebedürftiger im Kontext der stationären Versorgung
13.3. Kontakt und Beziehungsqualität pflegender Angehöriger – Mitarbeiter im Heim / Integration des Pflegenden Angehörigen in den Wohnbereichsalltag
13.3.1. Zufriedenheit mit Pflegequalität und Atmosphäre in der Einrichtung
13.3.2. Kommunikation und Beziehungsqualität mit Mitarbeitern
13.3.3. Integration in den Wohnbereichsalltag und Übernahme von Aufgaben
13.4. Kontakt und Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen
13.5. Partizipationsmöglichkeiten für Angehörige
13.5.1. Bereitstellung von Angeboten für Angehörige und deren Nutzung
13.5.2. Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Angehörige
13.6. Kontakt zum Sozialdienst und Inanspruchnahme entsprechender Angebote
13.7. Ideen, Visionen, Anregungen
13.8. Zusammenfassung
Teil IV Angehörigenarbeit als Auftrag der Sozialen Arbeit in Pflegeheimen
14. Verortung der Sozialen Arbeit innerhalb der Angehörigenarbeit
15. Ziele und Handlungsangebote des Sozialdienstes in der Angehörigenarbeit als Konsequenz aus der Untersuchung
Schlussfolgerungen und Ausblick
Literatur
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Einleitung
„Ambulant vor stationär“ - so lautet eines der Grundprinzipien der 1995 als fünfte Säule des Sozialversicherungssystems eingeführten Pflegeversicherung. Unter diesem Leitsatz werden verschiedene Instrumente zur Förderung ambulanter Versorgungskonzepte subsumiert.
Der mit der aktuellen Altersentwicklung verbundene Anstieg von Multimorbidität und demenziellen Erkrankungsbildern wird inzwischen von zahlreichen Teilsystemen der Gesellschaft als eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahrzehnte realisiert. Dabei hat sich im Diskurs um die Versorgung der wachsenden Anzahl alter und hochaltriger pflegebedürftiger Menschen eine deutliche Stärkung ambulanter Strukturen durchgesetzt. Ein Motiv für die Präferenz ambulanter Konzepte ist die Suche nach Lösungen für den steigenden Kostendruck, der aus der rasanten Zunahme der Lebenslage „Pflegebedürftigkeit“ resultiert. Dabei wird seitens der Entscheidungsträger der Institution „Familie“ als Ressource für häusliche Versorgung und Betreuungsleistungen die größte Bedeutung zugeschrieben. Familienangehörige sind innerhalb der Pflegelandschaft nach wie vor die wichtigsten Leistungserbringer. Trotz sich wandelnder Familienstrukturen und veränderten weiblichen Erwerbsbiografien steigt infolge des demografischen Trends die absolute Anzahl der häuslichen Pflegearrangements seit Jahren kontinuierlich an.
Oftmals investieren Angehörige über Jahre hinweg ein enormes Maß an Zeit, Kraft und Energie für die Versorgung des Pflegebedürftigen. Eigene Bedürfnisse und Interessen werden nur noch reduziert bzw. gar nicht mehr gelebt und die Sorge um den Pflegebedürftigen kann sich zum alltagsbestimmenden Thema entwickeln. Bisweilen kann die Diskrepanz zwischen Pflegeaufwand und eigenen Ressourcen für pflegende Angehörige so groß werden, dass trotz Ausschöpfung ambulanter Hilfsangebote ein Umzug des Pflegebedürftigen in eine vollstationäre Einrichtung als Lösungsoption angebracht erscheint.
Insgesamt hat die stationäre Betreuung in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. In der jüngeren Vergangenheit sind unterschiedliche alternative stationäre Betreuungsformen für pflegebedürftige Menschen entstanden. Innerhalb der mittlerweile stetig bunter werdenden Palette an Angeboten kommt dabei der traditionellen Wohnform „Pflegeheim“ in Deutschland derzeit noch nach wie vor die größte Bedeutung zu.
Dass der Wechsel vom häuslichen Umfeld in eine stationäre Wohnform für den Pflegebedürftigen eine gravierende Risikosituation darstellt, ist allgemein bekannt. Die Frage, wie die verschiedenen Phasen der Integration ins Pflegeheim von Bewohnern erlebt werden, ist bereits in zahlreichen Forschungsprojekten analysiert worden.
Wie sich der Übergang von der ambulanten zur stationären Versorgung jedoch auf die pflegenden Angehörigen auswirkt und von welchen Gefühlen der Entscheidungsprozess sowie der Umzug des Pflegebedürftigen ins Heim begleitet wird, ist bislang nur marginal untersucht worden.
Die forschungsleitende Frage in der vorliegenden Diplomarbeit ist die Frage nach der Erlebensperspektive der pflegenden Angehörigen bei der Umstellung eines ambulanten auf ein stationäres Pflegesetting sowie nach den Konsequenzen, die sich daraus für den Auftrag der Sozialen Arbeit in stationären Einrichtungen ergeben.
Zunächst wird geklärt werden, welche Akteure in der häuslichen Kranken- und Altenpflege beteiligt sind, d.h. wer die pflegebedürftigen Familienmitglieder a priori versorgt und wer Pflegeleistungen empfängt.
Grundlage der weiteren Arbeit bildet eine qualitative Untersuchung anhand eines leitfadengestützten, problemzentrierten Interviews mit betroffenen Angehörigen. Nach der Darstellung der Forschungsmethode werden im dritten Teil der Arbeit die entsprechenden Untersuchungsergebnisse dargestellt.
Dabei wird zunächst die Lebenswirklichkeit von pflegenden Angehörigen vor dem Umzug ins Heim beleuchtet. Um die Auswirkungen des Wechsels ins Pflegeheim wirklich nachvollziehen zu können, wird dieser Bereich bewusst ausführlich dargestellt. Als relevante Aspekte werden neben Erfahrungen aus dem Alltagserleben und den Motiven für die Pflegeübernahme auch die Beziehungsqualität zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen näher erläutert. Im nächsten Schritt werden Faktoren des Entscheidungsprozesses aufgezeigt wie z.B. Grenzen innerhalb der häuslichen Versorgung, Akteure der Entscheidung und die Diskussion alternativer Lösungsoptionen. Die Umstellungsphase nach dem Einzug ins Heim und die damit verbundenen Erfahrungen sind ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Abschließende Themenkomplexe innerhalb der Angehörigeninterviews sind der Umgang mit der aktuellen Pflegesituation sowie die Verortung des Angehörigen innerhalb des Pflegeheimalltags.
Im letzten Teil der Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Soziale Arbeit innerhalb von stationären Einrichtungen Angehörigen bei der Bewältigung der Statuspassage „Umzug ins Pflegeheim“ Unterstützung anbieten kann. Als Konsequenz aus den Untersuchungsergebnissen werden Ziele und Forderungen für die Angehörigenarbeit formuliert, die anhand von Beispielen für Handlungsangebote der Sozialen Arbeit in Pflegeheimen konkretisiert werden.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und
Teil I „Die Familie ist der größte Pflegedienst der Nation“– Wer sind die Leistungserbringer häuslicher Alten- und Krankenpflege und wen pflegen sie?
Nach wie vor setzen Politiker und Entscheidungsträger auf Werte wie familialer Zusammenhalt und intergeneratives Verantwortungsbewusstsein, wenn es um die Frage nach Lösungskonzepten für die Bewältigung der Herausforderungen geht, welche der erwartete Anstieg der pflegebedürftigen Älteren um das Anderthalbfache bis zum Jahr 2020 mit sich bringt: „Die Bedeutung von Familie und weiteren privaten Netzen für die Unterstützung hilfe- und pflegebedürftiger Menschen ist unbestritten.... Es sind nach wie vor die näheren Angehörigen, die Unterstützung und Betreuung leisten.“ beschreibt der Fünfte deutsche Altenbericht die Situation bzgl. der Versorgung pflegebedürftiger Menschen (s. Fünfter Altenbericht, 2005, 314).
Auf welchen Fakten der inzwischen in der öffentlichen Diskussion etablierte Begriff der „Familie“ als „größtem Pflegedienst der Nation“ tatsächlich gründet, soll im Folgenden näher erläutert werden.
1 „Pflegende Angehörige“
1.1 Begriffsklärung
Innerhalb der jüngeren Fachliteratur werden unter dem Begriff „pflegender Angehöriger“ nicht nur Familienangehörige bzw. enge Bezugspersonen verstanden sondern auch Nachbarn, Freunde und andere Personen, die in die Pflege involviert sind. Entgegen dieser Entwicklung wird im Folgenden der Begriff des „pflegenden Angehörigen“ jedoch nur auf Menschen bezogen, die in einer engeren emotionalen Verbindung mit dem Pflegebedürftigen stehen. Diese Eingrenzung erfolgt auf dem Hintergrund der Forschungsfrage nach den Konsequenzen eines Eintritts ins Heim für die Angehörigen, die den Betreffenden zuvor zuhause versorgt haben. Hier ist eine Differenzierung zwischen Personen, die dem Pflegebedürftigen nahestehen und Personen, die lediglich marginal am Pflegearrangement beteiligt sind, obligat. Aus der Begriffsdefinition aufgrund der emotionalen Verbindung mit dem Pflegebedürftigen resultiert, dass diese Bezeichnung auch für Betroffene verwendet wird, deren Angehörige in einer stationären Einrichtung wohnen. Dies geschieht auch aus einem Verständnis des Pflegebegriffs heraus, der Pflege nicht ausschließlich als reduziert auf grund- und behandlungspflegerische Tätigkeiten begreift, sondern Aufgabenbereiche wie Beziehungspflege, Aufrechterhaltung von Kontakten, Vertretung von Interessen und Anliegen etc. bewusst impliziert. Wenn im Zusammenhang mit Untersuchungen bzw. Studien die Bezeichnung „pflegende Angehörige“ verwendet wird, folgt die Eingrenzung des Begriffs den Definitionskriterien der jeweils zitierten Erhebung. Diese basiert in vielen Fällen, wie z.B. in den MuG-Untersuchungen, auf einer Selbsteinschätzung der Befragten.
1.2 Profil der Pflegenden
Derzeit haben ca. 1,2 Millionen Menschen in Deutschland die Verantwortung für eine pflegebedürftige Person übernommen. Von ihnen betreuen etwa 36 % den Pflegebedürftigen als einzige Hauptpflegeperson. 29 % der Pflegenden teilen sich ihre Aufgabe mit einer weiteren Person und 27 % der Unterstützungsbedürftigen werden von drei oder mehr Personen versorgt (vgl. Meyer, 2006, 21).
Die Dauer einer Pflegebeziehung ist mit durchschnittlich 8,2 Jahren ab Beginn der ersten relevanten Unterstützungsleistungen relativ hoch. Das bedeutet, dass Pflegende häufig über einen langen Zeitraum die Belastungen der Pflegesituation bewältigen.
Oftmals befinden sich die Pflegenden selbst schon im höheren Lebensalter. Über 32 % der pflegenden Angehörigen haben das 65. Lebensjahr überschritten. Das bedeutet, dass viele Menschen in einem Alter die Verantwortung für einen Pflegebedürftigen übernehmen, in dem sie selbst schon ein erhöhtes Erkrankungs- bzw. Pflegerisiko tragen.
Die größte Gruppe unter den Pflegenden ist die mittlere Generation der 45-64-Jährigen mit einem Anteil von 48 %. Lediglich ca. 16% der Pflegepersonen sind jünger als 45 (vgl. Meyer, 2006, 21).
Eine Generationenzuordnung der pflegenden Angehörigen lässt sich auch hinsichtlich des Lebensalters der Gepflegten vornehmen: Während bei 60-79-Jährigen vorwiegend die Ehepartner im Bedarfsfall tätig werden, sind es bei den über 80-Jährigen vorwiegend Töchter und Schwiegertöchter, die Pflege leisten (Hagen, 2001, 96-97).
Die Rolle des pflegenden Angehörigen setzt nicht unbedingt voraus, im gleichen Haushalt mit dem Pflegebedürftigen zu leben. Viele Pflegende leisten Unterstützung und Betreuung trotz räumlicher Distanz, was spezifische Vor- und Nachteile impliziert. Allerdings lässt sich feststellen, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Pflegebeziehungen eine gewisse räumliche Nähe gegeben ist: Ca. 70 % der pflegenden Angehörigen leben in häuslicher Gemeinschaft mit dem Pflegebedürftigen. Weitere 14 % leben bis zu 10 Minuten entfernt und lediglich 16 % nehmen ihre Pflege- und Unterstützungsaufgaben aus größerer Entfernung wahr (MuG III, 2005, 76). Die Anzahl der Pflegebeziehungen mit einer größeren räumlichen Distanz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der steigenden Mobilität innerhalb unserer Gesellschaft künftig weiter zunehmen.
Ein interessanter Aspekt bezüglich familialer Pflege stellt ihre Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit dar: „In der Unterschicht ist die Pflegebereitschaft noch weit verbreitet. Im liberal-bürgerlichen Milieu hingegen nimmt sie allmählich ab.“ (s. Fröhlingsdorf, 2005, 88). Pflegende mit einer niedrigeren Schichtzugehörigkeit nehmen auch weniger außerhäusliche Hilfe bei ihrer Pflegetätigkeit in Anspruch als Angehörige höhergestellter Milieus (vgl. Hagen, 2001, S. 103). Als eine mögliche Ursache hierfür werden neben schichtspezifischen Wertvorstellungen auch materielle Aspekte vermutet. So haben z.B. Geringverdiener weniger finanzielle Einbußen als Besserverdienende, wenn sie zugunsten der Pflegetätigkeit ihren Arbeitsplatz aufgeben. Auch zeitliche Kriterien spielen hierbei eine Rolle, da z.B. ein arbeitsloser Angehöriger über größere zeitliche Ressourcen verfügt und die Pflegetätigkeit zudem evtl. auch als sinnstiftende, tagesstrukturierende Aufgabe begreift. Die höhere Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern wird auch als Begründung für das Phänomen herangezogen, dass dort vergleichsweise mehr Männer in häuslichen Pflegesituationen aktiv sind (vgl. Niejahr, 2007, 22).
Obwohl sich der Männeranteil unter den pflegenden Angehörigen insgesamt von 17 % zu Beginn der 90er Jahre auf 27 % merklich erhöht hat, sind Frauen innerhalb der Pflege immer noch deutlich überrepräsentiert (vgl. MuG III, 2005, 90). Manche Studien beobachten die Tendenz, dass infolge der Zunahme weiblicher Erwerbstätigkeit die Pflege durch Töchter und Schwiegertöchter leicht rückläufig ist. Ihre Position wird dann häufig durch Personen ausgeglichen, die in ihrer fehlenden bzw. geringen Beschäftigung einen Anreiz für die Pflegeübernahme sehen (vgl. Meyer, 2006, 23). Allerdings rangieren Töchter bei den Hauptpflegepersonen nach den Ehepartnern mit 25 % immer noch auf dem zweiten Platz, so dass ihre Präsenz in häuslichen Pflegesettings nach wie vor erheblich ist (vgl. MuG III, 2005, 77). Bei der Betreuung von Angehörigen mit Demenz ist die ungleiche Verteilung der Geschlechter in Bezug auf die Pflegeaufgaben sogar noch signifikanter. Wenn Männer in der häuslichen Pflege aktiv werden, sind es vorwiegend ihre Ehefrauen, deren Pflege sie übernehmen (vgl. Meyer, 2006, 22). Auch die Form, wie Männer sich an Pflege beteiligen, unterscheidet sich deutlich von den Aufgaben, die Frauen übernehmen. Während Frauen überwiegend in die „direkte“ Pflege, also auch Körperpflege und Hauswirtschaft involviert sind, übernehmen Männer häufiger Funktionen des „Pflegemanagements“, d.h. die Organisation von Pflege. Als Hintergrund dieses Phänomens wird das traditionelle Rollenverständnis vermutet, das in Pflegesituationen noch besonders evident ist: „In kaum einem anderen Lebensbereich wirken klassische Rollenerwartungen an Männer und Frauen so unwidersprochen fort wie bei der Pflege.“ (s. Niejahr, 2007, 22).
2 „Pflegebedürftige“
2.1. Begriffsklärung
Wenn im folgenden Abschnitt die Rede von „Pflegebedürftigen“ sein wird, sind ausschließlich Menschen gemeint, die im Sinne des SGB XI pflegebedürftig und in eine Pflegestufe eingruppiert sind. Menschen, die noch keiner Pflegestufe angehören, werden hier als „hilfs- bzw. unterstützungsbedürftig“ bezeichnet. Damit sollen die Definitionskriterien der diesem Abschnitt zugrunde liegenden Untersuchungsergebnisse übernommen und Missverständnissen vorgebeugt werden.
Im empirischen Teil der Arbeit wird auf diese Unterscheidung bewusst verzichtet und der Begriff „pflegebedürftig“ auf alle Personen angewandt, die auf Betreuungs- und Versorgungsleistungen angewiesen sind. Dies resultiert aus der Überlegung, dass es aus der Perspektive pflegender Angehöriger, um die es an dieser Stelle primär geht, abgesehen von finanziellen Aspekten irrelevant ist, ob der hilfebedürftige Angehörige die Kriterien für Pflegebedürftigkeit i.S.d. SGB XI erfüllt. Insbesondere in Bezug auf Menschen mit Demenz hat sich die Untauglichkeit dieses Definitionsinstruments inzwischen hinreichend bestätigt.
2.2 Profil der Pflegebedüftigen
In seinem Sonderbericht zur Lebenslage der Pflegebedürftigen ermittelte das Statistische Bundesamt, dass von den in Deutschland lebenden rund 2 Millionen pflegebedürftigen Menschen ca. drei Viertel innerhalb ihrer eigenen Häuslichkeit versorgt werden. Wurden zu Beginn der 90er-Jahre noch 1,12 Millionen pflegebedürftige Menschen zu Hause gepflegt, ist ihre Zahl mittlerweile auf 1,4 Millionen gestiegen (vgl. MuG III, 2005, 228). Gleichzeitig hat die stationäre Betreuung in den vergangenen Jahren einen noch deutlicheren Zuwachs zu verzeichnen: Zwischen 1996 und 2004 ist die Zahl der stationär betreuten Menschen um 69 % auf ca. 650 000 angestiegen (vgl. Föhlingsdorf, 2005, 87).
Etwa 75 % aller hilfebedürftigen Personen sind über 65 Jahre alt. Das Pflegerisiko steigt mit höherem Alter überproportional an: Während 2002 von den 65-74-Jährigen lediglich ca. 3% pflegebedürftig waren, sind von den über 75-84-Jährigen bereits 8,2% betroffen. Bei den über 85-Jährigen liegt der Anteil pflegebedürftiger Menschen schon bei ca. 30 % (vgl. MuG III, 2005, 228).
Von den in Privathaushalten lebenden Pflegebedürftigen werden 92 % von Angehörigen aus der Kernfamilie bzw. dem erweiterten Familienkreis unterstützt (vgl. Meyer, 2006, 12).
Ein großer Anteil der pflegebedürftigen älteren Menschen leidet an einer Erkrankung aus dem demenziellen Formenkreis, was sich als zusätzliche Herausforderung für häusliche Pflegesituationen erweist und häufig zu Grenzsituationen bzw. zur Beendigung ambulanter Pflegesettings führt. Derzeit gehen Schätzungen von über einer Million Menschen mit Demenz in Deutschland aus. Knapp die Hälfte der psychisch erkrankten pflegebedürftigen Personen wird zu Hause versorgt. Da demenzielle Erkrankungen erwiesenermaßen mit höherem Lebensalter bzw. Hochaltrigkeit zusammenhängen, ist infolge der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahren mit einem sprunghaften Anstieg dieser Krankheitsformen zu rechnen. Schätzungen gehen von einer Anzahl von 2 Millionen Betroffener im Jahr 2050 in Deutschland aus (vgl. Meyer, 2006, 32).
Die zweithäufigste psychische Erkrankung ist die Depression, von denen bei den über 65-Jährigen fast jeder Zehnte betroffen ist (vgl. Berliner Altersstudie, 1999, 185-219).
69 % der Pflegebedürftigen im Sinne des SGB XI sind Frauen. Der Anteil weiblicher Pflegebedürftiger befindet sich mit 64 % innerhalb der häuslichen Versorgung auf einem deutlich geringeren Niveau als mit 79 % in stationären Einrichtungen. Das Durchschnittsalter der im Heim gepflegten Menschen ist wesentlich höher als im häuslichen Bereich. Auch der Anteil Schwerstpflegebedürftiger (Pflegestufe III) liegt mit 26% im Heim mehr als doppelt so hoch wie in der ambulanten Versorgung (12%) (vgl. Statistisches Bundesamt, 2003, 3).
Teil II Anlage und Methodik der empirischen Untersuchung
3 Fragestellung
4 Forschungsdesign: Einzelfallanalyse
Als Untersuchungsplan wurde die innerhalb der qualitativen Forschung zentrale Einzelfallanalyse gewählt. Sie ermöglicht die Analyse von komplexen Zusammenhängen unter Betonung des lebensgeschichtlichen Hintergrunds der jeweiligen Person. Mit Hilfe dieses Instruments lassen sich sozialwissenschaftliche Hypothesen anhand eines konkreten Falls überprüfen. Mit relativ wenigen Versuchspersonen ermöglicht die Fallanalyse in die Tiefe gehende Einsichten auch in sozialwissenschaftlich schwer zugängliche Themenbereiche. Die Einzelfallanalyse kann auf vielfältigem Material basieren. Neben schriftlichen Quellen wie Tagebüchern, Krankengeschichten oder Autobiografien sind es v.a. mündliche Erzählungen, Berichte und Interviews, aus denen das entsprechende Material gewonnen wird (vgl. Mayring, 2002, 41-46). Insbesondere für die Interviews mit pflegenden Angehörigen ist der Aspekt relevant, dass die Einzelfallanalyse einen Zugang zu problematischen Themenbereichen eröffnet. „Pflegebedürftigkeit“ als nach wie vor stark tabuisiertes Thema stellt ein nicht einfach zu erschließendes Handlungsfeld dar. Viele Betroffene haben die Haltung internalisiert, dass Pflege etwas ist, das man „im Familienkreis erledigt“ und in dessen Intimität die Öffentlichkeit möglichst keinen Einblick haben soll. Besonders die Beendigung der häuslichen Pflege mit dem Umzug des Pflegebedürftigen ins Heim ist meist mit dem negativen Bild des „Abschiebens“ belegt und geschieht deshalb bevorzugt „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“. Im Rahmen einer von Vertrauen und Wertschätzung geprägten Gesprächssituation fällt es vielen Betroffenen leichter, Einblick in ihre Lebenssituation zu gewähren und über ihre Erfahrungen zu berichten, die dann auf dem Hintergrund der Lebenszusammenhänge verstehbar werden.
5 Feldzugang
Die Gesprächspartner wurden über verschiedene Zugänge gewonnen. Zwei Angehörige wurden von Sozialarbeiterinnen vermittelt, die in verschiedenen Pflegeheimen im Sozialdienst arbeiten und im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontakt zu den Betreffenden haben. Eine dieser beiden Personen war mir bereits zuvor über die örtliche Kirchengemeinde bekannt. Über den Pflegedienstleiter einer anderen Einrichtung wurden zwei weitere Interviewpartner gewonnen. Eine pflegende Angehörige wurde durch eine Mitarbeiterin der örtlichen kirchlichen Sozialstation vermittelt. Zu einer weiteren Gesprächspartnerin kam der Kontakt über private Beziehungen zustande.
6 Datenerhebung: Leitfadengestütztes, problemzentriertes Interview
Als Erhebungsinstrument wurde das problemzentrierte Interview gewählt. Unter diesem Begriff versteht man eine offene, halbstrukturierte Befragung, die sich an einem Leitfaden orientiert. Die Interviewsituation soll als möglichst freies Gespräch gestaltet werden, das sich jedoch auf eine bestimmte Fragestellung konzentriert (vgl. Mayring, 2002, 67).
Im Vorfeld der Interviews muss eine Analyse des betreffenden Problems erfolgen, auf deren Basis entsprechende Aspekte herausgearbeitet und in einem Leitfaden zusammengestellt werden. Aufgrund der vorangehenden theoretischen Erschließung des Problemfeldes ist das problemzentrierte Interview besonders für theoriegeleitete Forschungsprozesse geeignet.
Der Leitfaden für das Gespräch ist in einer bestimmten logischen Reihenfolge konzipiert und enthält entsprechende Formulierungsvorschläge. Durch die Erstellung des Leitfadens wird eine gewisse Standardisierung der Interviews erzielt. Außerdem wird mit seiner Hilfe der Gesprächspartner auf bestimmte Themen hingelenkt, ohne ihn jedoch durch Antwortvorgaben zu beschränken. Das bedeutet, dass das Interview in Form eines offenen Gesprächs erfolgt, für das eine gewisse Vertrauensbeziehung Voraussetzung ist. Diese vertrauensvolle Atmosphäre sollte mittels einer empathischen, wertschätzenden Gesprächshaltung seitens des Interviewers geschaffen werden. Wird eine solche Gesprächsbeziehung hergestellt, kann auch der Befragte vom Interview profitieren. Der Vorteil eines halboffenen Interviews liegt, verglichen mit der Datenerhebung mittels geschlossener Verfahren, in einer größeren Ehrlichkeit und Reflektiertheit der Ergebnisse (vgl. Mayring, 2002, 68-70). Im Gegensatz zu der völlig offenen, narrativen Interviewform, die mehr zu explorativen Zwecken genutzt wird, können in die problemzentrierte Befragung Erkenntnisse aus der vorangegangenen Problemanalyse miteinfließen. Dies führt zu einer erhöhten Spezifizität der Fragestellung und zu differenzierteren Ergebnissen.
Das gewonnene Material wird auf Tonträgern festgehalten und für die weitere Bearbeitung transkribiert. Dafür ist aus Datenschutzgründen das Einverständnis des Befragten einzuholen und auf eine Anonymisierung des Interviews zu achten.
7 Leitfaden
Als Grundlage für die Interviews mit den pflegenden Angehörigen wurde ein Leitfaden erstellt, der sich auf vier wesentliche Themenkomplexe der Forschungsfrage bezieht. Die Fragen sind chronologisch strukturiert und beziehen sich auf zeitlich unterschiedliche Phasen der Pflegesituation. Zu diesen vier Problemfeldern wurden jeweils Kategorien mit Fragen zu relevanten Aspekten der Thematik gebildet. Im Folgenden soll ein Überblick über die vier übergeordneten Themenkomplexe und ihre Unterkategorien erstellt werden.
Teil I: Häusliche Pflegesituation vor dem Einzug ins Pflegeheim
1. Einstieg: Entstehungsgeschichte der Pflegesituation
2. Pflegealltag, Belastungserleben
3. Entlastende Faktoren innerhalb der häuslichen Pflegesituation
4. Pflegemotive
5. Beziehungsqualität innerhalb der häuslichen Pflegesituation
Teil II: Entscheidung für das Pflegeheim als adäquate Versorgungsform / Schritte des Entscheidungsprozesses
6. Beweggründe für Beendigung der häuslichen Versorgung
7. Akteure der Entscheidung / Unterstützung und Beratung im Entscheidungsprozess
8. Emotionen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung
9. Gründe für die Auswahl der Einrichtung
10. Alternative Lösungsoptionen
Teil III: Die Zeit der Integration ins Pflegeheim im Spannungsfeld zwischen
Abschied und Neuorientierung
11. Aufnahmesituation
12. Subjektives Erleben des Einzugstags
13. Umstellungsphase und Neuorientierung des pflegenden Angehörigen
Teil IV: Die stationäre Einrichtung als Teil der Lebenswirklichkeit pflegender
Angehöriger
14. Konsequenzen des Umzugs ins Pflegeheim für das Alltagserleben des Pflegenden Angehörigen
15. Beziehungsqualität pflegender Angehöriger – Pflegebedürftiger im Kontext der stationären Versorgung
16. Kontakt und Kommunikation pflegender Angehöriger – Mitarbeiter im Heim / Integration des Pflegenden Angehörigen in den Wohnbereichsalltag
17. Kontakt und Austausch mit anderen pflegenden Angehörigen
18. Partizipationsmöglichkeiten für Angehörige
19. Kontakt zum Sozialdienst und Inanspruchnahme entsprechender Angebote
20. Ideen, Visionen, Anregungen
8 Datenauswertung: Qualitative Inhaltsanalyse auf der Basis der kommentierten Transkription
Für die Auswertung der Interviews ist es erforderlich, das Material zuvor entsprechend aufzubereiten. Vor der Bearbeitung müssen deshalb die auf Tonträgern vorliegenden Daten zunächst transkribiert werden. Hierbei stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl. Für die vorliegende Untersuchung wurde als Instrument die kommentierte Transkription verwendet. Die Form der Kommentierung erfolgte in Anlehnung an ein 1976 von W. Kallmeyer und F. Schütze entwickeltes System. Mit Hilfe der Kommentierung können über den Wortlaut hinaus auch Sprachmodus und nonverbale Kommunikationsbeiträge dargestellt werden. Diese Methode ermöglicht es, Emotionen und Informationen „zwischen den Zeilen“ besser wiederzugeben und somit zu einem tieferen Textverständnis beizutragen (vgl. Mayring, 2002, 91-92). Gerade im Hinblick auf die sensible Thematik der Problemstellung ist die Darstellung entsprechender Emotionsgehalte unverzichtbar für den Erkenntnisgewinn.
Die Auswertung des transkribierten Materials wurde anhand der qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Mit Hilfe dieser Technik können Texte systematisch analysiert werden. Die Bearbeitung und Auswertung erfolgt schrittweise mit Hilfe von am Textmaterial entwickelten Kategoriensystemen. Mayring unterscheidet dabei drei Formen dieser Methode: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (vgl. Mayring, 2002, 115). Die Auswertung der vorliegenden Untersuchung wurde in Anlehnung an die zusammenfassende Analyse vorgenommen. Ziel der Analyse ist es, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials ist“ (s. Mayring, 2003, 58).