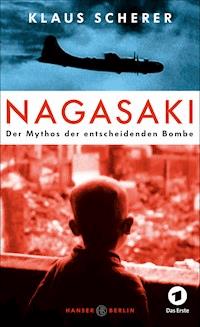7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist eine der ursprünglichsten Gegenden der Erde und zugleich der Schnittpunkt zweier Welten: die Region zwischen Sibirien und Japan. Klaus Scherer, langjähriger Asienkorrespondent der ARD und preisgekrönter Fernsehreporter, begibt sich auf eine Reise durch den unbekannten Fernen Osten: über die naturwilde, von Vulkanen bewachte Halbinsel Kamtschatka und den sturmumtosten Kurilen-Archipel bis auf Japans Nordinsel Hokkaido. Er begleitet Rentiernomaden und hartgesottene Piloten, folgt den Spuren früher Entdecker und trifft die Nachfahren der Ureinwohner, die ums Überleben kämpfen. Eine abenteuerliche Reise durch ein vergessenes Paradies – und ein großes historisches Panorama.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Klaus Scherer
Von Sibirien nach Japan
Reise durch ein vergessenes Paradies
Inhaltsverzeichnis
Karte
I. Kamtschatka
Von der Nordküste nach Petropawlowsk
Abrahamow
Im vergessenen Paradies
Die tanzenden Fischer von Kowran
Willkommen im Sperrgebiet
Im Schatten des Kljutschewskaja
Unterm Joch der Kosaken
Essos neue Gärten
Nomadenland
Tungusen-Tschums, Pyshiki und Posteli
Letzte Ausfahrt Petropawlowsk
Kamtschatski Blues
Spariwatj gegen Sperrfeuer
Friede, Freundschaft, Kaugummi
Von Kirchen und Kämpfern
Zwischen Pest und Skorbut
II. Jenseits des Alaid
Vom Kurilensee zur Straße von Nemuro
Fluchtpunkt Wildnis
Majestät Alaid
Menscheninseln
Im Bann des Taifuns
Im Niemandsland
In Schikotans Trümmern
III. Hokkaido
Vom Ostkap nach Hakodate
Westwärts in den Wohlstand
Schulklasse Japan
Männerberg und Höllental
Schicksalsstadt Hakodate
Abkehr zum Amur
Weltkulturerben
Dank
Tafelteil
I.Kamtschatka
Von der Nordküste nach Petropawlowsk
Abrahamow
Kowran, Kamtschatka. Erster Drehtag, Nebel. Durch meinen Kopf schießen Gedankenblitze, wie falsche Einzelbilder, die kaum merklich eine fertige Filmszene stören. Kindheitserinnerungen. Mein erstes Religionsbuch in der Volksschule hieß «Schild des Glaubens». Ich wunderte mich anfangs, was Bibelkunde wohl mit Verkehrsschildern zu tun habe, aber ich mochte die kleinen Zeichnungen zu den Geschichten darin. Eine zeigte den gramfaltigen Abraham draußen vor seinem Opferaltar. Bereit, Gott seinen Sohn zu geben.
Genau so steht der alte Nikita jetzt da. Stumm beugt er sich über den mit Wiesengras behäuften klotzigen Holztisch. Das Schlachtmesser fest umgriffen, den Blick angespannt. Dann sticht er langsam zu, führt die Klinge korrekt und sicher bis zum Ende des Schnitts und richtet sich auf. Er ist zufrieden. Der Tag hat ihm einen stattlichen Lachs beschert. Einen Meter dürfte er messen, gerade so wie die Schlachtbank, an der Nikita sein Leben lang den Fang zerlegt hat. Hier am Dorfrand von Kowran.
Als die Organe entnommen sind und der Alte die erste Fischhälfte vom Grätengerippe gelöst hat, wirft er den noch immer schweren Tierleib herum, sodass er auf die andere Seite klatscht. Wieder legt er erst die Filets frei, die er dann längsseits zerteilt und mit einem Faden verknotet, um sie so später zum Trocknen aufzuhängen. Mit dem Gewicht seines Körpers drückt er das Messer nun durch den knochigen Fischkopf, der krachend in Stücke zerfällt, als würde er tatsächlich nach alter Sitte geopfert. Erst der Unterkiefer, dann ein Rundschnitt unter die Kiemendeckel, dann der restliche Schädel. So hat es der Fischer von seinem Vater gelernt und dieser von seinem. So fischen die Itelmenen.
Sogar der biblische Dornbusch ist da, blitzt mir erneut ein Fehlbild dazwischen, als mein Blick kurz die Umgebung mustert. Dann lugt Nikitas treueste Zuschauerin am oberen Tischende über die Grashalmspitzen.
«Ich mag es, wenn Großvater Fische schlachtet», sagt die kleine Sascha mit scheuen, tiefschwarzen Augen unter dem Fransenhaar. Gut möglich, dass sie im Dorf bald die hübscheste Tänzerin sein wird. «Und ich esse gern seine Fischsuppe.»
Hinter ihr legt sich die dunstige Nacht auf die Hütte des Alten. Durch das gekreuzte Fenster fällt Licht auf uns.
«Was davon magst du am liebsten?», frage ich.
Da überlegt sie ein wenig, ob sie uns ihrer beider Geheimnis tatsächlich verraten soll. Dann öffnet sie langsam die kleine Faust, die etwas Rosafarbenes verborgen hält.
«Das Herz.»
Drinnen in seiner Küche bleibt dem Alten nicht mehr viel Platz. Wassereimer und Einmachgläser, Töpfe, eine Axt und die mit Sand gefüllte Blechschüssel für die Notdurft der Katze bedecken die Bodenbretter. Von der Decke her neigen sich Wäscheleinen mit Socken und Unterzeug über den Tisch, an dem wir nun sitzen. Nikita nimmt seine Wollmütze vom Kopf. Darunter kommt schlohweißes Haar zum Vorschein. Bald schon wird er achtzig Jahre alt sein. Er beugt sich über eine Schale Suppe, die er aufgekocht hat und nun vom tropfenden Löffel schlürft. Was hin und wieder an seinem Kinn herunterrinnt, pflückt er mit der freien Hand weg, als streiche sie einen Spitzbart. Dann wischt er sie am Hemd ab. Im fahlen Licht umschwirren uns Stechmücken.
«Das Dorf scheint bessere Tage gesehen zu haben», sage ich. «Was ist passiert?»
«Früher gab es hier eine Kolchose. Die hieß ‹Roter Oktober›. Die Sowjets hatten uns da hineingesteckt. Aber wir konnten immerhin davon leben. Dann hat man sie zugemacht», sagt er. «Das mit den Reformen ging alles zu schnell. Und zum Fischen erteilen sie uns keine richtigen Lizenzen. Früher, in unseren Dörfern, da ging es uns besser.»
Von seinem Sohn Oleg weiß ich, dass die Alten hier nicht gern über die Vergangenheit reden. Es gebe so viel zu beklagen, und sie hätten es ja auch lange getan, sagte er. Aber es habe nie etwas genutzt.
«Stammen die Leute alle von hier?», frage ich.
«Ich bin der Einzige aus meiner Generation, der hier geboren ist. Die anderen wurden zwangsumgesiedelt wie die meisten im Ort. Das fällt ja keinem leicht. Wem fällt es schon leicht, sein Dorf aufzugeben?»
Nikita Zaporodskij ist der erste Bewohner des sibirischen Ostens, bei dem wir auf unserer Reise zu Gast sind. Von seinem Dorf Kowran aus führt sie uns über die naturwilde, von Vulkanen bewachte Halbinsel Kamtschatka und die sturmumtosten Kurilen bis auf Japans Nordinsel Hokkaido. Auf dem Weg nehmen wir japanische Spuren in Russland auf und verfolgen russische bis zu den Gräbern des Exilfriedhofs von Hakodate, einer der schönstgelegenen Hafenstädte Nordjapans, an dessen Küste vor Jahren noch mein Berichtsgebiet als ARD-Fernostkorrespondent endete.
Wir, das ist ein Hamburger Fernsehteam auf Drehreise für eine zweiteilige TV-Reportage; zunächst mehrere Wochen im Sommer, dann weitere im Oktober, wenn in Kamtschatka der Schnee schon die Täler erreicht und auch in Japans Norden die Nächte kalt werden. Mit Kameramann Johannes Anders war ich zuletzt in Ländern unterwegs, die 2004 vom Tsunami verwüstet wurden. Kameraassistent Wolfgang Schick begleitete mich zuvor durch Südsee und Arktis. Die Tonleute Conrad Zelck und Andreas Zahrndt, die je einen Reiseteil übernehmen, und die deutsch-russische Producerin Polina Davidenko sind neu in der Crew; ebenso die Japanerin Mami Takahashi, die uns beim Dreh auf Hokkaido begleitet.
Dazu ich als Reporter mit Asien-Erfahrung, wenngleich mir Japans Grenzkontrolleure auf meinen Korrespondentenreisen schon den Zutritt auf die südlichen Kurileninseln verwehrten. Dabei reklamieren sie diese bis heute als ihre ureigenen «nördlichen Territorien» und ignorieren die nun schon sechzig Jahre währende russische Annexion. Nicht einmal Kunaschir, das in Sichtweite liegt, durfte ich von den Nordhäfen aus besuchen. Als Journalist nicht und als Ausländer schon gar nicht.
Mein Wunsch, diese weltabgewandte, weithin vergessene Gegend einmal bis nach Sibirien hinauf zu bereisen, entstand zu jener Zeit. Hin und wieder malte ich mir aus, welche Welt wohl hinter diesen wolkenverhangenen Konturen verborgen lag. Allein die Fahrtrichtung hat sich nun geändert – und folgt damit der Tradition früher Forscher, die mehr als ein Jahrhundert zuvor, meist im Auftrag der russischen Krone, aufbrachen, jene Welt zu erkunden, in der sich der weitläufige Osten des Zarenreichs damals verlor.
Im vergessenen Paradies
Selbst zu Pferd macht sich der junge Entdecker Notizen. Über sanftwellige Moosfelder sei er dem Meere zu geritten, schreibt er sich auf. Nun blicke er auf spitzkuppige Haufengebirge, die klar und schön aus der Ebene wüchsen. Mit seinem Gefolge ist er seit dem Morgen an Kamtschatkas Nordwestküste unterwegs, unweit der späteren Siedlung Kowran. Zuvor hat er einen ganzen Tag lang Sturm, Regen und «arge kurilische Winde» erlitten.
Nach drei Stunden Ritt südwärts weisen seine Begleiter auf eine schwarze Masse, die sich, von der Ebbe freigegeben, weit vor ihnen aus dem Strand wölbt und über der Vögel schwärmen. Als die Reiter sich nähern, erkennen sie den gestrandeten Wal. Er war seinen Jägern auf See zwar entkommen, aber die Harpunenwunden hatten ihn zu sehr geschwächt.
«Das Thier ist todt, jedoch noch nicht in Verwesung übergegangen», hält der Forscher fest und beginnt damit, es zu vermessen, vom «platt liegenden Schwanz» bis zu den «pinselhaften Enden der Maulbarten», die ihm – noch – den Blick ins Innere versperren. Knapp gebietet er seinen Begleitern, ein Beil zu holen, um es im Dienste der Wissenschaft beherzt ins Fischbein zu treiben. «Durch einige Hiebe war bald eine Lücke in die Bartenwand geschaffen», notiert er später. «Dahinter eröffnete sich eine dunkle, stinkende Höhlung, deren Decke aus zahllosen herabhängenden Barten bestand, während darunter eine riesige, schlüpfrige Zunge lag, in die ich beim Hineinsteigen etwas einsank.»
Im Schlund der Nasenöffnung wie im Dickicht der Barten entdeckt er noch allerlei Seegetier, das er fachkundig bestimmt. «Meine Kamtschadalen waren hoch erfreut über diesen Fund», beschließt er den Tag. Sogleich hätten sie sich daran gemacht, das Tier zu zerteilen und nach Hause zu tragen. «Hier gab es nun für längere Zeit ein schönes Hundefutter.»
Der deutsche Forscher Karl von Ditmar, eigentlich als «Beamter für besondere Aufträge im Bergfach» nach Russland entsandt, hat seine neue Stelle beim Gouverneur von Kamtschatka, dem Flottenkapitän Sawoiko, am 16.September des Jahres 1851 angetreten. Monatelang ist er zuvor durch die Weiten Sibiriens angereist, dessen östliches Ende entlang des Pazifiks damals noch als weithin unbekannt gilt. Einflussreiche adelige Lehrherren haben den jungen Mann eigens der Akademie der Wissenschaften zu St.Petersburg empfohlen, um die fremde Region in geografischer und geologischer Hinsicht zu erforschen. Auf nachdrücklichen Wunsch der russischen Verantwortlichen soll er dabei besondere Aufmerksamkeit auf das Vorkommen von Metallen, Steinkohle «und anderen schätzenswerthen Produkten des Mineralreiches» legen. Doch statt für den Zaren Bodenschätze zu orten, wird Ditmar vor allem zum Menschenentdecker – einem der ersten und eifrigsten, die das Leben in Kamtschatkas armseligen Dörfern beschreiben.
Vier Jahre lang durchquert er die Halbinsel. Schon deren Name – zu deutsch: «Land aus Feuer und Eis» – fasziniert ihn. Zwar verfasst er zunächst noch Artikel über «ostsibirische Mulden» und ähnliches. Doch bald schon zieht er völkerkundliche Vergleiche der «Korjaken und die ihnen sehr nahe verwandten Tschuktschen» vor. So wie den gestrandeten Wal erkundet er nun, von Pioniergeist und Neugier getrieben, das Vulkanland samt seinen Bewohnern.
Er steigt in den Schwefeldunst zwischen Geysiren und Gletschern, rühmt den Reichtum der Natur, die hier die Flüsse mit Lachsen wahrhaft überfüllt, und lässt sich von den Dorfältesten die bluttriefende Geschichte von Unterwerfung, Aufständen und neuerlichen Unterwerfungen erzählen, von brandschatzenden Kosakenhorden bis zu den Zwangsumsiedlungen, die es auch damals schon gab, nur da noch auf kaiserlichen Befehl. Er misst Flusslängen und Seenbreiten, studiert Klima, Pflanzenwuchs und die Chancen auf Feldbau, skizziert Rundblicke und erste geologische und ethnografische Karten, zählt in jedem Ort, den er bereist, Häuser und Vieh, Männer und Weiber, das Wild, das sie jagen, und die Fische, die sie fangen.
Bisweilen lobt er seine «Kamtschadalen» als dienstfertig und freundlich. Dann wieder bricht er selbstgerecht über ihnen den Stab, nennt sie unbrauchbar und glaubt gar an ein Phlegma, das ihnen eigen sei. «Es ist durchgehend bei allen hiesigen Völkern», resümiert er einmal, «dass ihnen das Herumnomadisieren, das Fischen und Jagen lieber ist als das Begründen einer angenehmen und behaglichen Häuslichkeit.»
Auf unserer Reise, die dort beginnt, wo Ditmar das Walmaul erforscht hat wie eine Tropfsteinhöhle, werden uns der Zeitzeuge von einst ein stiller Begleiter und seine Schilderungen ein Maßstab sein. Denn weit über seine Zeit hinaus gelten sie als der umfassendste Blick auf die Region. Und so wie einen die üppige Natur heute noch staunen macht, hat sich auch der Alltag der Bewohner oft wenig verändert. Noch immer kann man hier Landschaften begegnen, die wirken, als habe die Schöpfung sie eben erst erschaffen. Hunderte Vulkane, nach großzügiger Zählart sogar mehrere tausend, davon etwa dreißig aktiv, prägen die Halbinsel, zahlreicher und dichter als irgendwo sonst auf der Welt.
Sie von See her an den Küsten entlang rauchen zu sehen, fesselte schon die ersten Neuankömmlinge. Nicht nur, dass jene Schlote immer wieder in Flammen ausbrächen, erzählten ihnen damals die Bewohner. Manchmal gerieten sie durch das in der Luft laufende Feuer sogar nacheinander in Brand. Auch die Menge an Bären, die manche Ureinwohner noch immer gottgleich verehren, ist einzigartig. Demgegenüber verschwinden die Menschen fast. Rechnerisch verfügt ein jeder Bewohner über mehr als einen Quadratkilometer Land – auf einer Fläche, die etwa so groß ist wie Frankreich. Nur eine einzige Schotterstraße führt von der Hauptstadt Petropawlowsk 400Kilometer weit in den Norden. Dann endet sie wie alle anderen im Nichts.
Auch wir begegnen noch den kleinwüchsigen Nomaden, die einst auf ihren Rentieren reitend aus der Tundra ankamen. Wir hören von Alten wie Jungen, wie Ditmar damals schon, viel über Unrecht und Leid. Zwei weitere schmerzvolle Zäsuren hatten die Bewohner zuletzt zu ertragen: Erst die Zwangskollektivierung durch die Sowjets. Und dann den Fall in die Marktwirtschaft, der in der künstlich hochgepäppelten Peripherie des Riesenreichs nicht im Wohlstand endete, sondern im dumpfen, alles zerstörenden Aufprall. Wir erfahren vom Alltag der Matrosen, deren Dienstort noch immer am Ende der Welt liegt – und noch immer Todesgefahr birgt. Wie Ditmar raufen wir uns bisweilen die Haare über eine Art Starre, die das Land lähmt, nicht sicher allerdings, wie viel davon dem Phlegma, der Armut oder dem Wodka geschuldet ist. Und über das Fortleben der Militärbürokratie, jetzt noch gekrönt von herrschsüchtigen Geheimdiensten, die allein schon zum eigenen Nutzen den Kalten Krieg zelebrieren. Einen Krieg, der kurz nach unserer Ankunft das erste Todesopfer seit Jahrzehnten fordert – einen japanischen Krabbenfischer, den Russlands Küstenwache vor den Kurilen erschießt.
Schon Ditmar kritisiert die aus der Ferne entsandten Befehlshaber und Verwalter, obwohl sie – neben der Akademie – seine Auftraggeber und Vorgesetzten sind. «Selbst unreif zum Administriren», beschimpft er Militärs wie Beamte, «wollen sie ganz fremde Reiser auf total anders geartete Bäume aufpfropfen.» Auch jeder künftige Befehlshaber werde hier «wahrscheinlicherweise alles Gewesene wieder auf den Kopf stellen». Schon deshalb gebe es hier keine Fortentwicklung. Zwar sei die Natur so reichhaltig wie nirgendwo sonst. Doch «leere Hirne und kalte Herzen» verstünden es, diese Schätze zu ruinieren wie eine Pest.
Im März des Jahres 1855, als im Laufe des Krimkrieges um das Erbe des zerfallenden Osmanenreichs, der selbst hier noch eine Front finden sollte, der Angriff der Feinde auf Kamtschatka mit Bravour abgewehrt und in den Kirchen die eigene Kriegserklärung an sie verlesen ist, enden Ditmars Studienreisen. Dann raffen die so oft Vertriebenen einmal mehr ihr spärliches Hab und Gut zusammen, schlachten ihre Kühe und lassen die Zughunde frei, um den angeordneten Rückzug ins sibirische Hinterland anzutreten. Mit seinem Vorgesetzten Sawoiko, inzwischen zum Admiral aufgestiegen, verlässt so auch Ditmar die Bucht von Petropawlowsk, das da noch Peterpaulshafen heißt, verfolgt von den gegnerischen Fregatten. Nach ebenso tragischer wie glücklicher Flucht überlebt er, ausgerechnet dank jenes kurilischen Wetters, das er am Morgen des Walfundes noch verflucht hat. Nur ist es dieses Mal nicht der Sturmwind, sondern der Nebel – der sie unsichtbar macht.
Erst dreißig Jahre später, nach wohlmeinenden Mahnungen von Freunden, bringt der eigenwillige Forscher seine Notizen in geordneter Form zu Papier, um sie am 1.November 1888 der Akademie vorzulegen. Da hat das Zarenreich längst Nikolajewsk an der Amur-Mündung und Wladiwostok zu seinen Haupthäfen im Osten erhoben und die Überseekolonien an Amerika verkauft. «Bis dahin hatten namentlich die russischen Seefahrer auf ihren Reisen um die Welt auch Kamtschatka und den Peterpaulshafen angelaufen», schreibt Ditmar jetzt in seinem Vorwort. «Danach aber hörten auch diese gelegentlichen Besuche Kamtschatkas auf.» Selbst die nach ihm entsandten Forschungsreisenden hätten nun eher die zentralasiatischen Landstriche ins Blickfeld gerückt.
«Kamtschatka fiel einer fast gänzlichen Vergessenheit anheim», klagt er abschließend. Als habe nicht auch er gerade – mit den losen Notizen im Schrank – über Jahrzehnte dazu beigetragen.
Der Halbinsel erging es öfter so. Bis heute fühlen sich die Bewohner Kamtschatkas vom Kontinent abgeschnitten. Selbst Petropawlowsk dümpelt in seiner eigenen, einsamen Welt. Von den Kurilen, die ohnehin meist der Himmel verschluckt, nicht zu reden. Siedlungen, die uns von Landkarten dort vorgegaukelt wurden, fanden wir nur noch als verlassene Gemäuer. So manche Straßen und Wege, auf denen wir zu reisen geplant hatten, gibt es längst nicht mehr. Wenn es sie denn jemals gab.
Und auch die Ureinwohner Nordjapans, die Ainus, wurden von den Regierungen in Tokio beharrlich verleugnet, weil sie deren Reinrassigkeitsmythos störten. Eine Minderheitenpolitik erübrige sich in Japan, hieß es dort stets ebenso ignorant wie arrogant, denn im Lande gebe es nun mal keine Minderheiten.
Für das Naturparadies, das dieser Weltwinkel immer geblieben ist, war das heilsam. Für seine Bewohner nicht unbedingt.
Die tanzenden Fischer von Kowran
«Wir fliegen!»
Es war schon Nachmittag, als Polina ihr Mobiltelefon abgelegt und uns die Nachricht freudig zugerufen hatte. Seit dem Morgen hatten wir irgendwo im Landesinnern auf unseren fünfhundert Kilo Equipment gesessen und den Himmel beobachtet. Erst war er neblig und tief, dann grau und verhangen. Nie schien er sich lichten zu wollen. Erst am Nachmittag taten sich zaghaft ein paar hellblaue Löcher auf.
«Die Strecke nach Kowran sei jetzt okay, meint der Wetterdienst. Wir könnten nahe am Boden fliegen», jubelt Polina.
Für das Dorf, das zwei Flugstunden weiter nördlich liegt, nehmen wir Brot mit. Seit langem, heißt es an der Hubschrauberstation, habe es keinen Versorgungsflug mehr gegeben. Mit an Bord sind Mitglieder einer Tanzgruppe, die von einem Fest weiter südlich zurückkehren. Bald liegen sie, noch müde vom Auftritt und vom Feiern danach, auf der Klappbank längs der Bordwand übereinander. Als der Erste in der Reihe zur Seite kippte, fielen die anderen wie Mehlsäcke hinterher.
Über Felsen, die sich wie umgedrehte Schiffsrümpfe aus sattgrünen Wäldern wölben, donnern wir nordwärts. Baumlos und leer wird die Landschaft jetzt, als habe ein riesiger Gletscher sie geschleift. Dann folgen Grassteppe und Tundra. Im Tiefflug unter den Wolken erreichen wir das Grenzgebiet zwischen Itelmenen- und Korjakenstämmen, die Kamtschatka einst als Erste bewohnten. Den Norden der Halbinsel ertrotzten sich die Korjaken später als Autonomiegebiet. In Kowran leben noch beide Gruppen zusammen. Nieselregen setzt ein, sodass die Piloten die Wischer einschalten und sich näher zur Scheibe vorbeugen. Dann setzen sie neben dem Ort in den Mooskissen auf. Die prallen Reifen versinken fast völlig darin.
Schon vor der Landung hat es der wiedererwachte Tanzgruppen-Chef vor Heimweh kaum noch ausgehalten. «Kowran, Kowran», rief er unaufhörlich und reckte die Faust, obwohl er nur ein paar Tage weg gewesen war. «Schon ein einziger Tag zerreißt mir das Herz», sagte er unter Tränen. Jetzt, da ihre Eltern und Kinder sie abholen kommen, fallen sie sich in die Arme. Dann schultern sie ihre Stofftaschen und gehen durch den dichten Regen davon.
Dabei habe ich selten einen so trostlosen Ort gesehen. Die Menschen scheinen ebenso grau wie ihre mit Dachpappe vernagelten Hütten. Gebeugt stiefeln sie durch den Morast. Aus hohlen Fenstern wehen Fetzen aus Sackstoff und Folie. Nur ein paar dutzend Familien leben hier. Ein düsterer Quader mit Wohnungen steht als verfallende Gabe aus Moskau am Dorfrand – und abseits davon, wie ein Mahnmal, die Ruine einer Fabrik. Ein Mann in löchriger Pumphose, der nach Fisch riecht, schlurft herüber, um mit den Piloten zu plaudern. Als sie kurz darauf abfliegen, wirft ihn der Luftdruck fast um. Dann freut er sich über so viel unbändige Kraft. Später bekommt er mit, dass wir Deutsche sind. Er habe als Schuljunge noch unsere Wörter gelernt, weint nun auch er und zählt zögernd seine Finger von «eins» bis «zehn» ab. Unter Stalin sei man selbst dafür bestraft worden. «Die Deutschen haben es raus», endet er verbittert. «Die produzieren etwas. Wir machen hier gar nichts mehr. Wir leben im Schlamm.»
Wir folgen Oleg, der hier die Ureinwohner-Gemeinde anführt. Ein stiller, in sich ruhender Mann wie sein Vater, der mit ihm, seiner Schwester und deren Kindern in Nachbarschaft lebt und sich ebenfalls als Fischer durchschlägt. Die Unterkunft, die man uns im Ort zugewiesen hat, ist eine geräumte Wohnung in dem maroden Block. Zuletzt hat hier eine Frau aus dem Ensemble gewohnt, nun lebt sie in Chabarowsk. Eine der wenigen, die es geschafft haben. Die Verbliebenen sind arm und verbittert. Als wir uns die Dreckklumpen von den Schuhen klopfen und sie ausziehen wollen, mahnt uns Oleg, sie nicht vor der Tür abzustellen. «Sonst sind sie spätestens morgen früh weg», sagt er abgeklärt.
Drinnen riecht es nach Abflussrohr und nach süßlichem Muff. Bald wird mir klar, wie segensreich die Erfindung des Siphons war. Als Wärmequelle dient eine verbeulte Elektro-Kochplatte, die mitten im Raum steht, mit zwei blanken Drähten angeschlossen an eine aus der Wand gerissene Steckdose. Wasser gibt es nur aus dem Ortsbrunnen. Am Weg dorthin steht windschief die Dorflatrine.
Der Wohnblock hatte die Hüttensiedlung einmal als Zeichen des Fortschritts geschmückt. Nun schafft die Regierung es nicht einmal mehr, ihn instandzuhalten, geschweige denn zu beheizen. Durch das trübe Fensterglas, dessen Sprünge jemand mit Isolierband beklebt hat, sehe ich, dass die Fabrik wohl ein Stall war. Ein Hund durchwühlt offene Mülltröge. Brüchige Lattenzäune spießen Wäsche auf, bis sie trocken ist oder vergessen. Dann gehe ich in den Nebenraum, der als Küche dient. Außer dem stinkenden Spülbecken hält er einen Kartuschen-Gaskocher bereit. Die Importmarke ist gerade noch lesbar: «Dream Land».
«Na ja, wir haben auch erst 1983 fließendes Wasser bekommen», verblüfft uns Tonmann Conrad, der in der DDR aufwuchs. «Landleben halt, nur im Osten.»
Damit wir in Kowran drehen dürfen, musste Oleg uns einladen. Wenn es in diesem Dorf eine Familie gibt, die noch wirtschaften kann, dann ist es seine. Ihre drei Hütten sind klein, aber intakt, die Wände tragen sogar Farbe. Im Garten weht Wäsche. Seine Schwester lädt uns zu einer Willkommensmahlzeit ein: Fischsuppe nach Nikitas Art, Lachs und Kartoffeln. Danach sind wir auf unseren Proviant angewiesen.
«Der Milchbetrieb hat vor Jahren noch fünftausend Liter pro Jahr und Kuh abgeliefert, mehr als jeder andere in Kamtschatka», sagt Oleg. «Außerdem produzierten wir Kartoffeln. Jetzt ist der Ort leider so gut wie tot.» Die meisten Jungen, die ihr Glück unten in Petropawlowsk versuchten, kehrten wieder zurück, weil sie dort nicht mithalten könnten. In Kowrans Schule gebe es weder Physik noch Chemie. Damit könne man heute nicht einmal mehr in der Fischindustrie anfangen. «Hier gibt es keinerlei Zukunft», sagt er. «Und in den anderen Dörfern hier oben sieht es genauso aus. Überall das gleiche Elend.»
Olegs Worte sind niederschmetternd. Dennoch wundern sie uns. Nach allem, was wir hörten, gilt die Gegend als äußerst fischreich. Und die Häuser sind fast alle von Gärten umgeben, die nur überwuchert sind. Wenn die Kühe in der Kolchose viel Milch gaben, warum sollten sie es in anderen Ställen nicht auch tun? Zudem ist da das Tanz-Ensemble, das sogar schon in Europa und Amerika gastierte, um den Namen des Dorfes mit Stolz in die Welt zu tragen. Und zugleich vor Heimweh nach diesem Nest fast vergeht. Wie passt das alles zusammen?
Dann führt uns Oleg zu einer der Dorfältesten, die stumm vor ihrem Haus sitzt. «Ihre Familiengeschichte», sagt er, «ist auch die Geschichte von Kowran.»
Mutter, was fehlt dir?
Als die Uniformierten kommen, um ihren Vater mitzunehmen, verstehen die sechs Töchter nicht, was geschieht. Die älteren fünf haben in ihrem Leben nur Rentiere gesehen, denen die Familie stets hinterhergezogen war. Raissa, die Jüngste, ist noch ein Baby. Der Vater kommt ins Arbeitslager, wie viele der Rentierhalter. Es ist das übelste Jahr der Stalin-Zeit: 1938.Die Tiere gehören jetzt dem Staat. Die Arbeit der Nomaden wird fortan von anderen mitverrichtet, zwangsangesiedelt in neuen Kolchosen, den Luftschlössern der Landwirtschaftsplaner.
Erst als Raissa sechzehn ist, sieht sie den Vater wieder. Mit Mutter und Schwestern ist sie weitab von ihrer Heimat gelandet, zunächst in einem kleineren Milchbetrieb. Dann errechnen die Planer in Moskau, dass größere Einheiten auch bessere seien, lassen an der Nordwestküste einen riesigen Stall bauen und ziehen dort Arbeiter und Vieh aus anderen Kolchosen zusammen. Hier sei von jetzt an ihr Platz, wird Raissa erklärt, tagsüber als Melkerin und abends als Wache. Im Laufe der Jahre sterben Mutter, Vater und Schwestern. Nun ist sie fast siebzig und hockt auf einem umgedrehten alten Kochtopf vor ihrem Hauseingang.
«Weil mir meine Beine kaum noch gehorchen, versuche ich, nur einmal am Tag herunterzukommen», sagt sie. Auf der Stiege könne sie hinfallen. Und wenn sie Beeren suche in der Tundra, bleibe sie auch dort einfach auf ihrem Topf sitzen und pflücke alle um sie herum. Denn wenn sie Beeren im Haus habe, freuten sich ihre Enkel und kämen öfter vorbei.
«Die essen sie lieber als Süßigkeiten», lacht Raissa, die trotz all der Falten noch immer selbst ein Kindergesicht hat. «Aber pflücken wollen sie sie nicht.» Unter der Steppjacke, die einmal gelb war, ragen dürre Knie in Wollstrumpfhosen hervor. Die Füßchen stecken in lappigen Fellstiefeln. «Süßigkeiten könnte ich den Kleinen ohnehin nicht kaufen. Dafür reicht meine Rente nicht.»
Jeden Monat bekommt sie knapp elfhundert Rubel. Das sind etwa fünfunddreißig Euro – dafür, dass sie ihr Leben lang hart gearbeitet hat, für den Staat, der ihrer Familie Vater, Heimat und Rentiere nahm. «Was aus dem Dorf wurde, weiß ich nicht», seufzt sie. «Wir durften ja nicht mehr dorthin. Keiner durfte in die Dörfer zurück. Aber von überall brachte man Leute hierhier. Nur einmal hörte ich, dass daheim schon alles verfallen sei. Aber hier sieht es ja auch nicht mehr anders aus.»
«Wie kam es, dass auch die Kolchose so endete?», frage ich.
«Das hat uns ja keiner erklärt. Die wussten ja selbst nicht, warum», winkt sie ab. «Irgendwann waren die Schweine weg. Dann auch die Kühe. Mehr habe ich gar nicht mitbekommen, obwohl ich selbst mittendrin war.»
Bevor wir sie zurücklassen, frage ich sie nach dem Ensemble. Ob denn die Dorfbewohner wenigstens darauf stolz seien.
«O ja. Mein Sohn ist ja auch dabei. Sie waren sogar schon im Ausland. Und sie bringen mir immer etwas mit», lebt sie auf. Das letzte Mal sei es eine amerikanische Tasche mit Rädern gewesen. Die habe sie hier aber nicht durch die Pfützen ziehen wollen. «Wenn sie wegfahren, fragen sie immer, ‹Mutter, brauchst du etwas?› Aber ich mache mir nur noch Sorgen. Sie können dann ja die ganze Zeit keine Fische fangen.»
Zwischen Lachs und Mafia
Mit Oleg, dem alten Nikita und anderen Männern sind wir zum Fischen an der Flussmündung verabredet. Als wir Kamera und Kisten auf ihren alten Militärlaster packen, schreit uns eine Nachbarin Flüche entgegen. «Ihr wollt hier Bilder machen, und bei uns geht nicht mal der Fernseher», lallt sie. Ihr Mann uriniert derweil gegen die Hauswand. Dann krault sie einen der streunenden Hunde und fängt leise zu singen an. Hinter drei Kühen schlurft wortlos ein Alter mit Gerte vorbei.
Auch aus dem Tanzensemble fahren Fischer mit. Nahe der Steilküste steigen wir hinab zu den Holzbooten. In der letzten langgezogenen Flussbiegung wollen die Männer vom Meer her eindringende Lachse abfangen. Zuerst spannen sie ihr Netz von Boot zu Boot über den Fluss. Danach ziehen sie langsam stromabwärts. In Ufernähe schlagen sie mit Holzstangen ins Wasser, um die Lachse vom Fluchtweg abzuschrecken. Dann schließt sich die Bojenleine vor einem Flachufer zum Halbkreis, den die Fischer langsam verengen. Das Wasser darin wird unruhiger, die plätschernden Fischkörper kommen zum Vorschein. Am Ende ist es ein wilder Kampf silbrigroter, auf dem Trockenen hüpfender Leiber. Fischmäuler schnappen vergeblich, bis jede Bewegung ermattet. Zeit, die Beute zu schätzen.
Weil der Fang bescheidener ausgefallen ist als erwartet, verbleibt er ganz bei den Fischern im Dorf. «Wenn wir mehr haben, geben wir einen Teil der Filets in einer Kühlfabrik weiter südlich ab. Dort friert man sie ein, bis sie von Verarbeitern abgeholt werden, und zahlt uns fünfzig Prozent ihres Wertes», sagt Oleg. «Für ganze Fische bekommen wir einen höheren Anteil, weil etliche davon Kaviar enthalten.»
Nikita sammelt noch immer die kleineren Plattfische auf, die das Netz mitgeschleppt hat, und wirft sie in die Freiheit zurück. Die anderen rauchen erst einmal. Dann geht auch der Alte zum grünen Uferhang. Er holt wieder frisches Gras für ein Schlachtbett, das er den Fischen auch hier zurechtlegt. Was er ihnen so zurückgibt, ist das, was er selbst ausstrahlt, als Einziger: Nikita hat sich Würde bewahrt.
Ob ein Lachs Kaviar in sich trage, erkenne man von außen nicht, sagt Oleg und unterscheidet anhand der Kopfgrößen Männchen und Weibchen. Ein Fischer schneidet vor uns einem Lachs von der Stirn an einen knochigen Streifen aus Kopf und Rücken, den er hochhält. Den blutigen Rest schiebt er beiseite. «Delikatess», schwärmt er und beißt sich nun Stück um Stück weiter voran. «Itelmenischer Brauch», sagt er kauend. Mir fällt wieder ein, dass auch Nikita mir am Vorabend etwas Ähnliches in seiner Küche erklärt hatte. Da deutete ich es noch so, dass die Itelmenen den Fischen die Köpfe abbeißen würden, und notierte es ungläubig mit einem Fragezeichen. Danach hatte er abgewunken. Seine Zähne seien dafür schon lange zu schlecht.
«Schade, dass ihr nicht früher gekommen seid», seufzt der Fischer kopfschüttelnd. «Zuletzt haben wir hier nicht einmal Netze in den Fluss werfen müssen. Wir stellen dann einfach Zäune auf, die leiten den Fisch in Säcke, die sich ganz von alleine füllen. Am Ende muss man sie nur noch auf den Lastwagen laden.» Als dieser ans Flussbett gefahren kommt, werfen die Männer die glitschigen Fischkörper hinauf. Unversehrte und kopflose, ausgenommene und halb filetierte, manche noch mit herausschlingernden Fäden. In einem fleckigen Blechtopf sammelt ein anderer derweil die orangefarbenen Eierklötze, die sie aus manchen schon freigelegt hatten – den Kaviar.
Oleg ist der Vertragspartner der Kühlfabrik. Das Jahreslimit von hundert Tonnen, das die Regierung ihm und seiner Mannschaft für diese Lachssorte setzt, überschreiten sie gelegentlich. Auch er hält dies für vertretbar. Denn sie alle wissen von noch weit schlimmeren Gesetzesverstößen.
«Die größeren Fischmengen werden hier illegal gefangen und weggeworfen, sobald die Eier entnommen sind», sagt Oleg freimütig. Weil ganze Fische zu schwer seien und vergleichsweise wenig einbrächten, schnitten die Fischer dann auftragsgemäß nur den Kaviar heraus. Die Zwischenhändler zahlten in Rubel oder in Wodka. Nicht einmal seine eigenen Leute könne er davon abhalten, für die Syndikate zu arbeiten. Und auch die Regierung unterbinde es nicht. «Die wenigsten Leute hier haben Arbeit. Die offiziellen Erwerbslosenzahlen der Regierung muss man mal zwei oder drei nehmen. Die Arbeitslosigkeit liegt hier weit über fünfzig Prozent.» Entweder die Regierung wolle daran nichts ändern oder sie könne es nicht. «Vielleicht pfeift sie auch einfach auf uns. Oder sie steckt sogar selbst hinter der Mafia», sagt er. «Auch das ist nicht ausgeschlossen. Und es ist traurig.»
Ob es nicht riskant sei für ihn, uns solche Dinge zu erzählen, frage ich.
«Es sind ja offene Geheimnisse», erwidert er. «Schon die Kinder hier schwänzen die Schule, weil sie mit den Familien heimlich zum Fischen fahren. Und uns kann es passieren, dass wir nur Fangquoten für Lachssorten kriegen, die es die ganze Saison über nicht gibt. Wenn das noch drei Jahre so weitergeht, ist es mit dem Fischefangen hier sowieso erst mal vorbei.» Trotzdem spricht er von Plänen, an der Flussmündung ein eigenes Kühlhaus zu bauen. Das würde den legalen Fischern die Einnahmen verdoppeln. «Und fünfzehn neue Beschäftigte kämen vielleicht weg von den illegalen Geschäften.»
Wahrscheinlicher ist, dass sie weiterhin beides tun würden. Selbst uns gegenüber geben die Ensembletänzer zu, dass sie die Kaviarabnehmer beliefern. Die Schuld sehen auch sie bei den Fangquoten, die jedem Dorf von der Moskauer Fischereikommission zugeteilt werden – ein System, das Korruption, Unterschlagung und Schattenwirtschaft begünstigt. Auch auf See wird so ein Gutteil des Fischs von einem Boot zum nächsten geschmuggelt, bis nach Japan und Korea.
«Was sollen wir machen?», rechtfertigen sich die Fischer. «Die Fabrik zahlt uns im August erst den Lohn für den Mai und den Juni. Irgendwann will man ja seinen Kindern auch mal etwas zum Anziehen kaufen.»
Auch die Frauen der Fischer sind inzwischen zum Fluss gekommen, und mit ihnen Sascha, der ihr Großvater wieder ein Lachsherz zugesteckt hat, und ihre Kusine. Auf einer Wiese über dem Hochufer packen sie das Akkordeon aus und hängen sich Federkopfschmuck und Fellkutten mit bunten Borten um. Die beiden Mädchen schlüpfen in perlenbesetzte Pelzkleidchen. Dann wackeln sie mit Köpfen und Schultern zu fröhlich beschwingter Musik, die dunklen Pupillen immer auf uns gerichtet. Die Flachtrommel schlagend kniet einer der Tänzer zu ihnen herunter und lacht. Die Mädchenhände zeichnen Flusswellen in die Luft. Die Frauen stoßen dazu spitze Schreie aus, verbiegen die Körper und drehen sich im Kreise. Alle Augenpaare funkeln jetzt wie jene der Kinder. Die Gesichter könnten glücklicher nicht aussehen. Vergessen scheinen alle Klagen von eben.
Ein Schwarm Wildgänse überfliegt uns in Formation. Das Paradies lebt. Als Grasland, das sich hinter den Tanzenden wellt bis zum Himmel. Als Küstenlandschaft über dem dahintreibenden Strom. In den Blicken, die den Kowran’schen Widerspruch jetzt einfach auflösen. Einfach weglachen und forttanzen.
Ich schließe die Augen und bin bald verblüfft, wie sehr die Gesänge der Frauen den Schreien der Möwen gleichen.
Auf der Unterseite ihrer Trommel haben sie Orte notiert, an denen sie waren. München ist dabei und Los Angeles, kanadische Städte und norwegische und natürlich die russischen. Wie es für sie sei, nach solchen Reisen hier wieder anzukommen, frage ich.
«Manchmal würden wir schon gerne tauschen, wenigstens für eine Weile. Aber dann würde uns all das hier fehlen», antworten die Frauen. «Die Leute im Dorf hängen an uns wie wir an ihnen. Noch immer fragen wir hier die Alten, wie sie früher tanzten, damit sie es weitergeben. Und sie sind auch die Ersten, denen wir neue Tänze vorführen. Nur wenn sie ihnen gefallen, kommen sie in unser Programm.»
«Wie erfindet man einen neuen Tanz?»
«Viele Gesänge sind die der Vögel. Und manche Bewegungen schauen wir uns sogar von den Fischen ab. Wahrscheinlich könnten wir bald gar nicht mehr tanzen, wenn wir das Fischen aufgäben.»
Nach zwei Tagen sollte uns der Pilot vor Einbruch der Dunkelheit am Ortsrand abholen, um Richtung Osten nach Kljutschi zu fliegen. Die Sicht scheint passabel, die Wolkendecke ausreichend hoch. Doch dann bekommt Polina wieder Nachricht von der Fliegerstation, diesmal eine schlechte. Der Bergrücken zwischen dem Abflugort und hier sei nicht wolkenfrei. Die nächste Vorhersage komme morgen um neun. «Wir fliegen nicht», sagt sie kleinlaut.
Später sitzen wir in unserer Küche und reden über Armut und Schuld. Zunächst scheint alles klar auf der Hand zu liegen: Die Stalinisten haben den Ureinwohnern ihre Traditionen und Fähigkeiten geraubt, die sie hier hatten überleben lassen. Jetzt fehlen sie einer ganzen Generation. Die Alten hatte man auf den Melkschemel gezerrt. Die Jungen begreifen sich nicht mehr als Selbstversorger, sondern als Arbeitslose, was sie für die übrige Gesellschaft nun auch sind. Und zu Hause waren sie hier nie. Das Heimatgefühl gilt den Bewohnern, aber nicht dem Dorf selbst. Aus Korjaken- und Itelmenenkindern hatte man Russen machen wollen. Jetzt sind sie weder das eine noch das andere. Stalins Reißbrettplaner haben unterschätzt, was es heißt, Menschen die Wurzeln zu kappen.
Der Milchbetrieb habe nur funktioniert, weil die Arbeiten kontrolliert wurden, hatte auch Oleg gesagt. Als die Sowjets weg waren, sei alles zusammengebrochen. Die Kolchosendirektoren hätten die Tiere verscherbelt und sich verdrückt, wohl wissend, dass die gestützten Märkte nun fehlten. Den Bewohnern seien nur ihre Hütten geblieben. Und beim Tanzen ein paar Erinnerungen an die alte Kultur.
Aber bei Olegs Verwandten sehe es doch auch besser aus, kommen uns Einwände. Häuser und Gärten seien gepflegt, die Eltern nicht betrunken und die Kinder gewaschen. Außerdem stimme es nicht, dass den Bewohnern keine Alternativen blieben. Offensichtlich betrieben sie mit großer Energie den Kaviarschmuggel. Und verschwendeten dabei ihre eigene Ressource, den Fisch. Gärten und Gewächshäuser ließen sie derweil vergammeln. Den Rest ihres Schicksals besiegele der Wodka.