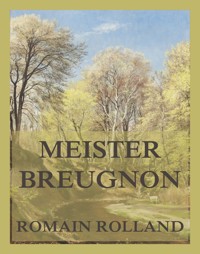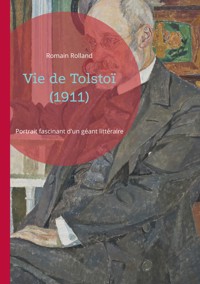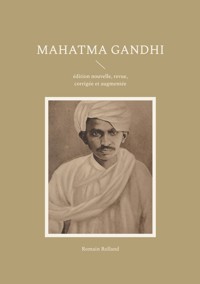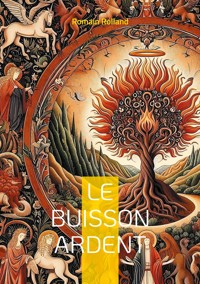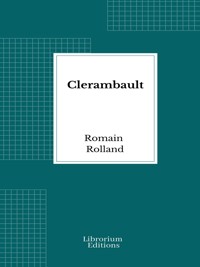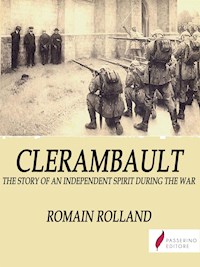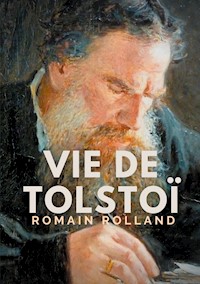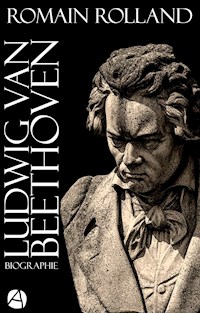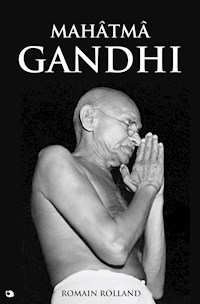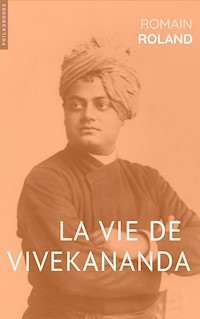19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zwei verfeindete Länder, zwei verwandte Seelen Während ihre Landsleute im ersten modernen „Großen Krieg“ gegeneinander kämpfen, werden Stefan Zweig und Romain Rolland zu intimen Brieffreunden: Von Rollands europäischer Haltung tief beeindruckt, schrieb Zweig dem französischen Schriftstellerkollegen 1910 einen Brief, der zum Anfangspunkt eines lebenslangen Zwiegesprächs werden sollte. Diese erstaunlichen Schriftstücke gewähren einen intimen Einblick in erlebte europäische (Geistes-)Geschichte und sind zugleich Belege einer großherzigen Freundschaft. Auch als der Erste Weltkrieg aufzog, hielten diese zwei europäischen Geistesgrößen des 20. Jahrhunderts an ihrem Austausch fest, an ihrer gemeinsamen Identität als Europäer. Erst in der Auseinandersetzung mit dem fünfzehn Jahre älteren Romain Rolland reifte Stefan Zweig zu dem kompromisslosen Pazifisten heran, der er für den Rest seines Lebens bleiben sollte. Diese Briefe – offenherzig das eigene Tun und Schaffen reflektierend und in Weltzusammenhänge stellend, mit ehrlicher Aufmerksamkeit für den anderen – sind gerade heute von unabweisbarer Aktualität und zugleich ein eminent wichtiges, berührendes Zeitzeugnis. Mit umfangreichem Hintergrundmaterial. Mit einem Begleitwort von Peter Handke
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Romain Rolland, Paris 1914
Romain RollandStefan Zweig
Von Welt zu Welt
Briefe einer Freundschaft 1914–1918
Mit einem Begleitwort von Peter Handke
INHALTSÜBERSICHT
Zwei Menschenkinder, zwei HochherzigeBegleitwort von Peter Handke
Der Beginn einer FreundschaftBriefe 1910–1913
1910
1911
1912
1913
Briefe 1914–1918
1914
1915
1916
1917
1918
ANHANG
Zeittafel
Personenregister
Editorische Notiz
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Über Romain Rolland und Stefan Zweig
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
PETER HANDKE
Zwei Menschenkinder,Zwei Hochherzige
Zum Briefwechsel zwischen Romain Rolland und Stefan Zweig während des Ersten Weltkriegs
Wie?: Das bald ein Jahrhundert zurückliegende Briefewechseln zwischen dem Franzosen Romain Rolland und dem österreichischen Juden und, wie er sich selbst immer wieder versteht, »Deutschen« Stefan Zweig während des Ersten Weltkriegs dem jetzigen Leser ans Leserherz – kein universelles Herz – gelegt!? Und ans Herz gelegt dieses Briefbuch überdies von einem, der den zwei Schriftstellern R. Rolland und St. Zweig kritisch (was nicht »ablehnend« oder gar »abtuend« meint) bis skeptisch begegnet (aber darin immer wieder – im Falle Zweigs –, von der Begegnung belebt), wenn er nicht, im Falle der Romane Rollands, von einer Lektüre, einer ernsthaft versuchten, eher unbeleckt geblieben ist!? Selbst Romain Rollands schallender und bis heute, anders als sein sonstiges Werk, nachhallender Aufruf zur Versöhnung, gleich bei Ausbruch des Großen Kriegs, der Grande Guerre, wie der Erste Weltkrieg in Frankreich heißt, »Au-dessus de la mêlée« (ungefähr: »Über dem Getümmel«), lockt nicht mehr so recht zur Lektüre, so pompös wie rollenspielend ist er geschrieben, und insbesondere, unter all den europäischen Völkern, großspurig wie -mächtig die Rollen verteilend, mit Frankreich und Deutschland in den Hauptrollen; wenn jener Aufruf weiterhin ein nachhallender ist, so nur noch als Wortmeldung zu einem besonderen Zeitpunkt, ist fern-fern nicht allein von dem Nachhall gottmenschlicher Worte im Hörerherzen, wovon einst Jakob Böhme in Görlitz an der Neiße geredet hat; Romain Rollands Worte in »Au-dessus de la mêlée« hallen heute, und im übrigen gleich wie schon damals im Moment, dem allerdings ihnen ein täuschend-wahres Echo verschaffenden, hohl.
Dagegen jetzt wie damals die unentwegt und inbrünstig nach Frieden rufenden, vier lange Jahre hindurch, Kriegsbriefe der beiden, Romain Rollands und Stefan Zweigs. Brandbriefe ja, aber Brandbriefe im Ansturm hin zum Frieden, zur Friedensbeschwörung, und darüber hinaus zur Friedensplanung, für die Zeit »danach«. Keine Literaten schreiben da einander, und schon gar keine Wortmelder, geschweige denn Präzeptoren, vielmehr zwei ernste, nicht tod-, nein, lebendigernste Männer, die dabei zugleich, Briefwort für Briefwort, zwei Menschenkinder sind, wie nur je welche, Menschenkinder an Hand einer Sprache, die jeweils, statt irgendeine eingebildete Öffentlichkeit zu beschallen mit der Pose des Sich-übers-Getümmel-Erhebens, an den Anderen, den bestimmten Einen sich wendet, in einem Bedürfnis, gar einer Bedürftigkeit zur Teilnahme wie Teilhabe, welche eben Menschenkindern zu eigen ist, oder wird, vor allem in einer epochalen Bedrängung.
Was der Briefwechsel, unter vielem anderen, eher nebenher auch zeigt: Dieser Andere, der bestimmte Eine, war nicht unbedingt, ein »Gewisser«. Vor allem trifft das auf den Briefschreiber Stefan Zweig zu. Der erscheint, was die Entschiedenheit und Klarheit des unbedingten Friedenswegwillens angeht, immer wieder als ein eher Unsteter – wenn nicht als Verteidiger »seiner«, der deutsch-österreichischen Kriegsseite. Und doch wieder: nein, nicht »immer wieder«, nur in den ersten Monaten des »Weltbrands« – aber was heißt da »nur«? –, siehe sein Verständnis, oder wie sie’s nennen?, für den als Präventivschlag getarnten deutschen kriegsauslösenden Überfall auf Belgien, seine Verharmlosung des deutschen Faustrechts dort in der Stadt Leuven, seine mit einem doch leichte Übelkeit erregenden Bedauern gemischte Rechtfertigung der Zerstörung der Kathedrale von Reims.
Romain Rolland, in seinen Briefen an Zweig: Von allem Anfang an nicht bloß der Eine und Bestimmte, sondern jemand Gewisser, gewiß nicht seiner Rolle, vielmehr seiner selbst als Menschenkind. Er, und wohl nicht allein, weil er der Ältere ist, zeigt sich durchwegs als der mit dem Maß, welches Stefan Zweig, zumindest in den ersten Kriegsmonaten, nie ganz verliert, doch brief(stellen)weise vor seinem Freund »in Fremdland« (Teiltitel des Aufrufs seinerseits Ende 1914 im »Berliner Tageblatt«) ziemlich blindlings sausen läßt. Schon Zweigs Vokabular – im Schwang und falschen Schwung wiederum vor allem im ersten Kriegsbriefejahr – streift ab und zu gefährlich jenes der (deutschen) Militärpropaganda, nicht nur in Einzelworten, kritiklos übernommen, wie »Kriegstüchtigkeit«, oder zu Deutschland und Frankreich als dem »Herzen Europas« – auch in Halb- und Ganzsätzen hat er, trotz all seiner herzhaften Friedenssehnsucht, anfangs etwas übrig für die »jetzige Wildheit, denn da ist Schönheit beigemengt« (Stefan Zweig in der Rolle des Waffentaufpaten eines Ernst Jünger im Stahlgewitter …), und scheint dann gar gekränkt, wenn nicht empört: »Siege wie jener von Tannenberg [von der französischen Presse?] (weggeleugnet), wo eine Viertelmillion Russen bis auf den letzten Mann [sic!] vernichtet [sic!] wurden«, so als sei solch ein Sieg, solch ein Vernichten ein schmählich vom Wind der Weltgeschichte weggeblasenes Ruhmesblatt – wobei Zweig sich ein paar Sätze darauf zu fassen scheint, indem er den Ruhm durch eine Vernichtungsschlacht letzten Endes doch nicht als vergleichbar betrachtet mit dem eines Goethe oder Beethoven. (Hm.)
Bald danach, und zugleich doch, seltsam, ganz lange danach, gar spät, erwacht Stefan Zweig aus seinem momentanen, gleichsam den Krieg auf deutscher und, mehr noch, österreichischer Seite mitfechtenden Wort- und Satztaumel, und klagt seinem Freund Romain Rolland, vielleicht auch von dessen ernstem Maß gestoßen und angesteckt, die »entsetzliche Verwüstung …, die der Krieg in meiner menschlichen, in meiner geistigen Welt angerichtet hat«, und wie er »aus dem brennenden Haus meines innern Lebens flüchten (muß), wohin – ich weiß es nicht«. Und auch so: Zerstört scheint vorerst das »Sicherheitsgefühl der vielfachen Heimat« – womit, vor allem, das Europa der vielfachen Formen, Sprachen, Weisen gemeint ist, das Europa der Kunst und der Künste.
Zwar geschieht dem Stefan Zweig auch danach noch dieser und jener Rückfall (so wenn er, über die Zerstörung von Reims, von Senlis undsofort hinaus, allein den Militärs das Recht auf Entscheidung zuspricht). Aber solche Rückfälle in einen Verlautbarungsjargon sind spätestens mit dem Ende des Jahres 1914, nach drei Kriegsmonaten (immerhin …) überstanden, und der Briefwechsel zwischen Romain Rolland und Stefan Zweig zeigt sich, wie wohl noch kein Briefwechsel in einem Weltkrieg, vor allem, was die gemeinsame, geteilte Dringlichkeit angeht, eines Sinnes, wenngleich – und das sorgt für den heute noch nach- wie auch vorleuchtenden Funkenflug fast all dieser Briefsätze der zwei – ganz und gar nicht einer einzigen, einheitlichen, einander angeglichenen Stimme. Die »vielfache Heimat«, deren Verlust Zweig gerade noch beklagt hat, sie nimmt eine Weise der Auferstehung vorweg in den so grundverschiedenen Stimmen der beiden (fast) völlig eines Sinnes Korrespondierenden.
Wie die zwei Stimmen, deren Rhythmus wie deren »melos«, unterscheiden? Es läge nah, Romain Rolland mit dem Satz von J.L. Borges zu sich selbst kommen zu lassen: »Ich bin entschieden eintönig«, aber das würde Rollands Briefschreibweise nicht gerecht. Auch er hat mehr als bloß eine Stimme, obwohl entschieden weniger, auch weniger prononciert verschiedene als der deutschösterreichische Jude, deutschjüdische Österreicher. (Dahingestellt, ob diese geringer ausgeprägte Spielfreude – die durchaus Teil eines großen Ernstes sein kann, wie oben bei Zweig – Romain Rollands Herkunftserbe aus Burgund, aus der französischen Provinz ist.) So oder so: die einmal entschieden starken, fast autoritären, einmal kindhaft zarten Stimmen Rollands zu unterscheiden, sei den nachgeborenen Briefelesern überlassen, als ein Ohrenaufgehen zusätzlich zum – versprochen! – Augenaufgehen im Lesen. Dagegen die geradezu märchenhaft mannigfaltigen, jeweils auf den ersten Ton klar erkennbaren Stimmen Stefan Zweigs … Dagegen? Daneben? Dem gegenüber. Aufregendes, hellhörig machendes Gegenüber, allein der hin und hertönenden, -lispelnden, -klagenden, -rufenden Briefschreiberstimmen – wobei Zweig, als der Brieffreund, sich immer wieder »zurücknimmt«, ein wenig anders als in seinen Artikeln und (späteren) Werken, wo zumindest mitgilt, was er einmal, als Mangel an »Effizienz«-Bewußtsein bei Rolland, fast rügt: »Für die Dinge, die mir wichtig sind, suche ich stets den größtmöglichen Widerhall.« Seine Briefe an Romain Rolland: Widerhall, und wie ein grundanderer, ein ungesuchter, und deshalb ein Jahrhundert später umso stärker, umso stiller nachhallend, auf gleiche und dabei doch grundanders melodische Weise wie »die Dinge« Romain Rollands.
Vielstimmig eines Sinnes: Kaum ein Brief aus den vier Jahren auf den beiden Seiten, der nicht den Krieg, das nichtendenwollende Gemetzel von Millionen und Abermillionen zum Thema hat. Thema? Weh, Schmerz, Mitleiden. Dazu der Zorn auf alle die Künstler, Dichter, die in diesem Weltkrieg, statt als Herz der Welt zu schlagen voll des Erbarmens, sich als herzlose Finsterlinge, oder, wenn nicht ärger, gehässig Leichtfertige und Besserwisser erweisen, lies Rollands Zorn zum Beispiel auf Thomas Mann, oder dem Völkerhaß zu verfallen scheinen, lies Zweigs wohl arg ungerechten Zorn auf seinen einst so verehrten Emile Verhaeren und dessen Empörgedicht zu der Deutschen Einfall in sein Belgien. (Und trotzdem bleiben Zweigs Worte von der »Liebe und Achtung« als der Quelle der »Inspiration«, ohne sie »keine schöpferischere Kraft« – Brief geschrieben Jahre vor dem Kriegsausbruch.)
Ein gemeinsames, gemeinsam erkanntes Dilemma der beiden – nicht Kriegs-, sondern stetigen und inständigen Friedenskorrespondenten, ein Dilemma, ein Zwiespalt, welcher sich im Fortgang der Greuel und des Grauens womöglich noch verstärkt: vom Krieg und von den Schlachten zu »schweigen«, und zugleich doch, im Sinn des Friedens, kontinuierlich (siehe allein die unvergleichliche Kontinuierlichkeit dieses Briefwechsels) das Wort zu ergreifen. »Tätiges Verbundensein«, nennt das einmal Stefan Zweig, »das bloß Betrachtende schwächt und erregt«. Und Romain Rollands Tätigkeit, weltkrieglang, beim Roten Kreuz in Genf, scheint ihm jenes tätige Empfinden kraft der Sprache nicht aufzuwiegen, wenngleich die Rot-Kreuz-Arbeit des entschiedenen Zivilisten ihn andrerseits empfindlich werden läßt für Zweigs rares Worterecken in der Militärsprache, siehe dazu sein sanften Tadel in einem Postskriptum: Des Freundes letzten paar Briefen sei anzumerken, daß er Uniform trage (St. Zw. diente eine Zeitlang, fürs erste wohl gar nicht so ungern, im k.-u.-k.-Heer).
Ein weiteres Dilemma, eins eher allein von Stefan Zweig erlittenes: Daß er einerseits wild und wilder sich aussprach gegen die »Politik« als Friedensstifter und -planer und keine Hoffnung in gleichwelche »Parteien« setzte, andrerseits jedoch sich auch von einem Alleingang nichts versprach: Weder Politik und Parteien noch Handeln auf eigene Faust bzw. eigenhändig, sondern »Organisation«, ein Traum, vorbereitet schon in einem Briefsatz lange vorher: »Wir müssen das Leiden von der Politik absondern.« Und wie stellte sich dann, etwa im dritten oder vierten Kriegsjahr, der Person die Lösung dieses Dilemmas dar? Beispielsweise so, in der beim Lesen immer aufs neue vor den Kopf stoßenden und doch bewegenden gleichsam »typischen« Stefan-Zweig’schen Kindlichkeitsweise: Seit er für die Gesamtheit arbeite, spüre er nach langem »wieder Mut und Lust, an eigenes Werk zu gehen«.
Solch Gemeinschafts- und Organisationstraum war dem Romain Rolland fern, und gewiß nicht nur, weil er für ihn bei der Rotkreuzstelle gut tausend Tage lang die oder eine Wirklichkeit war. Zwar war auch er gleich dem Stefan Zweig, wie seine Briefe in ihrem Vertrauen zum andern, ihrer »Zutraulichkeit« immer neu zeigen, jemand Kindlicher, jemand von Natur Hochherziger – die wieder unvergleichliche Hochherzigkeit der beiden! –, aber Rollands Kindlichkeit kam aus einer grundverschiedenen Quelle als der Zweigs, und, vor allem, sie wollte und, ja, zielte, wenn auch nicht ganz in die Gegenrichtung, so ziemlich woandershin. (Dazu, noch einmal: »Wollust des Verstehens … gerade in der Nichtübereinstimmung« – Zitat von wem? erraten?) Schon 1915, so Rolland, schreibe er »keine Artikel mehr«, in einem »gebieterische(n) Bedürfnis nach innerem Leben«, und es zieht ihn weg vom Zeitgeschehen in »ein Hochtal«, an »einen kühlen Bach«, der »unbekannte Dämon«, der in jedem wirke, dränge ihn zur »Kunst«, »er zerreißt mir die Flanken«.
Dem Drang vorangegangen ist jener andere, der, so Rolland später im Krieg, sein »Lebensgrund« sei, für den er sogar »die Liebe« geopfert habe: die »Unabhängigkeit«. Von diesem seinen Lebensgrund durchdrungen, erweist sich Romain Rolland immun gegen gleichwelche Organisation, paktierte und statuierte Gemeinschaft, Mehrheitsstruktur (man muß dazu nicht »Völkerbund«, etc. sagen). Immun, oder unfähig? Es sei dahingestellt. Jedenfalls verdankt sich derartiger Unfähigkeit eine der Herrlichkeiten in der herrlichen Korrespondenz unserer beiden, wenn Romain Rolland, in der Folge seiner Unabhängigkeitserklärung, unwillkürlich aufseufzt und zugleich dem Freund Zweig schreibend zuruft: »Ich habe mich immer, schon als Kind, für eine Pilgerseele gehalten … Wenn man mich beerdigen wird, so nur mit meinem Wanderstab! Und möge er dann ausschlagen wie der des TANNHÄUSER!«
Bemerkenswert gegen Ende, wie Stefan Zweig, ohne den Älteren jenseits der Fronten nachzuahmen, in eine ähnliche, wenn nicht die gleiche Richtung bewegt wird/sich bewegt. Es geht ihm auf: Es ist eine Zeit, »die dem Journalismus gehört und nicht der Kunst«, und daß selbst die vor dem Krieg von ihm verehrten Schreiber »Diener des Geldes« geworden sind, »Affen ihrer eigenen Gebärde«. Und dann, nach einer wieder typischen Zweig’schen Periode des Fastverzagens: Die »Müdigkeit … in Leidenschaft verwandelt und mein eigenes Erlebnis ins Symbol« – mit anderen Worten, Zweig ist neu unterwegs zur Kunst, oder überhaupt, 36 Jahre alt, 1917, zum ersten Mal? Zum ersten Mal jedenfalls in seinen mittlerweile wohl mehr als hundert Kriegsbriefen an Rolland kein Wort zur Aktualität, welcher auch immer, sogar ein aus- und nachdrückliches: »Nichts von der Zeit! Nichts von der Zukunft!«
Vielleicht noch bemerkenswerter endlich, wie Rolland und Zweig dann nicht bloß eines Sinnes, selbst in der »Nichtübereinstimmung«, sind, sondern, so anders als die drei Jahre zuvor, auch einstimmig, wie mit einer Stimme, unisono land- und tagversetzt, sprechen: Dem Lesenden tönen nun beide Stimmen ziemlich gleich, könnten die Rhythmen und Bilder des einen auch die des anderen sein. Zum Verwechseln ähnlich? Zum Unterscheidenlernen; zum Nuancenentdecken; zum Variantenerkennen.
Daß mit den Schlußakten der »großen Tragödie« (Zitat von wem?) mehr und mehr, neben dem Verlangen nach der Kunst, der »Arbeit am Symbol«, auch anderes ins Spiel kommt, ob naturgemäß oder zwangsläufig, besagt nicht, Romain Rolland und Stefan Zweig hätten Augen und Sinn abgewendet von dem Geschehen, weiterhin sind die Briefe Projektionen in den, einen Frieden, oder Friedensordnung, etwas Allgemeines, etwas Öffentliches, wenngleich vielleicht, was solch eine »Ordnung« oder Systematik angeht, vielleicht weniger feurig und präzise als im ersten Jahr des Kriegs.
Doch der Friede, ohne eigens projiziert oder projektiert zu werden, musiziert sozusagen mit in den ersten Alltäglichkeiten, von denen nun briefweise die Rede ist, sein kann, sein darf, so zum Beispiel, wenn Romain Rolland dem Freund von dem Hotel in der Westschweiz erzählt, das er ihm vorschlägt für ein endliches Wiedersehen (Zweig ist frei vom Militär), die Zimmer mit Blick auf die Berge von Savoyen zwar mit weniger Sonne als die mit Blick auf den Dent du Midi, »jedoch schöner«, und »nur wenige Gäste«, »man kleidet sich nach Belieben«, und eine Weise von Frieden kündigt sich sogar an, wenn Zweig dann abgestoßen ist von dem Stumpfsinn im Nobelferienort St. Moritz im Engadin. Fast schade, daß der Briefwechsel nicht ein bißchen mehr solcherart unauffälligen Friedensstoff anbietet …
Kann Ergriffenwerden zugleich lehren? Und ob, wie das diese Briefschaft von Anfang bis Ende zeigt, im Lesen »lehrreich«, »erhellend« und dabei, zuallererst, ergreifend von beider Schreiber Seite, ideales Lehren, durch Ergriffenheit, ohne daß ausdrücklich gelehrt werden soll oder will. Und besonders ergreifend werden die Briefe Zweigs und Rollands mit dem Kriegsende – der eine, wie schon zu Beginn, wieder mehr der schmetternde »Vokalist«, der andere, sonorer und traumhafter denn je, der »Konsonantier«, oder Mitlautende. Besonders ergreifend, indem, einmal, auf der sozusagen französischen Seite jeder Siegestriumph fehlt und, viel stärker noch, indem bei jedem der zwei endlich rein und hell, geradezu gebetshaft, die anhaltende Friedensinbrunst sich steigert zu einer noch unbekannten, erst zu formenden. »Oh [nur Stefan Zweig kann so ausrufen], in seiner Arbeit zu leben …, hinabzutauchen in die Abgründe des unbekannten Ich … Denn wenn ich einmal zu arbeiten beginne, gibt es keine Macht mehr über mir …« Und Rolland dann (im November 1918): »Dieses Geschrei, dieses Triumphgeheul (verführen) zum Schweigen und zur Einkehr«, und schon Monate vorher: Wir sind »die Vorläufer, die noch Finsternis umhüllt die Journalisten sind in allen Ländern gleich … Die Amerikaner befinden sich noch in der ›romantischen‹ Phase des Krieges … (empfinde für) die Menschheit … Erbarmen …, das sich aus viel Mitleid und viel Ironie zusammensetzt … keinerlei Vertrauen auf morgen. Die ›neue Welt‹ ist wie der Messias der Juden: sie soll immer kommen. Aber wir werden sie nicht sehen.« Und schon Jahre vorher Rollands Gebetsaufschrei (oder Frevel?), er werde »immer freier«, »in dem Maß, wie die Freiheit von der Erde verschwindet«.
Und jetzt hier ist es der Moment und der Ort, ein auf andere Weise gewaltiges, erhellendes Schreibwerk zum Großen Krieg zu streifen, das Buch »Wie der Weltkrieg entstand. Dargestellt nach dem Aktenmaterial des Deutschen Auswärtigen Amts«, von Karl Kautsky, zuerst verlegt bei Paul Cassirer, Berlin 1919 (inzwischen neuerschienen). Karl Kautsky ist da nicht der Politiker, oder kaum, vielmehr der gelernte Historiker, und zwar einer, von dessen Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit und doch spürbarem, dabei klärendem Zorn einmal auch in der sogenannten Neuzeit eine Geschichtsschreibung zu lesen ist, die jenseits des aktuellen Expertentums und dessen schon nach ein paar Sätzen durchschaubaren Parteientums das Ideal eines Thukydides frisch durchschimmern läßt. Allein anhand der Diplomatentelegramme, deren Syntax, deren Daten – die Kautsky immer wieder berichtigt, auch wenn’s nur um Stunden, freilich entscheidende, geht – gelingt es diesem Historiker, der bei seiner Grammatik- und Uhrzeiten-Analyse selber immer wieder von Entsetzen, zumindest Sarkastik und Hohn gepackt erscheint, montierend und collagierend zu zeigen, mit welch geradezu luziferischer Verantwortungslosigkeit, Verblendung menschen-(in dem Fall slawen-, russen-, serben-)verachtender Hybris das deutsche Reich, auf den Unheilsweg gebracht durch die sterbende, und noch möglichst viele »Feinde« mit ins Sterben nehmen wollende k.-u.-k.-Monarchie, den Weltenbrand nicht bloß »billigend in Kauf genommen«, sondern mutwillig, wenn auch in ein paar vorletzten Momenten gleichsam physikalisch zurückzuckend, losgefackelt hat, dem betrogenen und belogenen Volk voran das schon gar zu lange müßiggehende Heer »wie immer bereit«, und dem noch voran der so stupide wie machtwahnsinnige Kaiser Wilhelm, bei dessen schriftlichen Anmerkungen, so herz- wie kopflos, zu den in den letzten Wochen und Tagen zwischen den Staaten hin und hersausenden Diplomatendepeschen schrecklich klar wird, warum, mit diesem Wilhelm, das Machtkönigtum, das doch ein Giacomo Leopardi, in dessen Ursprüngen, für die naturgemäßeste der Regierungsformen betrachtet hatte, endgültig in den Orkus abstinken mußte. (Der italienische Regierungschef will neutral bleiben: Wilhelms Anmerkung: »Unerhörter Schuft!«; gegen England: »Unsere Konsuln in Türkei und Indien … müssen die ganze mohammedanische Welt gegen dieses verhaßte … Krämervolk zum wilden Aufstand entflammen. Denn wenn wir uns verbluten sollten, soll England wenigstens Indien verlieren«; die Balkanvölker europäische Kulturvölker?: »Sind eben keine …«, »die Russen … auch nicht besser«, Serbien ein selbstständiger Staat?: »… kein Staat im europäischen Sinn, sondern eine Räuberbande«; und noch einmal Italien: »es hat in Albanien still mausen wollen und das hat Österreich verpurrt«…)
Stefan Zweig, der am Anfang ja noch eine Art Achtung, wenn nicht Zutrauen zum deutschen Militär gezeigt, auch eine gewisse Zivilität der österreichisch-ungarischen Monarchie selbst im wüstesten Stellungskrieg gelebt hatte, ist mit den Jahren schrecklich und zugleich energisch erwacht. Aber er, der 1914 noch schrieb, »nur die Kämpfenden« wüßten »von der Wahrheit … Und die Kämpfenden werden immer menschlicher«, schweigt andrerseits 1918 von Schuld; Schuldzuweisungen, die ihm Jahre zuvor noch mir nichts dir nichts von Zunge und Feder gingen, werden, in den Briefen an Rolland zumindest, eher ausgespart, und die doch so ersehnte deutsche Revolution gegen das nun doch wohl durchschaute System und seine völkermordenden Krepierlaute: eitel; »sozialistische Republik«: »das Wort klingt gut«; »Deutschland … vergiftet vom Gedanken an das Geld«; »Lust …, für immer zu verstummen«; »einzige(s) [verbliebenes] Ideal … ist die Einsamkeit des Einzelnen, die unsichtbare Brüderlichkeit über die Staaten hinweg«; »zur Tatenlosigkeit verdammt … Wir haben keinerlei Einfluß auf die Wirklichkeit«. Und doch: »seine Anstrengungen verstärken«. Und immer wieder, von Anfang bis zum Ende der Kriegsbriefjahre, eine von Zweig wie Rolland, beschworene Gestalt: Tolstoj, nicht bloß dessen Leben und Werk – selbst sein Sterben sei eine »Prophetie« gewesen, eine andere »Auferstehung«. Eine so zarte wie kindliche Dankbarkeit sprüht zuletzt aus beiden Briefen, einmal aus dem Eingedenkwerden von Beispielmenschen, neben und mit Tolstoj etwa für Rolland, der andrerseits kein »Tolstojaner«, kein Wangenhinhalter ist, auch Seneca, Plinius (der Jüngere wohl?), Nicolas Poussin und vor allem Spinoza, »aus dessen Seite« einst dem angehenden Pilger »das erleuchtende Licht in mein kleines Zimmer« fiel; und Dankbarkeit zu guter Letzt (?) gegenüber dem »Schicksal«, das ihnen beiden, Rolland und Zweig, »die große Gunst« zuteilwerden ließ, »Freunde zu sein«.
»Edler Freund!«, so hat vor nun bald hundertfünf Jahren der greise und zu allem sonst griesgrämige Franz Grillparzer dem Adalbert Stifter auf dessen Geburtstagsbrief geantwortet. Romain Rolland und Stefan Zweig, diese zwei edlen Freunde: Haben sie, nach ihrem Aufbruch in ein neues Europa eingangs des Ersten Weltkriegs, nach ihrer Zuversicht hin zu einem nicht bloß deutschen, französischen, auch mehr als europäischen, zu einem »Allmenschen«, am Ende resigniert? Sich zurückgezogen in die »Innerlichkeit«? Sind geflüchtet aus der Gemeinschaft, der Polis, dem Gemeinwesen? Nein. Die zwei, jeder für sich und doch zusammen, sind in ein anderes Land gegangen, haben einen fremden, unentdeckten Kontinent zur Heim- und Arbeitsstätte gewählt.
Aber dieses andere Land gibt es nicht mehr, und seine Bewohner sind tot? Sind ausgestorben? Hat beider Zuversicht zu Europa, zu den Völkern, zum Volk – »das Volk, das herrliche, das … liebt …, (wird) in allen Ländern seinen Willen durchsetzen« – nicht recht behalten? Daß gerade »die Kämpfenden«, »die von der Wahrheit« wissen, bei ihrer Rückkehr von den Schlachtfeldern, jenes »Nie wieder Krieg!« verankern? Sind nicht die Kriege von heute »kein Thema« mehr, sind auch nicht Kriege mehr, nein, humanitäre Interventionen, chirurgische Operationen, und dort, wo sie, jeweils im Dienst der Demokratie und der Freiheit, im Dienst des Friedens im Himmelblau ihre Ätherbahnen ziehen und auf Erden ihre Operationsfelder bepflügen, garantieren unsere selbstlosen und todesmutigen Einsatztruppen die Stillegung der verfeindeten Völkerschaften, und darüber hinaus deren endgültiges Aufeinanderzugehen, die ultimative Versöhnung, das gemeinsame Chorsingen, die nicht bloß sonntäglichen, sondern alltäglichen Freundschaftsspiele und das, über unser Europa hinaus, in der ganzen, endlich »ganzen« Welt? Und insofern hätten die zwei Freunde in keine »Welt von gestern«, sondern in eine von morgen geblickt, will sagen, in die von heute, in ein System, das, wenn überhaupt, sich nur zum noch Besseren ändern wird können, und insofern wären Romain Rolland und Stefan Zweig »Propheten« gewesen, wenn auch andere als Leo Nikolajewitsch Tolstoj? Wie das? Und die beiden zu guter Letzt keine Propheten mehr, sondern – »Prophete(n) links, Prophete(n) rechts« – die Menschenkinder »in der Mitte(n)«.
Mai 2014Marquemont/Vexin
Stefan Zweig, 1920
DER BEGINNEINER FREUNDSCHAFTBRIEFE 1910–1913
1910
ROLLANDAN ZWEIG
Sonntag, l. Mai 1910
Lieber Herr Zweig
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr schönes Buch über einen Dichter, den ich bewundere, ebenso für die freundlichen Zeilen, die es begleiten. Es überrascht mich nicht, dass wir Sympathie füreinander empfinden. Seit ich zum ersten Mal Verse von Ihnen gelesen habe, weiß ich, dass wir in mancherlei Hinsicht gleich fühlen: in der Poesie der Glocken, des Wassers, der Musik und der Stille. Und Sie sind ein Europäer. Ich bin es auch, aus vollem Herzen. Die Zeit ist nicht mehr fern, da selbst Europa das kleine Vaterland sein und uns nicht mehr genügen wird. Dann werden wir das Denken anderer Völker in den poetischen Chor aufnehmen, um den harmonischen Zusammenhang der Menschheitsseele wiederherzustellen.
Seien Sie meiner aufrichtigen Wertschätzung versichert
Romain Rolland
162, boulevard Montparnasse
1911
ZWEIGAN ROLLAND
Wien VIII, Kochgasse 8
12. Februar 1911
Sehr verehrter Herr Rolland,
ich werde am 20. und 21. Februar auf einer Reise nach Amerika in Paris sein, und es wäre mir ein außerordentliches Vergnügen, wenn ich Sie aufsuchen dürfte. Der Anlass ist nicht oberflächliche Neugier; mein Besuch gilt auch ein wenig Geschäftlichem. Wir bilden zurzeit in Deutschland einen Kreis (vorläufig noch beschränkt) von Menschen, die Sie sehr lieben und die sich bei den Verlagen darum bemühen, den ganzen »Jean-Christophe« auf Deutsch übersetzt zu bekommen; wir möchten Sie auch gerne zu Vorträgen bei uns gewinnen. Das deutsche Publikum weiß noch nichts – oder doch wenig – von Ihrem Werk, aber wir wollen es übernehmen, den Mittler abzugeben. Es würde mich glücklich machen, Ihnen zu erzählen, wie sehr die Besten (und besonders in Wien) Sie lieben, und ich bitte Sie, mir die Gelegenheit zu geben, Sie zu sehen. Wenn möglich, geben Sie mir zwei verschiedene Stunden, zu denen ich Sie sehen könnte, bekannt, denn meine Freunde Bazalgette und Verhaeren werden zweifellos über meine Zeit nach meiner Ankunft disponiert haben, und ich möchte Sie nicht verfehlen. Meine Adresse in Paris ist: Hôtel du Louvre, boulevard de l’Opéra.
Nehmen Sie, verehrter Herr Rolland, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung
Stefan Zweig
ROLLANDAN ZWEIG
Sonnabend, 18. Februar 1911
Lieber Herr Zweig
Ich werde mich glücklich schätzen, Sie am Montag, dem 20., oder Dienstag, dem 21., zu empfangen, nicht bei mir zu Hause, 162, boulevard Montparnasse, sondern bei meinen Eltern, 29, avenue de l’Observatoire (gegenüber der Fontäne von Carpeaux). Ich wohne nämlich seit drei Monaten dort, in der Folge eines schweren Unfalls, dessen Opfer ich Ende Oktober wurde und der häusliche Pflege erforderlich gemacht hat. Aber jetzt bin ich einigermaßen wiederhergestellt, und einen Tag später hätte es Ihnen passieren können, mich nicht mehr in Paris anzutreffen. Ich gedenke Mittwoch oder Donnerstag nach Rom zu reisen.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihren freundlichen Brief und versichere Sie meiner herzlichen Ergebenheit
Romain Rolland
Wollen Sie es mich bitte wissen lassen, wenn Sie Dienstag kommen? Falls Ihnen der Montag besser passt, brauchen Sie nicht zu schreiben. Ich erwarte Sie.
ROLLANDAN ZWEIG
Rapallo
Mittwoch, 19. April 1911
Lieber Herr Zweig
Ich erfahre, dass sich nach dem Abdruck von Auszügen des »Jean-Christophe« im »Berliner Tageblatt« ein großes Frankfurter Verlagshaus wegen der Übersetzung des Werkes mit meinem Verleger Ollendorff in Verbindung gesetzt hat. Ich denke noch oft an unser Gespräch, das wir vor Ihrer Abreise nach Amerika geführt haben. Mein größter Wunsch wäre, falls es sich einrichten ließe, dass Sie die deutsche Übersetzung des »Jean-Christophe« übernehmen oder sich wenigstens darum kümmern würden. Wenn Sie diese Idee nicht aufgegeben haben, wäre es jetzt an der Zeit, unverzüglich mit Ollendorff zu verhandeln. Ich habe schon an Humblot, den Direktor der Société d’Editions littéraires et artistiques (Librairie P. Ollendorff, 50, Chaussée d’Antin), geschrieben. Für den Fall, dass er gleichzeitig auch Angebote anderer deutscher Verleger erhalten sollte, bitte ich ihn, dass er Sie bevorzugt. Ich dränge darauf, dass er sich mit Ihnen zu verständigen versucht, gegebenenfalls mit einigen Zugeständnissen. Sie müssten ihm umgehend schreiben.
Nehmen Sie meine herzlichen Grüße entgegen
Romain Rolland
Ich bin nur auf der Durchreise in Rapallo. Ich komme aus Rom und werde mich in irgendeinen Winkel Oberitaliens zurückziehen, um zu arbeiten. Ich kann Ihnen keine genaue Adresse angeben. Aber schreiben Sie ruhig nach Paris, 29, avenue de l’Observatoire, die Post wird mir nachgeschickt.
ZWEIGAN ROLLAND
Wien VIII, Kochgasse 8
[Poststempel: 23.4.1911]
Sehr verehrter Herr Rolland, gerade nach Wien zurückgekehrt, erfahre ich glücklich, dass man dank unserer Bemühungen in Deutschland endlich mit »Jean-Christophe« beschäftigt ist. Ich werde heute nicht an Herrn Ollendorff, sondern an den Frankfurter Verleger schreiben, der mutmaßlich kein anderer ist als Rütten & Loening, die mir schon verschiedene Angebote machten, für ihr Haus zu arbeiten. In diesem Falle könnte ich die Auswahl der Übersetzer überwachen, vielleicht ein Vorwort hinzugeben: ich hätte große Lust, das Buch selber zu übersetzen, aber im Moment habe ich dafür keine Zeit. Ich habe 1½ Jahre meines Lebens an die Herausgabe von Verhaeren gesetzt (die ein sehr großer Erfolg ist) und muss auf mehrere Jahre nun an eigene Werke denken. Aber seien Sie versichert, auch ohne materielle Beteiligung werde ich, wenn der Verleger es gestattet, die ganze moralische Verantwortlichkeit auf mich nehmen, damit die deutsche Ausgabe Ihres Meisterwerkes würdig sei.
Ich hörte in Boston häufig Ihren Namen. Sie haben dort gute Freunde, und auch in Havanna sah ich spanische Übersetzungen des »Jean-Christophe«. Es machte mich glücklich, zu sehen, wie das Schweigen der andern nichts auszurichten vermag gegen die Stimme des großen Werkes und wie das Verdienst immer doch stärker ist als die Gleichgültigkeit oder der Neid der andern.
Mit großer Freude gedenke ich meines Besuches bei Ihnen in Paris und wünsche noch einmal und aus ganzem Herzen, Sie möchten, von Venedig heimkehrend, den Weg über Wien nehmen. Es ist nur eine Nacht zu reisen, und Sie werden eine schöne Stadt sehen, voller Erinnerungen an die großen Meister, eine hervorragende Oper (»Rosenkavalier«, »Elektra«), und es hieße keine Zeit verlieren, wenn Sie auf der Rückreise einen Tag in Salzburg oder München verweilten. Sie werden hier viele finden, die Sie lieben und bewundern.
Sobald ich Nachrichten erhalte, wende ich mich gleich an Sie. Treulichst Ihr
Stefan Zweig
ZWEIGAN ROLLAND
Wien VIII, Kochgasse 8
26. April [1911]
In Eile
Sehr verehrter Herr Rolland, ich habe Antwort von dem Frankfurter Verleger. Er schreibt mir, dass er glücklich wäre, wenn ich mich der deutschen Herausgabe des »Jean-Christophe« annehmen wollte, und ich bin sicher, wir werden gut zusammenarbeiten, um Sie den Deutschen würdig zu präsentieren. Was ihn noch zurückhält, sind die Forderungen Ollendorffs, der nur 1000 Francs für den Band verlangt, vorausgesetzt jedoch, dass sie sämtlich erworben werden, eine Zahlung also von 10000 Francs auf einen Schlag, dazu die Honorare für die Übersetzer (und ich werde nur hervorragende genehmigen). Ich glaube, das ist zu viel, selbst für einen kühnen Verlag wie den Frankfurter, und ich habe ihm geraten, seine Vorschläge zuerst Ihnen zu unterbreiten. Selbstverständlich bin ich nicht gesonnen, Ihnen ungünstige Vertragsschlüsse einzureden, aber ich glaube, dass eine deutsche Ausgabe mit ihrem Widerhall außerordentlichen Einfluss auf den Verkauf der originalen Ausgaben hätte (genauso war es bei Verhaeren, wo der Verleger den Vorteil begriffen hatte). Ich wage nicht, Ihnen Ratschläge zu erteilen, hoffe aber, dass man sich einigen kann. Derselbe Verlag könnte auch »Beethoven«, »Michelangelo« und »Tolstoi« herausbringen und Ihre Werke in seiner Hand vereinigen.
Ich hoffe, die materiellen Verhandlungen werden bald beendet sein und wir können uns mit der künstlerischen Frage befassen. Es wäre nach meiner Ansicht sehr wünschenswert, wenn Sie für die deutsche Ausgabe ein spezielles Vorwort verfassen würden, zudem werde ich Ihrem Gesamtwerk einen Essay widmen. Aber noch ist es verfrüht, darüber zu sprechen.
Bitte glauben Sie, sehr verehrter Herr Rolland, an meine tiefe Zuneigung, die mir, wie ich hoffe, die Mittel geben wird, meine Aufgabe gut und gewissenhaft zu tun. Es gibt keine schöpferischere Kraft als Liebe und Achtung, und überall, wo diese sind, ist die Inspiration nicht fern. Getreulichst Ihr
Stefan Zweig
1912
ZWEIGAN ROLLAND
Wien VIII, Kochgasse 8
17. Februar 1912
Sehr verehrter Herr Rolland,
der Frankfurter Verlag Rütten & Loening unterrichtet mich, dass er mit Ihrem Pariser Verleger die Publikation des »Jean-Christophe« beschlossen hat. Mir ist dies eine große Freude, und ich beglückwünsche Sie, als Herausgeber und Übersetzer Herrn Otto Grautoff gewählt zu haben, der zurzeit vermutlich unter allen Deutschen die umfänglichsten Kenntnisse über die moderne Literatur in Frankreich besitzt. Endlich also soll »Jean-Christophe« erscheinen! Ich war dieserhalb mit deutschen Verlegern im Gespräch (vornehmlich mit S. Fischer, dem besten), aber er zögerte noch, und nun erwirbt sich Rütten & Loening das Verdienst um die Edition dieses Meisterwerkes.
Aber Herrn Fischer habe ich bereits versprochen, für seine Zeitschrift »Die Neue Rundschau«, die beste in Deutschland, einen großen Essay über »Jean-Christophe« zu schreiben, und warte nur mehr auf den zehnten Band. Vor wenigem erst las ich »Le Buisson ardent« und bedaure nun lebhaft, im Französischen nicht genug heimisch zu sein, um Ihnen ausdrücken zu können, wie tief bewegt ich war von dieser stetig sich erhöhenden moralischen Kraft. Mit Ungeduld erwarte ich den zehnten Band, um es deutsch zu sagen. Zum Glück sind Sie einer der wenigen in Frankreich, die ohne Mittler zu lesen vermögen, was wir schreiben.
Erlauben Sie mir, Ihnen meine frühere kleine Bitte zu wiederholen, die Sie freundlichst gewährt hatten: einen Teil des Manuskripts von »Jean-Christophe« oder eine andere Handschrift von Ihnen. Seien Sie versichert, dass ich sie mit höchster Sorgfalt aufbewahren werde: sie wird einer Sammlung von Autographen meiner geliebtesten Autoren zugehören und eine Novelle von Balzac und eine von Flaubert zu Nachbarn haben.
Ganz glücklich war ich heute Morgen, dass mein Wunsch, »Jean-Christophe« möge nach Deutschland heimkehren, endlich Wirklichkeit werden soll, und ich konnte nicht anders, wie Ihnen diese armen Worte der Freude und Erwartung zu senden. In Treue Ihr
Stefan Zweig
ROLLANDAN ZWEIG
Freitag, 23. Februar 1912
Lieber Herr Zweig
Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Brief. Ich bin glücklich, dass mein »Jean-Christophe« auf Deutsch herauskommt und dass Otto Grautoff bereit ist, die Übersetzung zu übernehmen. Ich bin sicher, dass er es mit aller Sorgfalt und allem wünschenswerten künstlerischen Einfühlungsvermögen tun wird. Der Verlag Rütten & Loening bereitet mir hingegen einige Sorge. Die Verhandlungen sind so schleppend vorangegangen, dass Ollendorff, weil ein Antwortbrief wochenlang ausblieb, drauf und dran war, sie abzubrechen; und noch heute sind nicht alle Formalitäten des Vertrages geregelt. Ich glaube, dass Rütten & Loening es nicht besonders eilig hat, das Werk herauszubringen.
Ich habe mit lebhaftem Interesse die »Vier Geschichten aus dem Kinderland« gelesen, die Sie mir freundlicherweise zugeschickt haben. Ich war bezaubert von der Kunst, mit der Sie diese jungen Seelen durchdrungen haben, jenes Zwitterhafte, das man zwischen zwölf und fünfzehn Jahren in sich trägt. Vor allem bewundere ich diese Stürme der Liebe und der leidenschaftlichen Eifersucht im Herzen des kleinen Schotten und des kleinen Juden vom Semmering.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!