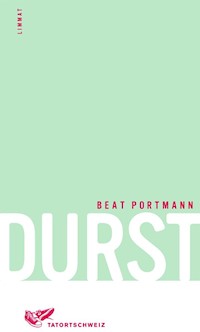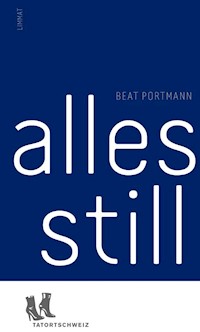Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine legendenumrankte Handschrift aus dem mittelalterlichen Sizilien erhitzt die Gemüter. Steckt vielleicht doch mehr Islam in der Geschichte Europas, als wir wahrhaben wollen? Zumindest behauptet dies ein renommierter Mittelalterforscher in einem Interview und gerät prompt zwischen die Fronten. Dubiose Kreuzzügler, Islamisten und Minarettgegner heften sich an seine Fersen - und mit ihnen der Erzähler und Krimiautor wider Willen im Auftrag eines öffentlichkeitsscheuen Mäzens. Doch wer zieht im Hintergrund die Fäden? Während der Erzähler einem der bestgehüteten Geheimnisse der Geschichte auf den Grund geht, kommen ihm mehr und mehr Zweifel an seiner eigenen Existenz. "Vor der Zeit" ist ein überraschender Roman über das monotheistische Erbe Europas und über das Verhältnis von Offenbarung, Schrift und Literatur und nicht zuletzt über die ewige Sehnsucht des Autors nach dem Roman der Romane.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beat Portmann, geboren 1976 in Luzern. Vorkurs an der Jazzabteilung der Musikhochschule Luzern. Er wurde mit einem Werkpreis des Kantons und der Stadt Luzern ausgezeichnet. Sein Kartenspiel «jarmony» wurde von der Musikhochschule Luzern herausgegeben. 2013 wurde sein Theaterstück «Wetterleuchten» von Volker Hesse uraufgeführt. Im Limmat Verlag sind die beiden ersten Romane der Trilogie mit dem namenlosen Ermittler-Erzähler, «Durst» und «Alles still», lieferbar. Beat Portmann lebt als freier Autor und Singer / Songwriter in Emmenbrücke.
BEAT PORTMANN
VOR DER ZEIT
Roman
Meinen Eltern
Ein jedes Ding hat seine feste Zeit,
im Todesschicksal enden alle Wünsche.
In ihrem unentwegten Wandel trägt
die Zeit die Farben des Chamäleons.
In ihrer Hand sind wir die Schachfiguren –
wie oft erliegt ein König einem Bauern.
Ibn al-Labbâna
Wie jede Geschichte vom Werden und Vergehen hat auch diese Geschichte weder Anfang noch Ende. Ihre Erzählung beginnt in der Erinnerung oder der Vorstellungskraft, sie beginnt damit, dass ich den alten Park heraufbeschwöre, das Kreisen der Mücken, den ekstatischen Gesang der Zikaden, den Windhauch in den Kronen der Kiefern; Zwergpalmen, Dattelpalmen, Orangenbäume und wilde Farne – mit leichter Hand um die kleine Normannenkirche angeordnet, die wie eine Erhebung der Erde selbst in der Brandung der Zeit steht.
Ich stelle mir vor, wie Ralph Thelmann dort über das verdorrte Gras ging, mit seiner ganzen Größe und den linkischen Bewegungen des Gelehrten, Schritt vor Schritt setzte und seinen Gedanken nachhing, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Er sah zu der Stelle und erblickte eine Rotte schwarzer, bulliger Körper. «Wildschweine!», schoss es ihm durch den Kopf. Sie mussten ihn schon etwas früher entdeckt haben und näherten sich entschlossen. Er sah sich um, wich zögernd zurück. Ein großes Tier trieb ihn vor sich her – Meter um Meter, mit dem ihm eigenen Ernst –, bis er sich schließlich umwandte, zu laufen begann und durch den Seiteneingang in die Kirche floh.
Ein Mitarbeiter, der das poröse Fundament der Westmauer präparierte, sah auf. Thelmann ging geradewegs auf eine Tasche zu, die an einem Fuß des marmornen Sarkophages lehnte, und zog eine Feldflasche hervor. Ein Schuss fiel, und kurz darauf ein zweiter. Die Männer in dem hohen, von einer zentralen Kuppel überdachten Raum erstarrten – der Zeichner, der sich bei der Apsis befand, der Grabungstechniker im Sondierfenster, Thelmann. Nach einigen Sekunden erschien im gleißenden Rechteck der Tür eine Silhouette, eine zweite folgte. Die Eindringlinge hatten ihre Gewehre über die Schultern gehängt und sahen sich grußlos um. Der Erste zeigte auf Thelmann und bedeutete ihm, mit ihnen mitzukommen. Ihre Entschlossenheit und der Umstand, dass sie bewaffnet waren, ließen keinen Gedanken an Widerspruch aufkommen. Nur der Grabungstechniker erkundigte sich mit fester Stimme, was sie hier zu suchen hätten. Niemand beachtete ihn.
Einer der Männer trat auf Thelmann zu, legte ihm die Hand auf den Rücken und führte ihn zur Tür. Draußen wartete ein weiterer Bewaffneter. Gemeinsam verließen sie den Park und gelangten zu einem schwarzen Geländewagen, der vor einer Zeile Zypressen stand. Etwas später bog der Wagen in die unbefestigte Straße ein und verschwand in einer Staubwolke, die noch lange in der Luft stehen blieb.
Es war einer dieser unwirklichen Föhntage, an denen die Hitze direkt aus dem Innern des Planeten kommt und die Dinge mit einer Gewalt durchdringt, die sie stärker noch als die Schwerkraft an die Erde bindet. Das Licht schien nicht von einem bestimmten Punkt, der Sonne, auszugehen, vielmehr leuchteten die Gegenständen aus sich heraus – eine Überdeutlichkeit der Farben und Konturen, die schmerzte. Wie eine Luftspiegelung standen die Alpen über den Dächern der Stadt und ritzten mit ihren Firsten den Himmel, dessen Blau an alte kolorierte Postkarten erinnerte.
Ich saß in einer Gartenwirtschaft an der Reuss, trank und nahm gelegentlich von den Passanten Notiz, die im beschädigten Film meiner Wahrnehmung auftauchten und wieder verschwanden. Irgendwo erhielt das Rattern eines Presslufthammers das Prinzip ökonomischer Betriebsamkeit aufrecht, ansonsten lag Ruhe über den Gassen und Plätzen der Stadt. Schläfrig ließen sich Schwäne, Enten und Blesshühner stromabwärts treiben. Die Hitze hatte den Tag in ein Negativ der Nacht verwandelt.
Ich legte mir Rechenschaft ab über mein Leben. Nicht aus Sentimentalität oder Pflichtbewusstsein oder gar in der Absicht, eine Entscheidung zu treffen. Es war mir einfach zur Gewohnheit geworden. Seit meinem letzten veröffentlichten Roman waren beinahe neun Jahre vergangen. In diesen neun Jahren hatte mein Verlag mehrere Arbeiten abgelehnt, darunter eine siebenhundertseitige Erzählung, die im Stil eines experimentellen Märchens von der Geworfenheit des Menschen in die Welt handelte. Mein Verleger hatte formelle Mängel vorgeschoben – «eine Geschichte muss sich aus sich selbst erklären» –, schließlich aber durchblicken lassen, dass er sich von mir etwas Verkäufliches wünschte, also noch einmal einen Kriminalroman.
Ich bestellte ein weiteres Bier. Menschen schlichen vorbei wie ihre bewusstlosen Doppelgänger. Ich ließ den Blick über die Häuserfront am jenseitigen Ufer schweifen und atmete den Seegeruch der Reuss – eine Ahnung von immer schattigen Buchten und sonnenglitzernden Wassern, von Fischen, Algen und dem Treibstoff der Motorboote.
Ich hatte mit einer Frau, die ich kaum kannte, ein Kind gezeugt, das ich so gut wie nie sah. Ich war mit den Alimentenzahlungen um Monate im Rückstand und lebte mehr schlecht als recht von der Hinterlassenschaft meiner Mutter. Ich trank viel, und ich verwirrte meinen Geist regelmäßig mit dem Konsum von Cannabis. Trotzdem stand ich jeden Mittag auf und saß meine Stunden am Schreibtisch ab, feilte an Sätzen, rang um Worte, haschte nach flüchtigen Metaphern; brütete oft auch nur dumpf vor mich hin.
Es war kurz vor Feierabend. Die narzisstische kleine Stadt, seit jeher gegen Süden ausgerichtet, gefiel sich in der Nachahmung ihrer mediterranen Vorbilder, Bühne und Protagonist der kultivierten Lebensart zugleich zu sein. Endlich konnten ihre alten Gemäuer austrocknen, ihre Büsten und Pilaster, Voluten und Rustikaquader aus dem Dämmerlicht des Nordens treten.
Auf einem Balkon hoch über der Reuss hatten sich drei Männer versammelt. Sie trugen elegante Anzüge und gestikulierten, wie es eher südlich der Alpen üblich ist. Oder stritten sie sich? Ich stellte mein Glas ab, vergaß die Zigarette im Aschenbecher. Bahnte sich da ein Handgemenge an?
Als der eine von ihnen stürzt, ist es zu spät zu reagieren. Ich kann nur zusehen, wie er das Geländer touchiert, sich überschlägt und ins Wasser klatscht. Der Schreck ist lautlos; es ist zu heiß, als dass sich jemand die Mühe zu schreien machte.
Hätte ich so einen letzten Kriminalroman beginnen können? Warum sollte ich mir die Handlung nicht einfach ausdenken, vom Anfang bis zum Ende, statt mich wie bisher auf wahre Begebenheiten zu stützen? Ich hätte jederzeit alles unter Kontrolle, würde mich in keine amourösen Geschichten verstricken und könnte mich zum strahlenden Helden aufschwingen, der im richtigen Moment die richtige Entscheidung trifft und entschlossen zur Tat schreitet.
Ein Kellner am gegenüberliegenden Ufer beugte sich übers Geländer. Was sah er da? Ich bezahlte meine Rechnung und stand auf. Mir wurde schwindlig, aber das kannte ich. Nach einigen Sekunden war es vorbei.
Ich ging das linke Ufer entlang und blieb beim Nadelwehr stehen. Ich versuchte mir vorzustellen, wohin der leblose Körper treiben würde. Würde er sich im Rechen des Kraftwerks verfangen oder wäre es ihm vergönnt, entlang dem Stirnwehr in den unteren Flusslauf zu gelangen? Das Rauschen meiner Blutzirkulation überlagerte das Tosen des Wassers, ich konnte seinen Hauch auf meiner Haut spüren – alles war in Bewegung, alles strebte der smaragdgrünen Wasserzunge zu, in die sich zu versenken Erlösung bedeuten müsste. Ich raffte mich auf und trat den Heimweg an.
Zu Hause legte ich mich aufs Sofa. Als ich wieder erwachte, verwischte die Dämmerung gerade die letzten Spuren des Tages. Ich richtete mich auf und stützte den Kopf in die Hände. Dann musste ich an den stürzenden Mann denken, daran, wie er auf dem Geländer aufschlug. Ich spielte es vor meinem inneren Auge durch, so lange, bis ich mir sicher war, das Knacken des Genickbruchs im Ohr zu haben. Ich stand auf und kochte Kaffee. Natürlich hatte ich mir das alles nur ausgedacht.
Ich wollte mir gerade eine Tasse einschenken, als das Telefon klingelte. Mit Befremden lauschte ich der Melodie, die ich tatsächlich vergessen zu haben glaubte. Seit meinem Zerwürfnis mit Adnan gab es nicht mehr allzu viele Leute, denen es in den Sinn hätte kommen können, mich anzurufen. Ich nahm den Hörer ab und räusperte mich.
Eine männliche Stimme sprach mich mit meinem Nachnamen an und erkundigte sich, ob ich der gleichnamige Schriftsteller sei.
Ich räusperte mich ein zweites Mal, diesmal kräftiger, worauf die Stimme die Frage wiederholte. Ich bestätigte, dass ich unter genanntem Namen Bücher veröffentlicht hätte. Der Mann stellte sich vor und erklärte, im Auftrag eines bedeutenden Mäzens anzurufen, dessen Namen er jedoch nicht preisgeben dürfe. Dieser sei ein Bewunderer meiner Werke und habe ihm aufgetragen, mich zu kontaktieren, um mit mir über eine interessante Sache zu sprechen.
Mir war klar, dass sich da jemand einen Scherz erlaubte – ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, von jemandem bewundert zu werden. Dennoch stimmte ich einer Verabredung am nächsten Tag zu und schlug das Restaurant Adler vor. Wenn er sich schon auf meine Kosten amüsieren wollte, dann konnte er sich zumindest zu mir in die Agglomeration bemühen. Ich beschrieb ihm den Standort und beendete das Gespräch.
Es war, als würde ein Fluch auf dem Gasthaus liegen, das der wechselvollen Geschichte der kleinen Industriestadt seit jeher ein unverzichtbarer Resonanzraum war. Noch in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren war es darin wild zugegangen, seither aber hatte es so manchen Wirt in den Konkurs getrieben. Dem zuletzt Angetretenen war es immerhin gelungen, den «Adler» auch für jene wieder salonfähig zu machen, die auf ihren guten Ruf bedacht sind, und seine Nachfolgerin schien nebst dem Sinn fürs Machbare die Beharrlichkeit mitzubringen, die es wohl brauchte, um den Bann endgültig zu brechen.
Als ich das Lokal betrat, saß sie mit einem mir unbekannten Mann an einem Tisch und begrüßte mich. Ich wich ihrem Blick aus und sah mich um. Die anderen Tische waren leer. Ich hatte mich verspätet und befürchtete, meine Verabredung verpasst zu haben, als ich ihren Satz realisierte: «Da kommt er ja!»
Der Unbekannte hatte sich nach mir umgedreht und sah mir erwartungsvoll entgegen. Zögernd näherte ich mich und reichte ihm die Hand. Sein Name, kaum ausgesprochen und von mir repetiert, war mir bereits wieder entfallen.
Ich hatte mir fest vorgenommen, an diesem Tag nicht zu kiffen. Aber es ging bereits gegen Feierabend, und vor ungefähr einer Stunde hatte ich der Versuchung nicht länger widerstehen können. Ich war in meiner Jugend gelegentlich mit dem Stoff in Berührung gekommen, ohne dass ich mir viel daraus gemacht hätte. Erst nach dem Tod meiner Mutter hatte ich begonnen, mich regelmäßig damit zu betäuben, und inzwischen war er zu einem festen Bestandteil meiner Selbstmedikation geworden. Andere konsumierten Drogen, um leistungsfähig, den Anforderungen des Alltags gewachsen zu sein. Das war die zeitgemäße Handhabung von verbotenen Substanzen. Mir aber ging es darum, mein Bewusstsein auf eine möglichst gleichförmige, wattige, leicht vernebelte Wahrnehmung einzustellen – immer ein wenig schläfrig, immer ein wenig entrückt und verspätet, sodass die Hiebe ihre Wirkung erst in der Reflexion entfalten konnten.
Ich setzte mich, bestellte ein Bier und streifte mein Gegenüber mit einem flüchtigen Blick. Der Mann war irgendwo um die sechzig, vielleicht auch älter, hatte schmale Lippen und eine wolkig aus der Stirn gekämmte, grau melierte Mähne. Er betrachtete mich mit diesem wohlwollenden Blick, mit dem man junge Kulturschaffende bedenkt – zu denen ich mich seit meinem neununddreißigsten Geburtstag definitiv nicht mehr zählte.
Nachdem mir die Wirtin das Getränk hingestellt hatte, hob der Mann seine übereinandergelegten Hände und sprach: «Es freut mich, Sie im Namen meines Auftraggebers kennenzulernen. Vielleicht ist es ihm zu einem späteren Zeitpunkt möglich, Sie persönlich zu treffen.»
Hatte er das wirklich so gesagt? Ich netzte meinen trockenen Mund und stellte das Glas vorsichtig ab.
«Er ist, wie bereits erwähnt, ein Bewunderer Ihrer Kriminalromane. Ihm imponiert, dass Sie sich nicht einfach – wie andere Schriftsteller – eine spannende Geschichte ausdenken, sondern sich mutig ins Geschehen stürzen und dabei auch vor gefährlichen Situationen nicht zurückschrecken.» Er lächelte und meinte: «Ich persönlich bin leider noch nicht dazugekommen, sie zu lesen, habe es mir aber fest vorgenommen.»
Verdammt, ich hätte nüchtern bleiben sollen. Niemand auf der Welt spricht in diesem Ton mit einem Schriftsteller, der nicht mindestens ein paar Jahre tot ist. Ich ärgerte mich über meine Selbstsabotage, darüber, dass ich die Situation überhaupt nicht einzuschätzen vermochte.
Er lächelte wieder konziliant. «Nun, die Sache ist die: Mein Auftraggeber weiß um das harte Brot junger Schriftsteller und möchte Ihnen mit einer kleinen Geste unter die Arme greifen.» Er ließ das Gesagte ein wenig nachwirken und präzisierte mit unmerklich zur Seite geneigtem Kopf: «Er gedenkt, Sie während der nächsten – sagen wir – zwei Jahre finanziell zu unterstützen. Wir haben da an einen monatlichen Zuschuss in der Höhe eines Handwerkergehalts gedacht. Damit Sie in aller Ruhe arbeiten können.» Er verstummte und sah mich erwartungsvoll an.
Ein Glücksgefühl schwappte über mir zusammen wie ein warmer, wohlriechender Brei. Ich biss auf die Zähne, hielt mich an meinem Glas fest und zischte: «Finden Sie das etwa witzig? Sie erwarten doch nicht, dass ich in Gelächter ausbreche?»
Sein Gesicht brachte ehrliche Verwunderung zum Ausdruck. «Sie glauben mir nicht? Ich versichere Ihnen, es ist unser voller Ernst.»
Eine Weile sahen wir uns wortlos in die Augen wie zwei Ringkämpfer, die die Stärke des Gegners einzuschätzen versuchen.
«Diese Zuwendung», brach er schließlich das Schweigen, «ist allerdings an eine kleine Gefälligkeit gebunden.»
Er hielt einen Zeitungsartikel in der Hand und reichte ihn mir.
Es handelte sich um ein Interview mit dem «renommierten Mittelalterforscher Ralph Thelmann, emeritierter Professor für semitische Philologie und Islamwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg». Das Gespräch enthielt Thelmanns Ankündigung, in Kürze der Weltöffentlichkeit ein Schriftstück präsentieren zu wollen, «das unser Verhältnis zum Islam auf eine grundlegend neue Basis stellen wird.» Er sei bereits vor Jahren in einer Handschrift aus dem normannischen Sizilien auf einen Hinweis gestoßen, wonach Roger der Zweite, König von Sizilien, Herrscher über Apulien und Kalabrien, eine streng geheime Zusammenkunft aus hochrangigen Vertretern der drei monotheistischen Religionen angeregt habe, um in einem vergleichenden Verfahren die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.
Ich ließ den Blick über die Fotografie des bärtigen Philologen gleiten, las die Bildlegende und überflog die mit großer Schrift hervorgehobenen Zitate. Neben dem erwähnten König Roger war da noch von einem gewissen Kaiser Friedrich dem Zweiten die Rede, der sich Jahrzehnte später höchstpersönlich der Sache angenommen haben soll.
Ich hatte keine Ahnung, um was es da ging, zumal sich meine Gedanken um die in Aussicht gestellte finanzielle Zuwendung drehten. Ich hob den Kopf und bemühte mich um einen halbwegs verständigen Ausdruck.
Der Mann hatte inzwischen einen weiteren Zeitungsausschnitt zur Hand und wies mit dem Zeigefinger auf eine Kurznachricht, wonach Ralph Thelmann, der sich zurzeit an einer Ausgrabung im Südwesten Siziliens beteilige, vor einigen Tagen entführt worden sei.
Wieder begegneten sich unsere Blicke. Ich ahnte etwas. Aber ich zog die Brauen hoch und fragte: «Und was – bitte sehr – habe ich mit der ganzen Geschichte zu tun?»
Ich befand mich in meinem cremefarbenen Zweierabteil des Nachtzugs Milano–Palermo, draußen zog die toskanische Landschaft mit ihren Zypressen und Kirchtürmen vorbei, es war heiß, betäubend heiß, obschon die Sonne vor einiger Zeit untergegangen war. Meine Unterarme klebten auf dem Metall des Fensterrahmens, ich hielt mein Gesicht in den Fahrtwind und tat von Zeit zu Zeit einen Zug an meiner Zigarette. Ich war auf Reisen, unterwegs im Land immerwährender nordischer Sehnsucht, die Fahrt kannte nur eine Richtung – Süden, immer weiter in den Süden, diesen ganzen unglaublichen Damenstiefel hinunter bis fast nach Afrika. Ich hatte genug Geld in der Tasche, zwei Unterhaltszahlungen im Voraus bezahlt, kleinere Schulden beglichen und – das Bemerkenswerteste – ich war nüchtern. Seit meiner Abreise morgens um neun hatte ich keinen Joint mehr geraucht. Und damit das so blieb, hatte ich meinen gesamten Vorrat zu Hause gelassen.
Mein Leben am Rand der Voralpen schien unendlich weit zurückzuliegen. Die bleierne Lethargie, der ewig gleiche Alltagstrott, ja selbst die Verabredung im «Adler» kamen mir vor wie die Wirklichkeit eines Fremden. Ich war an jenem späten Nachmittag noch sitzen geblieben und allmählich ins assoziieren geraten. Stunden später hätte ich nicht mehr mit Gewissheit sagen können, ob unser Treffen tatsächlich stattgefunden oder ob ich es mir nur ausgedacht hatte. Aber als nach zwei Tagen eine erste Überweisung auf meinem Konto einging und mir tags darauf die Fahrkarten inklusive Reisespesen zugesandt wurden, hielt ich mich nicht länger mit meinen Zweifeln auf.
Der Haken an der Sache? Darüber wollte ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Mein Auftrag war denkbar einfach: Ich sollte meine Sachen packen, den Nachtzug nach Palermo nehmen und mich dort mit einem Informanten treffen. Ich vermutete, dass ich über Thelmanns Entführung Recherchen anstellen und später darüber einen Tatsachenbericht verfassen sollte. Das hatte ich mir zumindest aus den Ausführungen des grau Melierten zurechtgelegt.
Ich überließ mich dem Rhythmus der Eisenbahn und schlief darüber ein. Stunden später schreckte ich auf und stellte fest, dass der Zug stillstand. Ich trat ans Fenster und starrte hinaus auf die menschenleeren Perrons und die verheißungsvolle Weite der italienischen Nacht. Langsam nahm der Zug seine Fahrt wieder auf, ein Pergamentmond zog über bewaldete Hügelketten, manchmal tauchte eine mittelalterliche Festung auf oder eines dieser anziehenden südlichen Dörfer. Und dann endlich das Meer, das Meer.
Als ich das nächste Mal aufwachte, standen wir an der Meerenge von Messina. Während der Zug zu einzelnen Waggonkombinationen zerlegt in den Bauch der Fähre verfrachtet wurde, stieg ich an Deck und tauchte ein in die Euphorie des Morgens, unter dem blauen Himmel am Meer.
Die Rückkehr ins enge Abteil war umso beklemmender. Immer in Sichtweite zum tyrrhenischen Meer reihte sich Ortschaft an Ortschaft, Barcellona, Capo d’Orlando, Castel di Tusa, Cefalù, Trabia, Bagheria und endlich Palermo. Ich nahm meinen Koffer und trat in die drückende Hitze der Bahnhofshalle.
Sizilien – alle waren sie hier gewesen: Elymer, Karthager, Griechen und Römer, Vandalen und Ostgoten, die Byzantiner ebenso wie die Sarazenen, Normannen, Staufer, Franzosen und Spanier, die Italiener schließlich und die Alliierten; nicht zu reden von den «Clandestini», den Flüchtlingen vom schwarzen Kontinent, die von Tunesien aus die Überfahrt wagen in ein vermeintlich besseres Leben. Goethe war hier gewesen, Johann Gottfried Seume und Lawrence Durrell, sie alle waren nach Sizilien gekommen – und nun also auch ich.
Hatte ich zuvor die Klimaanlage als unzureichend empfunden, so wurde mir nun ihre wahre Leistung bewusst. Betäubt schritt ich auf die Fast-Food-Kette am Ende der Perrons zu – den vereinbarten Treffpunkt. Ich trat durch die Glastür und hielt nach meiner Verabredung Ausschau; im Gegensatz zu Goethe, der vom Vizekönig persönlich zur Tafel gebeten worden war, schien mich hier niemand erwartet zu haben. Ich beschloss, an der Theke einen Cheeseburger zu bestellen.
Als mein Informant schließlich doch noch auftauchte, hatte ich bereits eine geraume Weile in der «Italienischen Reise» gelesen und erfahren, dass der Meister während der Überfahrt trotz Seekrankheit fleißig an seinem «Tasso» gearbeitet hatte. Obwohl ich die Person nie zuvor gesehen hatte, war es mir ein Leichtes, an ihrem etwas steifen Gang den Landsmann zu erkennen. Er war um die sechzig, trug Leinenhosen, ein Poloshirt und eine bedruckte Stofftasche. Seine kurz geschorenen Haare waren grau wie seine Augen hinter der randlosen Brille, die in scharfem Kontrast zu seiner Freizeitkleidung stand. Er wirkte wie jemand, der auf keinen Fall den Eindruck erwecken möchte, vermögend zu sein.
Er trat an den Tisch, sprach fragend meinen Namen aus und wedelte mit meinem Porträt, das er sich wohl von der Verlagswebseite heruntergeladen hatte. Ein flüchtiger Blick verriet mir, wie ich mich über die Jahre von mir entfremdet hatte.
«Hier ist es nicht gut …», er flatterte mit der Rechten. «Zu viel Betrieb, zu viele Leute.»
Ich hatte inzwischen wieder Platz genommen.
«Wir gehen besser woanders hin.»
Ich wartete, dass er sich mir zuwandte.
«Ist das alles, was Sie an Gepäck haben?» Er besah sich meinen fleischfarbenen Rollkoffer – eine Hinterlassenschaft meiner Mutter.
Ich bejahte.
«Dann gehen wir jetzt, kommen Sie.»
Ich zwängte Goethe in die Außentasche, stand auf und folgte ihm.
«Palermos Verkehr – eine einzige Katastrophe», entschuldigte er sich für seine Verspätung.
Als wir aus der Bahnhofshalle traten, schloss ich zu ihm auf.
Er sah sich nach allen Seiten um. «Diese Hitze! Wie sollen die Leute da arbeiten? Man vergisst das immer, wenn man daheim ist.»
Ich prägte mir seine überhastete Sprechweise ein – die Art, wie er die Silben verschluckte.
Wir setzten uns in ein Straßencafé. Mein Gegenüber konsultierte sein Smartphone und legte es griffbereit vor sich auf den Tisch.
«Ah, Sie sind Raucher.» Er streifte mich mit einem Blick. «Vergessen Sie nicht, dass das Rauchen – in geschlossenen Räumen – italienweit verboten ist.»
Er fixierte den Kellner mit aufgerissenen Augen und hob den Arm. Falls er darauf aus war, den Mann zu verärgern, so war ihm der Anfang schon ganz gut gelungen.
«Sie sehen krank aus», versetzte er, nachdem der Kellner unsere Bestellung entgegengenommen hatte.
Ich erwiderte seinen Blick.
«Ein paar Tage sizilianische Sonne werden Ihnen guttun.»
Ich nahm einen tiefen Zug und sprach in den Rauch hinein: «Sie haben sich noch nicht vorgestellt.»
«Tatsächlich?» Er rückte näher an den Tisch heran, sodass ich sein Aftershave riechen konnte. «Dann holen wir das gleich nach: Mein Name ist Notter, Ernst. Ihr Auftraggeber hat mich gebeten, Sie am Bahnhof abzuholen.»
Er warf einen Blick auf sein Smartphone und sagte: «Von Ralph Thelmann fehlt nach wie vor jede Spur. Sie sind über seine Entführung unterrichtet?»
Ich nahm die Zeitungsartikel hervor, die ich zusammen mit den Reisespesen erhalten hatte.
«Ja, ja, sehr gut! Er wurde vor den Augen seiner Mitarbeiter gekidnappt. Ich versuche seither, mit den Entführern Kontakt aufzunehmen.» Er sah sich um und lehnte sich ein wenig vor. «Ihr Auftraggeber hat bereits viel Geld in Thelmanns Forschung gesteckt. Er möchte, dass Sie der Sache nachgehen, Informationen zusammentragen und darüber schreiben. Ihm schwebt so etwas wie ein Kriminalroman vor.»
Ich sah ihn stirnrunzelnd an.
«Die Ausgrabungsstätte übrigens befindet sich westlich von Castel Vetrano. Ich hab Ihnen in der Nähe ein Hotelzimmer gebucht.» Er unterbrach sich, um den Mann zu mustern, der sich an den Nebentisch setzte. «Wichtig ist, dass Sie sich immer als Tourist ausgeben. Niemand soll erfahren, womit Sie sich wirklich befassen. Verstehen Sie, zu niemandem ein Wort.»
«Haben sich die Entführer denn schon gemeldet?»
«Nichts, nichts dergleichen. Bis jetzt.»
Ich nahm meinen Reiseführer zur Hand und entfaltete die Karte. Notter kam mir zu Hilfe und zeigte auf einen Punkt im Südwesten der Insel, nur wenige Kilometer von der Küste entfernt.
«Und wie geht es nun weiter?»
«Ich werde Sie anschließend zu Ihrem Hotel fahren, dort können Sie sich erst einmal erholen. Morgen dann treffen Sie sich mit einem Informanten, der Ihnen mehr über die Umstände von Thelmanns Verschwinden erzählen kann.»
Er schielte wieder zum Nebentisch.
«Ich würde gern erfahren, wer mein Auftraggeber ist.»
«Er will unter allen Umständen anonym bleiben.»
«Dann können Sie mir vielleicht verraten, warum er gerade mich auserkoren hat.»
«Das kann er Ihnen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt selbst erklären.»
Er brach ab und wandte sich in nahezu akzentfreiem Italienisch an den Mann vom Nebentisch. Ein kurzes Wortgefecht entstand, das immer hitziger zu werden drohte, bis plötzlich beide in Gelächter ausbrachen.
Als sich Notter wieder zu mir wandte, sah ich ihn fragend an.
«Ich wollte wissen, warum er uns die ganze Zeit belauscht. Er meinte, er habe sich über unsere Sprache gewundert. Raten Sie mal, was er dachte?»
«Keine Ahnung.»
«Hebräisch – er dachte, wir würden Hebräisch sprechen.»
Er verstummte und legte ein paar Münzen auf den Tisch. «Los, gehen wir.»
Der mysteriöse Mäzen ließ sich nicht lumpen. Mein Hotel im kleinen Fischerort Marinella war ein modernes Gebäude mit all dem Komfort, den gut betuchte Gäste für ihren Badeurlaub offenbar voraussetzen. Vom Balkon meines Zimmers hatte ich freie Sicht aufs Mittelmeer und die westlich gelegene Anhöhe, auf der sich die Überreste der antiken Stadt Selinunt befinden.
Ich zog mich um und ging an den Strand, wo ich im noch recht frischen Wasser das Unbehagen abstreifte, das Notters Bekanntschaft in mir ausgelöst hatte. Während ich meine weißen Glieder in der afrikanischen Sonne ausstreckte, dachte ich über meinen Auftrag nach. Informationen zusammentragen über Thelmanns Entführung, um daraus einen Kriminalroman zu konstruieren? Wie stellten die sich das vor? So billig war Unterhaltung nun auch wieder nicht zu haben, und um einen anständigen Fall loszutreten, brauchte es etwas mehr als die spektakuläre Ankündigung eines Mittelalterforschers in einem Zeitungsinterview.
Ich richtete mich auf und bemerkte eine junge Frau ganz in meiner Nähe, die bäuchlings auf ihrem Badetuch lag und in einem Buch las. Die Lektüre schien sie ungemein zu fesseln, denn sie hatte keine Augen für ihre Umgebung; nicht einmal, als eine Gruppe spielender Kinder direkt an ihrem Kopf vorbeirannte. Manchmal hob sie einen ihrer braunen Unterschenkel, ließ ihn ein wenig wippen und bewegte dazu die Zehen. Ich nahm mein Buch zur Hand und versuchte mich zu konzentrieren. Vielleicht würde sie es bemerken, das Geheimzeichen, mit dem sich Lesende einander zu erkennen geben.
Ich hatte kaum einen Abschnitt überflogen, als ich einen frisch geschlüpften Gecko entdeckte, der seine Wanderung durch die rötlichen Dünen aufgenommen hatte. Ich beugte mich über ihn und verfolgte eine Weile, wie er sich unverdrossen auf dem rutschigen Terrain fortbewegte. Entweder hatte er keine Ahnung, wie weit der Weg war, der vor ihm lag, oder es war ihm egal. Ich legte das Buch zur Seite und zündete eine Zigarette an.
Die junge Frau hatte sich inzwischen aufgesetzt. Sie hatte das kurze schwarze Haar eines verträumten Knaben. Plötzlich stand sie auf, streifte sich ein Strandkleid über und packte ihre Sachen. Sie war schön, schön wie der Tod, wie die Sünde – sie kam direkt in meine Richtung! Ich klammerte mich an mein Buch und sah verstohlen auf, als sie nur noch wenige Schritte von mir entfernt war. Ich erschrak – fast hätte ich sie angesprochen, ich glaubte sie zu kennen, aber dann war sie auch schon an mir vorbei, ohne mich zu beachten.
Mein Herz schlug bis zum Hals. War es möglich? Sie hier, auf Sizilien, am gleichen Strand? Die Ähnlichkeit war frappant. Auf einmal war alles wieder präsent: Anitas südostasiatische Augen, ihre Lippen, ihr Haar.
Am nächsten Tag machte ich mich zu Fuß auf den Weg zum archäologischen Park. Laut Notter sollte ich mich dort mit meinem Informanten treffen. Die Landschaft gab sich der Sonne hin, als gehörte sie zu ihr wie das Meer oder der feine Sand, der sich unaufhaltsam ausbreitete. Ich bezahlte beim Eingang mein Eintrittsgeld und begab mich zum Tempel E, den ich auch ohne die Hilfe meines Reiseführers leicht gefunden hätte. Als einziges Gebäude in seinen Grundzügen wieder aufgerichtet, ragten seine Säulen wohl an die zehn Meter in die Höhe. Trotz der Verwitterung waren die Kannelüren gut sichtbar, auch ein Teil des Gebälks war unlängst rekonstruiert worden.
Ich blieb in einiger Entfernung zum Treppenaufgang stehen und versuchte mir begreiflich zu machen, dass zwischen mir und der Errichtung dieses Gebäudes an die zweitausendfünfhundert Jahre lagen – zweitausendfünfhundert Jahre, in denen sich Generationen und Epochen in einem endlosen Stafettenlauf ablösten, ein Gewimmel von Schicksalen und Lebensentwürfen, das sich flimmernd über den Planeten legte. Dieses Monument einer übers Meer gekommenen Hochkultur hatte bereits zu einer Zeit hier gestanden, als meine Vorfahren – so stellte ich mir vor – wie Tiere gehaust hatten, glückliche behaarte Wilde ohne Vorstellung vom kulturellen Aufbruch der südlichen Völker, geistig genügsam und vollauf damit zufrieden, die letzte Eiszeit einigermaßen heil überstanden zu haben. Und während sich meine Gedanken an der schlichten dorischen Schönheit des Tempels entzündeten, kehrte mein Blick immer wieder zu einer Schönheit von anderer, vergänglicherer Natur zurück, die etwas abseits bei einem Trümmerhaufen stand.
Die junge Frau war mir gleich bei meiner Ankunft aufgefallen. Ich war mir nicht sicher, ob es dieselbe Person war, die ich tags zuvor am Strand beobachtet hatte. Plötzlich wandte sie den Kopf in meine Richtung. Hatte sie meine Aufdringlichkeit bemerkt? Ich versuchte ihrem Blick standzuhalten, während sie langsam auf mich zukam.
«Das gibts doch nicht!», rief sie aus, während sie einen Schritt vor mir stehen blieb.
«Anita?»
Sie schüttelte den Kopf, als versuchte sie ein Trugbild loszuwerden. «Dass wir uns hier begegnen?»
Ich glaubte, mich zu erinnern, von ihr geträumt zu haben. «Ich hätte dich kaum wiedererkannt …»
«Es sind seither ja auch mehr als zehn Jahre vergangen.»
«Du hast dir die Haare geschnitten …»
«Schon lange», winkte sie ab und trat auf mich zu.
Die Umarmung fühlte sich vertraut und fremd zugleich an.
«Du kamst mir irgendwie bekannt vor», sagte ich, nachdem ich einen Schritt zurückgetreten war, und es klang wie eine Rechtfertigung.
«Du mir auch.» Sie warf ihr asymmetrisch geschnittenes Haar aus der Stirn. «Aber erzähl, was machst du hier?»
«Was ich hier mache?» Ich sah mich um. «Ferien. Ich mache Ferien, Bildungsreisen und so.»
Sie nickte.
«Und du?»
«Was wohl? Dasselbe wie du. Ich wollte schon lange nach Sizilien.»
Sie verstummte, und ich überlegte, wie ich das Gespräch wieder in Gang bringen konnte.
«Bist du allein hier?», kam sie mir zuvor.
Ich nickte.
Sie warf einen Blick in die Runde. «Wollen wir uns den Park gemeinsam anschauen?»
«Gemeinsam?» Ich sah auf die Anzeige meines Mobiltelefons. Mein Informant hatte schon mehr als zwanzig Minuten Verspätung. «Ja, doch, zusammen machts bestimmt mehr Spaß.»
«Das klingt ja richtig begeistert.»
«Nicht doch. Ich bin einfach ein wenig – konfus»
Sie musterte mich lächelnd. «Komm, gehen wir. Warst du schon im Tempelinnern?»
Ich verneinte, und also stiegen wir die Stufen zum Podium hoch, besichtigten die Überreste der Cella und stolperten in den Trümmern der beiden Tempel F und G herum, bevor wir den Weg zur Akropolis unter die Füße nahmen. Sie lag weiter westlich auf einem Hügel, der zum Meer hin senkrecht abfiel.
Wir setzten uns in den Schatten einer Pinie, tranken aus Anitas Wasserflasche und gaben uns der überwältigenden Aussicht hin.
«Wohnst du auch in Marinella?»
Ich nickte.
«In welchem Hotel?»
Ich verriet ihr den Namen.
«Nicht übel.»
«Ja.» Ich hatte einen schlechten Geschmack im Mund. «Ich dachte, wenn ich schon mal Ferien mache …»
Anita schlüpfte aus den Sandalen und begutachtete ihre Nägel in der Farbe geronnenen Blutes.
Mein Blick schweifte wieder aufs Meer hinaus. «Irgendwo da drüben liegt der unbekannte schwarze Kontinent …»
«Sag mal, hast du dich etwa nicht eingecremt?»
«Eincremen? Wozu?»
«Damit du dich nicht verbrennst zum Beispiel.»
«Ich glaube nicht, dass das nötig ist …»
«Das denkst du jetzt, aber heut Abend wird es dir leidtun …»
Sie griff in ihren kleinen Rucksack und zog eine Tube hervor. «Hier. Mit extra hohem Schutzfaktor für Nordmänner.»
Ich öffnete sie und roch daran.
«Was ist?»
«Ich lieg ja nicht den ganzen Tag in der Sonne.»
«Wie du willst.»
Wir sahen uns die Ruinen der Akropolis an. Beim Anblick der Trümmerhaufen musste ich an meine zweijährige Tochter denken, daran, wie sie die von mir aufgebauten Bauklötze jeweils umgehend wieder zum Einstürzen brachte.