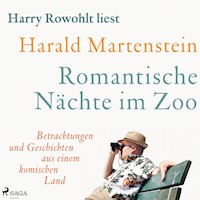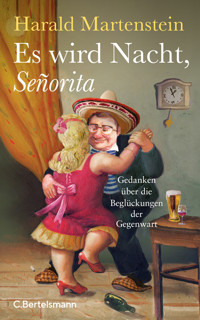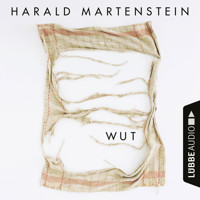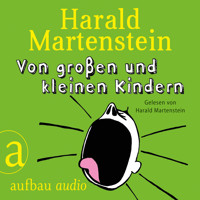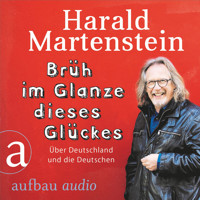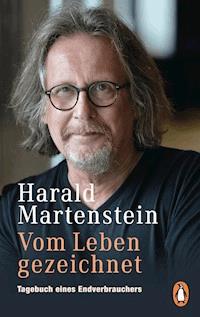9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martenstein für Eltern!
Kinder sind das Schönste, das es auf Erden gibt. Keine Frage. Aber dann werden sie größer und fangen an, die Welt zu erkunden. Bedauerlicherweise. Denn die Welt wird für die Erwachsenen immer komplexer und unverständlicher. Da ist guter Rat teuer. Martenstein hat ihn parat. Er ist selbst ein jahrelang gelöcherter Vater. Also erzählt er davon, wie er seinem Kind die Rätsel der Welt und das Leben erklärt. Was es mit der Politik auf sich hat. Wie man den Gefahren des Alkohols begegnet und auf raffinierte Weise mit dem anderen Geschlecht umgeht. Und und und. Seine Erklärungen und Betrachtungen sind, erwartungsgemäß, etwas ungewöhnlich und, natürlich, urkomisch. Für verzweifelte Eltern eben, denen man aus der Patsche helfen muss.
Neuausgabe mit komplett überarbeiteten Kolumnen sowie 17 ganz neuen Texten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Harald Martenstein, 1953 geboren in Mainz, ist Autor zahlreicher Sachbücher und Romane, unter anderem »Ansichten eines Hausschweins«, »Nettsein ist auch keine Lösung« und »Heimweg«. Seine Kolumnen im ZEIT Magazin, in der WELT am Sonntag, im NDR und auf Radio Eins haben Kultstatus. Er wurde unter anderem mit dem Henri-Nannen-Preis, dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Theodor-Wolff-Preis und zuletzt 2024 mit dem Medienpreis für Sprachkritik ausgezeichnet und unterrichtet an Journalistenschulen. Martenstein lebt in Berlin und in der Uckermark.
Harald Martenstein, Wachsen Ananas auf Bäumen?, in der Presse:
»Martensteins Beschäftigung mit der Vaterrolle ist ernst gemeint und trotzdem unterhaltsam. Mit vielen klugen Sätzen, die zu den schönsten gehören, die über Väter geschrieben wurden.« dpa
Außerdem von Harald Martenstein lieferbar:
Es wird Nacht, Señorita
Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff
Jeder lügt so gut er kann
Nettsein ist auch keine Lösung
Ansichten eines Hausschweins
Vom Leben gezeichnet
Die neuen Leiden des alten M.
Der Titel ist die halbe Miete
www.penguin-verlag.de
Harald Martenstein
Wachsen Ananas auf Bäumen?
Wie ich meinem Kind die Welt erkläre
Erweiterte, aktualisierte Neuausgabe.
Die Erstausgabe erschien 2012 bei C.Bertelsmann.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2012 / 2025 by C.Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Rainer Wieland
Covergestaltung: semper smile, München
Coverabbildung: © Justin Piperger/Bridgeman Images
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-06920-9V004
www.penguin-verlag.de
Inhalt
GEBRAUCHSANWEISUNG
I.
II.
I.Das Kind
Die Geburt
Bulgarien
Computer
Demokratie
Elite
Die Färöer-Inseln
Bewegte Bilder
Feuer
Fussball
Geburtstag
Geld
Gemüse
Die Gene
Gott
Das Grauen
Insekten
Der Journalismus
Die Katze
Der Klapperstorch
Christopher Street Day
Die Literatur
Männer
Der Nationalsozialismus
Die NATO
Olympische Spiele
Das Reisen
Der Spielplatz
Tierschutz
Toleranz
Der Wannsee
Weihnachten
Wurst
Die Zukunft
II. Der Sohn
Schuhe
Handys
Skifahren
Latein
Rauchen
Haustiere
Jagen und Fischen
Das Grips-Theater
Schindlers Liste
Porno
Mündlich: fünf
Feiern
Miaurizio
Keinohrhasen
Tätowierungen
Reden
Ausland
Wut
Der 23. Dezember
III. Die siebzehnte Reise
IV. Der Junge
Wozu Kinder?
Das Baby
Hundejahre
Späte Väter
Kinder und Karriere
Marlon Brando
Quality Time
Geschlechterklischees
Nur der Mann im Mond schaut zu
Ein Junge
Die Erbschaft
Lenny
Das Seepferdchen
Vergebung leicht gemacht
Missionarinnen
Musikalische Früherziehung
Im Hafen
GEBRAUCHSANWEISUNG
I.
Dieses Buch erzählt Geschichten. Die Geschichten handeln von einem Vater und seinem Sohn, und sie sind wirklich passiert, im Großen und Ganzen jedenfalls. Das Vaterwerden und das Vatersein, darum geht es.
Das Buch ist hoffentlich lustig geworden, aber – erschrecken Sie nicht! – es hat eine Botschaft. Diese Botschaft heißt: Es ist schön, Vater zu sein. Manchmal ist es anstrengend, manchmal ärgert man sich, und immer kostet es einen Haufen Geld. Aber hauptsächlich ist es schön.
Man verändert sich. Einerseits ist man plötzlich Vorbild, Respektperson, Erzieher, andererseits wird man selber wieder ein bisschen Kind. Man erlebt ein zweites Mal Kindheit, aus einer anderen Perspektive.
Die »neuen Väter«, das ist so ein Schlagwort der letzten Jahre. Aber wir Männer ändern uns nie, wir bleiben egoistische Schufte mit zwei oder drei liebenswerten Zügen. Wir sind nur ein bisschen schlauer geworden, deswegen kümmern wir uns mehr um die Kinder als unsere Vorfahren. Es ist ungerecht, dass die Frauen den ganzen Spaß haben.
In den Geschichten heißt es meistens »das Kind« oder »die Frau«. Am Anfang war das Kind noch klein, es verstand die Geschichten noch nicht so gut, und ich war mir nicht sicher, ob es ihm überhaupt recht ist, das Objekt meiner Beobachtung zu sein. Deswegen habe ich es im schützenden Nebel gelassen. Später gefiel es mir so. Das sind nun mal unsere Rollen – der Mann, die Frau, das Kind. Das ist angenehm ewig. Das werden hoffentlich weder die Politiker noch die Wissenschaftler jemals ändern können.
II.
Zum ersten Mal ist dieses Buch im Sommer 2001 herausgekommen. Mein erster Sohn war damals neun. Das Buch erlebte einige Auflagen und erschien in verschiedenen Ausgaben. Jetzt erscheint es neu. Ich habe nach 2001 nicht damit aufgehört, über das Vatersein zu schreiben, und es kommt mir sinnvoll vor, jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, von der Geburt bis zu jenem Moment, in dem einem plötzlich bewusst wird: Das Kind ist erwachsen. Du bist immer noch Vater, du bleibst es dein Leben lang, aber ein neues Kapitel wird aufgeschlagen.
Die alten Geschichten habe ich überarbeitet. Das heißt, ich habe sie verändert, dort, wo mir eine Formulierung nicht mehr gefiel, ich habe Namen und Anspielungen gestrichen, die heute nicht mehr so bekannt oder nicht mehr für alle verständlich sind. Manchmal habe ich Tricks verwendet. Dort, wo früher in einer Geschichte der Name des damals sehr aktiven Politikers »Rudolf Scharping« stand, habe ich zum Beispiel einen heute bekannteren Namen eingesetzt. Einige Texte habe ich ganz gestrichen, dafür gibt es jetzt neue.
Dieses Buch hat einen zweiten, dritten und vierten Teil. Im zweiten Teil geht es, was mir naheliegend erscheint, um den zweiten Teil der Kindheit, also um die Pubertät und um das Erwachsenwerden, auch um das Loslassen. Der dritte Teil ist eine Reisereportage. Er stellt den Versuch dar, eine vorläufige Bilanz meines Vaterseins zu ziehen, und er enthält, glaube ich, ein paar grundsätzliche Gedanken.
Im Jahr 2013 geschah etwas Unerwartetes. Kurz nach meinem 60. Geburtstag wurde meine zweite Frau schwanger. Sie war damals 47 Jahre alt und hatte ebenfalls bereits einen Sohn aus ihrer ersten Ehe. Wir hatten beide, vor dieser Überraschung, mit dem Kapitel »Kind« innerlich abgeschlossen. Andererseits, was sprach schon dagegen, außer der Tatsache, dass wir ziemlich alt waren?
Der vierte Teil handelt also von Eltern, speziell einem Vater, der eigentlich viel zu alt ist. Und weil dieses Buch im Laufe der Jahre zu einer Art Biographie geworden ist, mit dem Schwerpunkt Vaterschaft, wird es womöglich eines Tages einen fünften Teil geben, der von einem uralten Großvater handelt.
Einige dieser Texte haben bereits, in anderem Zusammenhang, in anderen meiner Bücher gestanden. Ein paar von ihnen wurden zuerst im Tagesspiegel, in GEO oder in der ZEIT veröffentlicht.
Ich danke den Müttern meiner Kinder, und ich danke meinen Söhnen David und Jakob. Beide haben, sobald sie dazu alt genug waren, diese Texte gelesen und immer gelassen auf sie reagiert, niemals haben sie Änderungswünsche geäußert. Es scheinen also, im Großen und Ganzen, wahre Geschichten zu sein, die hier erzählt werden.
I.Das Kind
Die Geburt
Es ist so weit, sagte die Frau. Ich spür’s genau.
Sommer. Ein Sonntag. Es war zu Beginn der neunziger Jahre, etwa achtzig Kilometer entfernt von Berlin. Wir machten einen Ausflug. Wenn wir jetzt im Westen gewesen wären, im echten Wilden Westen, dann hätte der Marshall gesagt: Wir brauchen heißes Wasser und Tücher. Schickt jemand rüber zum Doc.
Wir waren aber im Osten. Ganz tief drin. Ich sagte: Gut festhalten.
Das bringt doch nichts, wenn wir jetzt alle bei einem Verkehrsunfall draufgehen, stöhnte die Frau.
Ich sagte: Wer weiß, wie hier im Osten die medizinische Versorgung ist. Wer weiß, ob es heißes Wasser und Tücher gibt. Hier schneiden sie die Kinder, wenn sie bei der Geburt nicht spuren, mit bulgarischen Schneidbrennern heraus. Sofort nach der Geburt werden die Babys aufs Töpfchen gesetzt, die gynäkologische Abteilung singt dazu das Deutschland-Lied. Erste Strophe. Das traumatisiert so ein kleines Wesen.
Das Kind sollte in eine Epoche voller Vorurteile und Widersprüche hineingeboren werden, die sogenannte Nachwendezeit. Heute schämt man sich. Es dauerte dann sowieso noch fast zwei Monate bis zur Geburt.
Und, habt ihr schon einen Namen?, fragten die Freunde. David? Na ja. Ist eher ein Modename, oder?
Die Freunde hießen Thomas, Michael, Andreas, Andrea, Gaby, Peter und so weiter. Wie man halt so heißt in dem Alter.
Ihr habt doch alle selber Modenamen, dachte ich. Und? Leidet jemand darunter?
Eltern, die originell sein wollen, gefährden vorsätzlich das Kindswohl. Frank Zappa hat seine Tochter Moon Unit genannt. Moon Unit Zappa. Dorothy wäre ihr lieber gewesen, sagt sie in Interviews. Man kann seine Kinder auch Jimi Blue, Wilson Gonzalez, Lourdes oder Cosma Shiva nennen. Alles schon vorgekommen. Damit geben Eltern aller Welt bekannt, dass sie nicht sehr entspannt sind. Wenn ihr Kind sich später mal vorstellt, werden alle Leute denken: »Diese Person stammt von Eltern ab, die nicht entspannt waren.«
Ein guter Name kann gar nicht unoriginell genug sein. Jeder Mensch ist ein Kind seiner Zeit, und so weiter. So dachte ich.
Seid ihr eigentlich Philosemiten?, fragte ein Bekannter. So weit ist es in Deutschland also wieder gekommen, antwortete ich.
Der Bekannte schwieg verwirrt.
Den Satz »So weit ist es in Deutschland also wieder gekommen« kann man für alle Gesprächssituationen in Deutschland empfehlen. Damit macht man immer einen Stich.
Zeit verging. Und noch mehr Zeit. Und immer mehr. Das Kind war erst zwei, dann drei, dann vier Wochen überfällig. Es wuchs dabei aber immer weiter. Bald würde es anfangen, da drin laufen und sprechen zu lernen. Wenn es später einmal ein Musikinstrument richtig gut spielen sollte, dann mussten wir jetzt allmählich mit dem Unterricht anfangen.
»Da nehmen wir Sie jetzt mal auf unsere Station und geben ein Medikament, das die Wehen auslöst«, sagte der Arzt. »Ganz einfach.«
Es war ein junger Arzt. Junge Menschen tendieren dazu, alles im Leben für eine einfache, unkomplizierte Sache zu halten. Wenn man Kinder kriegt, ist man heutzutage meistens kein junger Mensch mehr.
Weitere Zeit verging.
»Da geben wir das Medikament jetzt einfach mal intravenös«, sagte der Arzt und trommelte mit den Fingern auf dem Tisch.
Wir zogen ins Krankenhaus. Herbst. Die Tage wurden kürzer. Die Großeltern riefen jeden Tag an und fragten, was denn nun wäre.
»Da erhöhen wir jetzt einfach mal die Dosis«, sagte der Arzt, leicht gereizt. »Und wenn das nicht hilft, erhöhen wir die Dosis einfach noch mal.«
»Wenn er da drin in die Pubertät kommt – wie machen wir das mit dem Rasieren?«, fragte ich. Diese japanischen Kunstschnitzer, die in das Innere eines hohlen Reiskorns eine zwölfbändige Enzyklopädie eingravieren können, mit ihren feinen Instrumenten, die kriegen das mit dem Rasieren im Mutterleib sicher hin.
Dann setzte die Geburt ein. Sie dauerte erst vier, dann acht, dann sechzehn Stunden. Alle zwei Stunden riefen die Großeltern an und fragten, was denn nun wäre. Das Kind hat heimlich bei Gottschalk angerufen, sagte ich, es läuft da irgendein Deal mit Wetten, dass …?. Oder es ist die Versteckte Kamera. In Wirklichkeit ist das Kind schon längst geboren, jetzt presst die Frau und presst und presst, und plötzlich schlüpft Tommi Ohrner raus. So hieß damals der Moderator.
»Da weiß ich jetzt aber auch nicht mehr weiter«, sagte der Arzt nach vierundzwanzig Stunden. Er war in der Zwischenzeit natürlich zu Hause gewesen. »Also los, Kaiserschnitt! Aber vorher muss ich den Chef anrufen. Das ist mein erster Kaiserschnitt.«
Als die Frau in den OP gerollt wurde, lief eine Schwester mit einem tragbaren Telefon herbei. »Das sind die Großeltern. Waren nicht abzuwimmeln. Wollen wissen, was denn nun ist.«
Die Frau nahm das Telefon und sagte: »Es ist jetzt im Moment gerade nicht so günstig. Ich ruf später noch mal an, okay?«
Bulgarien
Das Kind isst Haferflocken. Auch Müsli wird gerne genommen. Es hat sich von ganz alleine in diese Richtung entwickelt. Innerfamiliär wird keinerlei Müslidruck ausgeübt, im Gegenteil, das Kind ist am Frühstückstisch weit und breit der einzige Gesundesser. Ich esse Wurst. Ähnlich wie die Partei der Grünen scheinen Haferflocken und Müsli mehr zu sein als nur das Projekt einer einzigen Generation.
Ähnlich verhält es sich mit dem Haschischrauchen. Obwohl es keine »Alternativszene« und keinen Drogenpapst Leary und keine Band Amon Düül II mehr gibt, stecken sich immer noch etliche Menschen in ihren Dotcom-Lofts abends ihr Haschischpfeifchen an.
Von den Reichen der Azteken und Inkas sind die Kartoffel und der Tabak geblieben, von der Alternativszene bleiben Müsli und Haschisch.
Die Mode des Sushi-Essens dagegen hat das Kindermilieu nicht erreicht. Aus Kostengründen begrüßen wir dies.
Der Mensch hängt mit geheimnisvollen Fäden an den Essmoden seiner Kindheit. Als unsereins klein war, spielten die Gesichtspunkte »Gesundheit« oder »Frische« bei der Ernährung eine nachrangige Rolle. Meine Oma fand nichts Anstößiges daran, eine Dose Ravioli zu öffnen und sie ihrem Enkel zu servieren. Deswegen packt mich noch heute etwa einmal im Jahr der Heißhunger nach einer Dose Ravioli, ich kann nichts dagegen tun.
Wenn man das Kind sein Müsli essen sieht, stellt sich unwillkürlich der Gedanke ein: In zwanzig, dreißig Jahren werden die Essmode und die Essmoral wieder anders sein als heute. Das Kind und seine Freunde werden dann der Himmel mag wissen was essen. Das Kind aber wird zu seinen Freunden sagen: »Einmal im Jahr packt mich immer so ein Heißhunger nach Müsli. Kein Witz. Dann renne ich durch die halbe Stadt, um welches zu finden. Ich kann nichts dagegen tun.«
Es war also Sonntag, das Kind aß Haferflocken, wir blätterten in der Zeitung. Erfahrene Zeitungsleser erkennt man daran, dass sie dem aussterbenden Genre der Kleinanzeige die gebührende Aufmerksamkeit widmen. Erkenntnissen und Überraschungen sind im Genre Kleinanzeige Tür und Tor geöffnet.
Die Reise war ein Super-Spezial-Sonderangebot. Zwei Wochen Bulgarien, Flug, Hotel und Halbpension, einhundertneunundzwanzig Euro.
Das Ferienziel Bulgarien musste in den neunziger Jahren gewaltige Anstrengungen unternehmen, um mit der Kundschaft wieder ins Gespräch zu kommen, das Ergebnis waren solche Kleinanzeigen mit solchen Preisangeboten. Als ich die Anzeige las, dachte ich: »Bulgarien, einhundertneunundzwanzig Euro, das wird nicht sehr erholsam sein, aber interessant.«
Dieser Gedanke war nicht falsch.
Der Ort hieß Goldstrand. Er bestand aus mehreren Dutzend Hotelanlagen, die nicht ohne Geschick in einen waldigen Hang hineingebaut worden waren. Unten am Strand erstreckte sich eine Promenade. Es sah, auf den ersten Blick, nicht viel anders aus als in spanischen Ferienorten. Auch herrscht in Bulgarien keineswegs Katzenknappheit. Daran erkennt man die südlichen Ferienparadiese, an der verschwenderischen Fülle von Katzen, mit der Mutter Natur sie ausgestattet hat. Sobald unsere Generation Katzenurin riecht, gerät sie automatisch in Ferienstimmung.
Das Publikum bestand erstens aus Ostdeutschen, die ihren alten Reisegewohnheiten treu geblieben waren, zweitens aus Westdeutschen, für die Mallorca zu teuer gewesen wäre, drittens aus Russen und Ukrainern. Vor allem aus Russen und Ukrainern.
Man hörte damals oft von den schwerarmen Russen, die gezwungen sind, ihre Wohnungen mit wertlos gewordenen Rubelscheinen und KPdSU-Parteibüchern zu heizen, andererseits hörte man von den schwerreichen Russen, die an der Côte d’Azur die Ölscheichs ins soziale Abseits drängen. Offenbar gab es auch eine russische Mittelschicht. Deren Traumziel hieß Bulgarien.
Die russische Mittelschicht lieh sich morgens Jeeps, kaufte sich mittags Goldschmuck und hing abends an den Schießständen herum, die in den Kellern etlicher Hotels untergebracht waren. An den Schießständen wurden Maschinenpistolen verschiedener Fabrikate verliehen. Besonders beliebt waren Maschinenpistolen aus Deutschland oder aus Israel. Mit diesen Maschinenpistolen auf Zielscheiben draufzuhalten – das war ganz offensichtlich ein Freizeitvergnügen nach dem Geschmack der russischen Mittelschicht.
An der Strandpromenade erstreckte sich auf etwa fünf Kilometern Länge ein Rummelplatz. Autoscooter reihte sich an Riesenrutschbahn, Karussell an Geisterbahn, Süßigkeitenstand an Schießbude. Es gab einen Pool mit frei steuerbaren Mini-U-Booten, deren Bordkanonen giftig grüne Funken sprühten, ein Karussell mit röhrenden kleinen T34-Panzern und einäugige moldawische Schnelltätowierer, die in nur drei Minuten auf jedes gewünschte Körperteil einen roten Stern, ein Hakenkreuz, ein Papst- oder ein Saddam-Hussein-Porträt oder eine nackte Sharon Stone mit einer lila Orchidee auf der Scham tätowieren konnten. In den Lücken zwischen den Ständen trieben Stalinbilder-Verkäufer und Schlangenbändiger ihr Unwesen. Auf Klettergerüsten in der Form von Panzerkreuzern turnten russische Kinder und spielten, dass sie einander mit Maschinenpistolen niedermähen. Gelegentlich nahmen sie eine fette Katze als Geisel, verbanden dem sich windenden Tier die Augen und übten das Exekutieren. Die Preise der Fahrgeschäfte variierten zwischen zehn und vierzig Cent.
Das Kind rief: »Bulgarien ist das schönste Land der Welt! In Bulgarien tun sie was für die Kinder.«
Unsere Ferien sahen so aus: Morgens nahmen wir in unserem Hotel, einem Monument bulgarischer Großmachtträume, einen Saft zu uns. Sie hatten Säfte in Pink, in Malve und in Lila. Dann gingen wir an den Strand und lasen – Die Schlacht um Berlin, Die Kanonen von Navarone, dazwischen ein bisschen Philosophie –, während das Kind für fünf Euro den ganzen Tag U-Boot, Panzer und Motorrad fuhr oder sich von den russischen Kindern in die Geheimnisse des Katzenexekutierens einführen ließ. Abends, wenn die Leuchtreklamen der Spielcasinos, Schießkeller und Stripteasebars aufflammten, zogen wir uns in unser Zimmer zurück. Alle Zimmer mündeten auf einen schlauchartigen Gemeinschaftsbalkon. Dort lehnte die russische Mittelschicht am Geländer, sang ihre melancholischen Lieder oder spielte melancholisch auf ihren Gameboys.
Das Kind wollte sich sein Ärmchen tätowieren lassen. Mit einem Totenkopf. Das haben wir nicht erlaubt.
Weil ich tauchen kann, habe ich getaucht. Unter seiner Oberfläche ist das Schwarze Meer eine undurchsichtige Sache, man muss sich hauptsächlich auf den Tastsinn verlassen. Todor, unser Tauch-Instruktor, führte uns zu Stellen, wo man die Hände über schrundiges Metall gleiten lassen konnte. Es waren die Reste der bulgarischen Kolonialflotte, die an dieser Stelle den Krimtataren eine Lektion erteilt hatte.
Nach einigen Tagen gestatteten wir, dass sich das Kind von einem arbeitslosen grusinischen Kunstprofessor mit lila Tinte einen Totenkopf auf den Unterarm malen ließ, dazu die Parole »Sieg oder Tod«, in kyrillischer Schrift.
»Ob die Atmosphäre hier wohl gut ist für die kindliche Entwicklung?«, fragte die Frau. Ich sagte: »Es kann unmöglich falsch sein, wenn ein Kind schon früh andere Kulturen kennenlernt und sich mit ihnen auseinandersetzt.«
Als wir aus Bulgarien wieder hinausflogen, wusste das Kind, welches Land für immer sein Lieblingsland ist. Das Land, in dem sie was für Kinder tun. Sein Avalon. Sein Eden. Seine Ravioli. Das Land, an das Ernst Bloch gedacht haben muss, als er in Das Prinzip Hoffnung schrieb: »Etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.«
In jedes Kind scheint etwas Bulgarisches hinein. Und wir waren dort.
Computer
Gerne erinnert der erwachsene Mensch sich an seine erste Demonstration. Diese biographische Wegmarke erreicht man in unserem Kulturkreis auf halber Strecke zwischen dem Laufenlernen und dem Erwachen der Sexualität.
Das Kind hat also zum ersten Mal demonstriert: gegen die Schulpolitik. Es handelt sich um eine Familientradition, meine erste Demo richtete sich ebenfalls gegen die Schulpolitik. In der Schulpolitik ist immer was los.
Im Gegensatz zu früher demonstrieren heutzutage Eltern und Kinder gemeinsam. Die Demonstrationen haben Musik, meistens ist eine Sambagruppe dabei. Die Sambabranche ist ein deutscher Wirtschaftszweig, dessen Wohl und Wehe fast ausschließlich von der Demonstrationskonjunktur abhängt. Wenn es in Deutschland wieder eine Diktatur gäbe mit strengem Demonstrationsverbot, dann müssten als Erstes die Sambaschulen schließen. Das wollen wir niemals erleben.
Die Eltern schleppen in ihren Rucksäcken Proviant, damit das Kind während der Demonstration nicht abmagert. Musik, Tanz, Catering, der Freizeitwert von Demonstrationen ist eindeutig höher als früher. Trotzdem sagt das Kind: »Demonstrieren ist langweilig. Fußball ist besser. Playmo ist besser. Fernsehen ist besser.«
Die Berliner Schulpolitik sieht so aus, dass es an unserer Grundschule einen Computer für jeweils ungefähr achtzig Schüler gibt. Das ist nicht viel. Außerdem ist es ein ganz alter Computer mit Schornstein, Braun’schen Röhren und Handkurbel. Manchmal fängt er mitten im Unterricht an, Dalmatisch zu reden, eine untergegangene romanische Sprache des Balkans, oder er memoriert die deutschen Olympiasieger von 1924 bis 1936, oder er erzählt von seinen Eltern, die Hollerith-Maschinen waren, draußen in Ostpreußen.
Alle deutschen Elektronengehirne kamen damals einmal im Jahr zu einem Kongress in Königsberg zusammen, staatlich approbierte Gehirnwarte schmierten ihre Denkachse mit Elchfett, und ein baltischer Ingenieurbischof segnete sie feierlich ein. Das gab es damals noch, Ingenieurbischöfe, die sich speziell mit den spirituellen Bedürfnissen von Automobilen, Elektronengehirnen und Rundfunkgeräten befassten. Gerade von den Elektronengehirnen hat die Kirche sich damals viel versprochen. Sie sollten ausrechnen, wie viele Engel auf eine Stecknadelspitze passen, wie viel Atü man für eine Himmelfahrt braucht und ob man eine theologische Strahlenkanone bauen könnte, die der Church of England wieder zum wahren Glauben zurückhilft.
Einmal kam Thomas Mann aus seinem Sommerhaus auf der Kurischen Nehrung zum Kongress angereist, weil er dachte, die Elektronengehirne finden ein Mittel gegen seine nervöse Diarrhö. Da war die Blütezeit der deutschen Computerindustrie aber schon vorbei. In der Inflation waren viele deutsche Elektronengehirne der ersten Generation wegen der vielen Nullen wahnsinnig geworden, es gab eine hohe Suizidrate, sie vernetzten sich mit den Totalisatoren, die auf den Rennbahnen die Gewinnquoten ausrechnen, und sorgten dafür, dass die Gewinne nicht ausgezahlt wurden, so lange, bis sie von ihren wütenden Besitzern in den Pregel oder die Moldau geworfen wurden.
Das Kind sagt: »Die meisten in unserer Klasse haben doch längst einen Computer zu Hause. Können wir die nicht in die Schule mitnehmen?«
Junge, frische, ehrgeizige Computer sind das, sie lehnen es ab, in den Schuldienst einzutreten. Sie wollen in der Privatwirtschaft Karriere machen und das dicke Geld. Idealismus gibt es unter den jungen deutschen Computern nicht mehr.
Die Berliner Demonstrationen müssen sich fast alle durch das Brandenburger Tor hindurchzwängen, wegen des Symbolgehalts. Folglich muss auch fast jede schulpolitische Demonstration aus Richtung Charlottenburg erst einmal durch den Tiergarten hindurch, wo sie nur von Singvögeln und Maulwürfen gesehen wird, auf deren politische Meinung keiner Wert legt. Es wäre schlauer, auf dem Ku’damm zu demonstrieren oder im Wedding. Aber wir sind ja nicht schlau.
Die Inder dagegen sind schlau, kein Wunder, sie haben alle Computer. So glaubte man damals. Die CDU machte Wahlkampf mit einem Slogan, der »Kinder statt Inder« hieß. Der Slogan spielte mit der Furcht, dass demnächst hunderttausende indische Computerexperten nach Deutschland kommen würden, um dort die Arbeitsplätze zu besetzen und so der deutschen Jugend jede Zukunftsperspektive zu rauben. Die traditionelle Intellektuellenfeindlichkeit der CDU hatte zeitweise den Aggregatzustand der Inderfeindlichkeit angenommen.
Dieser Satz war jetzt so kompliziert, dass ihn vermutlich nur verstehen kann, wer in Indien zur Schule gegangen ist. Indische Germanisten, das wäre dann der nächste Schritt.
Andere mögliche Parolen lauten: »Deutsche Omas statt alte Romas!«, »Wir holen keine Polen!«, »Statt uns, die wir nach Jobs uns sehnen, nehmen sie jetzt nur Rumänen!«
Zum Kind aber sagte ich: Bald werden indische Germanisten, indische Brezelverkäufer und indische Singvögel über das Land herfallen, sie werden die CDU kaufen, auseinandernehmen und die CDU in großen Schiffen nach China transportieren, weil dort Parteien Mangelware sind. Sie werden das Brandenburger Tor in ein Hindu-Heiligtum verwandeln und euch eure Playmo-Männchen wegnehmen.
So wird es kommen, wenn ihr nicht fleißig demonstriert.
Demokratie
ln Deutschland wird auffällig oft im Herbst gewählt. Die Demokratie wäre bei den Menschen vielleicht beliebter, wenn im Frühjahr gewählt würde, am besten Ende Mai. Dann hätte die Demokratie einen dynamischen Touch, statt eines melancholischen, und man könnte den Wahlsiegern Blumenkränze umhängen, wie es in der Südsee Brauch ist. Die Berliner Runde aber käme Open Air aus dem Strandbad Wannsee.
Es war ein typischer Nieselregenwahlsonntagvormittag in Berlin. Abgeordnetenhaus-Wahl, anderswo heißt das »Landtag«. Im Westteil von Berlin hatte die SPD lange Zeit fünfzig oder sogar über sechzig Prozent, dann entleibte sie sich mit Hilfe zahlreicher Skandale und sank auf zwanzig Prozent. Die Berliner Parteien machen es ähnlich wie die Lemminge. Sobald es zu viele Wähler von einer Partei gibt, stürzt diese Partei sich freiwillig in den Abgrund.
Es war also ein grauer Nieselregenwahlsonntagvormittag. Wir spielten Monopoly. Ungeduldig haben wir darauf gewartet, dass unser Kind in das Brettspielalter hineinwächst. Morgen für Morgen betasteten wir die Fingerchen, wie die Hexe in Hänsel und Gretel, wir klopften mit silbernen Hämmerchen das kleine Gehirn ab und ließen uns das Zünglein zeigen.
Ist dies Zünglein groß genug, um zu sagen: »Du erhältst auf Vorzugsaktien sieben Prozent Dividende«? Kann dies kleine Gehirn endlich erfassen, was es bedeutet, nicht über Los zu gehen und nicht zweitausend Euro einzuziehen?
Das Kind aber sagte: »Ich will kein Monlopopi. Ich will lieber fernsehen.«
Sobald wir etwas tun wollen – spazieren gehen, Blumen gießen, einkaufen, irgendwas –, reagiert das Kind mit den Worten: »Ich will lieber fernsehen.«
Vögel wollen fliegen, Bienen wollen summen. Kinder wollen fernsehen.
Also sagte ich: »Wenn du gewinnst, darfst du zur Belohnung bestimmen, was ich nachher wähle.«
Hat die Welt jemals einen Siebenjährigen gesehen, der das allererste Monopoly-Spiel seines Lebens gewonnen hätte? Das ist so unwahrscheinlich wie eine absolute Mehrheit für die FDP.
Die Eltern protzten denn auch mit Schlossallee und Parkstraße, während das Kind sich trotzig an das öde Wasserwerk und den nichtsnutzigen Nordbahnhof klammerte.
Das Kind verlor. Es verlor deutlich. Dann weinte es. Und wie das Kind weinte. Oh, wie schrecklich ist es, Kinder weinen zu sehen.
Ich sagte: »Na gut.«
Das Kind lachte wieder. »Schröder, Schröder!«, krähte es fröhlich.
»Schröder ist Bundeskanzler. Der Bundeskanzler steht für das Berliner Abgeordnetenhaus nicht zur Wahl«, antwortete ich, ein bisschen unwirsch womöglich.
»Dann eben SPD«, sagte das Kind. Wir haben ihm zu früh zu vieles beigebracht. Jetzt ist es klug und kennt die größeren Zusammenhänge.
Auf dem Weg zum Wahllokal regnete es. Leere Straßen. Die Eltern mit ihren Kindern saßen zu Hause. Überall wurden Spiele gespielt. Überall weinten die Kinder.
Ich machte dem Kind Vorwürfe. »Du bist immer für die Stärksten. Du bist nur deshalb für Schröder, weil er regiert. Du bist nur deshalb für Bayern München, weil es oben steht. Man muss aber auch an die Schwachen denken. VfL Bochum. Energie Cottbus. Die Grünen.«
Das Kind fragte: »Ist die SPD in Berlin denn auch so stark?« Ich schwieg.
Im Wahlbüro saßen die Wahlhelfer, freundliche Damen und Herren im Sonntagsstaat. Ich nahm den Wahlzettel. »Darf ich mit in den Holzkasten?«, fragte das Kind.
»Eigentlich ist es nicht erlaubt«, antwortete die Königin der Wahlhelfer mit huldvollem Lächeln. »Aber wir drücken mal ein Auge zu.«
Als wir aus der Kabine kamen, steckten wir den Umschlag mit dem Wahlzettel in die Urne. Das Kind rief: »Er hat SPD gewählt, weil ich im Monopoly gewonnen habe, deswegen durfte ich bestimmen, was er wählt, und ich habe es genau kontrolliert. Schröder siegt! Schröder ist der Beste!«
Ich packte das Kind und zog es eilig fort, Wahlhelfer zurücklassend, die Anstalten zu einer unfreundlichen Zusammenrottung machten.
Diese Berliner Wahl war ungültig. Das stand fest. Verletzung des Wahlgeheimnisses, Stimmenkauf, verbotene Parteienwerbung im Wahllokal, da kamen sämtliche denkbaren Verstöße zusammen. Es waren südamerikanische Verhältnisse. Bei der nächsten Wahl würden die Vereinten Nationen den Dalai Lama als Beobachter nach Charlottenburg schicken. »Außerdem hast du geschwindelt, du hast im Monopoly gar nicht gewonnen«, so schalt ich das Kind. Aber kam es auf dieses letzte Detail der Verdorbenheit noch an?
Am Abend erfuhren wir: Die SPD hatte 22,4 Prozent bekommen, noch ein Prozent weniger als bei der letzten Niederlage. Inklusive meiner gekauften Stimme. Von Unregelmäßigkeiten in Charlottenburg war allerdings im Fernsehen nicht die Rede. Offenbar hatten die anderen Parteien darauf verzichtet, die Wahl anzufechten, weil ihnen das mit unserer Hilfe geschönte Ergebnis der Sozialdemokratie auch in der manipulierten Variante deprimierend genug erschien.
Auf diese Weise verlor ein Kind den Glauben an freie Wahlen und lernte, dass es nur eines gibt, worauf in Deutschland Verlass ist: die Schlossallee und die Parkstraße mit jeweils einem Hotel darauf.
Elite
Wie viel Fernsehen ist erlaubt? So hieß die alles beherrschende pädagogische Grundfrage der letzten Dekaden, bis sie von der Grundfrage »Wie viel Computer ist erlaubt?« verdrängt wurde.
Ohne zu übertreiben, darf ich behaupten, dass die Fernseh- und Computerfrage in den vergangenen fünfzig Jahren sämtliche anderen, traditionellen pädagogischen Probleme in den Hintergrund gedrängt hat – die Frage der sexuellen Aufklärung, die Frage nach dem Taschengeld, nach dem Respekt der älteren Generation gegenüber, ob man vom Tisch aufstehen darf, während die Eltern noch essen, und so weiter. Diese Fragen sind mehr oder weniger geklärt oder werden inzwischen als unwesentlich angesehen.
In der Pädagogik ist diese Frage heute das, was in der europäischen Politik lange Zeit die deutsche Frage gewesen ist. Solange sie offen ist, wird es im Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern keine dauerhafte Stabilität geben.
Kinder wollen möglichst viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Eltern möchten das Gegenteil. Dies ist die Ausgangsposition in nahezu sämtlichen Familien der mittleren und oberen Schichten unserer Gesellschaft. Ein klassischer Interessenkonflikt, ein Grundwiderspruch oder Antagonismus, wie ihn die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zwischen Bourgeoisie und Proletariat gekannt hat oder wie wir ihn in der Natur alle Tage erleben – im Futterstreit zwischen Löwe und Hyäne in Afrika oder zwischen Schafherden und Kängurus in den Weiten Australiens.
Wer setzt sich durch? Oder, mit Lenin zu sprechen: wer wen?
Meine Beobachtungen haben zu einem auf den ersten Blick überraschenden Ergebnis geführt. Der höchste Bildschirmkonsum ist in den vergangenen Jahrzehnten bei den willensstärksten, hartnäckigsten, durchsetzungsfähigsten und psychologisch-taktisch klügsten Kindern zu verzeichnen gewesen. Mit anderen Worten: bei Kindern, deren Persönlichkeitsstruktur auf eine spätere Führungsposition hindeutet.
Der Zusammenhang leuchtet unmittelbar ein. Während das weniger durchsetzungsfähige Kind irgendwann wegen des Widerstandes der Eltern resigniert und seine Wünsche den elterlichen Vorgaben murrend anpasst, denkt das willensstarke Kind keine Sekunde an Kapitulation. Das willensstarke Kind ringt im Gegenteil den elterlichen Widerstand gegen Fernsehen und Computer in zähem, langwierigem und erfindungsreichem Kampf nieder. In der Auseinandersetzung um Wetten, dass …?, um Wer wird Millionär? oder um Die Simpsons